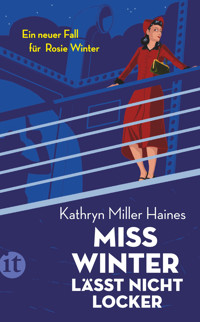
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Rosie-Winter-Krimis
- Sprache: Deutsch
Rosie Winter ist auf dem Weg in die Südsee. Zusammen mit ihrer Freundin Jayne und einer Gruppe Tänzerinnen soll sie in diesem Juni 1943 bei den Soldaten an der Front für gute Laune sorgen. Doch das erweist sich als gar nicht so einfach: Die Überfahrt ist turbulent, das Essen schlecht, und die Feldbetten sind hart. Außerdem stiehlt der Hollywood-Star Gilda DeVane den anderen Frauen die Show, und Rosies große Liebe Jack gilt seit Wochen als vermisst. Während Rosie zwischen Tanzeinlagen und Luftangriffen versucht, mehr über Jacks Verschwinden herauszufinden, wird Gilda bei einem ihrer Auftritte erschossen …
Rosie Winter bricht in die Südsee auf, um ihre große Liebe wiederzufinden. Seekrankheit, Kugelhagel, ein unliebsamer Verehrer und eine mörderische Verschwörung – nichts kann sie in diesem Juni 1943 aufhalten, denn Miss Winter lässt nicht locker.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Kathryn Miller Haines
MISS WINTERLÄSST NICHT LOCKER
Ein neuer Fall für Rosie Winter
Aus dem Amerikanischen von Kirsten Riesselmann
Insel Verlag
Für meine Schwester Pam, die noch nie davor zurückgeschreckt ist, einmal halb um die Welt zu reisen, um zu finden, was sie sucht.
Und für Garrett, der Grund genug für mich ist, zuhause zu bleiben.
1Eine kleine Reise
Mai 1943
Ich hatte gehofft, wir würden einen Bon-Voyage-Champagner bekommen. Stattdessen bekamen wir eine Leiche.
Was nicht das erste Problem war, das uns auf unserer Reise begegnete. Im Vorfeld war ich von der Regierung gepiesackt und vom Passamt gedemütigt worden, und man hatte mir so viele Schutzimpfungen verpasst, dass ich schon kein Wasser mehr zu trinken wagte – aus Angst davor, leck zu schlagen.
»Gehen Sie bitte zur Seite.«
Und jetzt standen meine beste Freundin Jayne und ich am Hafen von San Francisco in einer kilometerlangen Schlange, um an Bord der Queen of the Ocean zu gehen, einem ehemaligen Kreuzfahrtschiff, das die Navy einem neuen Verwendungszweck zugeführt hatte: uns zu den Kriegsschauplätzen im Pazifik zu bringen.
»Gehen Sie zur Seite, Miss.«
Ein Hafenwachtmeister, der sich über den Kai einen Weg in Richtung Schiff zu bahnen versuchte, stieß mit mir zusammen.
»Was schubsen Sie denn so?« Mir taten die Füße weh, ich hatte schlechte Laune und jetzt schon die Nase voll davon, wie die Militärs vorgaben, wer gut behandelt wurde und wer nicht. Der Wachmann machte sich gar nicht erst die Mühe, mir zu antworten. Er war bereits der Dritte, der mit versteinerter Miene an uns vorbeigerauscht war. Die Sonne brannte auf uns herunter, aber die Luft war kühl, es blies eine frische Brise. Dummerweise hatten wir uns im Zug umgezogen und Sommerkleider übergestreift, und ich stellte fest, dass ich mich nach meiner wollenen Strickjacke sehnte.
»Wie lange stehen wir jetzt schon hier?«, fragte Jayne. Seit fast einer Stunde waren wir keinen Zentimeter vorangekommen. Ich fragte mich bereits, ob das Ganze vielleicht eine militärische Übung war, die unsere Fähigkeit, stundenlang auf einem Fleck zu stehen, auf die Probe stellen sollte – sicher eine nützliche Fertigkeit, falls der Feind sich entschließen sollte, unsere Truppen mit attraktiven Krediten zu bombardieren. »Wenn ich mich nicht bald hinsetzen kann, kippe ich um, das versprech’ ich dir«, sagte Jayne.
Weitere Soldaten und Matrosen reihten sich hinter uns in die Schlange ein. Ich kann nicht behaupten, dass mir gefiel, was ich sah. Diese Jungs waren so jung, dass mindestens die Hälfte von ihnen sich noch nicht zu rasieren brauchte – darauf hätte ich meinen rechten Arm verwettet. Sie ließen Kaugummiblasen platzen, erzählten Witze und blätterten ihre Comics mit einer Hand um, weil sie mit der anderen ihre Taschen schleppen mussten. Vielleicht versuchten sie, sich von den kriegerischen Heldentaten von Mandrake dem Zauberer und Joe Palooka inspirieren zu lassen. Immerhin hatte man den beiden Geschichten auf den Leib geschrieben, in denen sie zur Armee gingen, um gegen die Nazis zu kämpfen, was nur recht und billig war. Oder waren solche Storys für die Soldaten doch zu nah dran am echten Leben? Vielleicht mochten sie Superman lieber, der nie die Möglichkeit bekommen würde, die amerikanische Uniform anzulegen. Er war wegen mangelnder Sehkraft ausgemustert worden – wahrscheinlich wusste der Verlag, wie unfair es wäre, den Mann aus Stahl im Kampfeinsatz zu zeigen, während die Jungs, die ihn verehrten, nicht über dieselben Superkräfte verfügten.
Jemand tippte mir auf die Schulter. Als ich mich umdrehte, sah ich einen hübschen Jungen, der erwartungsvoll auf mich herunterblickte. Die weiße Matrosenmütze hatte er so weit zurückgeschoben, dass er gegen die Sonne anblinzeln musste. »Stimmt es, dass sie eine Leiche gefunden haben?«
»Was?« Wenn das seine Art war, mit mir anzubandeln, musste er noch viel lernen.
»Es hört sich so an, als hätten sie eine tote Frau im Wasser gefunden.«
»Ja, das stimmt«, sagte ein Kamerad, der nicht zur Gruppe des Ersten gehörte. Er trug eine Marineuniform und hatte ein Milchgesicht. »Sie ist immer noch da unten. Sie versuchen, sie unterm Pier herauszufischen.«
»Ja«, sagte ein Freund von ihm, der mit seinem hellblonden Bürstenhaarschnitt in der Sonne fast glatzköpfig aussah. »Sie soll erschossen worden sein. Die Hafenpolizei durchkämmt in dieser Minute das ganze Schiff.«
Ich trat aus der Schlange, ließ meinen Blick über den Hafen schweifen und suchte nach einem Beleg für das, was sie gesagt hatten. Überall waren Menschen – insgesamt vielleicht zwanzigtausend, und alle mit dem Ausdruck im Gesicht, als seien sie gerade unabkömmlich. Neben den tausenden auf dem Kai herumwuselnden Männern und Frauen, die von hier in ihnen unbekannte Gefilde aufbrechen würden, standen tonnenweise Lebensmittel, Verpflegung und Munition – alles »Made in America« für die Truppen in Übersee. Auf riesigen Paletten warteten Milch- und Eipulver auf die Verladung. In eilig aufgebauten Kabinen wurden Soldaten in letzter Sekunde geimpft. Diejenigen, die noch keinen Einberufungsbefehl erhalten hatten und die Zeit bis zur Order absitzen mussten, wurden an Informationsständen in örtliche Hotels oder andere Vergnügungsetablissements dirigiert.
Und dann sah ich sie. Mit dem Gesicht nach unten im Wasser. Ihre Kleidung, die um ihre Aufgabe gebracht war, blähte sich um sie herum auf und sah aus, als wollte sie jeden Augenblick die Flucht ergreifen. Wenn ich nicht gewusst hätte, wonach ich suchte, hätte ich sie wahrscheinlich für eine im Hafenbecken dümpelnde, weggeworfene Puppe gehalten. Neben ihr schaukelte ein Motorboot, und der von ihm verursachte Wellengang erweckte für einen Augenblick den Anschein, sie wäre noch am Leben. Der Mann im Boot versuchte, ihren Rock mit etwas, das nach einem großen Haken aussah, zu fassen zu kriegen und sie zu sich heranzuziehen.
»Oh Gott«, sagte Jayne, »wie schrecklich.«
Als ihr Körper zum Boot gezogen wurde, drehte sich die tote Frau auf den Rücken. Lange blonde Ringellocken lagen wie ein Strahlenkranz um ihren Kopf – so würde ein Kind die Sonne malen. Obwohl wir weit weg standen, konnte ich sehen, dass ihre Augen geöffnet waren und immer noch Zeugnis ablegten von ihren entsetzlichen letzten Augenblicken.
Jayne griff meinen Arm und versuchte, mich zurück in die Schlange zu ziehen. »Guck nicht hin«, sagte sie. »Und denk nicht weiter dran.«
Ich versuchte, ihr zu gehorchen, aber die Frau im Wasser hatte mich in ihren Bann geschlagen. Sie kam mir bekannt vor. Vielleicht war mir das Antlitz des Todes aber auch derart vertraut, dass ich sie nur zu kennen glaubte. Der Tod schaffte es ja immer ganz gut, in meiner Nähe zu bleiben.
Der Junge mit dem blonden Bürstenhaarschnitt kam zu uns, schaute ebenfalls hinab und stieß einen leisen Pfiff aus. »Jetzt ist aber genug – so etwas sollten sich Damen doch nicht ansehen.« Er griff nach unseren Händen und zog uns zurück in die Reihe. Beim Loslassen musterte er uns von Kopf bis Fuß. Zweifelsohne versuchte er sich einen Reim darauf zu machen, warum wir uns anstellten, um an Bord eines Kriegsschiffs zu gehen, ohne eine Uniform zu tragen. »Sie sind nicht beim Women’s Army Corps, oder?«
»Nein«, sagte Jayne, »wir sind Schauspielerinnen.«
Er runzelte die Stirn. Unsere Rolle im Krieg war ihm offensichtlich nicht sofort klar.
»Wir machen bei den USO-Camp-Shows mit«, sagte Jayne.
»Wohin soll’s denn gehen?«
»Auf die Salomonen«, erläuterte ich. »Wir machen die Fronttournee.«
Er wandte sich wieder an seine Freunde. »Wow, Leute, die Mädels hier sind von der USO.«
Sofort schob uns einer seinen Koffer hin und drehte ihn so, dass wir eine Bank zum Sitzen hatten. Unser eigenes Gepäck – auf Anordnung der United Service Organizations nur vierundzwanzig Kilo schwer – war bei einem Gepäckträger, der versprochen hatte, es aufs Schiff zu bringen, bevor wir den Hafen verließen.
Die Männer bombardierten Jayne mit Fragen, wollten wissen, wen wir kannten, wo wir schon aufgetreten waren und ob sie uns schon mal irgendwo gesehen haben könnten. Jayne zählte eine ganze Reihe unbedeutender Theaterstücke, C-Prominenter und New Yorker Bezirke auf, von denen die meisten noch nie gehört hatten. Ich mischte mich nicht ein. In Gedanken war ich im Wasser und paddelte wie ein Hund, um bei der Leiche zu bleiben.
Warum kam sie mir so bekannt vor? Ich trat erneut aus der Schlange ans Hafengeländer, um das im Wasser treibende Mädchen zu betrachten. Sie war nicht mehr da. Obgleich es nicht mehr zu sehen war, konnte ich noch das Tuckern des Motorboots hören, das zum Anleger zurückfuhr. Schon ließ sich auch eine jammernde Sirene vernehmen, die schnell lauter wurde, als ein Krankenwagen in einer Kakophonie aus Lärm und Blaulicht auf den Kai gefahren kam. Die Sanitäter sprangen aus dem Führerhaus und zogen eine Bahre hinten aus dem Wagen. Sie bewegten sich zu schnell. Vielleicht wussten sie noch nicht, dass sie bereits tot war. Oder sie hatten Anweisung bekommen, den Leichnam zu bergen, bevor er noch mehr Aufsehen erregte. Schließlich wollte niemand, dass Soldaten an den Tod denken mussten.
Irgendwann ging den Jungs der Gesprächsstoff aus, und Jayne ersetzte die angelegentliche Plauderei durch die Zeitschriften, die sie als Reiselektüre eingepackt hatte. Während ich nach der Bahre auf dem Rückweg Ausschau hielt, blätterte sie durch eine Ausgabe der Photoplay.
»Unglaublich!« Ihre Stimme riss mich aus den Gedanken. Ich ging zurück zur Schlange und fand sie mit gerunzelter Stirn über dem Foto einer Frau in einem derart eng sitzenden schwarzen Samtkleid, dass ihre Vorderfront auf eine zweite Seite überquoll.
»Was ist?«, fragte ich.
»Wusstest du, dass MGM Gilda DeVane fallengelassen hat?«
Ich setzte mich neben sie und richtete meine Aufmerksamkeit zu gleichen Teilen auf sie und die heulende Sirene. »Nein. Aber ich würde wetten, dass Gilda DeVane nichts über die im Hafen treibende Tote weiß.« Gilda DeVane war der Inbegriff eines Hollywood-Stars. Sie hatte mit Musikkomödien angefangen, aber irgendjemand irgendwo hatte gemerkt, dass sie darin fürchterlich fehlbesetzt war, und ihr geholfen, sich ihren heutigen Ruf als ultimative Femme fatale zu machen. Sie sah unglaublich gut aus – grüne Augen, blonde Haare, perfekte Figur – und gab einem mit jedem ihrer Leinwandauftritte das Gefühl, selbst etwas falsch zu machen. Immer spielte sie harte Frauen, die böse Dinge taten, gegen Ende der letzten Rolle Zelluloids aber ihr Fehlverhalten einsahen. Falls man den Magazinen Glauben schenken durfte, war Gilda auch im echten Leben genau wie ihre Leinwandfiguren – ohne die schlussendliche Wendung zum Guten allerdings. Sie verschliss die Männer nur so, war zwei Mal verheiratet und mindestens sechs Mal verlobt gewesen, und wenn in den Boulevardheftchen ein Gerücht ohne Nennung eines Namens in die Welt gesetzt wurde, ging es meistens um sie. Ihr neuester Geliebter war Van Lauer, ein noch unbekanntes Gesicht, der aber von allen für den nächsten Tyrone Power gehalten wurde. Ein gut aussehender Junge mit einiger Schauspielerfahrung. Und einer Ehefrau.
»Man hat ihr auf jeden Fall den Vertrag gekündigt, ohne dasselbe auch mit Van Lauer zu machen«, sagte Jayne.
»Warum sollte er auch noch rausgeworfen werden?«
Jayne seufzte und gab sich keine Mühe, ihr Missfallen ob meiner Unwissenheit zu verbergen. Für sie las ich eindeutig nicht die richtigen Dinge. »Weil sie beide zu spät zu den Dreharbeiten erschienen sind. Das stand doch in allen Zeitungen.«
»Nicht in denen, die ich gelesen habe.« Über ihre Schulter gebeugt überflog ich den Artikel. Tatsächlich hatten Metro Goldwyn Mayer vor einem Monat ihren größten weiblichen Star gehen lassen. Der Autor vermutete, dass die Beziehung zwischen DeVane und Lauer der Grund für ihren Rausschmiss war, obwohl das Verhältnis zwischen den beiden laut Gerüchteküche auch schon wieder Schnee von gestern war. »Warum haben sie denn dann Lauer nicht gefeuert?« fragte ich. »Immerhin ist er doch derjenige mit der Frau und dem Skandal. Und mittlerweile müssten sie doch wissen, dass sie bei Gilda mit so was zu rechnen haben.«
Jayne zuckte mit den Schultern. »Frag mich nicht.« Die wahrscheinlichste Antwort war, dass mit Lauer mehr Geld zu verdienen war – oder dass jemand bei MGM zumindest daran glaubte. Gilda war auf dem absteigenden Ast, weswegen man sich, statt vor ihr den Kotau zu machen, seinen Wünschen gefügt und ihr die Tür gewiesen hatte, als die Affäre in den Zeitungen landete. Die Verlogenheit von Hollywood war einer der vielen Gründe, warum ich fest vorhatte, in New York zu bleiben. Nun ja – ein bisschen auch, weil Hollywood kein Interesse an mir zeigte. »Ich hoffe, Twentieth Century Fox macht mit ihr einen größeren und besseren Deal«, sagte Jayne und blätterte auf die nächste Seite, wo der schmucke Van Lauer in einer Air-Force-Uniform abgebildet war.
Ich schob die Zeitschrift von mir. »Ist das nicht wieder typisch? Er darf den Helden spielen, während sie als Hure ihres Weges ziehen muss.« Aus seiner Sicht sicher ein geschickterer Schachzug, als sich nur auf die Schauspielkarriere zu konzentrieren. Ich hatte erst letztens gehört, dass die Oscar-Statue wegen der kriegsbedingten Kontingentierung überarbeitet werden sollte. Anstatt aus Metall sollte sie jetzt aus Gips gemacht werden – eine interessante Metapher für die Art und Weise, wie der Krieg sogar Hollywood veränderte. Es reichte nicht mehr, schauspielerisch begabt zu sein. Die amerikanische Öffentlichkeit hatte schließlich bemerkt, dass Schauspieler selbst nicht viel mehr als bemalter Gips waren, und wollte jetzt echte, für unser aller Freiheit kämpfende Helden und keinen – angeblich ausgemusterten – Errol Flynn, der ihr im Kino etwas vorspielte. Was für alle bisherigen Leinwandhelden bedeutete: Wer weiter für wichtig erachtet werden wollte, hatte sich in Form zu bringen und aufs Schiff zu gehen.
Sich als Soldat zu verpflichten war ein brillanter Schachzug von Lauer. Der Krieg hatte eine Menge Schrecken zur Folge, war aber auch zu einer öffentlichkeitswirksamen Chance für tausende von Karrieren geworden, die etwas Anschub brauchten. Egal, was für ein fieser Geselle man war – man musste nichts weiter tun als zur Armee zu gehen, Kriegsanleihen zu kaufen oder einem Krankenhaus voller Veteranen einen Besuch abzustatten, und schon hatte die Öffentlichkeit vergessen, mit welchen Missetaten man vorher in Verbindung gebracht worden war. Eine Möglichkeit, die nicht nur Hollywood-Stars offen stand. Als Charles Lindbergh in die Uniform stieg und für die Alliierten in den Kampf zog, vergaß die amerikanische Öffentlichkeit schließlich auch recht schnell, dass er vorher die Nazis unterstützt hatte. Der Krieg konnte alle von ihren Sünden lossprechen. Vielleicht sogar Mörder.
Die Rettungssanitäter kamen vom Kai zurück. Der Leichnam war auf der Bahre festgezurrt und mit einem weißen Tuch bedeckt worden, das in der Brise flatterte. Eine Hand allerdings hatte sich gelöst, hing schlaff herab und schwang vor und zurück, als die Männer über die unebenen Bohlen gingen. Die Fingernägel der Frau waren Victory-Rot lackiert, und wegen der leuchtenden Farbe vor ihrer bleichen Haut sah es für einen Augenblick so aus, als ob ihr Blut von der Hand tropfte.
Der Krankenwagen fuhr weg, und die Hafenpolizei kam vom Schiff. Falls sie den Täter gefunden hatten, machten sie sich nicht die Mühe, ihn mitzubringen. »Gehen Sie weiter«, rief jemand dem Kopf der Schlange zu, und plötzlich ging es Stück für Stück voran. Jayne und ich standen auf, ganz erpicht darauf, aufs Schiff und aus der Sonne zu kommen. Schnell traten wir vom Pflaster auf den Landungssteg.
»Jetzt geht’s los«, sagte Jayne.
»Jetzt geht’s los«, echote ich und schloss in der Tasche die Hand um ein Foto, das ich kurz vor unserer Abreise aus New York eingesteckt hatte. Es war ein Bild von meinem Ex-Freund Jack, dem Grund für dieses irrsinnige Unterfangen. Auf dem Foto trug er noch keine Uniform, war noch der Jack vor dem Krieg, auf den Lippen ein Schauspielerlächeln, das für ein Stück warb, in dem er mitspielte. Als er mir den Abzug des Bildes gegeben hatte, hatte ich ihn in einer Schublade verstaut, weil ich es komisch fand, eine Art Erinnerungsstück von jemandem zu bekommen, den ich täglich sah. Vielleicht war er aber doch vorausschauender gewesen, als ich ihm zugetraut hatte.
Als ich mich noch einmal umdrehte, sah ich, wie Soldaten und Matrosen Familienmitglieder umarmten, die gekommen waren, um sich zu verabschieden. Jeder Abschied brach mir ein bisschen das Herz: Mütter, die sich die Gesichter ihrer Söhne einprägten, Frauen, die um einen noch ein bisschen länger währenden Kuss bettelten, und Kinder, die jene Tränen vergossen, die die Erwachsenen runterzuschlucken versuchten.
»Jetzt gibt’s kein Zurück mehr«, sagte Jayne.
Ich war mir nicht sicher, ob sie uns oder die anderen meinte, ging aber von Ersterem aus.
»Nein. Kein Zurück mehr.« Ich hatte die letzten vierundzwanzig Stunden nicht mehr geschlafen und merkte, wie das Adrenalin, das mich bislang bei der Stange gehalten hatte, langsam zur Neige ging. Was danach kommen würde, konnte ich mir denken. Die manische Energie, die ich aufgebracht hatte, um uns hierher zu bringen, würde versiegen, und an ihre Stelle würde der Strom der Gefühle treten, die ich seit Tagen zu unterdrücken versuchte. Wir waren dabei, aus Amerika wegzugehen. Wir ließen Karrieren hinter uns, die gerade erst Fahrt aufgenommen hatten, und ein Zimmer im Wohnheim, das nicht unter allen Umständen für uns frei gehalten würde. Wir verließen enge Freundinnen, noch innigere Feindinnen und einen Kater, der mich durchschaut hatte. Wir verließen alles Vertraute und fuhren in ein fremdes Land, mit einem Vorhaben, das im besten Falle unklug war.
»Glaubst du, wir machen etwas falsch?«, fragte ich.
Diese Frage hatte ich bislang noch gar nicht mit ihr besprochen. Jayne war die Art Freundin, die auf den Vorschlag, auf der Suche nach einem vermissten Ex-Freund in die Südsee zu reisen, mit der Gegenfrage »Was soll ich einpacken?« reagierte. Nie würde ihr in den Sinn kommen, mich deswegen für völlig von der Rolle zu erklären. Wenn sie mich andersherum mit ähnlichen Plänen konfrontiert hätte, wäre auch ich sofort zur Stelle gewesen – zumindest bildete ich mir das ein. Noch waren die Grenzen meiner Freundschaft nicht so weit strapaziert worden.
Jayne drückte meine Hand. »Wir machen nichts falsch, wir erleben ein Abenteuer.«
Auf dem Pier hinter uns hob ein Matrose sein Mädchen in die Höhe und drehte sich mit ihr im Kreis. Er ging nicht auf ein Schiff nach irgendwo, sondern kam auf Urlaub nach Hause, gesund und munter, aus irgendeiner Hölle dieser Erde, wo er stationiert gewesen war. Die Gesichter der beiden barsten fast vor Freude. Es war kein schön anzusehendes Glück. Sie schienen panisch nacheinander zu greifen, als ob der Boden, auf dem sie standen, Treibsand wäre.
»Wir finden ihn«, sagte Jayne.
»Versprochen?«, fragte ich.
»Großes Indianerehrenwort.«
Das war keine allzu große Garantie, aber ich musste trotzdem lächeln.
2Unter Seglern
Eine Stunde später bekamen wir von einem übereifrigen Matrosen namens Carson Dodger eine Führung durchs Schiff. Kurz bevor wir an Bord gegangen waren, hatte er uns aus der Schlange gefischt und gesagt, man habe sich Sorgen um uns gemacht. Wir seien die Letzten aus unserer Tourneetruppe – ob wir denn nicht gewusst hätten, dass wir uns nicht mit den ganzen anderen armen Würstchen hätten anstellen müssen?
»Muss uns entfallen sein«, sagte ich.
Carson war so groß wie ich und pummelig. An seinem Körper zeigte sich, was passiert, wenn man unterbeschäftigt zu viel Zeit auf See verbringt. Er hatte ein stets leutseliges Gesicht, obwohl mir bei genauerer Betrachtung auffiel, dass das weniger an seiner Zufriedenheit lag als an der Tatsache, dass er fett und sonnenverbrannt war.
»War da wirklich eine Frauenleiche im Wasser?«, fragte ihn Jayne. Die Kunst des Dummchen-Spielens beherrschte sie meisterhaft.
»Ja, Ma’am«, sagte er. »Sieht so aus, als ob sie erschossen und vom Pier gestoßen wurde.«
»Hat man den Täter schon geschnappt?«, fragte ich.
»Noch nicht, aber bald. Man geht davon aus, dass er sich auf eines der Schiffe geschlichen hat, weswegen sich hier eine ganze Zeit lang nichts vor und zurück bewegt hat.«
»Woher wissen Sie, dass es ein ›er‹ war?«, fragte ich.
»Nur geraten, Ma’am, aber so was würde eine Dame doch sicher nicht machen.«
Junge, Junge, der hatte noch eine ganze Menge über Frauen zu lernen.
»Ich kann Ihnen allerdings garantieren«, sagte Carson, »dass Sie an Bord der Queen of the Ocean absolut sicher sind.«
Ein allzu großer Trost war mir das nicht. Immerhin hatte die Queen of the Ocean die Größe von zwei Fußballfeldern. Man konnte sie in zwei Stunden unmöglich bis auf den letzten Winkel durchsucht haben.
Ich sparte mir, auf dem Thema herumzureiten. Während Carson weiter über die Sicherheit an Bord salbaderte, machte ich mir ein Bild von der Lage. Vor dem Krieg war die Queen of the Ocean ein Luxuskreuzfahrtschiff gewesen, das Schickimickis von Kalifornien nach Hawaii geschippert und währenddessen mit Speisen der Spitzenklasse, Unterhaltung erster Sahne und großzügigster Ausstattung verwöhnt hatte. Nach Pearl Harbor hatte sich die Navy das Schiff unter den Nagel gerissen, die Speisen durch Armeefraß und die Unterhaltung durch ein verstimmtes Klavier ersetzt sowie die Schotten olivgrün gestrichen, so dass sich in den übrig gebliebenen Kronleuchtern nur noch die Trostlosigkeit eines Feldlagers spiegelte.
Carson führte uns in einen ehemaligen Ballsaal, der jetzt zu einer der Kantinen geworden war, die unsere Mitreisenden verpflegen sollten. Die einzigen Relikte seiner einstigen Bestimmung waren vergoldete Wandpaneele, Marmorböden und ein paar vereinzelt herumstehende Ledersessel. Aber es wartete kein Essen auf uns, nur zwei miteinander plaudernde Frauen saßen in dem weitläufigen, leeren Saal.
Als wir näher kamen, unterbrachen sie ihr Gespräch und musterten uns, als ob wir zwei zur Auktion stehende Ponys wären.
»Hallo«, sagte ich. »Ich bin Rosie Winter, und das ist Jayne Hamilton.«
Die Frau links stand auf und gab uns die Hand. »Ich heiße Violet Lancaster.« Sie hatte ein rechteckiges Gesicht und so kleine blaue Augen, dass es aussah, als würde sie schielen. Die blonden Haare hatte sie sich in einem schlecht beratenen Versuch, Betty Huttons Frisur nachzuahmen, in fette Wurstlocken gelegt und auf den Kopf getürmt. Das Make-up war unbeholfen aufgetragen – zwischen ihrer Gesichts- und ihrer Halsfarbe gab es einen deutlichen Unterschied. Hätte sie ihre Haare offen getragen und einige Schichten Make-up heruntergemeißelt, wäre sie vermutlich gar nicht so unattraktiv gewesen, aber so hätte sie auch beim Zirkus auftreten können.
»Ich bin Kay Thorpe«, sagte die andere und gab uns die Hand. Ihr Erscheinungsbild ähnelte auf bedauernswerte Weise dem eines Pferdes. Auf ihrem lang gestreckten, kräftigen Körper thronte ein von einem derartigen Zinken beherrschtes Gesicht, dass sie selbst Cyrano in den Schatten gestellt hätte, und auf ihre riesigen Zähne hätte man mühelos Kinofilme projizieren können. Wenn sie sprach, sah sie alles andere an, nur nicht ihren Gesprächspartner. Zuerst hielt ich sie für unhöflich, aber dann wurde mir schnell klar, dass sie einfach nur schüchtern war. Na toll: eine schüchterne Bühnenkünstlerin. Das würde ungefähr so hilfreich sein wie ein blinder Busfahrer.
»Habt ihr von der Leiche gehört?«, fragte Jayne.
»Gehört ist gut – ich war schon da, als der Schuss fiel«, sagte Violet. Sie hatte einen Südstaaten-Akzent, dem man anmerkte, dass sie ihn normalerweise unterdrückte und nur dann herausrollte, wenn er ihre vornehme Herkunft und Andersartigkeit unterstreichen sollte.
»Du hast den Mörder gesehen?«, fragte ich.
»Nein, ich habe den Schuss gehört. Ich hätte mir vor Schreck fast in die Hosen gemacht.«
Was nicht einfach gewesen wäre, denn sie trug einen Rock. »Aber mehr hast du nicht mitgekriegt?«, fragte ich.
»Doch, einen Schrei. Und ein Platschen.«
»Hast du das der Polizei erzählt?«
Violet reckte den Kopf, als wäre allein schon die Frage ein Affront. »Natürlich.«
»Wer ist denn die Tote?«, fragte Jayne.
»Ich glaube, das wissen sie noch nicht«, sagte Kay, unverwandt an die Decke starrend. Sollte ich jemals von ihr bei einem Verbrechen ertappt werden, würde ich zu gern sehen, wie sie mich bei einer Gegenüberstellung identifizieren wollte.
»Hoffentlich niemand, der mit uns auf Tournee gehen sollte«, sagte Jayne. »Könnt ihr euch vorstellen, wie scheußlich das wäre?«
Und wie typisch. Im letzten Jahr waren gleich zwei Bekannte von mir umgebracht worden. Wäre ich ein prominentes Mitglied der Unterwelt, hätte ich solche Schicksalsschläge ja noch nachvollziehen können, aber ich war doch nur eine Schauspielerin, verdammt noch mal. Das Schlimmste, was Leuten wie mir passieren sollte, waren Ablehnung und Zurückweisung. Und kellnern müssen.
»Oh, keine Sorge«, sagte Violet. »Sie war keine von uns. Unsere Nummer fünf hat man bereits sicher in der Kapitänskajüte weggeschlossen.«
»Womit hat sie das denn verdient?«, fragte ich.
Violet ließ sich wieder auf dem Sessel nieder und schlug die Beine übereinander. »Willst du damit sagen, du weißt es noch nicht?« Ich schüttelte den Kopf. »Oh, das ist ja der Hammer. Haltet euch fest, Mädels. Wir sind nicht einfach nur fünf unbekannte Schauspielerinnen, die in die Südsee fahren – wir haben einen Star unter uns. Gilda DeVane hat sich unserer kleinen Truppe angeschlossen.«
»Gilda DeVane?«, fragte Jayne. »Echt?«
Violet beugte sich vor und sprach so leise weiter, als ob die Klatschreporterinnen Louella Parsons und Hedda Hopper mit gezückten Stiften im Hintergrund lauerten. »Es ist alles noch streng geheim, aber ein Freund von einem Freund von mir hat die ganze Tournee zusammengestellt, und er hat erzählt, dass Gilda noch im letzten Moment angeheuert hat. Kay hat vorhin gesehen, wie sie an Bord gegangen ist. Oder, Kay?«
Kay nickte. »Man hat sie in Windeseile zur Kapitänskajüte gebracht, noch vor der Durchsuchung des Schiffs.«
»Der Rest von uns scheint offensichtlich nicht ganz so unverzichtbar zu sein«, sagte Violet.
»Warum sollte Gilda DeVane in den Südpazifik fahren?«, fragte ich. »Ich dachte immer, die großen Namen kommen nach Europa.«
Violet grinste, was ihr Schielen doppelt so heftig wirken ließ. »Diejenigen, die nichts mehr zu verlieren haben, fahren mit Vorliebe dahin, wo die wüstesten Kämpfe toben. Das bringt die fettesten Schlagzeilen.«
Ich begriff, was sie sagen wollte. Gilda versuchte dasselbe wie Van Lauer, hatte sich aber, anstatt zum Militär zu gehen und einen schicken, privilegierten Einsatzbefehl zu bekommen, dafür entschieden, in eine Gefahrenzone zu reisen, damit die Öffentlichkeit dabei zusehen konnte, wie sie bei der Unterstützung der Truppen ihr Leben aufs Spiel setzte.
»Sie ist cleverer, als ich dachte«, sagte Violet. »Sie muss die Leute dazu bringen, sich wieder für sie zu interessieren. Blitzlichtgewitter und Sexgeschichten tun’s nicht mehr. Aber MGM wird sich um sie reißen, wenn sie das hier abgehakt hat, da bin ich mir sicher. Wenn sie’s schlau anstellt, bringt sie alle Soldaten, die ihr auf der Tournee über den Weg laufen, dazu, sich beim Studio schriftlich für sie ins Zeug zu legen. Zu einer Heldin kann niemand nein sagen.« Falls Gilda es wirklich genauso plante. Jetzt, nachdem MGM sie gefeuert hatte, würde alles, was sie tat, unausweichlich als Versuch interpretiert, ihre Karriere noch mal neu zu zünden. Beharrlich würden manche alles, was sie unternahm, nur ihrer Jagd nach einem Vertrag zuschreiben – sogar wenn es ohne diese Absicht geschah. »Wie auch immer«, sagte Violet. »Die schlechte Nachricht ist: Wegen Gilda rücken wir alle auf die hinteren Bänke. Und die gute: Das Wetter da unten soll schön sein.«
Wenn ich nicht gerade darüber nachgrübelte, wie ich etwas über Jacks Verbleib herausfinden sollte, verklärte ich in Gedanken meine Rolle bei den USO-Shows. Ich stellte mir vor, wie ich zum gefeierten Star wurde, als der Typ Mädchen, wegen dem die Männer sich schon Stunden vorher in die Schlange stellten. Die Wochenschau würde über mich berichten, mein Gesicht wäre auf allen Plakaten, und die Regisseure zuhause würden sich noch vor meiner Rückkehr darum prügeln, mit mir Gespräche führen zu dürfen. Natürlich würde ich etwas Gutes tun, aber ich würde gleichzeitig auch mein berufliches Fortkommen sichern.
Die Vorstellung, es wäre längst beschlossene Sache, dass wir auf der Tournee nur Nebenrollen zu spielen hatten, gefiel mir gar nicht. Zurückgestuft zu werden, weil jemand mehr Talent hatte als ich, machte mir nichts aus, aber in den Hintergrund treten zu müssen, nur weil jemand berühmter war als ich? Diese Erfahrung hatte ich schon einmal machen dürfen – und sie wurmte mich immer noch.
Bevor ich den anderen mein Unbehagen mitteilen konnte, öffneten sich die Türen des Ballsaals und das fünfte Gruppenmitglied rauschte in einer Wolke aus Stoff und Parfüm heran.
Wir alle begafften ihren Auftritt. Gilda DeVane beherrschte einen Raum nicht einfach nur, wenn sie ihn betrat. Man war vielmehr sofort davon überzeugt, dass es auch in ihrer Macht stand, mit einem Fingerschnipsen die Wände zum Verschwinden zu bringen. Obwohl sie in ihren imposant hochhackigen Schuhen kleiner war, als ich gedacht hatte. Trotz der geringen Körpergröße hatte sie üppige Stundenglas-Kurven, die im Vergleich sogar Jayne wie Shirley Temple aussehen ließen. Das lange, gewellte honigblonde Haar rahmte ihr Gesicht so, dass man den Eindruck hatte, sie immer nur im Profil zu betrachten. Und die großen, grünen Schlafzimmerblick-Augen deuteten an, dass sie gerade etwas Ungehöriges getan hatte, dem sie einfach nicht hatte widerstehen können.
Ab der ersten Sekunde konnte ich den Blick nicht von ihr wenden. Wie die Leiche im Wasser schlug sie mich in eine Art Bann.
Nach ein paar Schritten auf uns zu blieb sie stehen, das eine Bein leicht vor dem anderen. Der Trick eines Filmstars. Sie kannte ihre Schokoladenseite und beutete sie so oft wie möglich aus.
»Und das ist die Gruppe?« Ihre leise, melodische Stimme brachte einen dazu, sich vorzubeugen, damit man bloß nichts Wichtiges verpasste.
Befangen standen wir auf, um uns vorzustellen. Sie überwand die restlichen Meter und schüttelte jeder von uns die Hand. Ihre war weich und hinterließ einen Lavendelduft auf meiner Pranke.
»Wie reizend, euch alle kennenzulernen.« Sie stellte eine braune Lederhandtasche auf den Tisch, die weder zu ihren Schuhen noch zum Rest ihrer Garderobe passte. Aber was spielte das schon für eine Rolle. Nur aufgrund der Tatsache, dass sie Gilda gehörte, hinterließ sie bei mir den Eindruck des perfekten Accessoires. »So, wie dieser Tag begonnen hat, dachte ich schon, die ganze Reise wird abgeblasen. Als ich von der Frau im Wasser hörte, hatte ich Angst, es könnte sich um eins meiner Mädchen handeln. Unvorstellbar, wie entsetzlich das gewesen wäre.«
Wir murmelten unisono, es wäre wirklich furchtbar gewesen. Das war Gildas Zauber: Man hielt jeden ihrer Gedanken für originell, auch wenn man dieselbe Idee nur ein paar Augenblicke vorher selbst gehabt hatte.
Sie zog einen Sessel heran und setzte sich uns gegenüber. »Sie soll keinerlei Ausweise bei sich gehabt haben. Hoffentlich lässt sich ihre Identität noch feststellen. Armes Ding.« Ihr gedankenvoller Gesichtsausdruck hellte sich von jetzt auf gleich sehr stark auf. »Aber es hilft nichts, wir müssen jetzt nach vorne schauen. Ich bin schon ganz gespannt, alles über euch zu erfahren. Erzählt doch mal, wo ihr herkommt und was ihr so macht.«
Eine nach der anderen listeten wir unsere Heimatstädte und unsere bisherigen beruflichen Erfolge auf. Sie zeigte sich beeindruckt von Jaynes und meinem Theaterhintergrund, aber es ist sehr gut möglich, dass sie nur höflich sein wollte.
»Ich wohne seit neuestem in Hollywood«, sagte Kay. »Ich bin erst seit ein paar Monaten da und versuche, als Sängerin Fuß zu fassen. Auf das Gelände eines Filmstudios habe ich mich bislang noch nicht getraut.« Ihre Ausführungen richtete sie an ihren Schoß und den Fußboden.
Anstatt sie darauf anzusprechen, tätschelte Gilda ihr sanft das Knie. »Schon wenn man dich reden hört, ist klar, dass du eine wunderbare Singstimme hast.«
»Wirklich?« Kay sah zu ihr hoch und lächelte. Komplimente war sie nicht gewohnt.
»Und was für schöne Augen du hast«, sagte Gilda. »Die Männer werden in Schwierigkeiten stecken, sobald sie dich nur ansehen.«
Kay errötete, schaute aber nicht wieder zu Boden.
»Und du, Violet?«, fragte Gilda. »Was hat dich hierher verschlagen?«
»Das hier ist schon meine zweite Tournee mit der USO.« Vielleicht lag ich falsch, aber Violet schien von Gilda nicht im Entferntesten so eingenommen zu sein wie wir anderen. Etwas in ihren Äuglein verriet, dass sie sich von Gildas Charmeoffensive nicht so schnell würde entwaffnen lassen.
»Wirklich? Oh, dann kannst du uns sicher eine Menge beibringen. Bist du auch Sängerin, wie Kay?«
»Nein. Ich bin Komikerin, obwohl ich als Schauspielerin angefangen habe. Ich hatte eine Zeit lang einen Vertrag bei MGM. Bis der Krieg ausgebrochen ist. Als die Arbeit knapp wurde, habe ich beschlossen, mit auf Tournee zu gehen.« Ihre Stakkato-Sätze schrien nach einer Unterbrechung, die aber nie zu kommen schien.
Anmutig rahmte Gildas Hand ihr Gesicht. »Wo hast du bei MGM mitgespielt?«
»Ach Gott, bei nichts Großem. Nur Nebenrollen. Ich habe nie die Möglichkeit bekommen, ein Star zu werden, so wie du – obwohl mich schon viele Leute mit dir verglichen haben. Einer der Regisseure, mit denen ich zusammengearbeitet habe, hat mich immer Baby Gilda genannt. Ist das nicht zum Schießen?«
Gilda nickte, aber das Lächeln gefror auf ihrem Gesicht. Bevor sie es schaffte, ihre Überraschung zu verbergen, ging die Tür auf, und ein Mann und eine Frau kamen herein.
»Herzlich willkommen, meine Damen«, sagte der Mann. »Ich bin Reg Bancroft, der Kapitän der Queen of the Ocean, und das hier ist Molly Dubois von der USO.« Reg zog ein Klemmbrett unterm Arm hervor und stellte schnell unsere Anwesenheit fest. »Ich bitte Sie, die ganze Aufregung zu entschuldigen, durch die wir so in Verzug gekommen sind. Man hat mich darüber in Kenntnis gesetzt, dass das Schiff sauber ist und wir uns in Kürze auf den Weg machen können.« Als er das Wort »Aufregung« benutzte, kräuselte ich die Lippen. Eine Frau war ermordet worden. Man hätte diesen Umstand sicher angemessener benennen können. »Zunächst ein paar Formalitäten: Ihr Gepäck wird auf Ihre Zimmer gebracht. Bedauerlicherweise sind wir mit den Quartieren an Bord recht beengt, weswegen es nur zwei Zimmer für Sie fünf gibt. Seien Sie versichert, dass diese Aufteilung sehr viel großzügiger ist als das, was unsere Soldaten und Soldatinnen hinnehmen müssen.« Kay kicherte. Da das Gesagte nicht besonders lustig gewesen war, fragte ich mich, ob es eine Angewohnheit von ihr war, in unpassenden Momenten zu lachen. »Sie befinden sich jetzt im Hauptspeisesaal des Schiffs. Dort drüben«, er zeigte auf einen abgetrennten Bereich, wo – im Gegensatz zu den bis auf ein paar Kratzer nackten anderen Tischen im Raum – mit Tischdecken, Tafelsilber und Gläsern eingedeckt worden war, »werden Sie dinieren, zusammen mit den Offizieren an Bord. Das Essen wird Ihnen serviert und ist von einem anderen Kaliber als das, was die Allgemeinheit bekommt.« Ich übersetzte mir, was er gesagt hatte: Wir waren die Crème de la crème auf dieser Badewanne. Und das hieß: besseres Essen und mehr Privilegien als für alle anderen. »Wenn Sie gerade keine Probe haben, sind Sie herzlich eingeladen, die Annehmlichkeiten an Bord in Anspruch zu nehmen, auch unser Sonnendeck, das eigentlich den Offizieren vorbehalten ist, und das Kasino, in dem wir ein abendliches Unterhaltungsprogramm auf die Beine zu stellen versuchen, darunter auch ein paar Auftritte von Ihnen, wie ich hoffe.«
Er räusperte sich und blätterte zum nächsten Blatt auf seinem Klemmbrett. »Von diesem Moment an haben Sie sich an die Weisungen und Vorschriften der U.S. Navy zu halten. Jedem Befehl, den Sie bekommen, haben Sie widerspruchslos Folge zu leisten. Zu keinem Zeitpunkt werden Sie darüber unterrichtet, wo Sie sind oder wohin Sie gebracht werden, auch sollten Sie nicht darauf beharren, derlei Informationen mitgeteilt zu bekommen. Solange Sie sich an Bord dieses Schiffes befinden, dürfen Sie nachts an Deck nicht rauchen, geraucht werden darf nur, wenn keinerlei Gefahr besteht, dass die Glut von einem feindlichen Schiff aus gesehen werden könnte. Außerdem ist an Deck alles verboten, was versehentlich über Bord gehen und vom Feind gesichtet werden könnte, wie Bücher, Zeitungen und Kartenspiele. Sobald wir die amerikanischen Hoheitsgewässer verlassen, unterliegen wir striktem Verdunkelungsgebot.« Ich bekam einen trockenen Mund. Ich hatte nicht gedacht, dass wir schon in Gefahr schweben würden, bevor wir unser Ziel überhaupt erreicht hatten. Ich hatte keinen Gedanken daran verschwendet, dass schon ab dem Moment ein Risiko bestand, in dem wir Kalifornien verließen und aufs offene Meer fuhren. »Jede von Ihnen bekommt eine Mae West, die Sie ständig bei sich haben sollten. Bitte benutzen Sie sie nicht als Sitzkissen.«
Bar einer Erklärung, zu welchem Zweck die Marine wohl dralle Blondinen aushändigte, sahen wir uns an. Reg klatschte in die Hände, und ein Matrose kam herein, auf dem Arm fünf übereinander gestapelte Rettungswesten.
»Vielleicht täusche ich mich, aber für mich sehen die nach Schwimmwesten aus«, sagte Violet.
»Ich vergaß, dass Sie unsere Ausdrucksweise nicht beherrschen. Das sind in der Tat Schwimmwesten. Wir nennen sie nur Mae Wests.« Reg führte vor, wie die Westen anzulegen waren, und es wurde klar, wie sie zu ihrem Spitznamen gekommen waren. Von der Seite betrachtet hatten wir alle denselben eindrucksvollen Vorbau wie W.C. Fields Lieblingsdarstellerin, sogar diejenigen von uns, die nicht von Haus aus mit einem solchen gesegnet waren.
»Es ist von größter Wichtigkeit«, sagte Reg, »dass Sie allen Lautsprecherdurchsagen zuhören und Anweisungen, die Ihre Sicherheit betreffen, umgehend Folge leisten. Im Notfall sind Sie angehalten, sich hier in der Messe zu versammeln. Und zu guter Letzt: Kurz vor der Landung wird man Sie bitten, sich beim Schiffsarzt einer medizinischen Untersuchung zu unterziehen.« Er räusperte sich zum wiederholten Male, und mir fiel auf, dass er während der ganzen Zeit der Ansprache seinen Blick auf Gilda gerichtet hatte. In Gegenwart des Hollywood-Adels wurde auch dieser Mann, der wahrscheinlich endlos viele Seeschlachten geschlagen hatte, zum nervösen Schuljungen. Er befeuchtete sich einen Finger mit der Zunge und strich sich die Augenbrauen glatt. »Noch Fragen?«
»Wann öffnet die Bar?«, murmelte Violet im Flüsterton.
»Und jetzt, meine Damen, überlasse ich Sie den tüchtigen Händen von Molly Dubois.« Er salutierte vor uns – besser gesagt, vor Gilda – und verließ überstürzt den Saal. Molly Dubois trat an seine Stelle und lächelte in die Runde.
Ihre Predigt fiel sehr viel kürzer aus. Molly war da, um uns in Sachen aufführbarer Texte zu beraten und darüber aufzuklären, wie oft wir nach Erreichen des Zielorts aufzutreten hatten. Wir würden einem Basislager zugeteilt werden und dann über die Inseln reisen, um vor so vielen Soldaten wie möglich zu spielen, auch vor denjenigen, die zurzeit in behelfsmäßigen Militärkrankenhäusern lagen. Kostüme, Requisiten und Bühnenbilder könnte man uns nicht im großen Umfang zur Verfügung stellen, da es bei unserer intensiven Reisetätigkeit mit dem Transport schwierig würde. Wir hätten ein straffes Programm zu absolvieren, warnte sie, und wir wären viel mit Jeep, Boot und Flugzeug unterwegs, aber sie stellte uns auch garantiert unvergessliche Erlebnisse in Aussicht.
»Ich muss Sie daran erinnern, dass Sie von jetzt an Botschafterinnen der United Service Organizations sind. Alles, was Sie tun, fällt auf die USO zurück. Wir erbringen für unsere Brüder und Schwestern in Waffen eine äußerst wichtige Dienstleistung, und es würde mir gar nicht gefallen, wenn die Armee mit dem Verhalten eines unserer Mädchen unzufrieden wäre und deswegen unsere Aktivitäten zur Disposition stellen würde. Ich bitte Sie darum, stets vor Augen zu haben, wen Sie repräsentieren, und sich in Ihrem moralisch-ethischen Verhalten fortwährend an einem hohen Standard zu orientieren.
Miss DeVane ist die Leiterin Ihrer Truppe. Letzten Endes werden Ihre Auftritte nach ihrem Gutdünken gestaltet. Wir haben ihr eine Sammlung von Liedern und kurzen Stücken zukommen lassen, mit denen andere USO-Gruppen großen Erfolg hatten. Bitte bedenken Sie: Sie bekommen hier die Möglichkeit, Ihre darstellerischen Fähigkeiten auszubauen, indem Sie sich etwas ausdenken, das Ihre persönlichen Begabungen am besten zur Geltung kommen lässt. Ich hoffe, Sie begreifen das als eine Aufforderung zur Zusammenarbeit. Außerdem halten wir Sie dazu an, in den Feldlagern nach weiteren Unterhaltungskünstlern Ausschau zu halten. Viele der Soldaten sind Musiker und Schauspieler, die sich über die Gelegenheit freuen, auf die Bühne zu kommen und bei Ihren Darbietungen mitzumischen. Nutzen Sie deren einzigartige Fähigkeiten und geben Sie ihnen eine Chance, ebenfalls zu brillieren. Und jetzt würde ich gern mit Miss DeVane alleine sprechen, sofern es Ihnen nichts ausmacht.«
Damit verließen Molly und Gilda den Raum.
Zum ersten Mal seit unserer Abreise aus New York summte ich vor Aufregung.
»Von wegen Zusammenarbeit«, sagte Violet. »Das hier wird von vorne bis hinten eine Gilda-DeVane-Show.«
»Was?«, fragte Kay.
»Nichts«, sagte Violet und zog einen Flachmann aus der Tasche, dessen silbernen Verschluss sie immer wieder rasch auf- und wieder zudrehte. Das Geräusch machte mich wahnsinnig.
»Ich komm gar nicht drüber weg, wie hübsch sie ist«, sagte Jayne. »Versteht mich nicht falsch – ich wusste schon aus den Filmen, dass sie zum Anbeißen ist, dachte aber immer, mindestens die Hälfte kommt vom Licht und vom Make-up. Schön zu wissen, dass eine Frau auch in Wirklichkeit so aussehen kann.« Es war lustig, Jayne die Schönheit einer anderen Frau beurteilen zu hören. Meine beste Freundin war eine platinblonde Granate, für die Pfiffe und Komplimente so alltäglich waren wie Süßigkeiten, aber in Gildas Welt war sogar Jayne bestenfalls Durchschnitt. Ich wollte gar nicht dran denken, was das für mich bedeutete.
»Ich hätte erwartet, dass sie … na ja, gemein ist oder so was«, sagte Kay. »Sie spielt ja immer solche Charaktere. Und dazu noch all das, was die Zeitschriften über sie schreiben, also, ich hab gedacht …«
»Keine Sorge«, sagte Violet. »Dein Instinkt trügt nicht.«
»Was zum Teufel soll das denn heißen?«, fragte ich.
Violets Mund ging so schnell auf und zu wie ihr Flachmann. Gilda kam mit ausgebreiteten Armen zurück, als wollte sie uns alle zusammen umarmen. »Was bin ich froh, dass diese ganzen Formalitäten endlich erledigt sind. Ich weiß ja nicht, wie’s euch geht, aber mir ist von den ganzen Regeln und Verboten ganz schwindelig geworden. Ich hatte wohl vergessen, dass wir nicht einfach nur eine Show, sondern eine Show fürs Militär machen.« Wir murmelten zustimmend. Ich wartete auf Anzeichen dafür, dass Gilda wirklich vorhatte, unser gemeinsames Unternehmen zu ihrem alleinigen zu machen, oder dass sie wirklich ein so selbstverliebtes Prinzesschen war, wie Violet sie darstellte. »Ich möchte, dass ihr alle wisst, wie sehr ich mich auf diese Shows freue. Wir sitzen ab jetzt im selben Boot, und keine ist wichtiger als die andere.« Sie sah auf eine Armbanduhr, die die behauptete Gleichrangigkeit zwischen uns irgendwie stark in Frage stellte: ein umwerfendes Schmuckstück aus Platin und Diamanten, das die Schiffskronleuchter vergleichsweise schäbig aussehen ließ. »Wir werden innerhalb der nächsten Stunde ablegen. Sollen wir uns vorm Auslaufen nicht noch ein bisschen umsehen? Vielleicht könnten wir auch den Abend gemeinsam verbringen, damit wir uns besser kennenlernen.«
3Die mildtätige Schwester
Das Schiff war eine Stadt im Miniaturformat. Abgesehen von der Kantine gab es eine Verpflegungsstelle, die alle erdenklichen Dinge feilbot, die ein Soldat möglicherweise an seinen Einsatzort mitnehmen wollte. Dann gab es ein Gedunk – was wohl ein anderes Wort für Snack-Bar war –, in dem man Eis, Sprudel und Süßigkeiten bekam. Im bordeigenen Frisiersalon waren zwei Matrosen eigens dafür abgestellt, für andere das zu erledigen, was sie selbst ganz offensichtlich vergessen hatten. Der Schiffsschneider verlängerte und kürzte Armeehosen, bis sie nicht mehr standardmäßig zu lang oder zu kurz waren. Mit seinen Briefen ging man zur Post, wo auch das schiffseigene Mitteilungsblättchen erhältlich war. In dem Blättchen standen witzige Anekdoten über die Männer und Frauen an Bord der Queen of the Ocean (»Gestern gesehen: Kapitän Malloy, der mit einer feschen Kleinen in WAAC-Uniform eine kesse Sohle aufs Parkett legt. Wir hoffen allerdings, dass er auf dem Schlachtfeld eine bessere Figur macht!«) sowie weniger unterhaltsame Geschichten über die Vorgänge in den vor uns liegenden Ländern, die das Schiff über Funk erreicht hatten. (An diesem Tag machte die Postille einiges Gewese um die Niederschlagung des jüdischen Ghettoaufstands durch die Deutschen und die Zerstörung deutscher Staudämme durch die britische Luftwaffe.) Für die Freizeitgestaltung stand ein Kino bereit, das pro Tag drei Filme zeigte – momentan liefen Im Schatten des Zweifels, Girl Crazy und Einsatz im Nordatlantik. In der Schiffsbibliothek konnte man Bücher ausleihen, man konnte aber genauso gut den Spielsalon besuchen und dort Billard, Tischtennis, Shuffleboard, Dame und Schach spielen oder zum Gottesdienst bei einem der drei Seelsorger gehen.
Auf dem Sonnendeck, wo die Offiziere umherwandelten, wenn das Wetter mitspielte, gab es Golfschläger und Bälle, um Abschläge zu üben – ein aufgespanntes Netz sollte verhindern, dass die Bälle im Wasser landeten –, außerdem gab es dort ein Schwimmbecken, in dem sich jeder, der es nötig hatte, abkühlen konnte. Niemand nahm es je in Anspruch. Was vielleicht daran lag, dass die Offiziere es als ihrer nicht würdig empfanden, sich bis auf die Unterwäsche auszuziehen. Vielleicht fühlte sich aber auch der bloße Gedanke an Schwimmen schon viel zu sehr nach Urlaub an.
Nach dem Rundgang durchs Schiff gingen wir zusammen auf Deck, um uns das Auslaufen anzusehen. Seite an Seite standen wir an der Reling und warfen abwechselnd Blicke auf das Land, das wir verließen, und die offene See, auf die wir zusteuerten. Als das Schiff vom Kai ablegte, winkten wir Fremden zu, die mitten am Tag eine Pause einlegten, um zu sehen, wie die gewaltige QueenoftheOcean in See stach. Unter ihnen war auch ein Grüppchen Paparazzi, die ihre Kameras auf uns richteten. Gilda hielt ihnen die linke Wange hin, und als sich der Wind in ihrem Kleid verfing und die Sonne auf ihrem Haar glänzte, fing sie an, »God Bless America« zu singen. Wir stimmten alle mit ein und wiederholten den einfachen Refrain so lange, bis die Umrisse der Leute am Ufer nicht mehr zu erkennen waren.
Fast unbewusst wanderte mein Blick immer wieder zu der Stelle in der Nähe des Kais, wo die Frau getrieben hatte. Auch wenn sie nicht mehr dort war – ich hätte trotzdem schwören können, eine dunkle Silhouette zu erkennen, die auf dem von unserem Ablegemanöver aufgewirbelten Wasser sanft auf und ab wogte. Ob man mittlerweile wusste, wer sie war? Hätte sie auch auf dem Schiff sein sollen? War jemandem aufgefallen, dass sie fehlte?
Wir blieben noch eine Weile an Deck und tauschten Geschichten über frühere Reisen aus. Jayne und ich konnten nur von Zug- und Fährfahrten erzählen, aber die anderen Frauen waren alle schon mal im Ausland gewesen und ergötzten uns mit Geschichten von fernen Ländern und fremden Sitten. Zu gern hätte ich Zwischenfragen gestellt und hin und wieder einen Kommentar eingestreut, aber das Meer warf das Schiff derart hin und her, dass es sich zunehmend weniger so anfühlte, als stünde man auf festen Decksplanken. Mein normalerweise stählerner Magen wurde durchgeschüttelt, und ich merkte, wie mir übel wurde. Wahrscheinlich lag es an der Sonne, die jetzt, in einiger Entfernung zur Küste, doppelt so viel Kraft zu haben schien. Vielleicht waren auch die Eier, die wir am Vormittag im Zug verspeist hatten, nicht ganz so bauernhoffrisch gewesen, wie die Menükarte behauptet hatte. Oder es hatte etwas mit der Erinnerung an die Frau zu tun, die sich in Erwartung eines deutlich anderen Tagesverlaufs die Nägel blutrot lackiert hatte.
»Rosie?«, fragte Jayne. »Alles in Ordnung? Du siehst ein bisschen grün aus.«
Als sie die Farbe benannte, die ich angenommen hatte, beugte ich mich über die Reling und erbrach das bisschen, das ich im Magen hatte.
»Seekrank«, verkündeten die drei anderen mit dem Stolz von Ärztinnen, die eine Blitzdiagnose stellen.
»Oh Gott«, sagte ich, als sich mein Frühstück meilenweit über den Ozean verteilte. »Glaubt ihr, die Japaner sehen das?«
»Wenn sie auf die Entfernung Kotze orten können«, meinte Violet, »dann sollen sie verdientermaßen den Krieg gewinnen.«
Jayne half mir, unser Quartier zu finden. Auch wenn man uns zwei Zimmer zugewiesen hatte, war klar, dass wir zu viert in dem einen zu schlafen hatten, während unser fünftes, wichtigeres Gruppenmitglied eine Bude für sich bekam. In unsere Kajüte hatte man zwei Stockbetten, einen Einbauschrank und ein Badezimmer gequetscht, letzteres auf diejenigen ausgelegt, die gerne gleichzeitig pinkeln und duschen. Mir fehlte der Antrieb, mich zur Einrichtung zu äußern. Aus gegebenem Anlass belegte ich eines der unteren Betten und machte mich lang.
»Wie fühlst du dich?«, fragte Jayne.
»Benebelt. Wie kommt’s, dass es dir nicht so geht?«
»Gilda meinte, es könnte so eine Tänzerinnensache sein. Ich weiß, dass ich mich auf einen Punkt konzentrieren muss, um das Gleichgewicht zu halten.«
Wenn ich eines nicht war, dann eine begnadete Tänzerin. »Na bravo. Schon wieder ein Manko, das ich wegen meiner miserablen tänzerischen Fähigkeiten habe.« Ich schloss die Augen, musste aber feststellen, dass so alles nur sehr, sehr viel schlimmer wurde. »Glaubst du, das ist ein Omen?«
»Viele Leute werden seekrank.« Sie machte in der schlechten Kopie von einem Badezimmer einen Waschlappen nass.
»Ich meine die Frau im Wasser.«
Sie wrang den Lappen aus. »Ein Omen wofür?«
»Dass uns der Tod in die Südsee folgt?«
Sie kam wieder zu mir und legte den feuchten Waschlappen auf meine Stirn. Das war zwar wohltuend, half aber meinem aufgewühlten Magen nicht. »Der Mord hat doch mit uns nichts zu tun«, sagte sie.
»Seit wann bist du so abgebrüht?«
»Du weißt, wie ich das meine. Such nicht immer nach Anzeichen dafür, wie schlecht alles laufen wird. Das bringt nichts.« Sie hatte natürlich recht. Deutlich vernünftiger zu sein als ich, dafür hatte Jayne ein Händchen. »Brauchst du noch irgendwas?«
»Nein, ich glaube, ich muss das einfach aussitzen.« Ich versuchte, einen festen Punkt zu finden, auf den ich mich konzentrieren konnte. Aber das ganze Zimmer schien ein Echo der unsteten Bewegungen des Schiffs zu sein. »Wenn ich’s recht bedenke – könntest du mir einen Mülleimer oder so was bringen?«
Sie holte einen aus dem winzigen Badezimmer, stellte ihn neben mir auf den Boden und fragte: »Was hältst du von Gilda?«
»Sie ist anders, als ich erwartet hätte. Ich war mir sicher, ich würde es nicht gut finden, dass sie dabei ist, von wegen Sonderbehandlung und so, aber bislang finde ich sie nett.« Fairerweise muss man sagen, dass ich nicht bekannt war für meine Menschenkenntnis. Immerhin hatte ich mich innerhalb eines halben Jahres ungewollt mit gleich zwei Mördern angefreundet.
Jayne war so nett, mich nicht darauf hinzuweisen. »Ich kann sie auch gut leiden. Und die anderen?«
»Wir werden sehen. Zu Kay habe ich noch keinen Draht, aber sie scheint eine ehrliche Haut zu sein. Violet hat’s faustdick hinter den Ohren. Und eine Trinkerin ist sie auch. Ich wette, sie wird uns noch eine Menge Ärger bereiten.«
»Wie meinst du das?«
Ich starrte auf die Koje über mir. An einer Matratzenfeder klebte ein steinharter Kaugummi. »Ist dir das nicht aufgefallen? Violet hat mehr Gesichter als Mount Rushmore. Erst ist sie zuckersüß zu Gilda, und im nächsten Augenblick hat man den Eindruck, sie will sie nur lächerlich machen.«
»Klingt für mich nach stinknormaler Eifersucht.«
Ich wendete den feuchten Waschlappen. »Schon, aber auch wir hätten ja allen Grund, eifersüchtig auf Gilda zu sein, und kriegen es trotzdem hin, den Deckel draufzuhalten.«
»Sie waren beide bei MGM. Es muss hart sein, jemanden aufsteigen zu sehen, während du selbst auf der Stelle trittst.«
Als ob ich das nicht wüsste. Anders erging es mir mit meiner eigenen Karriere schließlich auch nicht.
»Das gibt sich schon wieder«, meinte Jayne. »Sie muss sich nur noch an den Gedanken gewöhnen, dass Gilda nicht der Feind ist.« Das war das Schöne am Krieg: Sobald man unsicher wurde, wer Freund oder Feind war, klärte die Regierung mit ein paar eindeutigen Plakaten alle Fragen.
Als hätten wir sie mit unserem Reden heraufbeschworen, kam Violet herein und warf ihre Handtasche auf das andere untere Bett. »Ist das alles? Ich dachte, wir hätten zwei Zimmer.«
»In dem anderen steht nur ein Bett«, sagte Jayne.
»Lasst mich raten, wer das bekommt.«
Jayne stand auf. »Ich glaube nicht, dass sie das so entschieden hat.«
Violet streifte die Stöckelschuhe ab und massierte sich die Füße. Der Gestank nach Schweißfüßen erfüllte den kleinen Raum. »Genau das sollt ihr glauben. Sie spielt euch etwas vor, damit sie auch ganz bestimmt von allen gemocht wird. Aber wartet nur ab – die wahre Gilda wird sich noch früh genug zeigen. Wenn sie wirklich volksnah sein wollte, würde sie sich mit uns das Zimmer teilen und es mit ihrem echten Namen und ihrer echten Haarfarbe versuchen – und mit ihrer echten Nase auch.«
Die Kajüte neigte sich nach links, mein Magen nach rechts. »Sie hat sich die Nase machen lassen?«, fragte ich.
»Vor Jahren schon, als sie angefangen haben, sie aufzubauen«, sagte Violet. »Ungefähr zur gleichen Zeit haben sie auch ihren Haaransatz verändert, ihr größere Brüste machen lassen und ihre Zähne überkront. Eine große Nase, flache Brüste und eine niedrige Stirn reichen vielleicht für eine hausbackene Maria Elizondo aus Laredo, aber einem Glamour-Girl wie Gilda DeVane kann man das nicht durchgehen lassen.«
Sosehr ich mich langsam über Violet ärgerte, musste ich doch zugeben, dass mich ihr Wissen faszinierte. Mir war klar, dass die Star-Maschine Hollywood Menschen mit neuen Namen und neuen Vergangenheiten ausspuckte, aber ich war seltsamerweise vollkommen ahnungslos, dass es auch solche gab, die sich für ihre Karriere vollständig umgestalten ließen. Allein die Vorstellung kam mir … nun ja, wie eine Filmidee vor. Hatte Gilda sich wirklich derart gründlich neu erfunden, oder hatte sich Violet nur eine Geschichte ausgedacht, die ihrer Verachtung für diese Frau angemessen war?
»Ich bitte dich«, sagte ich. »Du kannst unmöglich wissen, ob es stimmt, was du da erzählst.«
»Sie und ich sind gleichzeitig zu MGM gekommen. Sie erinnert sich vielleicht nicht mehr an mich, aber ich erinnere mich definitiv an sie. So, wie sie wirklich war.«
»Ich«, sagte Jayne, »habe auch mal ein Foto von ihr in der Movie Story gesehen. In einem dieser Kästen, wo man raten soll, was aus der jungen Frau auf dem Bild geworden ist. Wenn man sich anschaut, wie Gilda mit achtzehn ausgesehen hat, dann hat sie eindeutig was machen lassen.«
Selbstgefällig grinste Violet mich an, aber so schnell bekam sie mich nicht an den Haken. Mit dem, was mir in der Speiseröhre steckte, hatte ich gerade sowieso genug zu tun, da hätte kein Köder mehr reingepasst. »Gut, in Ordnung«, sagte ich. »Und was ist dagegen einzuwenden?«
»Es ist Betrug.« Violet wühlte in ihrer Tasche, bis sie ein silbernes Zigarettenetui und ein Feuerzeug gefunden hatte. Schon beim Gedanken an Rauch wurde mir noch schlechter. »Sie will alle glauben machen, allein durch ihr Talent so weit gekommen zu sein.«
»Und wer würde behaupten, dass dem nicht so ist?«, fragte ich.
Sie warf einen prüfenden Blick auf ihre Erscheinung, die sich im Etui spiegelte, und schien zufrieden. »Jeder, der ihre Filme gesehen hat.«
»Ach, komm schon. Sie hätte es nicht so weit gebracht, wenn sie eine schlechte Schauspielerin wäre.«
Violet zündete sich einen Glimmstängel an und zog daran. »Und da denken alle, die Mädels in New York seien schlauer und niveauvoller.« Sie unterstrich ihre Missbilligung, indem sie sich viel Zeit nahm, den Rauch auszustoßen. »Kennst du die Musicalfilme, in denen sie mitgewirkt hat? Sie haben ihre Stimme synchronisiert. Und die Tanznummern? Wenn du aufmerksam hingeschaut hättest, wäre dir vielleicht aufgefallen, dass ihr Gesicht und ihre Füße nie gleichzeitig in einer Einstellung zu sehen sind. All das kommt von einer anderen – einer, die wirklich singen und tanzen kann, aber eben nicht das besitzt, was die Sache rund macht. Gilda hat es so weit geschafft, weil sie sich von den Großkopferten bereitwillig in das hat verwandeln lassen, was gewünscht war, weil es ihr egal war, wie viele andere Karrieren es kostete, um ihre eine möglich zu machen. Und jetzt glaubt in Hollywood jeder Hinz und Kunz, dass genau das einen Star ausmacht. Wir können so begabt sein, wie wir wollen – wir haben keine Chance.«
Jayne regte sich neben mir. »Es sei denn … wir machen es so wie sie.«
»Gesetzt den Fall, du kannst es dir leisten«, sagte Violet. »Und wärt ihr bereit, euch von Grund auf verändern zu lassen?«
Ich garantiert nicht. Aber Violets Haltung ärgerte mich so, dass ich nicht anders konnte, als ihr zu widersprechen. »Sicher, wenn ich dann so weit käme wie sie.« »Dann tust du mir wirklich leid.«
Indem ich mich in den Mülleimer erbrach, ließ ich sie wissen, wie viel mir ihr Mitleid bedeutete.
Offenkundig war es wenig einladend, in einem kleinen Raum mit einem Mülleimer voll Erbrochenem gefangen zu sein. Jayne und Violet gingen und ließen mich im unteren Stockbett zurück, wo ich auf den unregelmäßigen Rhythmus einer Seereise zu Kriegszeiten fluchte. Ich hatte mir die Pazifiküberfahrt immer erholsam und gemächlich vorgestellt, getragen von einem sanften Wellengang, der das Schiff in eine angenehme Schläfrigkeit schaukelt. Wahrscheinlich war es auch genauso gewesen, als die Queen of the Ocean noch als Kreuzfahrtschiff unterwegs war, aber in Kriegszeiten war der eingeschlagene Weg in etwa so erholsam wie ein Wagenrennen über steiniges Gelände. Um möglichen Torpedoangriffen auszuweichen, fuhr das Schiff einen Zickzackkurs und wechselte alle fünf Minuten die Richtung, damit uns der Feind gar nicht erst ins Visier nehmen konnte. Passenderweise waren fünf Minuten genau die von mir benötigte Zeit, um zu der Überzeugung zu gelangen, mein Magen hätte sich beruhigt – bevor das Schlingern des Schiffs die nächste Welle grünen Zeugs heraufbeförderte.
Schlafen konnte ich nicht. Eine Weile konzentrierte ich mich auf das Foto von Jack, in der Hoffnung, das Schwarzweißbild besäße heilende Kräfte. Besaß es aber nicht. Also versuchte ich zu lesen und verschlang in Windeseile die Schiffspostille, die ich während des Rundgangs mitgenommen hatte. Unsere Truppen hatten die Aleuten-Insel Attu eingenommen. Und mit Hilfe der Briten hatten wir die Nazis und die Italiener zur Kapitulation in Nordafrika gezwungen.
Aber nicht bei allen Alliierten lief es so gut. Das australische Krankenhausschiff The Centaurian war von den Japanern versenkt worden, laut dem Blättchen sprachen die Verantwortlichen von einigen hundert Toten, viele davon Verwundete, die auf dem Schiff versorgt worden waren. Es war nicht einfach, sich die Tragweite dieser Tragödie vor Augen zu führen – nicht nur wegen der hohen Verluste bei einem einzigen U-Boot-Angriff, sondern weil viele der Toten bestimmt geglaubt hatten, mit ihren Verwundungen endlich den Fahrschein nach Hause gewonnen zu haben. Wie hatten wohl ihre letzten Augenblicke ausgesehen? Hatte man sie, um ihnen die Überfahrt zu erleichtern, mit Morphium vollgepumpt, oder waren sie bei vollem Bewusstsein, als der Tod sie in ihrer Hilflosigkeit ereilte?
Im Krieg war man nirgendwo sicher. Nicht auf einem Schiff, das Richtung Heimat fuhr. Noch nicht einmal in einer Kaserne.
Diese Erfahrung hatte Jack machen müssen. Er und sein befehlshabender Offizier waren die einzigen Überlebenden eines Bootes gewesen, dessen Kentern zehn Leben gefordert hatte. Der Offizier hatte behauptet, es sei ein Unfall gewesen, aber Jack wusste es offenbar besser. Es ging das Gerücht, sein eigener Offizier hätte auf ihn geschossen, um ihn zum Schweigen zu bringen. Angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit, das nächste Opfer dieses Menschen zu werden, hatte Jack das einzig Vernünftige getan und war weggelaufen.
Ich legte die Postille weg und griff zu Jaynes Zeitschriften.
Aus der Screen Idol lächelte mich eine hübsche Blondine an. Über ihrem Gesicht prangten die Worte: DAS NÄCHSTE GROSSE DING. Die Angaben zur Person standen neben dem Foto.
Name: Joan Wright
Alter: 22
Zu sehen in: Mr. Hogans Tochter, MGM, ab Herbst
Erinnert an: die junge Gilda DeVane
In mir zog sich alles zusammen. Das Mädchen sah tatsächlich wie Gilda aus, aber wer hatte beschlossen, dass Gilda alt war?
Ich blätterte auch die anderen Magazine durch. Vor nicht allzu langer Zeit war Gilda in den Fan-Zeitschriften auf jeder zweiten Seite zu sehen gewesen, sie hatte Ratschläge erteilt, das Ergebnis eines bestimmten Strickmusters vorgeführt, für Max Factor Werbung gemacht oder mit Schnappschüssen – immer nur sie bei irgendeinem sagenhaften gesellschaftlichen Ereignis – eine vierseitige Fotostrecke gefüllt. Entweder waren Jaynes Hefte die Ausnahme – oder Gilda war tatsächlich nicht mehr so gefragt. Vielleicht aber auch weder noch. Vielleicht musste man sich als Star, sobald man einen bestimmten Status erreicht hatte, auch nicht mehr so von der Presse hochjubeln lassen. Es musste eine Erleichterung sein, sich nicht mehr dauernd mit Eigenwerbung beschäftigen zu müssen.
Das einzige Foto, das ich von Gilda fand, illustrierte einen Artikel über ihre Entlassung bei MGM. Ich starrte auf ihr sorgfältig ausgeleuchtetes Gesicht und ihren Körper, rittlings auf einem Diwan, der, so wurde einem zumindest glauben gemacht, in ihrem Schlafzimmer stand. Ihr Gesichtsausdruck war von würdevollem Ernst. Das hier war eine Frau, der Unrecht geschah, die aber im Unterschied zu ihren Filmfiguren nicht auf Rache aus war für das ihr Widerfahrende. Sie trauerte wegen der schrecklichen Rückschläge, die sie einstecken musste – der Mann, der sie verlassen, und das Studio, das sie aufgegeben hatte –, und wollte die Öffentlichkeit wissen lassen, wie sehr beide sie verletzt hatten.
»Wie geht es dir?«
Beim Klang der Stimme schreckte ich auf, und meine Hand fuhr instinktiv zum Mund – nur für den Fall, dass meine Überraschung sich noch anders als nur durch ein Geräusch artikulieren sollte. Mit einem kleinen Tablett in der Hand stand Gilda in der Tür.
»Sehr gut, solange ich die Augen nicht schließe oder irgendetwas anschaue, das sich mit dem Schiff bewegt.«
»Ich dachte, das könnte vielleicht helfen.« Sie kam ins Zimmer und stellte das Tablett auf meinem Bett ab. Wie es aussah, standen Salzkräcker und ein Glas Gingerale darauf.
»Danke. Das ist nett von dir.«
»Ich wurde auch furchtbar seekrank, als ich zum ersten Mal mit so einem Ding fuhr. Allerdings war ich nicht so schlau wie du und bin gleich ins Bett gegangen, sondern habe behauptet, mir ginge es gut. Letzten Endes habe ich mich dann vor hunderten Fremden blamiert, zwei davon entstammten einem europäischen Königshaus.«
»Autsch.«
Ihr Blick blieb an dem Foto von Jack hängen, das neben mir lag. »Sieht gut aus. Dein Freund?«
»Ex.«





























