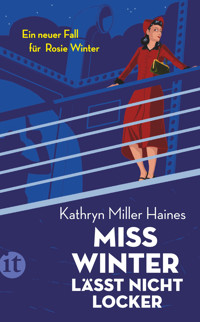11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Rosie-Winter-Krimis
- Sprache: Deutsch
Um die Miete bezahlen zu können, bräuchte Rosie Winter – großes Talent und große Klappe – dringend mal wieder ein Engagement. Aber im Kriegsjahr 1942 sind die guten Rollen am Broadway schwer zu kriegen, und für die schlechten hat Rosie leider viel zu viel Temperament. So hält sie sich mit einem Job im Detektivbüro von Jim McCain über Wasser. Bis ihr eines Nachmittags die Leiche ihres Bosses in die Arme fällt.
Miss Winters Hang zum Risiko: Ein Krimi mit Witz, Herz und Spannung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Kathryn Miller Haines
Miss Winters Hang zum Risiko
Rosie Winters erster Fall
Aus dem Amerikanischen von Kirsten Riesselmann
Insel Verlag
Inhalt
1 Der Tor und der Tod
2 Auf dem Grund
3 Ein Puppenheim
4 Die königliche Familie
5 Die Gespenstersonate
6 Frau Warrens Gewerbe
7 Ernst sein ist alles
8 Der Menschenfeind
9 Die beste Zeit deines Lebens
10 Die Wacht am Rhein
11 Schade, dass sie eine Hure war
12 Galante Listen
13 Helden
14 Heilmittel gegen die Ehe
15 Der Milch- und Eiermann
16 Nie wieder Nacht
17 Die Nebenbuhler
18 Auf der Suche nach Gerechtigkeit
19 Durch den Staub zu den Sternen
20 Die Maßnahme
21 Spiel der Illusionen
22 Die Magd als Herrin
23 Die Dame hat ein Herz
24 Eine Dame in Gefangenschaft
25 Eine Frau ohne Bedeutung
26 Man lebt nur einmal
27 In der Sackgasse
28 Miss Information
29 Der Diktator
30 Ein verdienstvoller Versuch
31 Was für eine Idee
32 Opfer einer großen Liebe
33 Der Künstlereingang
34 Der Teufel nimmt sich eine Braut
35 Doktor Faustus
36 Aus heiterem Himmel
Danksagung
Für meine Mutter,die mir immer gesagt hat,dass ich alles schaffen kann,
meinen Vater,der mir die dafür notwendigen Mittelzur Verfügung gestellt hat,
und vor allem für Garrett,der dafür gesorgt hat, dass ichnicht aufgegeben habe.
1 Der Tor und der Tod
Die Vorsprechen waren glatter Mord.
An Silvester ging ich zum letzten Casting des Jahres 1942 – meine allerletzte Chance, in den nächsten zwölf Monaten von mir behaupten zu können, ich würde in etwas anderem auftreten als in einer Maske, einem Fellkostümchen oder bei Lions-Club-Versammlungen, wo ich Küchengeräte zu verscheuern hatte. Ich versuchte es bei Darauf können Sie Gift nehmen, einem neuen Musical, in dem die Deutschen zum Glück mal nicht auftauchten. Leider ließ die Partitur aber darauf schließen, dass auch die westliche Harmonielehre darin kaum eine Rolle spielte. Das Vorsprechen gestaltete sich als der übliche Viehauftrieb, in einem Raum, der groß genug für ein Feldlazarett war. Hunderte von Frauen, jede eine Set-karte in der Hand, reihten sich an der Wand entlang auf, während zwei Männer, ein großer und ein kleiner, vor uns auf und ab paradierten und unsere äußeren Merkmale beurteilten. Ich schaffte es durch »zu alt«, »zu klein« und »zu fett«. Dann blieb einer der Aufsichtsführenden vor mir stehen.
»Name?«, fragte er.
»Rosie Winter.«
Sein Bleistift kratzte über die Klemmmappe. »Sie singen?«
»Wie ein Vogel.«
»Tanzen?«
»Besser als die Pawlowa.«
Er warf einen Blick auf meine Beinchen, an denen so wenige Muskeln waren, dass es an ein Wunder grenzte, wie man damit überhaupt die Treppen hochkam. »Wo hat man Sie zuletzt sehen können?«
»Auf einem Autorücksitz.«
Ich wurde wegen »zu viel Persönlichkeit« abgelehnt.
An derartige Ausmusterungen war ich gewöhnt, aber die Absage von Darauf können Sie Gift nehmen war mehr als nur wieder mal eine nicht ergatterte Rolle in wieder einer dieser üblen Shows. Diesmal war ich offiziell am Ende. Ich hatte seit sechs Monaten kein Engagement mehr bekommen. Es war nicht nur höchste Eisenbahn, sich Gedanken über einen anderen Beruf zu machen, ich würde wohl außerdem auch aus meiner Pension fliegen, einem Etablissement, dessen günstige Zimmer nur an arbeitende Schauspielerinnen vergeben wurden. Und als ob das alles nicht schon Grund genug gewesen wäre für eine ordentliche Scheißlaune, hatte sich zudem vor einem Monat die Liebe meines Lebens eingeschifft – er sei zu dem Schluss gekommen, dass die Marine ihm mehr bieten könne als ich.
Auf der Habenseite stand mein Tagsüberjob. Ich arbeitete für McCain & Sohn, ein kleines Detektivbüro an der Fifth Avenue, Ecke 38. Straße, einen Katzensprung vom Broadway entfernt. Den Job hatte ich über die Ladies Employment Guild gefunden (Motto: Mädel, LEG los, auch du bist eine Arbeitskraft!). Als ich dort anfing, gehörten nur zwei Leute dazu: Jim McCain, Eigentümer und Betreiber (und wahrscheinlich auch der »& Sohn« aus dem Firmennamen), sowie seine Sekretärin, eine gut gebaute, gut erhaltene Frau mittleren Alters, die, wie ich eher durch Zufall erfuhr, Agnes hieß. Meistens nämlich wurde sie Süße, Baby oder Zuckerschnecke gerufen. Agnes war zwar ein Quell der Freude in Jims Leben, aber irgendwann war ihm klargeworden, dass er nicht auf Dauer in einem Büro arbeiten konnte, in dem ausschließlich die Buchstabensuppe in alphabetischer Ordnung war. Deswegen stellte er mich ein.
Während Agnes tat, was auch immer sie so tat, ging ich ans Telefon, machte Termine, sortierte die Ablage – und ließ meiner Fantasie freien Lauf. Ich war mit Groschenheftchen groß geworden, weswegen die Arbeit für einen Privatdetektiv ein Traum für mich war. In meinen Gedankenflügen war ich die gepardenhaft grazile Handlangerin eines Meisterdetektivs, dessen stechender Blick in Sekundenbruchteilen Wahrheit von Lüge unterscheiden konnte. Gemeinsam brachen wir in dunkle Lagerhäuser ein, in bewachte Villen und unterirdische Schlupfwinkel und stellten Bösewichter, die Captain Zero, Der Bluter oder Die Domino-Dame hießen. Aber leider hatten die Groschenheftchen, hatte mein Dime Detective da irgendetwas falsch verstanden. Meiner Meinung nach war »ermitteln« nur ein Synonym für »warten«. Beides schien mir recht stumpfsinnige Arbeit zu sein: Jim wartete in seinem Büro darauf, dass eine Auftraggeberin anrief. Dann wartete er darauf, dass ein treuloser Ehemann das Haus verließ, in dem sein Flittchen wohnte. Und anschließend wartete er auf die Entwicklung des Films, seines Affären-Beweismaterials. Nichts davon war irgendwie glamourös.
Zumindest kam es mir so vor. Jims Gewerbe hatte allerdings noch eine andere Seite, eine Seite, die sich unserer Wahrnehmung entzog. Durch die Vordertür traten die Hahnreie und die betrogenen Frauen mit ihren verzweifelten, wässrigen Augen. Aber es gab auch einen Hintereingang, und den benutzten die Klienten, denen an Anonymität gelegen war – sie kletterten über die Feuerleiter und durchs Fenster in Jims Büro. Agnes und ich bekamen diese Leute nie zu Gesicht, aber wir hörten das leise Murmeln ihrer Stimmen, wenn sie von Missetaten erzählten, die niemals Gegenstand der Aktennotizen waren, die ich für Jim abzutippen hatte. Ich gab diesen mysteriösen Fremden Namen wie »der Nuschler« und »der Lispler« und war irgendwann in der Lage, sie anhand eines einzigen geflüsterten S-Lauts voneinander zu unterscheiden. Während Agnes und ich unsere Zeit im Vorzimmer verbrachten, spann ich mir zusammen, was im Büro drinnen gerade passierte. Die namen- und gesichtslosen Besucher wurden, auf ihre Sprachticks reduziert, für mich zu Geldwäschern, Betreibern illegaler Wettbuden und Streikbrechern. Agnes hörte meinen Hirngespinsten schweigend zu und deutete nur hin und wieder durch ein schiefes Lächeln an, dass sie mehr wusste, als sie je zugeben würde.
Ich mochte Agnes. Ich mochte den Job. Ich mochte Jim. Er war laut und ungestüm und so unordentlich, dass er manchmal Sachen verlor, von denen er nicht mal gewusst hatte, dass er sie besaß. Ich kannte ihn nicht wirklich gut, aber irgendwie vertraute ich ihm vorbehaltlos. Er war einer der letzten Lichtpunkte in einer Welt, die sich rasend schnell auf die totale Finsternis zubewegte.
Ich ging zu Fuß zu McCain & Sohn und holte mir unterwegs, als Belohnung für mein vergebliches Vorsprechen, bei Frankie’s Diner eine tröstende Tasse Kaffee. Beim Betreten unserer Räumlichkeiten stolperte ich über einen Berg Post, der durch den Türschlitz geworfen worden war. Agnes und ich hatten das Büro an Heiligabend abgeschlossen, aber im Vorzimmer hing ein scheußlicher Gestank – Jim hatte wohl in unserer Abwesenheit gearbeitet und war so freundlich gewesen, Essensreste über die Feiertage zum Verrotten dazulassen. Die Heizung hieß mich mit einem Ächzen willkommen, ich sammelte die Post auf, machte Licht und warf meine Handtasche auf einen der Empfangssessel. Churchill, unser Bürotiger, kam hinter dem Topf mit der Dieffenbachie hervor und schenkte mir ein gereiztes Maunzen.
»Hat Papi dir nichts zu futtern gegeben?«, fragte ich ihn. Churchill antwortete nicht, aber man konnte auch nicht erwarten, dass sich des Teufels liebstes Kind mit solchen Formalitäten abgab. Ich holte eine Dose Katzenfutter aus einem Aktenschrank, kippte den Inhalt in Churchills Schüssel und drückte die Büchse für die städtische Schrottsammlung flach. Ohne das kleinste Dankeschön raste Churchill zu seiner Schale und grub das Gesicht in den unappetitlichen Brei.
Um mich nicht so allein zu fühlen, schaltete ich das Radio ein und drehte den Suchknopf, bis ich WJZ fand, wo sie die letzten Stunden des Jahres mit den Spitzenreitern von 1942 herunterzählten. Während Kay Kysers Big Band »(There’ll Be Bluebirds Over) The White Cliffs of Dover« schmachtete, saß ich an meinem Schreibtisch und sortierte die Post in Briefe, Rechnungen und Sonstiges. Im Sonstigen landeten die Zeitungen der letzten Tage und ein Flugblatt, das irgendeine gute Seele für wichtig genug gehalten hatte, um es durch den Türschlitz zu schieben. Unter einer kruden Roosevelt-Karikatur stand in fetten Lettern: ROOSEVELT BETRÜGT AMERIKA. Propaganda des Amerikadeutschen Bundes. Großartig. Ich warf das Flugblatt in den Mülleimer und einen Blick in die Times vom Tage. Die neue Liste mit den Gefallenen und Verletzten zur See lag vor, praktischerweise gleich nach Bundesstaaten geordnet. Für die Jungs aus New York ging die Times noch einen Schritt weiter und schrieb die Namen der Ehefrauen und Eltern sowie die Postadressen dazu. Ich überflog die Liste und war froh, dass der Name, nach dem ich suchte, im Alphabet weit oben hätte kommen müssen. Er war nicht dabei. Jack ging es gut.
Bing Crosby setzte ein mit »Be Careful, It’s My Heart«. Ich schaltete das Radio aus.
Als ich die Zeitung zur Seite legte, bemerkte ich ein in Leder gebundenes Kontenbuch mit Goldschnitt. Das Finanzamt hatte Jim letzthin auf dem Amtsweg mitgeteilt, dass von Unternehmen ein gewisses Maß an Buchführung erwartet wurde. Das Thema war mir zu Füßen gelegt worden wie eine ausgeweidete Maus, die ich trotz meines empfindlichen Magens loswerden sollte. Ich öffnete das Buch und überflog die Zahlen, die Jim unter »Sonstige Kosten« eingetragen hatte. Ein Sonnenstrahl stahl sich aus seinem Büro und beschien eine Spalte voller Solls. Eigentlich machte Jim die Tür immer nur dann auf, wenn er gerade hinaus- oder hineingehen wollte, aber jetzt war sie nicht nur unverschlossen, sondern stand sogar eine Handbreit offen.
»Hallo?«, rief ich. Churchill hörte auf zu fressen. Wir verharrten reglos in Erwartung einer Antwort. Als keine kam, ging ich zur Tür und horchte. Churchill ließ seine Mahlzeit stehen und stieß auf der Schwelle zu mir. »Hallo?« Zentimeter für Zentimeter schoben wir uns in den Raum. War es im Vorzimmer kuschelig warm gewesen, hätte man in Jims Verlies Fleisch lagern können. An der einen Wand standen Bücherregale, statt mit Büchern mit Aktenordnern vollgestopft, die ich noch nie in der Hand gehabt hatte. Ein massiver Schreibtisch aus Eichenholz war nah ans Fenster geschoben und derart mit Papieren überhäuft worden, dass die Arbeitsfläche nicht mehr zu erkennen war. Ein Telefon, das der Schnur zwischen Hörer und Apparat verlustig gegangen war, drohte von einem Stapel alter Telefonbücher zu kippen. Eine leere Flasche Scotch und zwei billige Kristallgläser drängten sich auf einer Kladde. Es gab drei Sessel: einen für den Meister selbst und zwei – die nicht zusammenpassten – für seine Gesprächspartner. Die Wände waren bis auf zwei Zeugnisse nackt: eines von der Polizeischule, eines vom City College.
Der Gestank, von dem ich im Vorzimmer nur einen Hauch abbekommen hatte, mischte sich mit Jims Zigarrenrauch und Churchills Pisse zu einer Duftwolke, die ich, das hätte ich geschworen, förmlich auf der Zunge schmecken konnte. Um den Raum durchzulüften, zog ich die Verdunkelungsvorhänge auf und entdeckte, dass die Fenster bereits offen waren. Auf der Suche nach der Ursache für den Gestank kontrollierte ich den Papierkorb. Leer. Ich öffnete das Schreibtischfach. Die einzigen ungewöhnlichen Gegenstände darin waren eine 38er und eine noch unangebrochene Flasche Gin.
Churchill streifte vor dem Schreibtisch auf und ab und strahlte die Wärme eines Nudelholzes aus. Normalerweise blieb jeder von uns beiden schön in seinem eigenen Revier. Churchills Bestreben, mir jetzt Gesellschaft zu leisten, wertete ich als Affront.
»Hau ab!« Ich zeigte mit dem Finger Richtung Vorzimmer, als Antwort schlich er hinüber zur Schranktür und rieb sein Hinterteil daran. Ein gequältes Geräusch entfloh den unteren Gefilden seines Bauches. In dem Moment, in dem ich sicher war, mir das nur eingebildet zu haben, kam das Geräusch noch einmal, und zwar doppelt so laut. Churchills Pfote sauste mit ausgefahrenen Krallen durch die Luft und fuhr dann ins Holz der Schranktür.
»Das reicht jetzt, Churchill. Raus! Schsch!« In der Hoffnung, ihm einen Schrecken einzujagen, schlug ich mit der Hand gegen den Schreibtisch, aber er ließ weder von seiner Betätigung ab, noch ließ er mich aus den Augen. »Ist da was im Schrank? Willst du mir das sagen?« Er gab keine Ruhe und flitzte erst davon, als ich auf den Schrank zuging. Ich drehte den Knauf und schaute hinein.
Jim schaukelte an einem Telefonkabel, das erst um seine Hände und seinen Hals gebunden und dann um die Kleiderstange geschlungen worden war. Seine Haut war dunkelblaugrau und hing ihm von den Knochen, als ob der Kleber, der das alles mal zusammengehalten hatte, inzwischen nichts mehr taugte.
Ich fuhr zurück und stieß an die Schreibtischecke. Bei einer ganzen Reihe von Beerdigungen war ich schon gewesen und hatte massenweise Leichen gesehen, aber die hatte man immer sauber und hübsch zurechtgemacht, wie Bauchrednerpuppen – nicht wie diese in einem Moment der Gewalt erstarrte baumelnde Statue. Ich wollte schreien, aber ein Würgereiz machte diesen Impuls zunichte. Als er abgeklungen war, hatte ich keinen anderen Wunsch mehr, als meine Augen nie wieder auf dieses Ding im Schrank richten zu müssen. Ich hatte Angst. Nicht davor, dass derjenige, der das getan hatte, immer noch im Büro lauerte, sondern davor, dass Jim sich aus seiner Schlinge befreien, aus dem Schrank treten und verkünden könnte, für ein frischgebackenes Geschöpf der Nacht wie ihn gehöre es sich einfach, mein Gehirn zu verspeisen.
Aber das hier war nicht die eine gute Gruselgeschichte im Tales of Terror-Heftchen des Monats. Das hier war ein Mann, den ich gemocht hatte, und meine Angst würde ihn nicht aus seiner misslichen Lage befreien und ihm die Ruhe geben, die er verdiente.
Zwanzig Minuten später waren die Bullen da. Bis dahin hatte ich die Ginflasche zur Hälfte geleert, mich ausgeheult und einen Trampelpfad in den Dielenboden getreten. Anstatt mich zu verhören, fragte mich ein Bulle in einer zu kleinen Uniform nach meinem Namen und sagte mir dann, ich solle mich vom Acker machen. Das brachte ich nicht über mich. Ich lehnte also am Türpfosten zwischen meinem und Jims Büro und sah durch einen Schleier aus Zigarettenrauch zu, wie mein früherer Boss untersucht, fotografiert und von seiner Schlinge geschnitten wurde.
Der Leiter dieser Unternehmung war ein sauertöpfischer Lieutenant namens Schmidt, der in Jims Sessel saß und einen Block mit Notizen vollkritzelte. Dabei machte er einen derart uninteressierten Eindruck, als sei er in der Oper und müsse gegen die Müdigkeit ankämpfen.
Ich fuhr mir übers Gesicht und zwang den Gin, meinen Kopf freizugeben. »Kann ich noch etwas tun?«
»Nein«, sagte er, »ich glaube, wir haben alles, Schätzchen.«
Ich nickte, hatte aber immer noch keine Lust abzuhauen. »Was denken Sie?«
Schmidt packte die Füße auf Jims Schreibtisch und verschmierte mit seinen Hackenabdrücken die ganzen Akten. »Worüber?«
»Über den Krieg natürlich«, schnappte ich. Mein Sarkasmus prallte an ihm ab. »Die Leiche. Was denken Sie über die Leiche?«
Er zuckte mit den Schultern, als wolle er sagen: Kennste eine, kennste alle.
Der Schrank war jetzt leer, sein Inneres wurde gerade in ein Blitzlichtgewitter getaucht, das mich blendete. Ich verließ meinen Posten an der Tür und näherte mich dem Schreibtisch. »Was glauben Sie, wie lange er schon tot ist?«
Er heftete die Augen auf den Block. Was ich für Notizen zum Fall gehalten hatte, entpuppte sich als Einkaufszettel. »Das muss der Untersuchungsrichter sagen, aber so aufgebläht, wie die Leiche war, und dann der Geruch – ich tippe mal, der hat seit Weihnachten hier gehangen.«
Ich trommelte mit den Nägeln so lange auf die Schreibtischplatte, bis er zu mir hochsah. »Gibt es irgendeinen Hinweis auf den Täter?«
Er klappte den Notizblock zu und seufzte. »Da gibt’s für mich kein Hängen im Schacht, Schätzchen. Solche Fälle haben wir andauernd. In der Jahreszeit kriegen viele Leute Depressionen, seit dem Krieg sogar noch mehr.«
»Ach ja? Und fesseln sich alle vorher die Hände?«
Er verlagerte die Füße, und die Flecken auf den Papieren bekamen die Form von Halbmonden.
»Lieutenant, sind Sie in einem Stall aufgewachsen?« In seinen Augen tauchte ein Fragezeichen auf, dann schüttelte er den Kopf. »Dann nehmen Sie Ihre Füße von meinen Akten. Das sind verdammt noch mal keine Schuhabstreifer.«
Er ließ die Beine vom Schreibtisch rutschen, womit er ein noch größeres Durcheinander verursachte, und knallte seine Treter Größe 45 auf den Boden. »Sie sind nicht auf den Mund gefallen.«
»Sonst wäre das mit dem Essen auch ziemlich schwierig.« Ich stützte mich mit den Händen auf den Schreibtisch und beugte mich zu ihm hinunter. »Hören Sie, ich habe keine Ahnung, was für ein Spiel Sie hier spielen, aber Jim McCain ist keiner von diesen Weihnachtsselbstmördern. Er ist umgebracht worden, ganz einfach.«
Sein Gesicht hellte sich auf und zeigte sein schönstes Die-Kleine-fängt-ja-an-zu-laufen-Lächeln. »Wie heißen Sie, Schätzchen?«
»Schätzchen ganz sicher nicht.«
»Na gut, Süße. Sie sind nicht zufällig Polizistin oder vielleicht sogar Detektivin?«
Ich suchte nach einem Bären, den ich ihm aufbinden konnte, fand aber keinen. »Sie kennen die Antwort.«
Er blätterte seinen Block durch, bis er auf das gestoßen war, was ich vorher dem anderen Bullen erzählt hatte. »Nein, Miss Winter, Sie sind Schauspielerin, und bestimmt eine verdammt gute. Ist sicher nicht einfach für Sie, Ihren Boss hier so zu finden. Ich lege jetzt mal die Umstände zu Ihren Gunsten aus und nehme an, dass Sie etwas zu emotional reagieren, ein bisschen durcheinander sind.« Er zog ein Päckchen Zigaretten aus der Tasche und bot mir eine an. Mit einem Kopfschütteln lehnte ich ab. »Sie ticken nicht wie ein Detektiv, also fällt Ihnen vielleicht nicht auf, was mir auffällt. Es ist nämlich so: Ihr Freund Jim war finanziell nicht besonders gut dran. Wir haben ein paar Briefe vom Finanzamt gefunden, und es sieht so aus, als ob er das eine oder andere Problemchen gehabt hätte.« Er blätterte flüchtig seine Aufzeichnungen durch und hielt kurz das Flugblatt des Amerikadeutschen Bundes hoch. »Neue Freunde hat er sich wohl auch zugelegt.«
»Das ist nicht seins. Ich habe es in der Post gefunden.«
»Sicher, Schätzchen, ganz wie Sie meinen.« Er verstaute das Flugblatt wieder zwischen seinen Unterlagen und kritzelte etwas dazu. »Und was tut einer, der pleite ist und politisch in der falschen Ecke steht? Natürlich ist das eine feige Nummer, aber was kümmert’s ihn. Trotzdem, während er so drüber nachdenkt, kriegt er es doch mit der Angst, ob er die Sache auch wirklich durchgezogen bekommt. Und damit er sich’s, wenn er oben steht, nicht doch noch mal anders überlegt, bindet er sich lieber vorher die Hände zusammen.«
Ich richtete mich auf. »Und wie ist er da hochgekommen? Ist er in die Schlinge hineingesprungen, nachdem er sich die Hände gefesselt hat? Oder ist er vielleicht geflogen?«
Der Lieutenant erhob sich und strich sich die Bundfalten seiner mit Essensflecken übersäten Hose glatt. Er war ein dicklicher Typ, und man hätte ewig an ihm herumzupfen können, die Hose hätte trotzdem nicht richtig gesessen. »Ich will mal ganz offen sein.« Er durchbohrte die Luft mit seiner Zigarette. »Jim McCain war Abschaum, und jeder, der mit ihm zu tun hatte, war auch Abschaum. Für mich und meine Dienststelle ist das hier ein Selbstmord, und wenn irgendjemand das bezweifelt, dann sorge ich dafür, dass er dasteht wie ein kompletter Idiot.«
Ich versuchte ihm fest in die Augen zu sehen, was aber so von unten nach oben etwas traurig ausfiel. »Was hat Jim Ihnen eigentlich getan?«
Er aschte auf den Schreibtisch ab. »Er war ein korrupter Polizist und ein mieser Detektiv. Vielleicht sollten Sie sich das mal genauer durch den Kopf gehen lassen, statt hier mit mir zu streiten.«
2 Auf dem Grund
Ich saß in Frankie’s Diner auf einem Fensterplatz und sah zu, wie der Leichenwagen kam und wieder abfuhr. Sobald ich mir sicher war, dass auch die Bullen weg waren, ging ich zurück ins Büro und schloss die Tür hinter mir ab. Churchill begrüßte mich mit einem leisen Maunzen und wickelte sich um meine Beine, bis keiner von uns beiden mehr ohne den anderen vorwärtskam. Jims Tür stand immer noch offen, die Lampen in seinem Zimmer verbreiteten ein unheimliches goldenes Licht. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, da wieder hineinzugehen, sank auf meinen Stuhl, griff nach dem Telefon und ließ mir von der Vermittlung Agnes’ Nummer geben.
Agnes als am Boden zerstört zu beschreiben wäre ungefähr so treffend gewesen, wie die Deutschen einfach als dickköpfig zu bezeichnen. Die Frau heulte und wehklagte, bis sie keine Stimme mehr hatte. Schließlich begann die Verzweiflung sich auf ihre Atmung auszuwirken, was aus jedem Ausatmen ein langgezogenes schmerzvolles Stöhnen machte.
»Es tut mir so unglaublich leid, Agnes«, sagte ich in einem der seltenen Momente, in denen sie still war.
Ihre Stimme kam zurück, tief, heiser und so zittrig, dass klar war: Sie hatte immer noch genug Tränen, um ein U-Boot zu versenken. »Warum, Rosie? Warum?«
»Ich weiß es nicht.« Churchill flüchtete sich zwischen meine Beine. Sein Schwanz wickelte sich um meine Wade wie das Riemchen einer Römersandale.
»Er war so ein guter Mensch.«
»Stimmt. Ein prima Kerl.« Ich wollte sie trösten, aber zunehmend schien mich das, was passiert war, gar nicht mehr so viel anzugehen. Ich sah Agnes vor mir als altnordische Königin auf einer Bühne, wie sie den Verlust ihres Gefährten beklagte. Es war einfach leichter, mit den Ereignissen zurechtzukommen, wenn ich mir vorstellte, dass man sie als Ganzes in Brand setzen und aufs Meer hinaustreiben lassen konnte.
Ein Rascheln an Agnes’ Ende der Leitung ließ darauf schließen, dass sie sich mit einem Taschentuch übers Gesicht fuhr. »Ich weiß, dass er mich geliebt hat. Erst neulich hat er noch gesagt, dass er seine Frau verlässt. Wir wollten gemeinsam fortgehen und in Acapulco heiraten. Habe ich dir das schon mal erzählt?«
»Ja.« Sie hatte mir diese Geschichte schon dutzende Male erzählt, das Einzige, was sich jeweils änderte, war der Ort, an dem die Hochzeitsfeierlichkeiten stattfinden sollten. Ich zweifelte nicht daran, dass Jim ihr solche Versprechungen gemacht hatte, aber im Grunde ihres Herzens wusste Agnes bestimmt, wie leer sie waren.
»An Heiligabend wollte er noch vorbeikommen. Ich hatte Kasseler gemacht. Ich habe meine Zucker-Lebensmittelmarken eingetauscht für die zweite Portion Fleisch. Ich war so wütend, als er nicht aufgetaucht ist.«
Mein Kopf wog ungefähr achtzig Pfund. Ich konnte ihn nur aufrecht halten, indem ich ihn auf meiner Hand abstützte. »Du konntest doch nicht wissen, dass er tot ist.«
Ihre Stimme wurde höher. »Ich habe sogar bei ihm zu Hause angerufen. Ich habe mit seiner Frau geredet. Ich musste einfach wissen, ob er bei ihr war statt bei mir.«
Jim hatte nie über seine Frau gesprochen; dass er überhaupt eine hatte, wusste ich nur von Agnes. Bisher hatte ich immer angenommen, dass sie entweder krank war oder vielleicht überhaupt nicht existierte. Die letzte Version gefiel mir jetzt besser, denn wenn Agnes wirklich mit einer leibhaftigen Frau gesprochen hatte, würde ich das auch noch tun müssen.
»Was hat seine Frau denn gesagt?«, fragte ich.
»Dass sie Besuch hat und sich darum jetzt nicht kümmern kann. Ich habe mich so aufgeregt, dass ich einfach aufgelegt habe.«
»Hast du irgendeine Idee, warum er an Weihnachten noch ins Büro gekommen ist?«
»Keine Ahnung. Vielleicht ein Kunde? Du kennst doch Jim: Sobald es um Geld geht, arbeitet er auch zu den unmöglichsten Zeiten.«
Um zu verdrängen, dass sie die Gegenwartsform gebraucht hatte, kniff ich mir mit Daumen und Zeigefinger in die Nasenwurzel. »Glaubst du, dass irgendjemand wütend auf Jim war und sich an ihm rächen wollte?«
Agnes schniefte. »Ich weiß es nicht, Rosie. Ich –« Sie verschluckte den Rest, und ich sah sie vor mir, die Augen so fest zugedrückt, wie ich es mit meinen Fingern machte, wenn ich beim Trinken aus dem Hahn keinen Tropfen Wasser verschütten wollte. »Wir können gar nichts machen, oder? Es passieren die schrecklichsten Sachen, und wir können nichts dagegen machen.« Ich antwortete nicht. Der Krieg hatte uns beigebracht, dass wir machtlos waren. Egal, wie viel man darüber redete, an der Situation änderte das nichts. »Ich muss los.«
Sie legte auf, und ich starrte auf den Hörer. So hart dieser Anruf gewesen war – der nächste würde noch viel schlimmer werden. Ich wollte nicht, dass Mrs. McCain die Neuigkeiten von jemandem wie Lieutenant Schmidt zu hören bekam, aber ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie man einer völlig Fremden beibrachte, dass ihr Ehemann tot war. Ich probte meine Zeilen wie für ein Tschechow-Stück, und als ich in der Lage war, sie ohne zitternde Lippen aufzusagen, suchte ich Jims Privatnummer aus dem Telefonbuch heraus und bat die Vermittlung um eine Verbindung.
»Hallo, hier bei McCain.« Eine Frau nahm ab, deren ausländischer Akzent die Silbenzahl eines jeden ihrer Worte verringerte.
»Mrs. McCain?«, fragte ich.
»Mrs. McCain nicht hier. Kommen bald. Kann ich ausrichten?«
Auch wenn es unwahrscheinlich schien, dass Mrs. McCain gerade erst vom Einwandererschiff gestiegen war – dass Jim die Kohle für ein Dienstmädchen hatte, hätte ich mindestens genauso wenig erwartet. »Bin ich da bei Jim McCain? Dem Privatdetektiv?«
»Mr. McCain nicht hier. Kann ich ausrichten?«
Ich räusperte mich und legte mir die Finger an die Schläfen. Sicher war ich nicht gerade die Königin der Umgangsformen, aber ich hatte doch den leisen Verdacht, dass man einen Todesfall nicht einfach übers Telefon ausrichten lassen sollte. »Mein Name ist Rosie Winter. Ich arbeite für Jim. Mrs. McCain soll mich so bald wie möglich im Büro anrufen.«
»Mrs. McCain nicht da.«
Ich verstärkte den Druck auf meinen Schädel. »Ja, das habe ich verstanden, aber ich möchte, dass sie mich im Büro zurückruft. Sagen Sie Mrs. McCain, sie soll Mr. McCain im Büro anrufen.«
In der nächsten Stunde klingelte das Telefon acht Mal. Einer hatte sich verwählt, drei waren potentielle Auftraggeber, vieren der Anrufer hatte Jim bei unterschiedlichen legalen Rechtsverletzungen geholfen. Ihnen allen erklärte ich, dass wir bis einschließlich Neujahr geschlossen hätten und Jim bis dahin nicht zu sprechen sei. Als das Telefon zum neunten Mal klingelte, steckte ich schon halbwegs in meinem Mantel.
»McCain und Sohn, guten Tag.«
»Jim McCain bitte.« Eine Frauenstimme, glatt wie Porzellan, brach aus dem Hörer.
»Mit wem spreche ich?«, fragte ich.
»Mit wem spreche ich?«, wiederholte sie.
»Mit Jims Assistentin. Wie kann ich Ihnen behilflich sein?«
Das Porzellan wurde zu Stacheldraht. »Meine liebe Jims Assistentin, es ist nicht gerade eine angemessene Form der Begrüßung, wenn man als erstes wissen will, mit wem man spricht.«
»Ich habe guten Tag gesagt.« Kampfbereit stellten sich meine Nackenhaare auf. »Und vielleicht dürfte ich Ihnen auch gleich einen Rat geben? Wenn Sie schon jemanden anrufen, dann schmieren Sie doch der Person, die den Hörer abnimmt, ein bisschen mehr Honig ums Maul. Sonst könnte es nämlich passieren, dass sie einfach wieder auflegt.«
»Wie können Sie es wagen, so mit mir zu sprechen!«
Ich ließ die Wut hochkommen und meine Trauer übermannen. »Hören Sie mal, Schwester, Sie haben damit angefangen.«
»Und ich bin auch diejenige, die damit Schluss macht. Geben Sie mir meinen Mann, und dann überlegen Sie sich doch am besten schon mal, wo Sie als nächstes arbeiten werden!«
Der Mantelärmel, in den ich noch nicht geschlüpft war, baumelte an meiner Seite wie ein gebrochener Flügel. »Mrs. McCain?«
»Ich warte. Holen Sie Jim ans Telefon.«
Ich fiel auf den Stuhl und ließ den Kopf so weit nach vorn sinken, bis er auf Holz stieß. »Eigentlich bin ich diejenige, die Sie angerufen hat, nicht Jim.«
Das Geräusch von Papier, das zu einem Ball geknüllt wird, raschelte durch die Leitung. »Jims Taktlosigkeiten interessieren mich nicht. Falls Sie angerufen haben, um irgendetwas zu beichten, verschwenden Sie unser beider Zeit.«
Ich gab alles, um Mitgefühl für dieses Weib zu empfinden, aber ihre Art machte mir das unmöglich. Welche Frau brachte es fertig, seit Weihnachten keinerlei Kontakt mit ihrem Mann zu haben und dabei nicht das kleinste bisschen in Panik zu geraten? Jim war bestimmt kein Heiliger, aber sicher hätte er zumindest so getan, als wäre er besorgt, wenn sich dieses Weibsstück unangekündigt aus dem Staub gemacht hätte.
Sie räusperte sich. »Sind wir dann soweit, Jims Assistentin?«
»Nein, sind wir nicht. Erstens ist mein Name Rosie Winter, und zweitens rufe ich nicht an, um irgendetwas zu beichten.« Ich schnappte mir einen Bleistift und ließ die Radiergummiseite über die Schreibtischplatte quietschen.
Jedes ihrer Worte bekam eine Extrabetonung. »Warum. Haben. Sie. Dann. Angerufen?«
»Jim ist tot.«
In der Leitung wurde es still. Churchill kam an der Längsseite des Schreibtischs entlanggelaufen und sprang auf die Arbeitsfläche. Er schlug mit der Pfote nach meinem Stift, bis ich mit dem Gequietsche aufhörte. Dann legte er sich in Lauerstellung platt auf den Bauch und wartete darauf, dass seine Beute ihre Tätigkeit wieder aufnahm.
»Oh«, sagte Mrs. McCain endlich. Im Hintergrund hörte man eine Türklingel, dann hektische Schritte, die über einen Flur trippelten, und danach die Stimme des Dienstmädchens, das mit einer Spur von Hysterie verkündete: »Polizei, Madame. Polizei!« Mrs. McCain räusperte sich erneut, und ihre Stimme wurde weicher, was nicht einer Gefühlsaufwallung zuzuschreiben war, sondern der größeren Entfernung zwischen ihr und dem Hörer. »Danke für den Anruf.«
Ich starrte in Jims Büro und versuchte mir vorzustellen, wie er am Schreibtisch saß und an dem Stummel einer Zigarre sog, die ihm die Zeit bis zum Feierabend verkürzen sollte. »Es tut mir wirklich sehr leid. Falls Sie etwas brauchen, irgendetwas, lassen Sie es mich bitte –«
Sie unterbrach mich. »Ich werde das selbst regeln, denke ich. Einen schönen Abend noch.«
Um halb sieben verließ ich das Büro und ging in Richtung Finanzamt am Times Square, Ecke 42. Straße. Seit September galt die Verdunkelungspflicht, und in den Hochhäusern über Midtown wurden jetzt nach und nach die Lichter gelöscht, so dass die Skyline der Stadt allmählich verschwand. Das Quecksilber hing bei 17 Grad minus, was diesen Silvesterabend zum kältesten seit Beginn der Messungen machte. Erste Feiernde mit knallbunten Papierhüten auf den Wollmützen lieferten einen Vorgeschmack auf die große anstehende Party, während die Straßen, wegen der Treibstoff- und Reifenrationierung völlig verödet, vom leichten Schneefall weiß wurden. Auf Ladenfenster und Telegrafenmasten gekleisterte Hinweisschilder gaben Order aus, sich für die Dauer des Krieges bedeckt zu halten: »Er beobachtet Sie! Der Feind hört zu! Bewahren Sie Stillschweigen – er will wissen, was Sie wissen! Schon Schall kann töten: Werden Sie nicht zum Mörder durch unbedachte Worte!« Ich vergrub mich tief in meinem Mantel und hielt den Blick starr auf den Bürgersteig gerichtet. Die Dunkelheit, die Geschehnisse des Tages und die Schilder zusammengenommen ließen alles zur Bedrohung werden. Ein überquellender Mülleimer wurde zur letzten Ruhestätte einer verstümmelten Leiche. Ein zu früh losgegangener Silvesterkracher zum Schrei einer Frau. Das Echo meiner eigenen Schritte zum rasenden Auftragskiller, der mir auf den Fersen war.
Denk an etwas anderes, befahl ich mir. Ich versuchte mich an irgendein Buch zu erinnern, das ich kürzlich gelesen hatte, aber die einzigen Geschichten, die mir in den Kopf kamen, waren die aus meinen Thrillerheft-chen – was mir nicht wirklich weiterhalf. Ich summte ein paar Takte eines Liedes vor mich hin, um dann festzustellen, dass ich mich unbewusst für »I’ll Never Smile Again« entschieden hatte. Damit das bloß nicht wahr wurde, brach ich mitten in der Strophe ab. Vermutlich war Shakespeare der Einzige, der hier noch als Ablenkung taugte, und so forschte ich in meinem Gehirn nach dem bisschen, das ich auswendig konnte. Ein Liedchen aus Macbeth spülte an die Oberfläche und versetzte mich von jetzt auf gleich mitten hinein in ein schottisches Schloss: »Morgen, und morgen, und dann wieder morgen,/Kriecht so mit kleinem Schritt von Tag zu Tag,/ Zur letzten Silb auf unserm Lebensblatt;/Und alle unsre Gestern führten Narren/Den Pfad zum staubigen Tod.«
Das reichte. Ich beschloss, die Sache mit dem Denken ganz sein zu lassen.
Schließlich landete ich am Bahnhof und ging die Treppen bis zum Drehkreuz hinunter. Auf dem Bahnsteig standen außer mir nur eine Handvoll Menschen, die sämtlich aussahen, als seien sie gerade aus der Klapse entlassen worden. Kugellampen tauchten die unterirdische Welt in ein kränkliches gelbes Licht. Eine lecke Leitung verlor in unregelmäßigen Abständen mit einem Pling Pling Pling Wasser, war endlich still, nur um dann ihr taktloses Granteln wieder aufzunehmen. Ein Schatten tauchte hin und wieder am Rand meines Gesichtsfelds auf. Immer wenn ich mich umdrehte, um ihn genauer in Augenschein zu nehmen, verlor er sich zwischen den Pfeilern.
Der Seventh-Avenue-Zug hatte zehn Minuten Verspätung. Ich setzte mich ganz hinten in den letzten Waggon und verbrachte die Fahrt damit, jedes Gespräch, das ich mit Jim in den Tagen zuvor geführt hatte, noch einmal durchzuspielen. Er war nicht deprimiert gewesen. Auch die Sache mit dem Finanzamt hatte ihn eigentlich nur amüsiert. Dass er zu Hause Ärger hatte, war offensichtlich, aber das machte Agnes wieder wett. Ich kniff die Augen zusammen und sah Jim vor mir, wie er im Wandschrank hing, wie ein Luftzug seinen Körper zum Schwingen brachte und wie seine seelenlosen Augen plötzlich die Person erkannten, die vor ihm stand. Es passieren die schrecklichsten Sachen, und wir können nichts dagegen machen. Agnes hatte den Nagel genau auf den Kopf getroffen. Mir blieb nichts mehr, nichts würde sich mehr ändern lassen. Ich sah wieder auf. Mir gegenüber saß ein riesenhafter Mann, der mir, nur halb hinter einer Zeitung verborgen, mit seinen kleinen engstehenden Augen Zwillingslöcher in den Schädel starrte.
3 Ein Puppenheim
Ich stieg am Bahnhof Christopher Street aus und mischte mich unter den stärker werdenden Fußgängerverkehr – nur für den Fall, dass der Widerling mit den Schweinsäuglein beschließen sollte, mich zu verfolgen. Tat er aber nicht, soweit ich das beurteilen konnte, was mich allerdings nicht daran hinderte, mich anderthalb Häuserblocks weit zum Schatten von zwei Angehörigen der Handelsmarine zu machen. Um kurz nach sieben landete ich heil im George Bernard Shaw House, das ich Heim für Launische Schauspielerinnen nannte. Die Pension befand sich im Greenwich Village, zwischen der 10. Straße und der Hudson Street, und war früher ein bei Seeleuten beliebtes Hotel gewesen. Heute gab sie immer noch ein schönes Beispiel für die Architektur des Sezessionskriegs ab, aber nur, weil der aktuelle Besitzer ein zu großer Geizkragen war, als dass er das Haus auf den Standard des 20. Jahrhunderts gebracht hätte. Ein Starlet, dem eine gute Partie geglückt war, hatte um die Jahrhundertwende herum etwas Geld in die Bude gesteckt und solchen Hallodris wie mir damit ein kostengünstiges Dach über dem Kopf beschert. Einzige Voraussetzung: Man musste den gleichen Berufsweg einschlagen wie die Stifterin.
Egal an welchem Tag man also das Haus betrat, man stieß immer auf Sängerinnen, die im Wohnzimmer ihre Aufwärmübungen machten, auf Tänzerinnen, die das Treppengeländer als Stange benutzten, sowie auf ein halbes Dutzend Frauen, die gegen die Wände redeten, um sich die Zeilen für Vorsprechen und Theaterproben in den Schädel zu hämmern. Es wimmelte von Indizien für unsere Arbeit. Der Wohnzimmertisch war übersät mit alten Ausgaben von Variety, Radio Stars, Cue und Photoplay. Ein Bücherschrank brach fast unter dem Gewicht von Sammelalben voller Kritiken zusammen. Das Klavier bog sich unter den Kopien der neuesten Broadway-Partituren, und aus dem Radio dröhnten Sendungen, von denen sich alle 20 Frauen, mit denen ich zusammenwohnte, ihren großen Durchbruch erhofften.
Im Hausflur kam ich an der sogenannten Schandmauer vorbei, einer Wand, an der unsere Pensionsmutter Belle anstelle einer Tapete die Setkarten aller früheren und jetzigen Bewohnerinnen aufgehängt hatte. Weil das Shaw House in Sachen Unterhaltung zwar großzügig, ansonsten aber knapp bei Kasse war, hatte es auch seine Nachteile. Da unsere Miete subventioniert wurde, erwartete man von uns, dass wir uns an eine ellenlange Liste von Hausregeln hielten. Abgesehen davon, dass wir jedes Jahr eine gewisse Zahl an Theaterengagements vorweisen mussten, wurde unser Kommen und Gehen auch noch stärker überwacht als in einem Hochsicherheitsgefängnis. Und es gab so viele Einschränkungen, was unsere Zimmerausstattung betraf, dass es leichter war, die erlaubten Gegenstände aufzulisten als die verbotenen.
Auf Zehenspitzen betrat ich die Diele und hielt nach Belle Ausschau. Eine Woche noch, dann hatte ich die Sechs-Monate-ohne-Arbeit-Marke erreicht. Das hieße für mich: Raus aus dem Bau. Mein Plan sah deshalb vor, Belle so lange aus dem Weg zu gehen, bis ich Arbeit oder sie zur Religion gefunden hatte. Zum Glück schien das Haus an diesem Abend wie leergefegt. Alle, außer meiner besten Freundin und mir, hatten es geschafft, sich in der Silvesternacht engagieren zu lassen, und hüpften jetzt zusammen mit den Ensembles des Stork Club, der Stage Door Canteen oder des neuen Rockefeller Center ins neue Jahr hinein. Die Auftritte dort versprachen bare Münze und flüchtige Romanzen. Gegen ein paar Scheinchen hätte ich nichts einzuwenden gehabt, aber Männer, die mir nichts, dir nichts zur Armee rannten und alles andere zurückließen, wollte ich keine mehr um mich haben. Warum sollte ich mich am Ende des alten Jahres noch mit dem auseinandersetzen, was ich im neuen vergessen wollte?
»Rosie!« Jayne kam die Treppen heruntergerannt, schlang ihre Arme um mich und umarmte mich so fest, dass sie mir fast die Schulter ausgerenkt hätte. Meine beste Freundin war eine zierliche Blondine mit dem Körperbau einer Pariser Vase – untenherum schlank, obenherum üppig – und der Stimme einer Zweijährigen. Sie war ein freundlicher Mensch und arbeitete hart, was in Kombination mit ihrem Aussehen jeden Regisseur, der ihr über den Weg lief, dazu bewegte, ihren beruflichen Werdegang unterstützen zu wollen. Der letzte dieser Knaben hatte sie bis zum Broadway gebracht und sogar die Presse bezahlt, damit die Entdeckung des neuesten It-Girls auch schön bejubelt wurde. Ein Zeitungsartikel nach dem anderen kündete von Jaynes punktgenauer Komik und ihrem bombastischen Aussehen, bis ein einzelner Kritiker, der hier namenlos bleiben soll, sie »Amerikas Quiekling« nannte und sich alle anderen sofort auf seine Seite schlugen, ihre Vorzüge vergaßen und sich nur noch auf ihre Stimme kaprizierten. Die war tatsächlich zu hoch, um im Theater gut zu tragen, was Jayne dazu verdammte, den Rest ihrer Karriere mit Mannequinjobs, Tanzen und Kinderrollen in Radioproduktionen zu verbringen.
»Ist Belle da?«, fragte ich sie mit einem Bühnenflüstern. Jayne stieg im selben Tonfall auf meine Heimlichtuerei ein. »Ist ausgegangen.«
Sie bekam eine etwas großzügigere Umarmung von mir. »Wie war deine Reise?«
»Das darfst du beurteilen.« Sie hielt die rechte Hand hoch und wedelte mit einem Klunker herum, der so groß war, dass ich mich wunderte, warum sie keinen Pagen angeheuert hatte, der ihn für sie durch die Gegend schleppte.
Ich bog ihren Finger in verschiedene Richtungen, und verspielt brach sich das Licht in dem Stein. »Da sieh aber mal einer an … Wann soll denn der große Tag sein?« Jayne war mit einem der Vizes von Mafiaboss Vincent Mangano zusammen, einem Ganoven namens Tony B., der mit ihr für ein paar Tage in die Adiron-dack-Berge gefahren war. Tony war alles andere als redlich, aber man kam nicht umhin, seinen tadellosen Geschmack zu bewundern, wenn es um überteuerte Geschenke ging. In den vergangenen Monaten hatte er Jayne derart mit funkelndem Tand überschüttet, dass sie einem Sternbild Konkurrenz machen konnte.
Jayne löste ihre Hand aus meiner. »Das ist kein Verlobungsring. Das ist ein Versprechensring.«
»Und was hast du ihm versprochen?«
Sie zwinkerte mir zu. »Dass ich den Ring nicht verliere.« Sie nahm mich wieder an die Hand und führte mich nach oben in unser Zimmer. Wir wohnten auf einer Fläche, die kleiner war als ein Viehwaggon und von einem Heizkörper beherrscht wurde, der wegen der Ölrationierung ausschließlich dekorative Zwecke erfüllte. In hausfraulicher Hinsicht waren wir beide nicht sonderlich begabt, und das sah man: Kleidungsstücke quollen aus Kommoden, Wäsche lugte aus zugestopften Schreibtischschubladen, und ein windschiefer Weihnachtsbaum aus einem Billigladen grüßte vom Fenstersims.
Aber es war mein Zuhause, und mir gefiel es.
Jayne verschwand in ihrem Schrank und tauchte mit zwei randvoll befüllten Martinigläsern wieder auf, die wir bei einem »Dish Night«-Kinobesuch im Roxy als Werbegeschenk bekommen hatten. »Ta-da!«
»Immer her damit, solange ich nichts Gegenteiliges sage!«
Sie setzte sich neben mich auf die Heizung und stieß mit mir an. »Frohes Neues!«
»Das wird sich erst noch herausstellen.« Ich nahm einen Schluck flüssigen Mut. »Als ich heute Nachmittag zur Arbeit gegangen bin, habe ich Jim McCain tot in seinem Schrank gefunden.« Ich leerte das Glas ganz und fischte die Olive heraus.
Jayne schoss in die Höhe. »Was?«
Während ich ihr von den Ereignissen des Tages berichtete, wurde Jaynes Gesicht zu einem Wimmelbild voller sich hebender und senkender Augenbrauen, geschürzter Lippen und von innen zerkauter Wangen.
»O Rosie«, meinte sie, als ich fertig war, »ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.«
»Wie wär’s mit: Dieses Jahr wird sicher besser als das letzte?«
»Muss. Der arme, arme Jim.« Sie legte einen Finger an den Mund und biss auf den Nagel.
»Wie auch immer. Wenn ich mal einen Moment vollkommen egoistisch sein darf – alles in allem heißt das, dass ich arbeitslos bin. Falls ich hier also rausgeschmissen werde, habe ich noch nicht mal genug Kohle, um mir eine neue Wohnung zu mieten.« Und selbst wenn – eine zu finden war sowieso sehr unwahrscheinlich. Neben all den anderen Annehmlichkeiten hatte der Krieg New York auch eine Wohnungsnot beschert.
»Es hat sich also noch nichts für dich ergeben?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein. Schlimmer kann’s nicht mehr kommen.« Der Krieg machte alles schwierig, sogar die Schauspielerei. Die Eintrittspreise waren hochgegangen, die Theater setzten die Stücke meist schneller wieder ab als im Spielplan vorgesehen, und die Rationierung hatte sowohl Tourneetheater als auch kleine Kellerbühnen, von denen unser Überleben in mageren Zeiten abhing, ins Aus getrieben. Sogar die Lichter auf dem Broadway waren der Verdunkelung zum Opfer gefallen. Ein Dauerwitz unter meinen Freundinnen war: Wenn du das Glück haben solltest, irgendwo groß rauszukommen, geh vor Sonnenuntergang zum Theater, falls du deinen Namen noch auf der Leuchttafel lesen willst.
Ich atmete tief ein und wappnete mich, um das Unaussprechliche zu äußern. »Ich glaube, ich muss langsam einsehen, dass meine Schauspielkarriere vorbei ist.«
»Jetzt mach aber mal einen Punkt.« Jayne zog einen Zettel aus der Tasche und winkte mir damit zu. »Ein Peter Sherwood hat angerufen. Er möchte, dass du zu einem Vorsprechen kommst.«
»Wofür?«
Sie schielte auf den Wisch und entzifferte ihre Hieroglyphen. »Es geht sogar um zwei Stücke. Das eine ist die Wiederaufnahme von einem Musical.«
Seit Kriegsbeginn war es schick geworden, Stücke von vor zwanzig Jahren noch einmal herauszubringen – als ob man durch die Wiederbelebung der Vergangenheit die Gegenwart in kollektiver Vergessenheit ignorieren könnte. »Und das andere?«
»Heißt offenbar Das Ghetto.«
»Oh, worum es da wohl gehen mag?« Wenn die Ensembles gerade nicht damit beschäftigt waren, den Müll der letzten beiden Dekaden wieder auszugraben, gaben sie ihr Bestes, den Krieg auf Verwertbares auszupressen. Mir gefiel keine der beiden Möglichkeiten. Ich konnte weder ein Lächeln aufbringen für Inszenierungen, die vor dem Krieg einfach die Augen verschlossen, noch genug Anteilnahme für die in mir finden, die genau das Gegenteil taten.
»Vielleicht sind es ja großartige Stücke, großartige Rollen«, sagte Jayne.
»Irgendwie habe ich da so meine Zweifel. Und wer zum Teufel ist Peter Sherwood?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Ist doch egal. Wahrscheinlich hat er dich irgendwo spielen sehen.« Eine persönliche Einladung zu einem Vorsprechen war wie ein Sechser im Lotto, aber das änderte nichts an der Tatsache, dass es hier um äußerst armselige Veranstaltungen ging. »Hast du die Kritiken zu Rubys Stück gesehen?«
»Nein, und das darf auch gern so bleiben.« Ruby Priest war die jüngste Erfolgsgeschichte unseres Hauses. Normalerweise freute ich mich über die Erfolge der anderen Schauspielerinnen, aber angesichts von Rubys Charakter wünschte man sich zwangsläufig, sie durch eine Falltür plumpsen und nie wieder auftauchen zu sehen.
Jayne lehnte sich gegen das Fenster. »Sie wird unerträglich werden.«
»Das ist sie doch sowieso schon. Aber jetzt hat sie auch noch einen Grund dafür.«
Jayne musste lachen und bekam einen Schluckauf. Nach zwei Hicksern hatte sie ihn wieder unter Kontrolle und feierte das, indem sie ihr Glas leerte. »Sei nicht sauer«, sagte sie.
»Worüber soll ich nicht sauer sein?« Ich kniff meine Augen zu Schlitzen zusammen. »War das der letzte Rest Alkohol?«
»Nein, war’s nicht.« Der Schluckauf kam zurück. Sie legte sich eine Hand auf den Mund, um ihn zu unterdrücken. »Ich habe mich bei Bentleys neuer Produktion beworben.«
»Das ist doch spitze. Du kannst dir ruhig höhere Ziele stecken als ein paar missgünstige Musical-Kritiken.« Lawrence Bentley, ein Schauspieler, der sich zum Schriftsteller gewandelt hatte, war der neue Goldjunge am Broadway. Seine Stücke waren sentimentaler Mist und vermittelten, meist wenig subtil, patriotische Botschaften oder bekräftigten zumindest ethnische und religiöse Stereotypen. Seit Pearl Harbour fraßen die Leute ihm förmlich aus der Hand. Er war derart gefragt, dass pro Abend gleich zwei seiner Stücke irgendwo aufgeführt wurden, ein jedes wetteifernd um dasselbe fantasielose Publikum.
»Danke«, sagte Jayne. »Ich weiß einfach, dass es ab jetzt für uns aufwärts geht.«
»Das hoffe ich sehr.« Ein Laut, den ich als Lachen angelegt hatte, kam als ein Quäken heraus. »Aber ich muss schon sagen, Mädchen, das mit Jim und meiner Arbeitslosigkeit … Ich glaube, so tief unten war ich noch nie.« Meine Augen brannten, als neue Tränen nach den alten Ausgängen suchten.
Jayne stand auf und stellte feierlich ihr Glas auf die Heizung. »Das reicht jetzt für heute. Zieh dich an. Wir gehen aus.«
Ich fuhr mir übers Gesicht. »Ich bin nicht in Stimmung. Ich möchte ruhig ins neue Jahr rutschen – nur ich und ein bisschen Lachsaft.«
Jayne nahm mich an den Händen und versuchte mich auf die Füße zu ziehen. »O nein, das wirst du nicht. Wenn du hier bleibst, grübelst du den ganzen Abend lang vor dich hin. So beendet man kein Jahr.«
»Ich grüble nicht. Mache ich nie.«
»Rosie.« Sie legte den Kopf auf eine Art schief, die mich sofort an sämtliche Abende erinnerte, die ich voller Selbstmitleid allein in unserem Zimmer verbracht hatte. Es war ein hartes Jahr gewesen.
Ich senkte den Blick. »Außerdem kann es ja sein, dass er heute Abend …«
»Hast du was von Jack gehört?«
Wenn mir solche Gedanken durch den Kopf gingen, kamen sie mir vernünftig und einleuchtend vor. Wenn jemand anders sie äußerte, fiel mir auf, wie dumm sie waren. Jack Castlegate – Hauptdarsteller, Liebling des Broadway und außerdem derjenige, von dem ich mal gedacht hatte, dass er den Romeo zu meiner Julia spielen würde – hatte sich direkt nach Thanksgiving verpflichtet und war an Bord gegangen. Seitdem hatte ich keinen Mucks mehr von ihm gehört. Man konnte das natürlich dem Krieg in die Schuhe schieben, wie so vieles in diesen Tagen. Auf der anderen Seite musste ich einfach zugeben, dass das Aus der Beziehung wahrscheinlicher war – immerhin hatte der Mann meinen Geburtstag, Weihnachten und jetzt auch noch Silvester verstreichen lassen, ohne mir auch nur den winzigsten Gruß per Feldpost zukommen zu lassen.
»Selbst wenn ich wollte, ich kann nicht. Ich bin blank. Mit viel Glück kann ich mir nächste Woche noch was zu essen kaufen.«
Jayne drückte meine Hand. »Das geht natürlich auf mich.«
Ich atmete tief ein und entrang mir ein Lächeln. »Na gut«, sagte ich, »ich bin dabei, aber ich darf bestimmen: Wir gehen nur dahin, wo die Getränke billig und die Bands groß sind.«
4 Die königliche Familie
Silvester war ein Riesenreinfall. Als wir loszogen, waren schon so viele Leute unterwegs, dass wir uns nur noch mit der Masse treiben lassen konnten. Am Ende standen wir zusammen mit vierhunderttausend unserer engsten Freunde auf dem Times Square. New Yorks größte Party war zwar extrem gut besucht, aber vom Krieg mundtot gemacht worden – als ob alle stillschweigend übereingekommen wären, dass Freudensbekundungen respektlos seien. Um Mitternacht wurde keine Glitzerkugel vom Mast herabgelassen, dafür streiften die Lichtfinger der Luftaufklärungsstationen durch den Nachthimmel. Die Menge schaute in schweigender Ehrfurcht zu, bis die Sängerin Lucy Monroe die Stille mit »The Star-Spangled Banner« durchbrach. Überall um uns herum tanzten, umarmten und küssten sich Soldaten und ihre Mädchen, als ob sie ein ganzes Leben in diesen einen Abend quetschen müssten. Als 1942 zu 1943 wurde, hatte sich meine Trauer darüber, Jack um Mitternacht nicht küssen zu können, in eine schreckliche Angst verwandelt, dass ich weder ihn noch sonstwen jemals wieder küssen würde.
Am nächsten Tag hätte alles ganz anders aussehen können, aber mein Kater und die Abendzeitungen verschworen sich, um das genaue Gegenteil zu bewirken. Das deutsche Radio hatte vorausgesagt, dass der Krieg mindestens zwanzig Jahre dauern würde. Das allein hätte schon gereicht, dazu war aber auch noch die Zahl der Gefallenen des letzten Jahres veröffentlicht worden – allerdings versteckt in Artikeln, die ihr ungeheuerliches Ausmaß herunterspielten, indem sie daran erinnerten, dass jährlich zehnmal so viele Menschen bei Unfällen starben.
Zwischen einer Reklame für Kriegsanleihen und der Ankündigung einer öffentlichen Auktion versteckt fand sich auch eine Traueranzeige für Jim. Sein Leben war zu einem Identitätstrio zusammengeschnurrt: Privatdetektiv, liebender Ehemann, ehemaliger Polizist.
Am 4. Januar, dem Tag der Beerdigung, hatte Jayne einen Auftrag fürs Radio, also rief ich Agnes an, um zu hören, ob sie dort ihre Aufwartung machen würde. Nach sechs Versuchen und zweiundfünfzigmal Klingelnlassen beschloss ich, ohne Damenbegleitung hinzugehen.
Die Feier für Jim fand in einem Beerdigungsinstitut in der 74. Straße, Ecke Lexington Street, statt. Die Bude war eine einzige geschmacklose Jahrhundertwendebombast-Falle und passte zu Jim so gut wie ein Tranchiermesser zu einem Kleinkind. Schwere, ausgebleichte Brokatvorhänge hingen vor grell tapezierten Wänden, die vom Zigarettenqualm aus Jahrzehnten schmierig geworden waren. Auf jeder nur möglichen Fläche standen Nippes, und auf marmornen Dekortischchen und zierlichen Blumenständern türmten sich Bouquets, deren überwältigender Geruch die Idee nahelegte, in ihnen seien mit Zerstäubern bewaffnete Zwerge verborgen.
Der Raum war voller Leute, die ich nicht kannte. Auf der einen Seite stand eine Gruppe ungemütlich dreinschauender harter Jungs, die wahrscheinlich eine innige Bekanntschaft mit Jims Feuerleiter gepflegt hatten. Die Männer trugen Nadelstreifenanzüge und Ringe am kleinen Finger, sie umarmten sich zur Begrüßung und falteten dann zum Herumstehen die Hände vor dem Genitalbereich. Die andere Seite des Raumes war von Herrschaften bevölkert, die der Seite »Vermischtes« in der Times entflohen waren. Die stark geschminkten Damen dieser Kaste begrüßten sich mit Küsschen, wobei ihre Wangen sich niemals auch nur im Ansatz berührten. Herren in Maßanzügen gaben sich gewichtig die Hand, und ihre Stimmen troffen von einer übertriebenen Emotionalität, die besser zu einem schlechten Sommertheaterstück gepasst hätte.
Ich fühlte mich keiner Gruppe zugehörig und heuchelte deswegen Interesse an einer Broschüre, um heimlich den Gesprächen lauschen zu können. Der kleine Prospekt machte mich darauf aufmerksam, dass man als Soldat oder als Verwandte eines Soldaten »nie weiß, wann mit schlechten Nachrichten zu rechnen ist. Deswegen: Seien Sie vorbereitet und kaufen Sie eine Grabstelle.«
Die Mafiosi redeten nicht viel, und wenn doch, taten sie es in einem engen Kreis und mit so gedämpften Stimmen, dass man nichts verstehen konnte. Ab und an tauchten sie zum Luftholen auf und ließen Bemerkungen über die schönen Blumen oder die rege Beteiligung fallen – vermutlich in der Hoffnung, durch solcherlei unverfängliche Beobachtungen erscheine ihre Anwesenheit so normal wie die der Leiche. Als ich meine Abhörversuche gerade aufgegeben hatte, packte ein Gentleman, dessen übertriebene Schmuckausstattung ihn als den Anführer kennzeichnete, einen Gangster niedrigeren Ranges am Arm und führte ihn für eine Privatunterhaltung beunruhigend nah in meine Richtung.
»Haben wir veranlasst, dass im Büro saubergemacht wird?«, fragte der Boss. Als ich seine Stimme hörte, klingelte es bei mir – der Lispler!
»Ist wohl nicht notwendig. Man hat mir versichert, dass keine Namen benutzt wurden.«
Der Lispler legte dem anderen den Arm um die Schultern. »Er war ein guter Kerl, und wir haben uns sehr nah gestanden, aber jeder hat so seine Fehler. Wir müssen sichergehen, dass hier keine gemacht worden sind.«
Der Gangster zupfte an seinen Manschetten und nickte.
Der Lispler sah aus, als wolle er noch mehr sagen, aber dann zog ein Braunhaariger mit kleinen engstehenden Augen seine Aufmerksamkeit auf sich. Wortlos blickte der Braune zu mir. Daraufhin rückte der Lispler die Krawatte gerade und lächelte mich wissend an.
»Wie geht’s denn so?«, fragte er mich.
Ich bemühte mich, ob des Angesprochenwerdens überrascht dreinzuschauen; hätte ich ihn vorher nicht so angestarrt, hätte er mir das auch sicher abgekauft. »Ganz prima«, sagte ich mit einem schmalen Lächeln.
Der Lispler nickte und ging mit seinem Kumpel zurück zum Rest der Gruppe.
Während sich die Kleinganoven um Diskretion bemühten, redeten die Abgesandten der besseren Gesellschaft laut durcheinander, mal über Roosevelts Außenpolitik, mal über die Auswirkungen des Krieges auf die Wirtschaft und ihre Urlaubspläne. Die etwas Mutigeren warfen Blicke in die andere Zimmerecke und machten säuerliche Bemerkungen über die Anwesenheit »dieser Leute«. Jims Name fiel selten – und wenn, dann nur, weil man sich schnell vergewissern wollte, wie der Verstorbene doch gleich geheißen hatte.
Offenbar hatte keiner von ihnen Jim gekannt. Seine Frau aber kannten alle. Bei meinem Telefonat mit Mrs. McCain waren mir für sie die schillernden Adjektive gleich dutzendfach eingefallen – ihre Freunde kannten nur ein Wort: anspruchsberechtigt. Jims bessere Hälfte hatte wohl die Taschen voller Geld und so viele potentielle Nachfolger für ihn, dass sie eine eigene Unterabteilung der Armee hätte aufmachen können.
Die Frage war nur: Warum hatte eine Frau wie sie einen Mann wie Jim geheiratet?
Ich reihte mich in die Warteschlange vor dem Sarg ein und beschloss, meine Zeit gut zu nutzen. Vor mir stand ein Mann in einem Kammgarnanzug. Er war ungefähr sechzig, fast kahl und hatte ein auffälliges Feuermal auf der Stirn, dort, wo eigentlich der Haaransatz gewesen wäre. Dieser Schönheitsfehler unterschied ihn vom Rest der Anwesenden, und wahrscheinlich musste er trotz einer privilegierten gesellschaftlichen Stellung ständig darum kämpfen, von einer Welt akzeptiert zu werden, die rechtmäßig die seine war. Sicher sehnte er sich verzweifelt danach, dass jemand ihn im Gespräch als seinesgleichen behandelte.
»Guten Tag«, sagte ich in meinem besten Katharine-Hepburn-Tonfall. »Was für ein tragischer Verlust, nicht wahr?«
Er musterte mich lange und kam zu dem Schluss, dass er mich zwar nicht kannte, ich aber vielleicht trotzdem jemand war. »Guten Tag.« Er gab mir die Hand. »Woher kennen Sie Eloise?«
»Aus dem Verein. Und Sie?«
»Aus dem Club.«
Ich nickte wissend. »Es ist reizend, dass sie so viel Unterstützung bekommt.«
»Ja, ja«, pflichtete er mir bei.
Ich beugte mich zu ihm und senkte die Stimme. »Es hat mich einigermaßen überrascht zu erfahren, dass ihr Mann Privatdetektiv war.«
Mein Begleiter kam mir entgegen und gab bereitwillig sein Wissen preis: »So ist es uns wohl allen gegangen. Sie hat ihn niemandem gegenüber je erwähnt.«
»Was denken Sie, warum nicht?«
»Aus Scham natürlich. Eine Fitzgerald sollte sich nicht mit Gesindel einlassen.«
Ich überspielte meine Überraschung mit einem Husten. Cromwell Fitzgerald war einer der größten Stahlunternehmer der Ostküste. Die industrielle Revolution hatte seiner Familie einen Geldsegen in der Liga der Rockefellers und Vanderbilts beschert.
Zumindest hatte man mir das in der Grundschule so beigebracht.
Ich blickte meinem Gegenüber in die Augen. »Aber Eloise hat das Gesindel ja immerhin geheiratet. Warum tut man sich das an, nur um den Ehemann dann so lange zu verstecken, bis er tot ist?«
Er kam so nah, dass ich seine Nasenhaare sehen konnte. »Das, meine Liebe, ist die Eine-Million-Dollar-Frage. Vielleicht hätte sie einen weiteren Skandal nicht überstanden.«
Ich lüpfte eine Augenbraue. »Einen weiteren?«
Er musterte mich von Kopf bis Fuß. »Nun ja, Sie sind jung. Wahrscheinlich ist das alles noch vor Ihrer Geburt passiert.« Er kaute an seinen nächsten Worten wie an einem neuen Gebiss. »Das hier ist nicht der erste … Verlust für Eloise. Es war so unglaublich tragisch, besonders als die Anschuldigungen laut wurden. Natürlich ist Eloise vor Gericht von sämtlichen Anklagepunkten freigesprochen worden, aber so ganz ist die Sache wohl leider noch nicht aus dem allgemeinen Gedächtnis verschwunden.«
Die Leiche wartete auf die nächste Trauerbekundung. »Sie entschuldigen mich.«
Er bezog am Sarg Stellung und schaute heimlich auf seine Taschenuhr – es musste schon eine angemessene Zeit verstrichen sein, bevor man weitergehen durfte. Nach ihm nahm ich den Platz auf dem Betstuhl ein und starrte auf den Leichnam. Der tote Jim sah überhaupt nicht aus wie der lebendige. Seinem Anzug fehlten die verräterischen Falten und seinem Mund die Zigarre, an seinem Finger steckte ein glänzender Goldring, den ich schon länger an eines seiner allwöchentlichen Pokerspiele verloren geglaubt hatte. Besonders verstörend fand ich seinen Kopf: Jim ohne Filzhut sah aus wie Jim ohne Arm.
Ich schloss die Augen und betete, dass sein Ende schnell und sein Leben, allem Anschein zum Trotz, ein glückliches gewesen sein möge. Dann bekreuzigte ich mich, stand auf und suchte schon im Gehen in meiner Handtasche nach einem Trinkgeld für das Mädchen an der Garderobe.
»Sie sind sicher Rosie. Ich bin Eloise McCain.« Eine Porzellanpuppe in einem schwarzen Haute-Couture-Kostüm und einem Hut, der wie ein Vogel im Flug aussah, stellte sich mir den Weg und hielt mir die Hand hin. »Sehr freundlich von Ihnen, ihm die letzte Ehre zu erweisen.«
»Das war das Mindeste, was ich tun konnte.« Sie wirkte unnatürlich leicht und erinnerte mich an Puppenmöbel aus Balsaholz.
Ihre großen blauen Augen musterten mich durch das schwarze Netz ihres Hutschleiers. »Es war so nett von Ihnen, dass Sie mich angerufen haben.«
In ihrer Stimme lag eine künstliche Süße, die ihre Aufrichtigkeit fragwürdig erscheinen ließ. Jedes ihrer Worte hatte etwas Doppelzüngiges.
»Ich an Ihrer Stelle hätte es auch lieber so erfahren.« Ich konnte nicht anders, als sie anzustarren: Unter ihrem Hut türmte sich widerspenstiges rotes Haar wie ein Wirbelsturm zu einer Tolle. Sie reichte mir zwar nur bis ans Kinn, aber mit ihrer Ausstrahlung gab sie mir das Gefühl, zu ihr aufblicken zu müssen.
Sie ließ meine Hand los und streckte ihren Arm anmutig nach hinten aus. »Das ist mein Sohn Edgar.« Ein Mann in Marineuniform und mit einem Blick, der alles und jeden als Beute zu betrachten schien, tauchte auf und warf einen Schatten über seine Mutter. Er reichte mir eine Pranke, die mich an die Stahlgreifer erinnerte, mit denen man auf Jahrmärkten nach Plüschtieren angelt.
»Freut mich, Sie kennenzulernen«, sagte ich. »Jim hat immer nur Gutes über Sie erzählt. Über Sie beide.« Ich unterstrich meine Lüge mit einem Hüsteln und zählte im Geiste die Schritte bis zum Ausgang.
Edgar gab meine Hand frei und musterte mich kritisch. »Wie gut kannten Sie ihn?«
Ich war mir nicht sicher, ob diese Frage unverfänglich war oder schon einen Vorwurf enthielt, entschied mich aber für ersteres. Im Zweifel für den Angeklagten. »Ich habe nur ein paar Monate für ihn gearbeitet. Er war ein toller Mensch, fand ich.«
Die Befragung ging weiter. »Sind Sie verheiratet?«
Ich trat von einem Fuß auf den anderen und überlegte, wie ich mich am höflichsten verabschieden konnte. »Nein.«
Edgar hob eine Augenbraue. »Haben Sie mit ihm zusammengelebt?«
»Edgar!« Eloise schaute sich blitzschnell um, ob jemand mitgehört hatte.
»Das ist eine durchaus berechtigte Frage, Mutter. Wir wissen von Jims Liebeleien, und sie ist definitiv sein Typ.« Er sprach »Typ« so aus, dass es klang wie »billig«. Auf meine Schuhe mochte diese Beschreibung zutreffen – als Charakterisierung meiner Person konnte ich das so nicht hinnehmen.
Ich fasste ihn am Handgelenk und zog ihn zu mir her. »Sie haben wohl Ihre Manieren vergessen, Matrose. Dafür entschuldigen Sie sich gefälligst, eher bin ich hier nicht weg.«
Erst sah er überrascht aus, dann belustigt. Augenscheinlich machte ich keine sehr bedrohliche Figur. »Es gibt nichts, wofür ich mich entschuldigen müsste«, sagte er.
»Dann sind Sie offenbar taub, denn ich habe gerade eine grobe Beleidigung gehört. Soll Mutters kompletter Verein das mitbekommen, oder kriegen wir das auch unter uns geregelt?«
Er kämpfte gegen ein Grinsen. »Es tut mir leid, falls ich mich in Ihnen getäuscht habe.«
Ich schluckte das »falls« herunter und ließ ihn los. Gerade wollte ich mich abwenden, als er mich am Ellbogen zu fassen bekam. Er schob sich nah heran, bis seine Stimme nur noch ein Kitzeln an meinem Ohr war.
»Wissen Sie, Rosie – ich wollte Ihnen lediglich entgegenkommen. Denn was wäre einem Mädchen wie Ihnen wohl lieber: eine Hure sein oder eine alte Jungfer?« Die vier golden gestreiften Rangabzeichen blinkten mir von seinem blauen Ärmelaufschlag entgegen.
Ich riss mich los und griff ins Revers seiner Uniform. Wieder zog ich ihn so nah zu mir heran, dass ich ihn hätte küssen können. »Hören Sie, Edgar, ich bin gerade mal zweiundzwanzig, aber das wird mich nicht daran hindern, bei Ihnen gleich ganz unsanft die Notbremse zu ziehen. Ihr Papa war mein Chef und mein Freund. Wenn Sie auf der Suche sind nach seinen Geliebten, sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Ich bin hierhergekommen, um mich von ihm zu verabschieden, und nicht, um mich beleidigen zu lassen.«
Ich ließ ihn so plötzlich los, dass er fast das Gleichgewicht verlor. Bevor er wieder nach mir greifen konnte, hatte ich mich schon durch die Menge geschlagen und ging zur Garderobe.