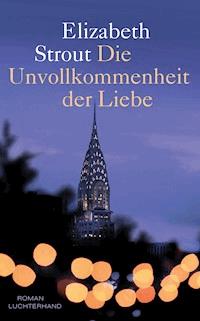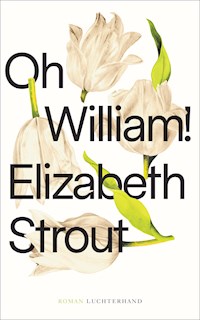Sie kann manchmal eine rechte Nervensäge sein: Olive
Kitteridge, eine pensionierte Mathelehrerin, hat zu allem, was in
Crosby geschieht, eine dezidierte Meinung. Sie kann stur und
boshaft sein, dann wieder witzig, manchmal sogar eine Seele
von Mensch. Auf jeden Fall kommt in Crosby, der kleinen Stadt
an der Küste von Maine, keiner an ihr vorbei: die schrille
Barpianistin, die insgeheim einer verlorene Liebe nachtrauert,
ein ehemaliger Schüler, der nicht zum Familienbesuch in seine
Heimat zurückkehrt, Olives Sohn, der sich von ihren
Empfindlichkeiten bevormundet fühlt, ihr Mann Henry, der
die Ehe mit ihr nicht nur als Segen, sondern auch als Fluch
empfindet. Und während sich die Menschen in Crosby mit
ihrem ganz normalen Leben herumschlagen, den Problemen
wie den Freuden, lernt Olive auf ihre alten Tage, das Leben
zu lieben. Elizabeth Strouts Roman erzählt von Liebe und
Kummer, von Toleranz und Wut. Mit Blick aufs Meer ist ein
weises und anrührendes Buch über die Natur des Menschen
in all seiner Verletzlichkeit und Stärke, gnadenlos ehrlich
und unglaublich schön.
Elizabeth Strout, geboren 1956 in Portland, Maine, wuchs
in Kleinstädten in Maine und New Hampshire auf. Nach dem
Jurastudium begann sie zu schreiben. Ihr erster Roman Amy
und Isabelle wurde für die Shortlist des Orange Prize und den
PEN/Faulkner Award nominiert, für Mit Blick aufs Meer bekam
sie 2009 den Pulitzerpreis, Die Unvollkommenheit der Liebe
kam auf die Longlist des Man Bo0ker Prize 2016.
Elizabeth Strout lebt in Maine und in New York City.
Elizabeth Strout
Mit Blick aufs Meer
Roman
Aus dem Amerikanischen von Sabine Roth
btb
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel Olive Kitteridge bei Random House, New York.
Copyright © der Originalausgabe 2008 Elizabeth Strout
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2010 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Diese Übersetzung wurde veröffentlicht in Absprache mit Random House, einem Imprint von Penguin Random House LLC
Umschlaggestaltung: semper smile
ISBN 978-3-641-04072-7V008
www.btb-verlag.de
Bitte besuchen Sie auch unseren LiteraturBlog www.transatlantik.de.
Für meine Mutter,die beste Geschichtenerzählerin,die ich kenne
Apotheke
Viele Jahre lang war Henry Kitteridge Apotheker in der nahegelegenen Stadt und fuhr die Strecke jeden Morgen, über verschneite Straßen oder regennasse Straßen oder sommerliche Straßen, deren Ränder bis zu den Ausläufern der Stadt zugewuchert waren von den neuen Trieben der wilden Himbeeren, ehe er in die breitere Straße zur Apotheke einbog. Jetzt, im Ruhestand, wacht er immer noch früh auf und erinnert sich, wie lieb ihm diese Morgen waren, wenn die Welt sich anfühlte wie sein Geheimnis: Die Reifen schnurrten so sanft unter ihm, und das Licht brach durch den Frühnebel, und zu seiner Rechten blitzte kurz die Bucht auf, dann die Kiefern, hoch und schlank, und fast immer hatte er das Fenster einen Spalt offen, weil er den Kiefernduft liebte und die schwere Salzluft, und im Winter liebte er den Geruch der Kälte.
Die Apotheke war ein kleiner zweigeschossiger Bau, Wand an Wand mit dem Nachbarhaus, in dem ein Heimwerkermarkt und ein kleines Lebensmittelgeschäft untergebracht waren. Jeden Morgen parkte Henry hinterm Haus bei den großen metallenen Müllcontainern, und dann betrat er die Apotheke durch die Hintertür und schaltete drinnen die Lichter an, drehte den Thermostat hoch oder setzte, wenn es Sommer war, den Ventilator in Gang. Er öffnete den Tresor, legte Geld in die Kasse, schloss die Ladentür auf, wusch sich die Hände, zog seinen weißen Kittel über. Das Ritual hatte etwas Wohltuendes, fast als wäre der alte Laden mit seinen Regalen voll Zahnpastatuben, Vitaminpräparaten, Kosmetikartikeln und Haarspangen, seinen Nähnadeln, Grußkarten, roten Gummiwärmflaschen und Einlaufpumpen ein Freund, ein in sich ruhender, verlässlicher Freund. Und alles Unerfreuliche, das zu Hause vorgefallen sein mochte, alle Beklommenheit, weil seine Frau wieder einmal mitten in der Nacht aus dem Bett aufgestanden und durch das dunkle Haus gewandert war – all das blieb zurück wie ein fernes Ufer, wenn er in der Sicherheit seiner Apotheke herumging. Hinter der Theke, bei seinen Schubladen und Pillenreihen, war Henry ein fröhlicher Mensch. Gut gelaunt ging er ans Telefon, gut gelaunt händigte er Mrs. Merriman ihr Blutdruckmittel aus und dem alten Cliff Mott sein Digitalis, gut gelaunt füllte er das Valium für Rachel Jones ab, die in der Nacht, in der ihr Kind zur Welt kam, von ihrem Mann verlassen worden war. Henry war einer, der zuhörte, und viele Male die Woche sagte er: »Ach je, das tut mir aber leid«, oder: »Ist denn das zu fassen?«
Insgeheim wirkten in ihm noch die Ängste nach, die er als Kind bei den beiden Nervenzusammenbrüchen seiner Mutter ausgestanden hatte – einer Mutter, von der er ansonsten furios umsorgt worden war. Wenn also, was selten vorkam, ein Kunde einen Preis überteuert oder die Qualität einer elastischen Binde oder eines Eisbeutels ungenügend fand, versuchte Henry möglichst rasch zu vermitteln. Viele Jahre hindurch arbeitete Mrs. Granger für ihn; ihr Mann war Hummerfischer, und sie hatte etwas von einer kalten Meeresbrise an sich. Beflissenheit gegenüber verstimmten Kunden war ihr fremd. Er musste, während er seine Rezepte bearbeitete, immer mit halbem Ohr lauschen, ob sie nicht gerade an der Kasse eine Beschwerde abwimmelte. Es war ein ganz ähnliches Gefühl, wie wenn er daheim achtzugeben versuchte, dass Olive, seine Frau, Christopher nicht zu hart anfasste, wenn er bei den Hausaufgaben geschlampt oder sonst eine Pflicht versäumt hatte – diese stetig angespannte Aufmerksamkeit, dieser Drang, alle zufrieden zu wissen. Sobald ihm Mrs. Grangers Stimme schroff vorkam, stieg er herab von seinem Podest an der Rückwand und ging nach vorn, um selbst mit dem Kunden zu reden. Davon abgesehen leistete Mrs. Granger gute Arbeit. Er schätzte an ihr, dass sie nicht geschwätzig war, fehlerfreie Bestandslisten führte und sich kaum krank meldete. Dass sie eines Nachts im Schlaf starb, überraschte ihn und erfüllte ihn mit leisem Schuldbewusstsein, als wäre ihm in all den Jahren Seite an Seite mit ihr das entscheidende Symptom entgangen, das er mit seinen Pillen und Säften und Spritzen vielleicht hätte heilen können.
»Ein Mäuschen«, sagte seine Frau, als er das neue Mädchen einstellte. »Eine richtig graue Maus.«
Denise Thibodeau hatte runde Backen und kleine Äuglein, die durch ihre braun eingefassten Brillengläser spitzten. »Aber eine nette graue Maus«, sagte Henry. »Eine niedliche Maus.«
»Niemand ist niedlich, der sich so miserabel hält«, sagte Olive. Es stimmte, Denises schmale Schultern hingen vornüber, als wollte sie Abbitte für etwas leisten. Sie war zweiundzwanzig und hatte gerade ihren Abschluss an der Staatlichen Universität in Vermont gemacht. Ihr Mann hieß auch Henry, und als Henry Kitteridge Henry Thibodeau kennenlernte, empfand er etwas Strahlendes an ihm, das ihn fesselte. Der junge Mann war kräftig, mit grobknochigem Gesicht und einem Leuchten in den Augen, das seine schlichte, anständige Erscheinung aus der Durchschnittlichkeit heraushob. Er war Klempner und arbeitete im Betrieb seines Onkels. Denise und er waren seit einem Jahr verheiratet.
»Sonst noch Wünsche«, sagte Olive, als er vorschlug, sie sollten das junge Paar zum Essen einladen. Henry ließ das Thema fallen. Dies war die Zeit, als sein Sohn, auch wenn man ihm die Pubertät äußerlich noch nicht ansah, in eine plötzliche, aggressive Muffigkeit verfiel, die die Stimmung im ganzen Haus vergiftete; Olive wirkte genauso verändert und unstet wie Christopher, und die beiden fochten schnelle, wilde Kämpfe aus, die ebenso schnell in eine stumme, enge Vertrautheit umschlagen konnten, während Henry, ratlos und verdutzt, dastand und nichts begriff.
Aber als er sich an einem Spätsommerabend, als die Sonne schon hinter den Fichten unterging, auf dem Parkplatz noch mit den Thibodeaus unterhielt, befiel Henry Kitteridge eine solche Sehnsucht nach der Gesellschaft dieser jungen Leute, die ihn mit einem so zurückhaltenden und doch eifrigen Interesse ansahen, während er von seiner eigenen fernen Studienzeit sprach, dass er sagte: »Ach, übrigens, Olive und ich würden euch demnächst gern zu uns zum Essen einladen.«
Er fuhr heim, vorbei an den hohen Kiefern und der aufblitzenden Bucht, und dachte an die Thibodeaus, die in die entgegengesetzte Richtung fuhren, zu ihrem Trailer am Stadtrand. Er stellte sich das Trailerinnere vor, gemütlich und aufgeräumt – denn Denise hatte eine reinliche Art -, stellte sich vor, wie sie einander von ihrem Tag erzählten. Denise sagte vielleicht: »Er ist wirklich ein netter Chef.« Und Henry antwortete: »Also, ich mag ihn richtig gern.«
Er bog in seine Einfahrt ein, die im Grunde nur eine Grasfläche oben am Hang war, und sah Olive im Garten. »Hallo, Olive«, sagte er und ging zu ihr. Er wollte die Arme um sie legen, aber eine Dunkelheit schien neben ihr zu stehen wie ein Bekannter, der das Feld nicht räumen will. Er sagte ihr, dass die Thibodeaus zum Essen kommen würden. »Das gehört sich einfach«, sagte er.
Olive wischte sich den Schweiß von der Oberlippe, wandte sich ab und riss ein Büschel Glatthafer aus. »Dann wär das ja auch geklärt, Mr. President«, sagte sie. »Sag schon mal dem Koch Bescheid.«
Am Freitagabend folgte das Paar ihm nach Hause, und der junge Henry schüttelte Olive die Hand. »Schönes Haus haben Sie hier«, sagte er. »Und dieser tolle Meerblick! Mr. Kitteridge sagt, Sie haben es selber gebaut.«
»Ja, haben wir.«
Christopher saß seitlich auf seinem Stuhl, hingefläzt in pubertärer Wurstigkeit, und antwortete nicht, als Henry Thibodeau ihn fragte, ob er in der Schule irgendwelchen Sport trieb. Henry Kitteridge spürte eine unerwartete Wut in sich aufsteigen und hätte den Jungen am liebsten angebrüllt; in seinen schlechten Manieren schien ihm etwas Hässliches zutage zu treten, das im Hause Kitteridge nichts verloren hatte.
»Wenn man in einer Apotheke arbeitet«, sagte Olive zu Denise, als sie einen Teller mit Baked Beans vor sie hinstellte, »kriegt man die Geheimnisse der ganzen Stadt mit.« Sie setzte sich ihr gegenüber, schob ihr die Ketchupflasche hin. »Da muss man den Mund halten können. Aber das können Sie ja, wie es scheint.«
»Denise macht das alles genau richtig«, sagte Henry Kitteridge.
Denises Mann sagte: »Und ob. Wenn Sie sich auf jemand verlassen können, dann auf Denise.«
»Das glaube ich Ihnen«, sagte Henry und reichte ihm den Korb mit den Brötchen. »Und bitte, sagen Sie doch Henry zu mir. Einer meiner Lieblingsnamen«, fügte er hinzu. Denise lachte leise; sie mochte ihn, das konnte er sehen.
Christopher lümmelte sich noch tiefer in seinen Stuhl. Henry Thibodeaus Eltern hatten eine Farm ein Stück landeinwärts, und so fachsimpelten die beiden Henrys über Getreide und Stangenbohnen und über den Mais, der dieses Jahr wegen der Dürre nicht so süß war wie sonst, und darüber, wie man ein gutes Spargelbeet anlegt.
»Sag mal, muss das sein«, sagte Olive, als Henry Kitteridge dem jungen Mann die Ketchupflasche reichte und sie dabei umstieß, so dass die Sauce wie angedicktes Blut auf den Eichentisch schwappte. Er wollte sie aufheben, bekam sie aber nicht richtig zu fassen, und Ketchup landete auf seinen Fingern und dann auf seinem weißen Hemd.
»Lass mich das machen«, befahl Olive und stand auf. »Lass es einfach mich machen. Herrgott noch mal, Henry.« Und Henry Thibodeau – vielleicht weil er in so scharfem Ton seinen Namen hörte – setzte sich gerade hin und schaute schuldbewusst drein.
»Ach je, was bin ich ungeschickt«, sagte Henry Kitteridge.
Zum Nachtisch bekam jeder ein blaues Schälchen in die Hand gedrückt, in dem eine Kugel Vanilleeis herumrutschte. »Vanille mag ich am liebsten«, sagte Denise.
»So ein Glück aber auch«, sagte Olive.
»Genau wie ich«, sagte Henry Kitteridge.
Als der Herbst kam und es morgens später hell wurde und die Apotheke nur einen schmalen Keil Sonnenlicht abbekam, bevor die Sonne über das Haus davonwanderte und der Laden nur noch von den Deckenlampen erhellt wurde, befüllte Henry auf seinem Podest an der Rückwand die kleinen Plastikfläschchen und ging ans Telefon, während Denise vorn bei der Kasse die Stellung hielt. Mittags packte sie das belegte Brot aus, das sie sich von zu Hause mitbrachte, und aß es hinten im Lager, und danach holte er sein Mittagessen heraus, und manchmal, wenn niemand im Laden war, besorgten sie sich noch einen Kaffee im Lebensmittelgeschäft nebenan. Denise schien von Natur aus still, aber sie neigte zu plötzlichen Ausbrüchen von Mitteilsamkeit. »Meine Mutter hat seit vielen Jahren MS, wissen Sie, deshalb mussten wir alle schon sehr früh mit anpacken. Meine Brüder sind alle drei vollkommen unterschiedlich. Finden Sie es nicht auch seltsam, wenn das so kommt?« Der älteste Bruder, erzählte Denise, während sie eine Shampooflasche gerade rückte, sei der Liebling ihres Vaters gewesen, bis er ein Mädchen heiratete, das der Vater nicht leiden konnte. Sie selbst habe wunderbare Schwiegereltern, sagte sie. Sie habe einen Freund vor Henry gehabt, der Protestant war, und seine Eltern hätten sie längst nicht so nett behandelt. »Es hätte nie funktioniert«, sagte sie und strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr.
»Ja, Henry ist ein fabelhafter junger Mann«, antwortete Henry.
Sie nickte und lächelte hinter ihrer Brille wie eine Dreizehnjährige. Wieder stellte er sich den Trailer vor, sah die zwei vor sich, wie sie sich darin balgten wie übergroße Welpen; er hätte nicht zu sagen vermocht, warum ihn bei dem Gedanken ein solches Glücksgefühl durchströmte, wie flüssiges Gold kam es ihm vor.
Sie war so tüchtig wie Mrs. Granger, aber lockerer. »Im zweiten Gang, gleich unter den Vitaminen«, sagte sie einer Kundin. »Hier, ich zeig’s Ihnen.« Einmal erzählte sie Henry, dass sie die Leute manchmal ein wenig herumspazieren lasse, bevor sie sie fragte, ob sie ihnen helfen könne. »Auf diese Weise stolpern sie vielleicht über das eine oder andere, das sie auch noch brauchen können. Und dann steigt Ihr Umsatz.« Die Wintersonne spannte ein Trapez über das Regal mit den Kosmetikprodukten; ein Bodenstreifen leuchtete wie Honig.
Er zog beifällig die Brauen hoch. »Das war ein Glückstag für mich, Denise, als Sie durch diese Tür gekommen sind.« Sie schob mit dem Handrücken die Brille höher und fuhr mit dem Staubwedel über die Salbentiegel.
Jerry McCarthy, der Junge, der einmal die Woche – bei Bedarf öfter – die Arzneimittel aus Portland anlieferte, machte gelegentlich auch im Lager Pause. Er war achtzehn und frisch mit der High School fertig, ein großer dicker Junge mit einem glatten Gesicht, der ganze Teile seines Hemds durchschwitzte, manchmal bis über seine Schwabbelbrüste hinab, so dass es aussah, als gäbe der arme Kerl Milch. Auf einer Holzkiste hockend, die dicken Knie fast auf Ohrenhöhe, futterte er Sandwiches, aus denen mayonnaisetriefende Brocken von Eiersalat oder Thunfisch entwischten und auf seinem Hemd landeten.
Ab und zu bekam Henry mit, wie Denise ihm eine Papierserviette hinstreckte. »Das passiert mir auch ständig«, hörte er sie eines Tages sagen. »Sobald ich ein Sandwich zu essen versuche, auf dem nicht nur Aufschnitt ist, bekleckere ich mich von oben bis unten.« Es konnte unmöglich stimmen. Blitzgescheit war sie vielleicht nicht, aber auf jeden Fall blitzsauber.
»Guten Tag«, sagte sie, wenn das Telefon klingelte. »Hier ist die Stadtapotheke. Was kann ich für Sie tun?« Wie ein kleines Mädchen, das erwachsen spielt.
Und dann, eines Montagmorgens, als es schneidend kalt in der Apotheke war, schloss er den Laden auf und fragte: »Wie war das Wochenende, Denise?« Olive hatte sich tags zuvor geweigert, mit in die Kirche zu kommen, und gegen seine Gewohnheit war Henry heftig geworden. »Ist das zu viel verlangt?«, hatte er sich sagen hören, als er in der Unterhose in der Küche stand und seine Hosen bügelte, »dass die eigene Frau einen in die Kirche begleitet?« Ohne sie zu gehen schien ihm wie ein öffentliches Eingeständnis familiärer Zerrüttung.
»Und ob das zu viel verlangt ist!«, hatte ihm Olive förmlich entgegengespuckt und ihrem Groll freien Lauf gelassen. »Hast du eine Ahnung, wie saumäßig müde ich bin! Den ganzen Tag unterrichten und in schwachsinnigen Konferenzen sitzen, wo einem dieser Drecksdirektor den letzten Nerv raubt, dann Einkaufen, Kochen, Bügeln, Wäschewaschen, mit Christopher Hausaufgaben machen! Und du …« Sie hielt die Lehne eines Esszimmerstuhls gepackt, und ihr dunkles Haar, noch ungekämmt und von der Nacht ganz verdrückt, fiel ihr in die Augen. »Du, Mr. Oberdiakon Friede-Freude-Eierkuchen-Daherfasler, erwartest von mir, dass ich meinen Sonntagvormittag opfere, um mit einem Haufen Vollidioten herumzuhocken!« Unvermittelt setzte sie sich auf dem Stuhl nieder. »Ich hab’s ganz einfach satt«, sagte sie mit ruhiger Stimme. »Es steht mir bis hier.«
Eine Schwärze zog durch sein Inneres, etwas Erstickendes. Am nächsten Morgen sagte Olive beiläufig: »Jims Auto hat letzte Woche gerochen, als hätte sich jemand darin übergeben. Hoffentlich hat er’s saubergemacht.« Jim O’Casey war ein Kollege von Olive und nahm sowohl sie als auch Christopher seit Jahren mit zur Schule.
»Hoffentlich«, sagte Henry, und auf diese Weise wurde ihr Streit beigelegt.
»Oh, ich hatte ein ganz wunderbares Wochenende«, sagte Denise, und ihre Äuglein hinter den Brillengläsern blickten ihn mit einem so kindlichen Eifer an, dass es ihm schier das Herz brach. »Wir sind zu Henrys Eltern gefahren und haben nachts Kartoffeln geerntet. Henry hat die Scheinwerfer eingeschaltet, und wir haben nach Kartoffeln gegraben. In diesem eiskalten Boden die Kartoffeln zu finden – wie Ostereiersuchen war das!«
Er hörte auf, den Karton mit dem Penicillin auszupacken, und stieg die Stufe hinunter, bevor er antwortete. Außer ihnen beiden war noch niemand im Laden, und unter dem Schaufenster zischte der Heizkörper. »Das hat sicher Spaß gemacht, Denise«, sagte er.
Sie nickte und strich über das Regal mit den Vitaminen gleich neben ihr. Über ihr Gesicht huschte ein Anflug von Furcht. »Mir ist kalt geworden, und ich hab mich ins Auto gesetzt und Henry beim Graben zugeschaut, und ich habe gedacht, es ist zu schön, um wahr zu sein.«
Was gab es in ihrem jungen Leben, das sie so misstrauisch gegen das Glück gemacht hatte? Die Krankheit ihrer Mutter? Laut sagte er: »Kosten Sie’s nur aus, Denise. Sie haben noch viele glückliche Jahre vor sich.« Oder, dachte er, während er sich wieder seinen Kartons zuwandte, oder es hatte mit ihrem Glauben zu tun – dem ständigen schlechten Gewissen der Katholiken.
Das Jahr, das dem folgte – war es das glücklichste in seinem Leben? Er dachte das oft, auch wenn es ihm selber töricht vorkam, eine derartige Einstufung vorzunehmen; aber in seiner Erinnerung war dieses besondere Jahr durchtränkt von einem wohligen Gefühl der Zeitlosigkeit, und wenn er in die Apotheke fuhr, durch frühmorgendliches Winterdunkel und dann später durch die zunehmende Helle eines Frühlings, vor dem sich prall der Sommer auftat, waren es die harmlosen kleinen Freuden seines Arbeitstages, von denen sein Herz so zum Überfließen voll schien. Wenn Henry Thibodeau in den gekiesten Hof einbog, ging Henry Kitteridge oft zur Tür, um sie für Denise aufzuhalten, und dabei rief er: »Morgen, Henry«, und Henry Thibodeau streckte den Kopf zum offenen Fahrerfenster heraus und rief zurück: »Morgen, Henry«, mit einem breiten Grinsen auf seinem anständigen, freundlichen Gesicht. Manchmal war es auch nur ein Salut: »Henry!« Und der andere Henry ebenfalls: »Henry!« Es war ein Spiel, an dem sie beide gleich viel Spaß hatten, und Denise, sachte zwischen ihnen hin und her geworfen wie ein Football, huschte schnell in den Laden.
Ihre Hände, die aus den Fäustlingen zum Vorschein kamen, wirkten so dünn wie die eines Kindes; sobald sie aber die Tasten der Kasse drückten oder etwas in ein weißes Tütchen packten, bewegten sie sich mit der ganzen Anmut von Frauenhänden – Händen, so dachte Henry, die zärtlich den Körper ihres Mannes berührten und die eines Tages mit ruhiger, fraulicher Kompetenz eine Windel wechseln, über eine fiebrige Stirn streichen oder ein Geschenk von der Zahnfee unter ein Kopfkissen stecken würden.
Wenn er sie sah, wie sie sich die Brille höher auf die Nase schob und den Kopf über die Inventarliste beugte, dachte Henry bei sich, das ist das Rückgrat Amerikas, denn dies war die Zeit, als gerade die Hippies aufkamen, und wenn er in der Newsweek von Marihuana und »freier Liebe« las, befiel ihn manchmal ein Unbehagen, das ein Blick auf Denise beschwichtigen konnte. »Wir gehen unter wie das alte Rom«, verkündete Olive triumphierend. »Amerika ist ein riesiger stinkender Käse.« Aber Henry hielt fest an seinem Glauben, dass die Mäßigkeit den Sieg davontragen würde, und in der Apotheke verrichtete er seine tägliche Arbeit an der Seite eines Mädchens, das nur den einen Traum hatte, eines Tages mit ihrem Mann eine Familie zu gründen. »Emanzipation ist nichts für mich«, erklärte sie Henry. »Ich will ein Haus haben und Betten machen.« Gut, wenn er eine Tochter gehabt hätte (und wie gern hätte er eine Tochter gehabt!), dann hätte er Bedenken angemeldet. Er hätte gesagt: In Ordnung, mach Betten, aber sieh zu, dass du trotzdem noch deinen Kopf benutzt. Aber Denise war nicht seine Tochter, und so sagte er ihr, Hausfrau und Mutter zu sein sei mit die vornehmste Bestimmung überhaupt – und empfand undeutlich, wie befreiend es war, einen Menschen zu mögen, in dem nicht das eigene Blut floss.
Er liebte ihre Arglosigkeit, er liebte die Unverdorbenheit ihrer Träume, aber das hatte selbstredend nichts mit Verliebtheit zu tun. Im Gegenteil, ihre natürliche Zurückhaltung ließ sein Verlangen nach Olive mit neuer Heftigkeit auflodern. Olives scharfe Zunge, ihre vollen Brüste, ihr aufbrausendes Temperament und ihr unvermitteltes, tiefes Lachen entfesselten in ihm einen ungekannten Andrang fast schmerzhafter Lust, und nicht Denise war es, die ihm bei seiner nächtlichen Verausgabung manchmal vor Augen stand, sondern merkwürdigerweise ihr starker junger Ehemann – die Wildheit des jungen Mannes in diesem Moment animalischer Besitznahme -, und dann erfasste Henry Kitteridge sekundenlang eine unglaubliche Raserei, als wäre er in diesem Akt ehelicher Vereinigung eins mit allen Männern, die mit der Gesamtheit aller Frauen eins wurden, in denen, moosig und dunkel, das Geheimnis der Erde verborgen lag.
»Du meine Güte«, sagte Olive, wenn er sich von ihr herunterwälzte.
Henry Thibodeau hatte im College Football gespielt, Henry Kitteridge ebenfalls. »War das nicht das Größte überhaupt?«, fragte der junge Henry ihn eines Tages. Er war früh gekommen, um Denise abzuholen, und stand im Laden. »Das Gejohle von der Tribüne zu hören, und dann kommt dieser Pass direkt auf dich zu, und du weißt, du kriegst ihn? Mann, das fand ich so was von klasse.« Er grinste, und sein klares Gesicht schien ein gebrochenes Licht abzustrahlen. »So was von klasse.«
»Ich fürchte, ich war längst nicht so gut wie Sie«, sagte Henry Kitteridge. Er war gut im Laufen gewesen, im Ausweichen, aber er war nicht aggressiv genug, um ein wirklich guter Spieler zu sein. Es beschämte ihn, daran zu denken, wie viel Angst er bei jedem Spiel gehabt hatte. Er war fast froh gewesen, als es mit seinen Noten bergab ging und er aufhören musste.
»Ach, so gut war ich gar nicht«, sagte Henry Thibodeau und fuhr sich mit seiner kräftigen Hand über den Kopf. »Ich hab einfach nur gern gespielt.«
»Er war gut«, sagte Denise, während sie ihren Mantel anzog. »Er war sogar richtig gut. Die Cheerleader haben ihn mit Namen angefeuert.« Und scheu, voller Stolz, intonierte sie: »Let’s go, Thibodeau, let’s go.«
Schon auf dem Weg zur Tür sagte Henry Thibodeau: »Jetzt müssen wir Sie und Olive aber endlich mal zu uns einladen.«
»Ach, macht euch da gar keine Gedanken.«
Denise hatte Olive mit ihrer kleinen, ordentlichen Schrift ein Dankeskärtchen geschrieben. Olive hatte es überflogen, es über den Tisch zu Henry segeln lassen. »Die Schrift ist genauso mäuschenhaft wie sie selbst«, hatte Olive gesagt. »Sie ist das farbloseste Geschöpf, das ich je gesehen habe. Wenn jemand dermaßen blass ist, muss er da auch noch Grau und Beige tragen?«
»Ich weiß«, sagte er zustimmend, so als hätte sich ihm diese Frage auch schon gestellt. Sie hatte sich ihm nicht gestellt.
»Ein echtes Dummchen«, sagte Olive.
Aber Denise war nicht dumm. Sie hatte einen Kopf für Zahlen und merkte sich alles, was Henry ihr zu den Arzneimitteln erklärte, die er führte. Sie hatte einen Abschluss in Biologie und kannte sich mit Molekularstrukturen aus. In ihrer Mittagspause saß sie manchmal auf einer der Kisten hinten im Lager, auf dem Schoß das Merck-Handbuch. Ihr Kindergesicht, ernsthaft gemacht durch die Brille, neigte sich konzentriert über die Seiten, ihre Knie ragten in die Höhe, ihre Schultern hingen nach vorn.
Süß, schoss es ihm durch den Kopf, wenn er im Vorbeigehen einen Blick zu ihr hineinwarf. »Geht’s gut, Denise?«, fragte er dann manchmal.
»O ja, wunderbar.«
Das Lächeln blieb auf seinem Gesicht, wenn er seine Fläschchen anordnete, seine Etiketten tippte. Denises Wesen verband sich mit dem seinen so mühelos wie Aspirin mit dem Enzym COX-2; Henry glitt schmerzfrei durch den Tag. Das freundliche Zischen der Heizkörper, das Klingeln der Ladenglocke, wenn jemand zur Tür hereinkam, das Knarzen der Dielenbretter, das Ping der Registrierkasse – im Geist verglich er die Apotheke damals zuweilen mit einem gesunden, autonomen Nervensystem im Zustand ruhigen Funktionierens.
An den Abenden siedete das Adrenalin. »Ich tu nichts anderes als kochen und putzen und hinter anderen Leuten herräumen«, schrie Olive etwa und knallte einen Teller Rindsgulasch vor ihn hin. »Alle sitzen nur mit langen Gesichtern da und warten darauf, dass ich sie bediene!« In seinen Armen kribbelte es.
»Vielleicht könntest du ein bisschen mehr im Haushalt mithelfen«, sagte er zu Christopher.
»Untersteh dich, ihn herumzukommandieren! Du interessierst dich ja noch nicht mal genügend für ihn, um zu wissen, was er in Sozialkunde durchmacht!«, fauchte Olive ihn an, während Christopher stumm blieb, den Mund süffisant verzogen. »Herrgott, sogar Jim O’Casey kümmert sich mehr um den Jungen als du«, sagte Olive. Sie klatschte ihre Serviette auf die Tischplatte.
»Jim O’Casey unterrichtet bei euch an der Schule, alles, was recht ist, und er sieht dich und Chris jeden Tag. Was ist denn so schlimm in Sozialkunde?«
»Nur dass der Dreckslehrer ein Vollidiot ist, was Jim intuitiv versteht«, sagte Olive. »Du siehst Christopher auch jeden Tag. Aber du kriegst nichts mit, weil du dich in deiner heilen kleinen Welt mit deinem grauen Mäuschen verschanzt.«
»Ihr macht ihre Arbeit Spaß«, gab Henry zurück. Aber am Morgen war die Schwärze von Olives Stimmung oft verflogen, und wenn Henry zur Arbeit fuhr, lebte die Hoffnung, die er am Vorabend verloren geglaubt hatte, neu auf. In der Apotheke regierten Friede und Wohlgefallen.
Denise fragte Jerry McCarthy, ob er denn aufs College gehen wolle. »Weiß nicht. Glaub nicht.« Jerry wurde rot – vielleicht war er ein bisschen in Denise verliebt, oder er kam sich kindisch vor in ihrer Nähe: ein Junge, der noch zu Hause wohnte und unter seinem Babyspeck litt.
»Mach doch einen Abendkurs«, sagte Denise fröhlich. »Da kannst du dich gleich nach Weihnachten einschreiben. Nur einen einzigen Kurs. Probier’s doch.« Denise nickte und sah Henry an, der zurücknickte.
»Das stimmt, Jerry«, sagte Henry, der bis dahin kaum einen Gedanken an den Jungen verschwendet hatte. »Was interessiert dich denn?«
Der Junge hob die dicken Schultern.
»Irgendwas muss dich doch interessieren.«
»Dieses Zeug hier.« Der Junge zeigte auf die Medikamentenkisten, die er gerade durch die Hintertür hereingetragen hatte.
Und tatsächlich belegte er einen Chemiekurs, und als er im Frühling mit Eins abschloss, sagte Denise: »Rühr dich nicht vom Fleck.« Sie kehrte mit einer kleinen Torte in einer Tortenschachtel aus dem Lebensmittelladen zurück und sagte: »Henry, wenn das Telefon nicht läutet, feiern wir jetzt.«
Beide Backen voller Torte, vertraute Jerry Denise an, dass er letzten Sonntag zur Kirche gegangen war, um dafür zu beten, dass er in der Prüfung gut abschnitt.
Das gehörte zu den Dingen, die Henry an den Katholiken nie begreifen würde. Er wollte schon sagen: Gott hat keine Eins für dich geschrieben, Jerry, das warst du selber. Aber Denise fragte: »Gehst du jeden Sonntag in die Kirche?«
Der Junge schaute verlegen und schleckte sich Zuckerguss von den Fingern. »Von jetzt an schon«, sagte er, und Denise lachte und Jerry auch, wobei er rot anlief.
Herbst nun, November, und so viele Jahre später, dass Henry, als er sich an diesem Sonntagmorgen kämmt, einige graue Haare zwischen den schwarzen Plastikzähnen herauszupfen muss, ehe er den Kamm wieder in die Tasche steckt. Er macht für Olive noch ein Feuer im Kamin, bevor er zur Kirche aufbricht. »Bring mir ein bisschen Tratsch mit«, sagt Olive zu ihm und zieht ihren Pullover herunter, den Blick in einen großen Topf gerichtet, in dem Äpfel schmurgeln. Sie kocht Apfelmus aus den letzten Äpfeln des Jahres, und der Geruch – süß, vertraut, alte Sehnsüchte wachkitzelnd – weht ihn kurz an, als er mit Tweedjacke und Krawatte zur Tür geht.
»Ich geb mir Mühe«, sagt er. Niemand scheint heutzutage mehr einen Anzug in die Kirche anzuziehen.
Ohnehin gibt es nur noch eine Handvoll regelmäßiger Kirchgänger in der Gemeinde. Das bekümmert Henry, und es macht ihm Sorgen. Sie hatten zwei verschiedene Pfarrer in den letzten fünf Jahren, und beide haben auf der Kanzel alles andere als inspiriert gewirkt. Der jetzige, ein Bärtiger, der ohne Talar predigt, wird ihnen auch nicht lange erhalten bleiben, vermutet Henry. Er ist jung, und seine Familie wächst, er wird bald weiterziehen. So spärlich, wie die Gottesdienste besucht sind, fürchtet Henry, auch andere könnten gespürt haben, was er selbst zunehmend abzuleugnen versucht: dass von dieser wöchentlichen Zusammenkunft nichts wirklich Tröstliches mehr ausgeht. Wenn sie die Köpfe beugen oder einen Psalm singen, fehlt jetzt – für Henry – das Gefühl, dass Gottes Gegenwart sie segnet. Aus Olive ist eine radikale Atheistin geworden. Er weiß nicht, wann das passiert ist; zu Anfang ihrer Ehe war sie es jedenfalls nicht. In ihrem Biologiekurs am College haben sie über das Sezieren von Tieren diskutiert; schon allein das Atmungssystem sei ein Wunder, fanden sie damals, die Schöpfung einer wunderbaren Macht.
Er rumpelt den Fahrweg entlang, biegt dann in die Asphaltstraße ein, die zur Stadt führt. Nur ein paar tiefrote Blätter hängen noch in den kahlen Zweigen der Ahornbäume, die Eichenblätter sind rostbraun und runzlig; ganz kurz kommt zwischen den Stämmen die Bucht in Sicht, stumpf und stahlgrau heute unter dem verhangenen Novemberhimmel.
Hier vorne stand früher die Apotheke. Sie ist einem großen Drogeriemarkt mit riesigen gläsernen Gleittüren gewichen, so groß wie die alte Apotheke und der Lebensmittelladen zusammen, ja selbst die Kiesfläche mit den Mülltonnen, wo Henry nach Feierabend so oft noch mit Denise geschwatzt hat, bevor sie in ihre getrennten Autos stiegen und heimfuhren, ist diesem Laden einverleibt worden, in dem es nicht nur Arzneimittel zu kaufen gibt, sondern auch überdimensionale Rollen Küchenpapier und Mülltüten in allen Größen, Teller und Tassen, Bratenwender und Katzenfutter. Die Bäume an der Seite hat man gefällt, um Parkraum zu schaffen. Man gewöhnt sich an so vieles, denkt er, ohne sich daran zu gewöhnen.
Es scheint sehr lange her, dass Denise dort fröstelnd in der Winterkälte stand, bevor sie schließlich ins Auto stieg. Wie jung sie war! Wie schmerzlich, an ihr verstörtes Gesicht zurückzudenken; aber gleichzeitig erinnert er sich doch auch, wie er sie zum Lächeln bringen konnte. Jetzt, so weit weg im fernen Texas (so fern, dass es fast ein fremdes Land scheint), ist sie so alt wie er damals. Einmal war ihr ein roter Fäustling zu Boden gefallen, und er hat sich danach gebückt – hat das Bündchen für sie aufgespreizt und zugesehen, wie ihre kleine Hand darin verschwand.
Die weiße Kirche steht dicht bei den kahlen Ahornbäumen. Er weiß, weshalb er dauernd an Denise denken muss. Letzte Woche ist die Geburtstagskarte ausgeblieben, die sie ihm seit zwanzig Jahren schickt, unfehlbar pünktlich bis jetzt. Sie schreibt immer ein paar Zeilen dazu. Manchmal stechen ein, zwei Sätze heraus, wie letztes Jahr, als sie erwähnt hat, dass Paul, der die unterste High-School-Klasse besucht, fettleibig geworden ist. Ihr Wort. »Paul hat inzwischen ein echtes Problem – mit seinen dreihundert Pfund ist er fettleibig.« Sie sagt nichts darüber, was sie oder ihr Mann dagegen zu tun gedenken, wenn sich denn etwas »tun« lässt. Die Zwillingstöchter, jünger, sind beide sportlich und fangen schon an, Anrufe von Jungs zu bekommen, »was mir echt Angst macht«, hat Denise geschrieben. Sie setzt nie ein »Alles Liebe« oder »Liebe Grüße« darunter, immer nur ihren Namen in ihrer kleinen, ordentlichen Handschrift, »Denise«.
Auf dem gekiesten Vorplatz der Kirche steigt gerade Daisy Foster aus ihrem Auto, und sie reißt in einem übertriebenen Ausdruck freudiger Überraschung den Mund auf, aber die Freude ist echt, das weiß er – Daisy freut sich immer, ihn zu sehen. Daisy hat vor zwei Jahren ihren Mann verloren, einen pensionierten Polizisten, fünfundzwanzig Jahre älter als sie, der sich zu Tode geraucht hat; sie sieht immer gleich hübsch und lieb aus mit ihren netten blauen Augen. Was aus ihr werden wird, weiß Henry nicht. Frauen sind so viel tapferer als Männer, überlegt er, während er seinen üblichen Platz in der mittleren Bank einnimmt. Die bloße Vorstellung, dass Olive stirbt und er allein zurückbleibt, scheint ihm der Vorgeschmack eines Grauens, das nicht zu ertragen ist.
Und damit ist er mit seinen Gedanken wieder bei der Apotheke, die es nicht mehr gibt.
»Henry geht dieses Wochenende jagen«, sagte Denise an einem Novembermorgen. »Jagen Sie auch, Henry?« Sie zählte Geld in die Kasse und sah nicht zu ihm hoch.
»Früher mal«, antwortete Henry. »Für so was bin ich zu alt.« Das eine Mal, dass er als Junger eine Hirschkuh erlegt hatte, war ihm ganz elend geworden von dem Anblick: der hübsche, hochgerissene Kopf, der von einer Seite zur anderen pendelte, ehe die dünnen Beine einknickten und das Tier auf dem Waldboden zusammenbrach. »Gott, bist du ein Sensibelchen«, hatte Olive gesagt.
»Henry geht mit Tony Kuzio.« Denise schob die Lade zu und kam um die Kasse herum, um die Pfefferminzdragees und Kaugummis umzuordnen, die säuberlich auf dem Tresen auslagen. »Seinem besten Freund, seit er fünf war.«
»Und was macht Tony jetzt?«
»Tony ist verheiratet und hat zwei kleine Kinder. Er arbeitet für Midcoast Power und streitet mit seiner Frau.« Denise warf einen Blick zu Henry herüber. »Aber sagen Sie nicht, dass ich das gesagt habe.«
»Nein.«
»Sie ist dauernd angespannt und macht Szenen. So würde ich nicht leben wollen, echt nicht.«
»Nein, das ist kein Leben.«
Das Telefon klingelte, und Denise vollführte eine spielerische Halbpirouette und ging an den Apparat. »Stadtapotheke, guten Morgen. Was kann ich für Sie tun?« Eine Pause. »Aber sicher haben wir Multivitaminpräparate ohne Eisen … Nichts zu danken.«
In der Mittagspause erzählte Denise dem ungeschlachten, pausbäckigen Jerry: »Mein Mann hat pausenlos von Tony geredet, als wir uns kennengelernt haben. Von dem vielen Unsinn, den sie als kleine Jungs angestellt haben. Einmal sind sie losgezogen und kamen erst zurück, als es schon dunkel war, und Tonys Mutter sagte zu ihm: ›Ich hab mir solche Sorgen um dich gemacht, Tony, ich könnte dich umbringen.‹« Denise zupfte eine Fluse vom Ärmel ihres grauen Pullovers. »Das fand ich immer so lustig. Sich Sorgen machen, ihr Kind könnte tot sein, und es dann umbringen wollen.«
»Sie werden schon sehen« – Henry Kitteridge trat hinter den Kisten hervor, die Jerry ins Lager geschleppt hatte -, »von ihrem allerersten Fieber an hören Sie keine Sekunde auf, sich zu sorgen. Warten Sie’s nur ab.«
»Ich will ja gerade nicht warten«, sagte Denise, und zum ersten Mal machte Henry sich klar, dass sie bald Kinder bekommen und nicht mehr bei ihm arbeiten würde.
Unerwartet meldete sich Jerry zu Wort. »Magst du ihn leiden? Tony? Versteht ihr euch?«
»Doch, ich mag ihn«, sagte Denise. »Gott sei Dank. Ich hatte erst richtig Angst, ihn kennenzulernen. Hast du noch einen besten Freund von ganz früher?«
»Schon«, sagte Jerry, und das Blut stieg ihm in die dicken, glatten Backen. »Aber irgendwie haben wir nicht mehr richtig viel miteinander zu tun.«
»Meine beste Freundin«, sagte Denise, »ich weiß nicht, sie ist so ein bisschen forsch geworden, als wir in die Junior High School gekommen sind. Möchtest du noch eine Limo?«
Ein Samstag zu Hause, zum Mittagessen Krebsfleischsandwiches, mit Käse überbacken. Christopher wollte schon in seins hineinbeißen, da klingelte das Telefon, und Olive ging hin. Christopher wartete, ohne dass man ihn darum bitten musste, das Sandwich in der erhobenen Hand. Es prägte sich Henry unauslöschlich ein, dieses instinktive Innehalten seines Sohns in demselben Moment, in dem sie von nebenan Olives Stimme hörten. »Oh, Sie armes Kind«, sagte Olive in einem Ton, den Henry niemals vergessen würde – so voller Bestürzung, dass ihr ganzes äußeres Olive-tum von ihr abzufallen schien. »Sie armes, armes Kind.«
Und dann stand Henry auf und ging nach drüben, und an viel mehr erinnerte er sich nicht, nur an die winzig kleine Stimme von Denise und daran, dass er ein paar Sätze mit ihrem Schwiegervater sprach.
Die Beerdigung fand in der Kirche Unserer Lieben Frau von der Buße statt, in Henry Thibodeaus Heimatort drei Autostunden entfernt. Die Kirche war groß und düster, mit riesigen Buntglasfenstern, der Priester in seinem reichgefältelten weißen Gewand schwenkte Weihrauch hin und her. Denise saß schon vorne bei ihren Eltern und Brüdern, als Olive und Henry ankamen. Der Sarg war zu, er war bei der Totenwache am Vorabend geschlossen worden. Die Kirche war fast voll. Henry, der mit Olive weit hinten saß, erkannte niemanden, bis er die Nähe einer großen, stummen Gestalt spürte, und als er aufsah, stand da Jerry McCarthy. Henry und Olive rückten, um ihm Platz zu machen.
Jerry flüsterte: »Ich hab’s in der Zeitung gelesen«, und Henry legte ganz kurz die Hand auf sein fettes Knie.
Der Gottesdienst wollte nicht aufhören, auf Bibellesungen folgten andere Lesungen und dann die aufwendigen Vorkehrungen für die Kommunion. Der Priester nahm Tücher und faltete sie auseinander und breitete sie über einen Tisch, und dann erhoben sich die Leute Reihe um Reihe aus ihren Bänken und traten nach vorn und knieten sich hin und ließen sich eine Oblate in den Mund schieben, und alle tranken aus demselben großen Silberkelch, nur Henry und Olive blieben an ihren Plätzen. Trotz des Gefühls der Unwirklichkeit, das sich Henrys bemächtigt hatte, vermerkte er es bei sich doch als unhygienisch, dass all diese Leute aus ein und demselben Kelch tranken, und er vermerkte auch – nicht ohne Zynismus -, wie der Priester, nachdem alle abgefertigt waren, seinen Raubvogelkopf in den Nacken legte und den ganzen Rest in sich hineinschüttete.
Sechs junge Männer trugen den Sarg durch den Mittelgang hinaus. Olive stieß Henry mit dem Ellbogen an, und er nickte. Einer der Sargträger – einer der beiden hintersten – hatte ein so kalkweißes, starres Gesicht, dass Henry Angst bekam, er könnte den Sarg fallenlassen. Das war Tony Kuzio, der nur wenige Tage zuvor das Gewehr angelegt und seinen besten Freund erschossen hatte, weil er im Morgendunkel dachte, Henry Thibodeau sei ein Hirsch.
Wen gab es, der ihr helfen konnte? Ihr Vater lebte im Norden von Vermont mit einer Frau, die Invalidin war, ihre Brüder und deren Frauen wohnten viele Stunden entfernt, ihre Schwiegereltern waren starr vor Kummer. Sie blieb zwei Wochen bei den Schwiegereltern, und als sie wieder zur Arbeit kam, sagte sie Henry, dass sie bald dort wegmüsse; sie seien lieb und nett, aber sie hörte ihre Schwiegermutter die ganze Nacht weinen, es mache sie ganz krank. Sie müsse für sich sein, um allein weinen zu können.
»Völlig verständlich, Denise.«
»Aber zurück in den Trailer, das kann ich nicht.«
»Nein.«
In dieser Nacht setzte er sich im Bett auf und stützte das Kinn in die Hände. »Olive«, sagte er, »das Mädchen ist vollkommen hilflos. Sie kann nicht Auto fahren, sie hat in ihrem Leben noch keinen Scheck ausgestellt.«
»Wie schafft man es«, sagte Olive, »in Vermont aufzuwachsen und nicht Auto fahren zu können?«
»Weiß auch nicht«, gab Henry zu. »Ich hatte keine Ahnung, dass sie nicht Auto fahren kann.«
»Wenigstens ist mir jetzt klar, wieso Henry sie geheiratet hat. Ich konnte es mir erst nicht erklären. Aber als ich dann bei der Beerdigung seine Mutter gesehen habe – gut, armes Ding. Aber sie scheint so gar keinen Pep zu haben.«
»Nun ja, sie ist völlig gebrochen vor Trauer.«
»Sicher, das verstehe ich«, sagte Olive geduldig. »Ich sage dir lediglich, dass er seine Mutter geheiratet hat. Wie die meisten Männer.« Nach einer Pause: »Außer dir.«
»Sie muss Auto fahren lernen«, sagte Henry. »Das ist das Allerwichtigste. Und sie braucht eine Wohnung.«
»Meld sie in der Fahrschule an.«
Stattdessen übte er mit ihr in seinem Wagen auf unasphaltierten Nebenstraßen. Inzwischen lag Schnee, aber auf den Wegen zum Wasser hinunter hatten die Pick-ups der Fischer ihn glatt gewalzt. »So ist’s recht. Ganz langsam die Kupplung rauslassen.« Der Wagen bockte wie ein wildes Pferd, und Henry stemmte die Hand ans Armaturenbrett.
»Es tut mir leid«, flüsterte Denise.
»Nein, nein. Das wird schon.«
»Ich hab einfach Angst. So was Dummes.«
»Weil es ganz neu für Sie ist. Aber, Denise, jeder Schwachkopf kann Auto fahren.«
Sie sah ihn an, und dann kicherte sie plötzlich, und er lachte auch, ohne es zu wollen, während ihr Kichern immer heftiger wurde, so heftig, dass ihr die Tränen kamen und sie anhalten und das weiße Taschentuch nehmen musste, das er ihr hinstreckte. Sie setzte die Brille ab, und er schaute aus seinem Fenster, solange sie mit dem Taschentuch beschäftigt war. In dem Schnee wirkten die Wälder entlang der Straße wie ein Schwarzweißbild. Selbst die immergrünen Zweige der Kiefern sahen dunkel aus über den schwarzen Stämmen.
»In Ordnung«, sagte Denise. Sie fuhr wieder an; wieder wurde Henry nach vorn geworfen. Wenn die Kupplung draufging, würde ihm Olive den Kopf abreißen.
»Nichts passiert«, sagte er Denise. »Übung macht den Meister.«
Nach ein paar Wochen fuhr er sie nach Augusta, wo sie die Fahrprüfung bestand, und dann ging er mit ihr ein Auto kaufen. Geld genug hatte sie. Henry Thibodeau hatte eine gute Lebensversicherung gehabt, wie sich herausstellte, immerhin etwas. Jetzt half Henry Kitteridge ihr dabei, das Auto zu versichern, erklärte ihr, wie sie die Zahlungen regeln musste. Davor war er mit ihr auf der Bank gewesen, und zum ersten Mal in ihrem Leben besaß sie nun ein Girokonto. Er hatte ihr gezeigt, wie man einen Scheck ausschrieb.
Er war entsetzt, als sie eines Tages in der Arbeit die Summen erwähnte, die sie Unserer Lieben Frau von der Buße zukommen ließ, damit jede Woche eine Kerze für Henry angezündet und einmal monatlich eine Messe für ihn gelesen wurde. »Das ist schön, Denise«, sagte er. Sie hatte abgenommen. Wenn er am Ende des Tages unter der Lampe an der Hauswand stand und sie über den dunklen Parkplatz davonfahren sah, den Kopf so ängstlich über das Lenkrad gereckt, gab es ihm einen Stich, und beim Heimfahren in seinem eigenen Wagen packte ihn eine Traurigkeit, die er den ganzen Abend nicht abschütteln konnte.
»Was zum Teufel ist los mit dir?«, fragte Olive.
»Denise«, sagte er. »Sie ist hilflos.«
»Die Leute sind nie so hilflos, wie man denkt«, erwiderte Olive. Und indem sie den Deckel auf einen Topf auf dem Herd knallte: »Gott, genau das habe ich befürchtet.«
»Was hast du befürchtet?«
»Lass einfach den verdammten Hund raus, ja?«, sagte Olive. »Und setz dich zum Essen.«
Eine Wohnung fand sich in einer kleinen Neubauanlage ein Stück außerhalb. Denises Schwiegervater und Henry halfen, ihre wenigen Habseligkeiten hinzuschaffen. Die Wohnung lag im Erdgeschoss und bekam nicht viel Licht. »Immerhin ist es sauber«, sagte Henry zu Denise, die den neuen Kühlschrank öffnete und in die blanke, gähnende Leere starrte. Sie nickte nur, drückte die Tür wieder zu. Leise sagte sie: »Ich habe noch nie allein gelebt.«
In der Apotheke ging sie herum wie in Trance, und es machte sein eigenes Leben in einem Maß unerträglich, wie er es nie für möglich gehalten hätte. Es war eine Überreaktion, das war ihm klar. Aber es beunruhigte ihn; Fehler schlichen sich ein. Er vergaß, Cliff Mott eine Banane täglich zu empfehlen, weil das harntreibende Mittel, das er zu seinem Digitalis verschrieben bekommen hatte, den Kaliumbedarf erhöhte. Die alte Mrs. Tibbets verbrachte eine schlimme Nacht, nachdem sie Erythromyzin genommen hatte – hatte er ihr nicht gesagt, dass man es zum Essen einnahm? Er arbeitete langsam, zählte seine Pillen manchmal doppelt und dreifach, bevor er sie in ihre Fläschchen füllte, überprüfte mehrmals die Rezepte, die er tippte. Daheim fixierte er Olive mit weit aufgerissenen Augen, wenn sie sprach, damit sie wusste, dass er ihr zuhörte. Aber er hörte ihr nicht zu. Olive war eine furchterregende Fremde; sein Sohn feixte ihn an. »Bring den Müll raus!«, schrie Henry eines Abends, als er das Türchen unter der Spüle öffnete und eine Tüte mit Eierschalen, Hundehaaren und zusammengeknülltem Wachspapier fand. »Das ist das Einzige, was wir von dir verlangen, und nicht mal das schaffst du!«
»Hör auf, rumzubrüllen«, befahl Olive ihm. »Meinst du, dadurch wirkst du männlicher? Wie unglaublich jämmerlich.«
Der Frühling kam. Die Tage wurden länger, die letzten Schneereste schmolzen, die Straßen glänzten vor Nässe. Forsythien tupften die kalte Luft mit Wolken aus Gelb, dann reckten die Rhododendren der Welt ihre kreischend roten Köpfe entgegen. Er sah alles durch die Augen von Denise und empfand die Schönheit als Angriff. Vor der Farm der Caldwells stand ein handgemaltes Schild an der Straße, KÄTZCHEN ZU VERSCHENKEN, und am nächsten Tag rückte er in der Apotheke mit einem Katzenklo, Katzenfutter sowie einem kleinen schwarzen Kätzchen an, dessen Pfoten so weiß waren, als wäre es durch eine Schüssel Schlagsahne spaziert.
»Oh, Henry!«, rief Denise, nahm ihm das Kätzchen aus den Armen und drückte es an die Brust.
Er war überglücklich.
Weil es noch gar so klein und jung war, durfte das Tier tagsüber mit in die Apotheke, wo auch Jerry McCarthy es in seiner dicken Hand halten musste, vor seinem schweißfleckigen Hemd. »Mann, ja. Goldig. Nette Katze«, sagte er pflichtschuldig, und Denise befreite ihn wieder von seiner pelzigen kleinen Last und rieb ihre Nase an Slippers Köpfchen, während Jerry ihr zuschaute, die dicken, feuchtglänzenden Lippen leicht geöffnet. Jerry hatte noch zwei Kurse an der Universität belegt und in beiden wieder mit Eins abgeschlossen. Henry und Denise gratulierten ihm wie zerstreute Eltern; Kuchen gab es keinen.
Sie hatte Schübe manischer Gesprächigkeit, gefolgt von tagelangem Schweigen. Manchmal schlüpfte sie zur Hintertür hinaus und kam mit verschwollenen Augen zurück. »Machen Sie früher Schluss, wenn Sie möchten«, sagte er. Aber sie sah ihn mit Panik im Blick an. »Nein. Nein, um Gottes willen. Ich will nur hier sein.«
Der Sommer in diesem Jahr war sehr warm. Noch heute sieht er sie vor dem Ventilator am Fenster stehen, das dünne Haar zu kleinen Wellen hochgepustet, und durch ihre Brillengläser auf das Fensterbrett hinunterstarren. Minuten am Stück stand sie so da. Einmal fuhr sie eine Woche einen ihrer Brüder besuchen. Ein andermal fuhr sie für eine Woche zu ihren Eltern. »Ich gehöre hierher«, sagte sie, als sie zurückkam.
»Wie will sie in diesem winzigen Kaff jemals einen neuen Mann finden?«, fragte Olive.
»Ich weiß nicht. Ich hab mich das auch schon gefragt«, gab Henry zu.
»Andere Leute würden ihr Bündel schnüren und zur Fremdenlegion gehen, aber dafür ist sie nicht der Typ.«
»Nein. Der Typ ist sie nicht.«
Ihm graute, als es Herbst wurde. An Henry Thibodeaus erstem Todestag ging Denise mit ihren Schwiegereltern zur Messe. Er war erleichtert, als dieser Tag vorbei war, als eine Woche vorüberging und dann noch eine; aber die Feiertage nahten, und er fühlte eine Beklemmung, als trüge er eine Last, die um keinen Preis abgesetzt werden durfte. Als eines Abends beim Essen das Telefon klingelte, hob er voll böser Ahnungen ab. Denise stieß kleine Wimmerlaute aus – Slippers war aus der Wohnung entwischt, ohne dass sie es bemerkt hatte, und als sie noch rasch zum Einkaufen wollte, hatte sie ihn überrollt.
»Fahr hin«, sagte Olive. »Fahr in Gottes Namen hin und halt deiner kleinen Freundin das Händchen.«
»Olive, hör auf«, sagte Henry. »Was soll das? Sie ist eine junge Witwe, die ihre Katze überfahren hat. Hast du denn gar kein Mitleid?« Er zitterte richtiggehend.
»Sie hätte keine einzige Katze überfahren müssen, wenn du ihr das Vieh nicht geschenkt hättest.«
Er nahm ein Valium mit. Und dann saß er hilflos neben ihr auf der Couch und sah ihr beim Weinen zu. Es drängte ihn sehr, den Arm um ihre schmalen Schultern zu legen, aber er verschränkte die Hände fest im Schoß. Vom Küchentisch schien eine kleine Lampe herüber. Sie schnäuzte sich in ihr weißes Taschentuch und sagte: »Oh, Henry. Henry.« Er war sich nicht sicher, welchen Henry sie meinte. Sie sah zu ihm hoch, ihre kleinen Augen waren fast völlig zugeschwollen; sie hatte die Brille abgenommen, um das Taschentuch dagegendrücken zu können. »In meinem Kopf red ich andauernd mit Ihnen«, sagte sie. Sie setzte die Brille wieder auf. »Entschuldigung.«
»Entschuldigung wofür?«
»Dass ich in meinem Kopf andauernd mit Ihnen rede.«
»Nein, woher denn.«
Er brachte sie zu Bett wie ein Kind. Gehorsam ging sie ins Bad und zog ihren Schlafanzug an, und dann lag sie unter der Decke, die ihr bis zum Kinn reichte. Er saß auf der Bettkante und strich ihre Haarsträhnen glatt, bis das Valium zu wirken begann. Die Lider sanken herab, und sie drehte den Kopf auf die Seite und murmelte etwas, das er nicht ganz verstand. Als er den Wagen langsam über die schmalen Straßen zurücklenkte, kam ihm die Finsternis draußen bedrohlich vor, wie ein Lebewesen, das sich gegen die Scheiben presste. Er stellte sich vor, er zöge mit Denise ins Hinterland und sie wohnten in einem kleinen Häuschen. Er könnte irgendwo dort oben eine Arbeit finden, und sie könnte ein Kind bekommen. Ein kleines Mädchen, das ihn vergöttern würde; alle Töchter vergötterten ihren Vater.
»Na, Witwentröster, wie geht’s ihr?«, fragte Olives Stimme aus der Dunkelheit des Bettes.
»Es ist ein ziemlicher Kampf für sie«, sagte er.
»Für wen ist es das nicht?«
Am nächsten Morgen arbeiteten er und Denise in schweigender Verbundenheit. Auch wenn sie vorn an der Kasse war und er hinten an seiner Theke, spürte er sie unsichtbar ganz nahe, als wäre sie Slippers geworden, oder auch er, und ihre Seelen streiften aneinander entlang. Am Ende dieses Tages sagte er: »Ich kümmer mich schon um Sie«, und seine Stimme war belegt vor Ergriffenheit.
Sie stand vor ihm und nickte. Er zog den Reißverschluss ihrer Jacke für sie zu.
Bis heute weiß er nicht, was er sich damals dachte. Überhaupt ist ihm vieles nur undeutlich in Erinnerung. Tony Kuzios Besuche bei ihr. Dem sie sagte, dass er verheiratet bleiben müsse, denn wenn er einmal geschieden sei, könne er nie wieder kirchlich heiraten. Die bohrende Eifersucht und Wut, die ihn packten, wenn er sich vorstellte, wie Tony spätnachts in Denises kleiner Wohnung saß und sie um Vergebung anflehte. Dieses Gefühl, in Spinnweben zu ersticken, deren klebriges Netz ihn immer enger einschnürte. Sein Wunsch, Denise möge nicht aufhören, ihn zu lieben. Denn sie liebte ihn. Er sah es in ihren Augen, als ihr der rote Fäustling herunterfiel und er sich danach bückte und ihn für sie aufspreizte. In meinem Kopf red ich andauernd mit Ihnen. Der Schmerz war haarfein, schneidend, nicht zu ertragen.
»Denise«, sagte er eines Abends beim Abschließen. »Sie müssen Freunde finden.«
Sie wurde glühend rot. Mit eckigen Bewegungen zog sie ihre Jacke über. »Ich hab Freunde«, sagte sie dünn.
»Selbstverständlich haben Sie das. Aber ich meine hier, in der Stadt.« Er wartete an der Tür, bis sie ihre Handtasche aus dem Lager geholt hatte. »Sie könnten in die Grange Hall zum Square Dance gehen. Da waren Olive und ich früher manchmal. Nette Leute dort.«
Sie schob sich an ihm vorbei, ihr Gesicht war feucht. Sein Blick streifte über ihren Scheitel. »Oder ist Ihnen so was zu spießig?«, fragte er lahm, als sie auf dem Parkplatz standen.
»Ich bin spießig«, sagte sie leise.
»Ja«, sagte er ebenso leise, »ich auch.« Als er durch die Dunkelheit nach Hause fuhr, stellte er sich vor, er wäre es, der mit Denise zum Tanzen ging. »Partnerin drehn und vorwärts gehn«, und auf Denises Gesicht breitete sich ein Lächeln aus, ihre Fußspitze klopfte auf den Boden, ihre kleinen Hände lagen auf den Hüften … Nein – es war nicht zu ertragen, und ihm wurde angst und bange vor ihrem Zorn, den er so plötzlich zu spüren bekommen hatte. Er konnte ihr nicht helfen. Er konnte sie nicht in die Arme nehmen, konnte nicht ihre feuchte Stirn küssen, konnte nicht neben ihr schlafen, neben diesem kleinen Mädchen in dem dicken Flanellschlafanzug, in dem er sie in der Nacht gesehen hatte, in der Slippers starb. Olive zu verlassen war so undenkbar für ihn, wie sich das eigene Bein abzusägen. Ganz abgesehen davon, dass Denise bestimmt keinen geschiedenen Protestanten wollen würde – so wenig, wie er selbst mit ihrem Katholizismus zu Rande käme.
Sie sprachen nur das Nötigste, während die Tage dahingingen. Eine unnachgiebige Kälte schlug ihm jetzt von ihr entgegen, eine Kälte, die ihn anklagte. Was hatte er für Erwartungen bei ihr geweckt? Aber sobald sie einen Besuch von Tony Kuzio erwähnte oder einen Film, den sie in Portland gesehen hatte, merkte er, wie in ihm eine mindestens ebenso große Kälte aufstieg. Er musste die Kiefer zusammenbeißen, um nicht zu sagen: »Aber zu spießig sein, um zum Square Dance zu gehen!« Was sich neckt, liebt sich, schoss ihm durch den Kopf, und er hasste sich dafür.
Dann wieder sagte sie völlig unvermittelt – nach außen hin zu Jerry McCarthy, dessen dicker Leib seit einiger Zeit eine ganz neue Würde ausstrahlte, wenn er dasaß und lauschte, aber in Wahrheit zu Henry (das sah er an der Art, wie sie zu ihm herüberspähte und nervös die kleinen Hände ineinanderschlang): »Als ich ganz klein war, bevor meine Mutter krank wurde, da hat sie zu Weihnachten immer diese besonderen Plätzchen gebacken. Wir haben sie mit Zuckerguss und Liebesperlen verziert. Ach, manchmal denke ich, so viel Spaß hatte ich seitdem nie wieder …«, und ihre Stimme schwankte, und die Augen hinter den Brillengläsern blinzelten. Und er begriff, dass der Tod ihres Mannes für sie auch das Ende ihrer Mädchenzeit bedeutet hatte, dass sie um das einzige Ich trauerte, das sie bis dahin gekannt hatte und das nun ausgelöscht war, verdrängt durch diese neue, ratlose junge Witwe. Sein Blick begegnete ihrem und wurde weich.
Hin und her ging es so, hin und her. Zum ersten Mal in seinem Apothekersleben genehmigte er sich Schlaftabletten, jeden Tag ließ er eine in seiner Hosentasche verschwinden. »Können wir, Denise?«, fragte er sie, wenn es Zeit zum Schließen war. Dann holte sie entweder stumm ihre Jacke, oder sie sah ihn mit Sanftheit im Blick an und sagte: »Wir können, Henry. Wieder ein Tag geschafft.«
Daisy Foster dreht sich zu ihm um, als sie sich zum Singen erhebt, und lächelt ihm zu. Er nickt zurück und schlägt das Gesangbuch auf. »Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich steh’.« Die Worte, der dünne Gesang stimmen ihn hoffnungsvoll und tieftraurig zugleich. »Man kann einen Menschen auch lieben lernen«, hat er zu Denise gesagt, als sie ihn an dem Frühlingstag damals hinten im Lager aufsuchte, und während er nun das Gesangbuch in die Ablage zurücksteckt und sich wieder auf die schmale Bank setzt, wandern seine Gedanken zurück zu seiner letzten Begegnung mit ihr. Sie waren aus dem Süden gekommen, um Jerrys Eltern zu besuchen, und sie hatten mit ihrem kleinen Sohn Paul bei Henry und Olive vorbeigeschaut. Was Henry vor allem im Gedächtnis geblieben ist: Jerrys sarkastische Bemerkung darüber, dass Denise jeden Abend auf dem Sofa einschlief und manchmal die ganze Nacht dort lag. Und die Art, wie Denise sich wegdrehte und über die Bucht hinaussah – ihre kleinen Brüste hoben sich kaum ab unter dem dünnen Rollkragenpullover, aber dafür hatte sie einen Bauch bekommen, als hätte sie einen halben Basketball verschluckt. Sie war kein Mädchen mehr – kein Mädchen blieb für immer Mädchen -, sondern eine Mutter, eine müde Mutter, und ihre runden Wangen waren so schmal geworden, wie ihr Bauch rund war, so dass es schon jetzt so wirkte, als drückte die Schwerkraft des Lebens sie nieder. Das war der Moment gewesen, als Jerry scharf sagte: »Denise, halt dich grade. Schultern zurück!« Er sah Henry an, schüttelte den Kopf. »X-mal hab ich ihr das schon gesagt.«
»Wie wär’s mit einem Teller Fischsuppe?«, fragte Henry. »Olive hat sie gestern ganz frisch gekocht.« Aber sie mussten weiter, und als sie weg waren, verlor Henry kein Wort über ihren Besuch und Olive erstaunlicherweise auch nicht. Er hätte nie gedacht, dass Jerry sich zu dem Mann mausern würde, der er jetzt war, massig und (dank der Fürsorge von Denise) nicht unappetitlich, ja nicht einmal mehr richtig fett, einfach ein großer, dicker Mann mit einem großen, dicken Gehalt, der mit seiner Frau auf die gleiche Art sprach wie Olive manchmal mit Henry. Er hat Denise nicht wiedergesehen, obwohl sie in der Gegend gewesen sein muss. In ihren Geburtstagskarten hat sie vom Tod ihrer Mutter und ein paar Jahre später dem ihres Vaters berichtet. Ganz bestimmt ist sie zu den Beerdigungen hochgefahren. Denkt sie an ihn? Machen sie und Jerry halt, um das Grab von Henry Thibodeau zu besuchen?
»Du siehst so frisch aus wie eine Blume auf der Wiese«, sagt er zu Daisy Foster auf dem Kirchenvorplatz. Das ist ein alter Scherz zwischen ihnen; er sagt es seit Jahren zu ihr.
»Wie geht es Olive?« Daisys blaue Augen, unverändert groß und hübsch, lächeln wie stets.
»Olive geht’s gut. Sie hütet das heimische Feuer. Und was gibt’s bei dir Neues?«
»Ich habe einen Verehrer.« Das sagt sie sehr leise und legt dabei die Hand an den Mund.
»Wirklich? Ach, Daisy, das freut mich für dich.« »Er verkauft tagsüber Versicherungen in Heathwick und führt mich freitags abends zum Tanzen aus.«
»Ach, das freut mich«, sagt Henry noch einmal. »Ihr müsst mal zu uns zum Essen kommen.«