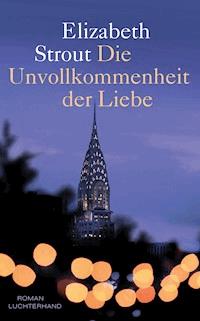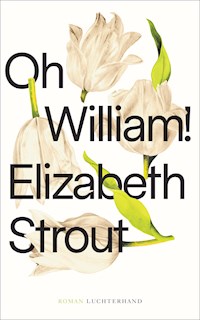2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einer Kleinstadt im einsamen Norden der USA hat Pastor Tyler Caskey nach dem tragischen Tod seiner Frau das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Er hadert nicht nur mit sich und der Welt, sondern zweifelt auch an Gott und seinem Glauben. Und in der Gemeinde, in der er bis dahin geliebt und geachtet war, fragen sich immer mehr Leute, ob Tyler sich nicht zu sehr gehenlässt in seinem Schmerz… Mit unnachahmlicher Leichtigkeit und großer Menschenkenntnis zeichnet Elizabeth Strout das Porträt einer ganz gewöhnlichen Kleinstadt. Und sie erzählt von Menschen wie du und ich, von ihren Stärken und Schwächen, von ihrer Warmherzigkeit und Freundlichkeit, aber auch von ihrem Misstrauen und ihrer Engstirnigkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Elizabeth Strout
Bleib bei mir
Roman
Aus dem Amerikanischen vonSabine Roth
Luchterhand
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.Die Originalausgabe erschien 2006 unter demTitelAbide with Me bei Random House, New York.Quellen: William Wordsworth "I wandered lonely as a cloud", © 2007http://gedichte.xbib.de/Wordsworth_gedicht_Narzissen.htm, Deutsch von Bertram Kottmann.
Copyright © der Originalausgabe 2006 Elizabeth Strout
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014 Luchterhand Literaturverlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
DieVeröffentlichung der Übersetzung wurde vereinbart mit Random House, einem Imprint der Random House Publishing Group, Random House Inc., New York
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-13977-3V003www.luchterhand-literaturverlag.de
Bitte besuchen Sie auch unseren LiteraturBlog www.transatlantik.de
facebook.com/luchterhandverlag
twitter.com/LuchterhandLit
Dem Andenken meinesVatersR. G. Strout
ERSTES BUCH
Eins
Ach, Jahre ist das schon her, da lebte ein Pastor mit seiner kleinenTochter in einer Stadt am Sabbanock River, oben im Norden, wo der Fluss noch schmal ist und dieWinter sich damals endlos hinzogen. Der Pastor hießTyler Caskey, und eineWeile wurde seine Geschichte flussauf und flussab und hinüber bis an die Küste erzählt, in so vielenVarianten, dass sie ihre ursprüngliche Schlagkraft verlor, und natürlich tat auch dasVergehen der Zeit das seine dazu. Aber ein paar Leute soll es inWest Annett noch geben, die sich deutlich an die Ereignisse jener winterlichen letzten Monate des Jahres 1959 erinnern. Und wer nur geduldig genug nachfragt und seine Neugier entsprechend zügelt, der bringt sie wahrscheinlich dazu, ihm ihreVersion zu erzählen; wie verlässlich sie ist, steht dann wieder auf einem anderen Blatt.
Unstrittig ist, dass der ReverendTyler Caskey zu der Zeit zweiTöchter hatte, aber die jüngere, die gerade erst laufen lernte, lebte einige Stunden entfernt beiTylers Mutter, ein Stück flussabwärts in einer Stadt namens Shirley Falls, wo sich der Fluss weitete und die Straßen breiter waren und die Bebauung dichter, die Häuser größer, ernster zu nehmen als die Zivilisation umWest Annett. Da oben konnte – und kann – man Meilen auf gewundenen Nebenstraßen fahren, ohne auf mehr zu stoßen als ein paar vereinzelte Farmhäuser hier und dort, umgeben von hektarweise Feldern undWald. In einem solchen Farmhaus wohnten der Pfarrer und die kleine Katherine.
Die Farm musste mindestens hundert Jahre alt sein. Aufgebaut und all die Jahrzehnte bewirtschaftet hatte sie Joshua Locke mit seiner Familie, aber während der großen Depression, als die Farmer keine Saisonarbeiter mehr bezahlen konnten, war sie immer mehr verfallen. Auch die Schmiede der Lockes, die noch aus der Zeit vor dem ErstenWeltkrieg stammte, musste den Betrieb einstellen. Die letzten Jahre hindurch hatte der einzige Erbe allein dort gewohnt, Carl Locke, ein Mann, der sich selten in der Stadt blicken ließ und seinen wenigen Besuchern mit der Flinte in der Hand entgegentrat. Am Ende jedoch vermachte er den ganzen Besitz –Wohnhaus, Scheune und ein paar Morgen Land – den Kongregationalisten, obwohl niemand sich erinnern konnte, dass er die Kirche mehr als zweimal in seinem Leben von innen gesehen hatte.
Nun warWest Annett, trotz der Annett Academy mit ihren drei weißen Gebäuden, eine recht kleine Stadt; auch die Geldsäckel der Kirche waren klein. Als der Reverend Smith,West Annetts Pastor seit unvordenklichen Zeiten, endlich doch in Pension ging und sich mit seiner tauben Frau nach South Carolina aufmachte, wo irgendein Neffe für dasWohlergehen der beiden Sorge tragen würde, vergoss der Gemeindekirchenrat ein paar Krokodilstränen zum Abschied, um sich dann händereibend umzudrehen und ein äußerst vorteilhaftes Immobiliengeschäft zu tätigen. Das Pfarrhaus an der Main Street wurde an den örtlichen Zahnarzt verkauft, und der neue Pastor sollte draußen an der Stepping Stone Road in der Farm der Lockes einquartiert werden.
Auch das hatte bei der Entscheidung fürTyler Caskey eine Rolle gespielt: Seine Jugend, seine unbeholfene Liebenswürdigkeit und seine sichtliche Scheu, über Finanzielles zu reden, so die Überlegung der Auswahlkommission, würden ihn schon davon abhalten, sich über sein Exil zwei Meilen vor der Stadt zu beschweren. Die Rechnung war aufgegangen. Der Pastor hatte sich in den sechs Jahren, die er nun schon dort draußen wohnte, über nichts beklagt und außer darum,Wohn- und Esszimmer rosa streichen zu dürfen, die Kirche auch nie um etwas gebeten.
Nicht zuletzt deshalb blieb das Haus innen wie außen ein wenig heruntergekommen. Es behielt sein kaputtesVerandageländer, die schiefen Eingangsstufen. Aber es hatte diese angenehmen Proportionen, wie man sie bei alten Häusern manchmal findet: zwei hohe Stockwerke mit großzügigen Fenstern und anmutig geneigtem Dach. Und wenn man es sich näher besah – mit der Südsonne, die es von der Seite her bekam, und dem nach Norden gelegenen Hauswirtschaftsraum –, merkte man, dass die Menschen, die es vor Jahren gebaut hatten, mitVerstand und Liebe bei der Sache gewesen waren; es besaß eine Symmetrie, die aus sich heraus wirkte und dem Auge wohltat.
Beginnen wir also mit einemTag Anfang Oktober, den man sich ohne weiteres strahlend schön denken kann, die Äcker um das Haus des Pastors braun und golden, die Bäume auf den Hügeln von einem leuchtenden Gelblich-Rot. Es gab – wie immer – viel Anlass zur Sorge. Die Russen hatten vor zwei Jahren ihre Sputnik-Satelliten in denWeltraum geschickt – einer zog noch immer seine Kreise mit diesem armen toten Hund an Bord – und spionierten uns nun, so hieß es, auch noch von oben aus; auf unserem eigenen Grund und Boden ja sowieso. Nikita Chruschtschow, vierschrötig und bemerkenswert unattraktiv, war zweiWochen zuvor zu einem Staatsbesuch eingetroffen, ob es den Leuten hier passte oder nicht – und vielen passte es nicht, sie fürchteten, er könnte ermordet werden, bevor er es wieder nach Hause schaffte, und was hätte das für Folgen! Experten, wer immer sie waren und wie immer sie es anstellten, hatten ausgerechnet, dass eine Langstreckenrakete von Moskau nach New York nicht weiter als 7,3 Meilen von ihrem Ziel entfernt niedergehen würde, und auch wenn es beruhigend war, außerhalb dieses Radius zu leben, gab es doch drei Familien inWest Annett, die sich im Garten einen Bunker gebaut hatten, man konnte ja schließlich nie wissen …
Dennoch war dies das erste Jahr seit langem, in dem die Anzahl der Kirchenmitglieder landesweit nicht überproportional zum Bevölkerungswachstum gestiegen war, und das musste doch etwas heißen. Möglicherweise hieß es, dass die Menschen nicht überreagierten. Möglicherweise hieß es, dass die Menschen gern glauben wollten – und es offenbar auch glaubten, besonders hier in den nördlichen Ausläufern Neuenglands, wo fast nur Alteingesessene lebten und kaum Kommunisten darunter (gut, bis auf eine Handvoll) –, dass jetzt, nach einem halben Jahrhundert unvorstellbarer menschlicher Gräueltaten, dieWelt vielleicht endlich zu Anstand und Sicherheit und Frieden zurückkehren konnte.
Und der heutigeTag – mit dem wir die Geschichte beginnen wollen – war wunderschön mit seinem Sonnenschein, den fernen Baumkronen in ihrem furchtlos flammenden Gelb und Rot. So sehr solch einTag auch etwas Beängstigendes haben kann, harsch und scharf wie zersplitterndes Glas, der Himmel so blau, dass er in der Mitte auseinanderzubrechen droht, war dieser Herbsttag doch makellos schön. EinTag, an dem man sich den hochgewachsenen Pastor unschwer vorstellen konnte, wie er spazieren ging und dabei dachte: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.Tatsächlich war es in diesem Herbst Reverend Caskeys Gewohnheit, einen Morgenspaziergang die Stepping Stone Road entlang und zurück über den Ringrose Pond zu machen, und an manchen Morgen ging er gleich weiter in die Stadt, zu seinem Büro im Untergeschoss der Kirche, und winkte unterwegs Leuten, die zum Gruß auf die Hupe tippten, oder blieb stehen, um ein paarWorte mit jemandem zu wechseln, der rechts ranfuhr, beugte den schweren Körper zum Fenster hinunter, lächelte, nickte, die Hand auf derTürkante, bis das Fenster hochgekurbelt wurde und er noch einmal kurz winkte.
Aber nicht heute Morgen.
Heute Morgen saß er zu Hause in seinem Arbeitszimmer und trommelte mit einem Stift auf die Schreibtischplatte. Gleich nach dem Frühstück hatte ihn die Schule seinerTochter angerufen. DieVorschullehrerin seinerTochter war eine junge Frau namens Mrs. Ingersoll, und sie hatte den Pastor mit einer bemerkenswert hellen Stimme – ein klein bisschen spitz für seinen Geschmack – für den späten Nachmittag zu einem Gespräch über Katherines Betragen gebeten.
»Gibt es ein Problem?«, hatte der Pastor gefragt. Und in der Pause, die folgte, sagte er: »Ich komme natürlich«, und stand auf, den schwarzen Hörer in der Hand, während er sich im Zimmer umsah, als hätte er etwas verlegt. »Danke für Ihren Anruf«, fügte er hinzu. »Wenn es irgendwelche Probleme gibt, will ich das natürlich wissen.«
Unter seinem Schlüsselbein stellte sich ein kleiner stechender Schmerz ein, und als er die Hand darauflegte, fühlte er sich einen Moment lang absurderweise wie beim Fahneneid. Danach ging er mehrere Minuten vor seinem Schreibtisch auf und ab und klopfte sich mit den Fingern an den Mund. Einen solchen Einstieg in denTag kann niemand gebrauchen, aber am allerwenigsten Reverend Caskey, der es schwer genug gehabt hatte in letzter Zeit, und während die Leute sich über diesen Umstand durchaus im Klaren waren, war der Mann inWahrheit viel mehr am Boden, als irgendjemand ahnte.
Das Arbeitszimmer des Pastors in dem alten Farmhaus war das ehemalige Schlafzimmer von Carl Locke. Es war ein großer ebenerdiger Raum mit Blick auf ein nach der Seite hinausgehendes Gärtchen, das einmal sehr hübsch gewesen sein musste. Eine alteVogeltränke stand noch in der Mitte eines kleinen Rondells aus inzwischen größtenteils zerbrochenen Steinplatten, und Ranken überwucherten ein schief hängendes Spalier, hinter dem ein StückWiese und eine alte, gleichsam außer Sicht humpelnde Steinmauer zu sehen waren.
Trotz aller Geschichten, dieTyler Caskey über den griesgrämigen und, wie manche sagten, verdreckten alten Mann gehört hatte, der den Raum vor ihm bewohnt hatte, und trotz der Klagen seiner Frau über den Uringeruch, den sie hier noch Monate nach dem Einzug an warmenTagen auszumachen meinte, mochteTyler das Zimmer. Er mochte den Ausblick; er empfand nach all der Zeit sogar eine gewisse Seelenverwandtschaft mit dem alten Mann selbst. Und jetzt dachteTyler, dass er seinen Morgenspaziergang heute ausfallen lassen würde; er wollte einfach hier sitzen, wo ein anderer vor ihm mit Fragen der Rechtschaffenheit und im Zweifel auch mit seiner Einsamkeit gehadert hatte.
Eine Predigt musste vorbereitet werden. Stets musste eine Predigt vorbereitet werden, und die für den kommenden Sonntag sollte denTitel »Über die Fallstricke der Eitelkeit« tragen. Ein kniffligesThema, das Fingerspitzengefühl erforderte (was für Beispiele würde er anführen?), zumal er mit seiner Botschaft eine Krise abzuwenden hoffte, die am Gemeindehorizont vonWest Annett heraufzog, eine Krise wegen der Anschaffung einer neuen Orgel. In einer kleinen Stadt mit nur einer Kirche kann die Frage, ob diese Kirche eine neue Orgel braucht, naturgemäß hoheWellen schlagen; die Organistin, Doris Austin, war geneigt, jeglichen Einwand als Anschlag auf ihre Person zu sehen – eine Haltung, die all jenen mit einer natürlichen Skepsis gegen jede Art vonVeränderung sauer aufstieß. Und in Ermangelung anderer großerThemen stand die Stadt kurz davor, dies zu ihremThema zu machen. Reverend Caskey war gegen die Orgel, sagte das aber nicht öffentlich, sondern versuchte nur, mit seinen Predigten Denkanstöße zu geben.
Am letzten Sonntag warWeltkommunionstag gewesen, und der Pastor hatte diesen Aspekt unmittelbar vor der Kollekte betont: Sie waren Christen in Kommunion mit derWelt.Traditionsgemäß hatte am Freitag vor demWeltkommunionstag ein Mittagsgottesdienst für die Damen vom Frauenbund stattgefunden, und bei der Gelegenheit hatte der Pastor bereits über die Fallstricke der Eitelkeit sprechen wollen, um Geist und Sinn dieser Frauen – deren Bemühungen die Kirche einen großenTeil ihrer Mittel verdankte – behutsam von extravaganten Begehrlichkeiten wegzulotsen (JaneWatson wollte eine neue Garnitur Leinentischdecken für den Kirchenkaffee). Aber er war außerstande gewesen, seine Gedanken zu sammeln, und obwohl er sich gern als jemand sah, der seine Zuhörer, bildlich gesprochen, sanft bei ihren weißen, neuenglischen Schlafittchen packte – Jetzt schön die Ohren aufgesperrt! –, war ihm seine freitägliche Darbietung zur Enttäuschung geworden; er hatte nur ganz allgemeine Lobesworte gefunden, für selbstlosen Einsatz, gesammelte Spenden.
Ora Kendall, deren tiefe StimmeTyler immer in drolligem Gegensatz zu ihrem kleinen Gesicht und den wilden schwarzen Locken zu stehen schien, hatte ihn eine Stunde nach dem Gottesdienst angerufen und ihren unausbleiblichen Kommentar abgegeben. »Zwei Sachen,Tyler. Alison stört es, wenn Sie katholische Heilige zitieren.«
»Na ja«, sagteTyler leichthin, »darum mache ich mir jetzt keine großen Gedanken.«
»Zweitens«, sagte Ora. »Doris will diese neue Orgel noch dringender, als sie sich von Charlie scheiden lassen und Sie heiraten will.«
»Das mit der Orgel, Ora – darüber entscheidet der Gemeindekirchenrat.«
Ora brummte zweifelnd. »Jetzt tun Sie nicht so,Tyler.Wenn Sie irgendwelches Engagement dafür zeigen, würde derGemeindekirchenrat sofort zustimmen. Sie sind ihr das schuldig, findet sie, weil sie so einzigartig ist.«
»Jeder Mensch ist einzigartig.«
»Genau. Deshalb sind auch Sie der Pastor und nicht ich.«
Heute Morgen versuchteTyler Caskey sich erneut an ein paar Zeilen zumThema Eitelkeit. Er hatte sich Stichpunkte zu Prediger 12 gemacht, über die Sinnlosigkeit des Lebens aus der menschlichen Sicht »unter der Sonne«. »Unter der Sonne ist alles eitel und ein Haschen nachWind«, hatte er geschrieben. Er klopfte mit seinem Stift, statt weiter auszuführen, dass der Blickwinkel der »über der Sonne« sein musste, der das Leben als ein Geschenk aus der Hand Gottes offenbarte. Nein, er saß nur da und sah aus dem Fenster.
Seine blauen, weit geöffneten Augen registrierten weder dieVogeltränke noch die Steinmauer oder sonst irgendetwas; sie starrten ins Leere. Erinnerungsfetzen trieben an den Rändern seines Bewusstseins vorbei – das Plakat, das in seinem Kinderzimmer gehangen hatte: EIN ARTIGER JUNGE GIBT KEINEWIDERWORTE, Picknicktische auf derWiese der Applebys, wo in einem Erdloch Bohnen für die gesamte Nachbarschaft schmorten, die braunenVorhänge imWohnzimmer des Hauses, in dem seine Mutter noch immer wohnte, jetzt mit der Kleinen, Jeannie – und an dieser Stelle blieben seine Gedanken hängen: die besitzergreifende Art, mit der die großen Hände seiner Mutter die zarten Schultern des Kindes durch das Zimmer lenkten.
Der Pastor blickte hinab auf den Stift, den er hielt. »Die beste Lösung in einer schwierigen Situation«, so hatte er es anfangs erklärt, aber jetzt waren keine Erklärungen mehr nötig. Alle wussten, wo das Kind war, und niemand hatte seinesWissens etwas an der Regelung auszusetzen. Und tatsächlich missbilligte sie niemand.VonVätern wurde damals nicht erwartet, dass sie kleine Kinder allein großzogen, erst recht nicht, wenn so wenig Geld da war; und auch wenn der Frauenbund ihm die Dienste von Mrs. Connie Hatch zurVerfügung stellte, die (für ein paar Cent) im Haushalt aushalf, sah die Gemeinde ein, dass das Mädchen bis auf weiteres besser bei seiner Großmutter Caskey aufgehoben war – die im Übrigen nie angeboten hatte, auch die kleine Katherine zu sich zu nehmen.
Nein, Katherine war sein …
Kreuz, schoss es ihm durch den Kopf, und er verzog das Gesicht, denn sie war ja nicht das Kreuz, das ihm auferlegt war. Sie war das Geschenk, das Gott ihm gemacht hatte.
Er setzte sich gerade hin, so wie er nachher vielleicht beim Gespräch mit der jungen Lehrerin sitzen würde – ernsthaft lauschend, die Hände um die Knie gelegt. Aber seine Manschetten waren ausgefranst.Wieso sah er das jetzt erst? Er inspizierte sie gründlicher und stellte fest, dass das Hemd ganz einfach alt war, an dem Punkt angelangt, wo seine Frau es ihm weggenommen, die Ärmel auf halbe Länge abgeschnitten und es zu ihrer pinkfarbenen Gymnastikhose angezogen hätte.
»Das befreit mich«, hatte sie immer gesagt. Aber manchmal war sie in diesem Aufzug auch an dieTür gegangen, und als er einmal im Scherz gesagt hatte, dass ihn das seine Stelle kosten könnte, denn wenn Marilyn Dunlop zum Pfarrhaus kam und die Frau des Pastors in einem abgeschnittenen Männerhemd und Gymnastikhose antraf und den anderen dann vielleicht noch in ausgeschmückter Form davon berichtete …, war die Antwort seiner Frau gewesen: »Sag mal,Tyler, gibt es eigentlich noch irgendwas, was ich allein entscheiden darf?« Denn es kränkte sie furchtbar, dass die Mauern des alten Farmhauses nicht ihr Eigentum waren, sondern das der Kirche, und sie nicht einmal eineWand streichen durften ohne Genehmigung – obwohl die natürlich erteilt worden war, zumal der Pastor die Farbe selbst kaufte. »Ich will alles pink!«, hatte seine Frau überschwänglich ausgerufen und die Arme in die Luft geworfen, und er hatte ihr später wohlweislich nicht erzählt, dass seine Schwester Belle bei einem Besuch gesagt hatte: »Du liebe Güte,Tyler – als würdet ihr in einem Bubblegum wohnen!« (Und jetzt eben leuchtete das ganzeWohnzimmer bonbonrosa, dieWände glühten in dem hellen Sonnenlicht in einem rosigen Schein, der sich bis in den Flur zu ergießen schien, so dass er ihn durch dieTür seines Arbeitszimmers sehen konnte.)
Tyler stand auf und ging hinaus auf den Flur, durch das rosaWohnzimmer. »Mrs. Hatch?«, rief er.
Connie Hatch besorgte gerade den Frühstücksabwasch und drehte sich mit dem Geschirrtuch in den Händen um. Sie war eine große Frau, fast so groß wie er. Es ging das Gerücht, dass sich vor Generationen ein Agawam-Indianer in Connies Stammbaum geschmuggelt hatte, und wenn man ihre Züge eingehender betrachtete, konnte einem das durchaus plausibel erscheinen, denn ihre Backenknochen waren hoch und breit und die Augenbrauen schwarz, nicht allerdings ihre Haare, die von einem sanften Braun waren und so lose zurückgesteckt, dass sie ihr immer wieder ins Gesicht fielen, manchmal bis über das Feuermal an ihrer Nase, das so rot leuchtete wie Himbeermarmelade. Sie hatte grüne Augen, die sehr hübsch waren.
»Was mache ich da am besten?« Er hielt die Handgelenke hoch. Dem Pastor war es ernst mit seiner Frage, seine Augen forschten im Gesicht der Haushälterin.Vielleicht war es das, mehr noch als alles andere, was seine anhaltende Beliebtheit in der Gemeinde ausmachte: diese Momente plötzlicher Ratlosigkeit, fundamentalerVerunsicherung. Gerade angesichts seiner sonstigen Beherrschtheit, der sanften, zerstreuten Ergebenheit, mit der er sein Unglück trug, erlaubten es diese Augenblicke offen eingestandenen Nicht-weiter-Wissens den Menschen – besonders den Frauen, aber keineswegs nur ihnen –, ihren Pastor als jäh und ungeahnt verwundbar zu sehen, was ihn die restliche Zeit nur umso stoischer erscheinen ließ. Heldenhaft fast schon.
»Wegen was?«, fragte die Haushälterin. Sie hielt das Geschirrtuch in beiden Händen und besah sich die Manschetten. »Das Hemd haben Sie aufgetragen, würde ich sagen.« Connies dunkle Brauen mit den wenigen grauen Haaren darin hoben sich in einer Art müder Anteilnahme. »Kommt vor«, sagte sie und trocknete sich die Hände zu Ende.
»Meinen Sie, ich sollte ein neues Hemd kaufen?«
»Auf jeden Fall.« Mit dem Handrücken schob sie eine Haarsträhne zurück, die hinter ihrem Ohr hervorgerutscht war, kramte dann in derTasche ihres Pullovers und fischte eine Haarklammer heraus. »Liebe Güte. Kaufen Sie zwei.«
Der Pastor, erleichtert über diese klar umrissene Aufgabe, beschloss, nach Hollywell zu fahren und seine Einkäufe dort zu erledigen; zu groß erschien ihm die Gefahr, näher anWest Annett einem seiner Gemeindeglieder in die Arme zu laufen, das sich – nach Sonntag – fragen könnte, ob nicht er am Ende selbst über die Fallstricke der Eitelkeit gestolpert war. Er griff sich seine Brieftasche, den Autoschlüssel, den Hut, und indem er die Anfangszeilen eines Lieds aus dem Gesangbuch summte, die ihm in den Kopf gekommen waren, »ich trau auf dich, umgeben von Getreuen«, stieg er die schiefenVerandastufen hinunter.
Ein Eichhörnchen trippelte über dieVeranda, einWindzug ließ einen Zweig gegen einen Fensterladen tippen. Im Haus war es still bis auf das Klappen einer Schranktür, als Connie Hatch die Badehandtücher einräumte und dann demWohnzimmerboden mit dem Mopp zu Leibe rückte. Ein paarWorte zu Connie. Die Frau war sechsundvierzig. Sie hatte gedacht, sie würde Kinder haben, aber es waren keine gekommen. Das, imVerein mit gewissenVorfällen, zu denen es gekommen war (Geheimnissen, die sie im Schlaf heimsuchten, oft mit dem quälenden Anblick zweier starrender Augen), hielt sie unter einer unsichtbaren Glocke wachsenderVerwirrung gefangen, und wäre jemand in dasWohnzimmer des Pastors getreten und hätte gefragt: »Connie, wie war dein Leben bisher?«, wäre sie um eine Antwort verlegen gewesen. Gut, das würde natürlich nie passieren.
Aber es bereitete ihr Mühe, einen Gedanken im Kopf zu behalten. In ihrem Hirn herrschte ein Geflimmer wie bei einem schlecht eingestellten Fernsehkanal in dem Apparat, den ihr Mann letztenWinter mit nach Hause gebracht hatte. Sie hatte es versäumt, den Pastor zu fragen, ob er rechtzeitig zum Mittagessen zurück sein würde – eher nicht, wenn er bis nach Hollywell fuhr, aber die Ungewissheit, diese Unsicherheit, was von ihrerwartet wurde, setzte ihr zu. (Dabei war der Pastor der unproblematischste Dienstherr, den sie je gehabt hatte; bei seiner Frau war das anders gewesen.)Vor Jahren hatte Connie sich in der Schule schwergetan, und kein Feuermal hatte sie so gezeichnet wie dieses Gefühl damals – die rotglühende Angst vor der Note oben auf dem Blatt, vor den rot bekritzelten Rändern, dem Lehrer, der in Großbuchstaben geschrieben hatte: DAS HIRN IST ZUM BENUTZEN DA, CONNIE MARDEN! Connie rammte den Mopp gegen den klobigen hölzernen Fuß der Couch.Wenn der Pastor doch zum Mittagessen zurückkam, würde sie ihm eineTomatensuppe aus der Dose warm machen und dazu ein paar Salzkräcker buttern, das schmeckte ihm immer. Sie hielt inne, um sich das Haar neuerlich nach hinten zu stecken.
Wusste Connie – wahrscheinlich schon –, dass sie eine jener Frauen war, an der man im Lebensmittelladen vorbeiging und sie sah, ohne sie zu sehen? Aber es war eineWeichheit in ihren Zügen, ein anrührendes Zögern, als hätte sie viele Jahre versucht, fröhlich zu sein, und nun hätte sie es aufgegeben, auch wenn die Spuren einer früheren, eifrigen Herzlichkeit noch erkennbar waren. Ihr Gesicht hatte sich nicht verhärtet, anders als bei so vielen Frauen in der Gegend, Frauen, deren Gesichter schon in mittleren Jahren fast Männergesichter hätten sein können – nicht das von Connie Hatch.
Die Leute sagten auch jetzt noch manchmal: »Aber schöne Augen hat sie, wirklich«, auch wenn das Gespräch danach meist zum Erliegen kam, denn was ließ sich noch mehr über Connie sagen? Sie war seit Jahren mit Adrian Hatch verheiratet, und eine Zeitlang hatte sie in der Internatsschule in der Küche gearbeitet und dann im Bezirksaltenheim, aber dort hatte sie vor zwei Jahren aufgehört, um sich um ihre Schwiegermutter zu kümmern, eine wahrlich aufopferungsvolle Entscheidung, da waren sich alle einig, denn Evelyn Hatch wurde weder gesünder noch kränker und blieb eisern in dem großen alten Haus der Hatchs wohnen, während sich Connie und Adrian mit demTrailer nebenan begnügen mussten.
Später sollten die Leute versuchen, sich auf alles zu besinnen, was sie über Connie wussten. Nur wenigen fiel dabei ein, wie sehr sie an ihrem Bruder Jerry gehangen hatte, welcheVeränderung mit ihr vor sich gegangen war, als er im Koreakrieg umkam. Connie hatte aufgehört, in die Kirche zu gehen. Einige der Damen vom Frauenbund stießen sich daran; Connie war es egal.Was ihr nicht egal war, als sie nun hinaus auf die Hintertreppe trat, um den Mopp auszuklopfen, war Adrians Schweigen gestern Abend, als Evelyn zu ihr gesagt hatte: »Du hast ja nicht mal deinen Köter im Griff, Connie. Stell dir vor, du hättest Kinder gehabt!« Und Adrian hatte einfach bloß in derTrailertür gestanden und sie mit keinemWort verteidigt.
Connie schüttelte den Mopp so heftig, dass der Aufsatz davonflog und sie die Stufen hinuntersteigen und zwischen Blättern und Kieseln herumstochern musste, während die Sonne grell auf die Scheunenwand schien.
Der Pastor fuhr über Nebenstraßen nach Hollywell, auf der Suche nach Gott und auf der Flucht vor seinen Schäfchen. Er fuhr mit heruntergekurbeltem Fenster, den Ellbogen über der Kante, und reckte ab und zu den Kopf vor, um bessere Sicht auf die fernen Hügel zu haben oder auf eineWolke, so weiß wie ein dicker Sahneklecks, oder auf eine frisch gestrichene Scheunenwand, deren kräftiges Rot in der Herbstsonne glühte, und dabei dachte er: Früher einmal wäre mir das aufgefallen. Dabei fiel es ihm ja auf. Dieses Gefühl derWidersinnigkeit war eines, das er zu fürchten gelernt hatte, und deshalb fuhr er langsam – deshalb und weil ihn manchmal die grauenhafteVorstellung plagte, er könnte ein Kind überfahren (obwohl weit und breit kein Mensch zu sehen war), oder er könnte, ohne es zu wollen, gegen einen Baum prallen.
Halt deinTempo, dachte er.
Und halte Ausschau nach Gott. Der, wenn man die Psalmen ernst nahm, wasTyler tat, in dieser Sekunde aus dem Himmel herniederblickte, auf sämtliche Menschenkinder und sämtliche ihrerWerke. AberTylers wahre Sehnsucht war es, von dem GEFÜHL ergriffen zu werden; das Licht zu sehen, das über die schwankenden Zweige einerTrauerweide spielte, die Gräser, die sich imWindhauch zu dem Spalier von Apfelbäumen hinneigten, den Schauer gelber Ginkgoblätter, die mit solch zarter und süßer Selbstverständlichkeit zur Erde herabsanken, und zu wissen, tief und unumstößlich zu wissen: Hier ist Gott.
AberTyler misstraute Abkürzungen, und seine Angst vor billiger Gnade saß tief. Er dachte oft an Pasteurs Ausspruch, laut dem der Zufall nur den vorbereiteten Geist begünstigt, und der Moment erhabener Einsicht, auf den er dieserTage hoffte, sollte das »zufällige« Ergebnis seines disziplinierten Betens sein. Eine Furcht lebte in ihm, eine dunkle Höhle in seinem Innern: die Angst, dass ihn das GEFÜHL vielleicht nie wieder ergreifen würde. Dass diese erhebenden Augenblicke derTranszendenz nichts als das Resultat einer jugendlichen – und möglicherweise unmännlichen – Form der Hysterie gewesen sein könnten, ähnlich jener, die in ihrer Extremform vermutlich die heiligeTheresia von Lisieux hervorgebracht hatte, die noch als junges Mädchen gestorben war und deren Unschuld sein Fassungsvermögen himmelweit überstieg. Ja,Tyler war derzeit erdgebunden, und er fügte sich darein. Sonnenlicht spiegelte sich in der Haube seines alten roten Ramblers, während die Reifen über den Asphalt grummelten. Er kam an einerWeide voll Kühen vorbei, an einem Kürbisstand. Auf dem Heimweg sollte er vielleicht einen Kürbis für Katherine kaufen.
Und nun lag vor ihm die Hauptstraße von Hollywell mit ihrem efeuüberwachsenen Postamt und einem freien Parkplatz nur ein paar Schritte vom Herrenbekleidungsgeschäft. Seid dankbar in allen Dingen, undTyler parkte ein, tastete noch einmal nach seiner Brieftasche, trat hinaus in den Sonnenschein.
Aber …
Oje.
Auf der anderen Straßenseite, an der Ampel – die in diesem Moment auch noch umsprang –, stand Doris Austin, ihren dunklen Zopf zu einem säuberlichen kleinen Korb oben auf dem Kopf geschlungen, in einer Hand ein Päckchen, in der anderen eine braune Handtasche, und warf einen gewissenhaften Blick nach rechts, dann nach links, bevor sie sich anschickte, die Straße zu überqueren, und jede Sekunde würde sie aufschauen und Reverend Caskey bemerken, und, nein, er wollte ihr nicht begegnen. Er flüchtete in eine Apotheke. Eine kleine Glocke bimmelte, als er auf die Gummimatte trat.
Man steigt nie zweimal in denselben Fluss, hatte Heraklit gesagt, und daran mussteTyler nun denken, als er in der Apotheke stand, denn er hatte häufig das Gefühl, als würde um ihn herumWasser rauschen, und Doris Austin wäre ein Stöckchen, das sich in einem kleinen Strudel um seine Knöchel fing, weil die Frau (die in der Kirche die Orgel spielte und den Chor dirigierte) immer da auftauchte, wo er war, ob auf dem Parkplatz vor der Kirche oder an der Fleischtheke im Lebensmittelladen, und mit leiser, vertraulicher Stimme sagte: »Wie geht es Ihnen,Tyler? Kommen Sie einigermaßen zurecht?« Es machte ihn ganz kribbelig.
Trotzdem hatte er letzten Sonntag nach dem Gottesdienst, als Doris imVorraum ihren Pullover übergezogen hatte, zu ihr gesagt: »Was wäre diese Gemeinde ohne Sie, Doris. Unsere schöne Musik – das hält keiner für selbstverständlich.« Dabei taten die Leute natürlich genau das. Im Zweifel machten sich manche sogar über Doris lustig, wenn sie nach Hause kamen und sich zu ihrem Sonntagsessen hinsetzten, denn kein Abendmahlsgottesdienst verging, ohne dass die Frau ein Solo sang, und jedes Mal war es wieder peinlich – nicht nur anzuhören, sondern auch anzusehen. Ein Chormitglied spielte ein paarTöne auf der Orgel, und Doris stellte sich vorn an der Brüstung in Positur und wiegte den Oberkörper hin und her.Tyler in seinemTalar saß auf seinem Stuhl beim Altar und stützte den Kopf in die Hand, die Augen geschlossen wie zu andächtiger Meditation, während er sich im Grunde nur den Anblick der zappelnden Gemeinde ersparen wollte, der haltlos kichernden halbwüchsigen Mädchen in der letzten Bank.
Aber als er letzten Sonntag Doris’ dramatischenTremoli gelauscht hatte, war es ihm plötzlich erschienen, als bräche sich hier ein verzweifelter innerer Schrei Bahn. Ein kreischender Appell aus tiefster Seele, ein Betteln darum, nicht übergangen zu werden. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und erhöre mich! Und als er dann imVorraum auf sie getroffen war, hatte er gesagt: »Unsere schöne Musik – das hält keiner für selbstverständlich.« Aber die wässrige Dankbarkeit in ihrem Blick, während sie sich den Pullover überzog, erschreckte ihn, und er dachte, dass er wohl am besten nicht zu lange verweilte, wenn er sie lobte. Er lobte gern – das war schon immer so gewesen.Wer fürchtete sich denn nicht im tiefsten Innern, so wie Pascal, vor jenen »Räumen des Nichts … die von mir nichts wissen«?Wer auf Gottes weiterWelt, dachte er, war nicht froh zu hören, dass sein Dasein etwas bedeutete?
Aber es kam noch etwas hinzu. An jedem Abend seiner Kindheit hatteTylersVater ihn ermahnt: »Immer rücksichtsvoll sein,Tyler. Immer zuerst an den anderen denken.« (Wer kann dieWirkung solcher Lektionen abschätzen?) Und wenn das irgendwie in seinen Kampf hineinspielte, trotz allem auch an seine eigene Bedeutung zu glauben, so dachte er über dieseVerbindung nicht groß nach. Bewusst waren ihm lediglich die schlichtenTatsachen:Während sein Bedürfnis, Lob zu spenden, stärker geworden war, hatte auch seinWunsch, die Menschen zu meiden, zugenommen. Jetzt stand er da und schielte verstohlen auf die Zahnpastatuben.
»Kann ich Ihnen helfen?« Eine Frau lehnte sich über eineTheke mit Kosmetikprodukten.
»Hmm, gute Frage«, sagte Reverend Caskey. »Tja – was wollte ich hier gleich wieder?«
»Das kenne ich«, sagte die Frau. Ihre Fingernägel waren in einem blassen Perlmuttton lackiert. »Ich habe irgendeinen Gedanken im Kopf, und schwupp, ist er weg.« Sie schnippte mit den Fingern, ein weiches Geräusch.
»Ich weiß genau, was Sie meinen«, sagteTyler kopfschüttelnd. »Mein Gedächtnis ist das reinste Sieb. Pepto-Bismol! Pepto-Bismol war’s.« Er stellte die Flasche auf den Ladentisch.
»Wissen Sie, was mir vor ein paarTagen passiert ist?« Die Frau berührte ihr Haar mit der Handfläche, beugte sich ganz selbstverständlich vor, um sich in dem Spiegel neben der Kosmetiktheke zu betrachten. »Ich habe in den Kühlschrank geschaut und gedacht:Was suche ich eigentlich? Eine halbe Ewigkeit stand ich da. Und dann kam es mir endlich.«
Der Pastor drehte sich im selben Moment um, in dem Doris Austin durch dieTür trat und die kleine Glocke anschlug. »Ach, Doris, hallo«, sagteTyler, gerade als die Frau hinter dem Ladentisch sagte: »Ich hatte das Bügeleisen gesucht. Kann ich Ihnen helfen?«
»Das Bügeleisen.« Bei allerVerwirrung meinteTyler aus Doris’ Blick Scham zu lesen – sie war ihm gefolgt. »Wie geht es Ihnen?«, fragte er. »An diesem strahlendenTag.« Er wölbte seine große Hand um das Pepto-Bismol. »Sie erzählt mir gerade«, sagte er mit einem Nicken in Richtung der Frau hinter dem Ladentisch, »wie sie in ihrem Kühlschrank stundenlang nach dem Bügeleisen gesucht hat.«
»Stundenlang habe ich nicht gesagt. Kommt noch etwas dazu?«
»Nein, das wäre alles.« Der Pastor zückte seine Brieftasche. »Nicht stundenlang. Natürlich.«
»Sind Sie krank?«, fragte Doris. »Hat dieser ekelhafte Darminfekt Sie erwischt, der gerade umgeht?«
»Nein, nein. Nein, Doris. Mir fehlt nichts. Katherine hatte nur gestern Abend ein bisschen Bauchweh. Nichts Schlimmes.«
»Ich weiß ja nicht, ob Kinder so was nehmen sollten«, sagte Doris, und er machte sich klar, dass sie nur zu helfen versuchte – als nützliches Gemeindeglied.
»Wie alt ist sie denn?«, wollte die Frau hinter dem Ladentisch wissen. Sie gab ihm dasWechselgeld, und ihre Fingernägel streiften seine Handfläche.
»Katherine ist fünf«, sagte der Pastor.
»Arnold, darf eine Fünfjährige schon Pepto-Bismol nehmen?«, rief die Frau.
Der Apotheker an der Rückwand des Ladens sah auf. »Symptome?«
»Ein bisschen Magenweh. Hin und wieder.«Tyler hatte zu schwitzen begonnen.
»Ich könnte mir ja vorstellen, dass sie nicht genug isst«, steuerte Doris bei. »Sie ist so ein winziges kleines Ding.«
»Wie viel wiegt sie?«, fragte der Apotheker.
»Genau weiß ich es nicht«, sagteTyler. Der Hund seiner Mutter wog einunddreißig Kilo. Alle sahen ihn an.
»Eine kleine Dosis können Sie ihr geben«, sagte der Apotheker. »Aber wenn sie öfter Magenweh hat, müssen Sie mit ihr zum Arzt.«
»Natürlich. Danke.« Reverend Caskey nahm die weiße Papiertüte und ging zurTür.
Doris folgte ihm nach draußen, ohne etwas gekauft zu haben, was hieß, dass sie ihm tatsächlich gefolgt war. Er hatte eine flüchtigeVision, wie sie mit ins Herrenbekleidungsgeschäft kam und Kommentare zu den Hemden abgab. Auf dem sonnigen Gehsteig sagte sie: »Sie kommen mir auch dünner vor,Tyler.«
»Ach, mir geht’s gut.« Er hob die weiße Papiertüte zum Abschiedsgruß. »Kosten Sie dieses wunderbareWetter aus.« Und er wandte sich in die andere Richtung, zum Kleidergeschäft.
Er kaufte zwei weiße Hemden bei einem Mann, den er imVerdacht hatte, homosexuell zu sein. »Recht schönen Dank«, sagteTyler mit kurzem Lächeln und sah ihm geradewegs in die Augen, als er das Paket entgegennahm, und dann war es geschafft; wieder hinaus auf die Straße, hinein ins Auto, wo die Sonne ihm zu folgen schien wie ein greller Punktscheinwerfer, während er denWagen über die kurvenreichen Straßen vorsichtig zurück nach Hause lenkte.
Das Geflimmer füllte Connies Kopf vollständig aus, während sie das Mittagessen für den Pastor zubereitete – er hatte doch nicht in Hollywell gegessen. Als sie ihn mit der kleinen Glocke zum Essen rief, kam er in die Küche und sagte: »Mrs. Hatch, darf ich Sie etwas fragen? Finden Sie, Katherine sollte mehr mit anderen Kindern spielen? Soll ich ein paar Kinder hierher einladen?« Er zog einen Stuhl heraus und setzte sich schwerfällig an den Küchentisch, die langen Beine nach der Seite übergeschlagen. »Ich wollte das gern mit Ihnen besprechen, bevor sie heimkommt.« Das Kind wurde morgens von der Mutter eines Jungen, der ein Stück weiter straßenaufwärts wohnte, mit in die Schule genommen und nach dem Mittagessen wieder daheim abgeliefert.
Connie wandte sich ab und spülte den Suppentopf aus. »Schaden könnte es wahrscheinlich nicht«, sagte sie. Aber es machte sie verlegen – begriff er es denn nicht? Die Kinder wolltennicht mit dem Mädchen spielen. Connie hatte die Leute das sagen hören, und sie konnte es nachfühlen. »Sie ist sehr still«, sagte Connie. »Ich weiß nicht, was man da tun kann.« Connie war froh, dass es nicht ihre Aufgabe war, die Kleine liebenswerter zu machen. Sie hatte Mitleid mit ihr – wer hatte das nicht? –, aber Katherine zu mögen, dieses abweisende, stumme Kind, fiel nicht leicht.
»Ihre Lehrerin hat heute Morgen angerufen. Ich soll nach der Schule zu einem Gespräch kommen. Ich ziehe mir besser ein anderes Hemd an.« Aber der Pastor blieb sitzen. Er fügte hinzu: »Ich denke, es wird schon werden. Kinder sind zäh, wissen Sie.«
Connie öffnete den Kühlschrank, räumte die Butterdose hinein. Sie wischte sich die Hände am Geschirrtuch ab. »Ach«, sagte sie milde, »Katherine packt das. Man muss ihr eben Zeit lassen.«
Trotzdem. Es war jetzt ein Jahr her, und das Kind, das in der Nachmittagssonne Eicheln aufklaubte und seine neuen roten Schuhe durch den Kies zog (ein Geschenk vonTante Belle, die bei einem Besuch letzteWoche festgestellt hatte, dass das Mädchen jammervoll schlecht ausgestattet war für die weite neueWelt derVorschule) – ein Jahr war es jetzt her, und das Kind hatte kaum einmal den Mund aufgemacht.
Es war traurig. Gar keine Frage. Aber das Kind konnte einen aufbringen mit seiner Art. Es brachte Connie Hatch auf, die noch nicht vergessen hatte, dass die Kleine sie »Nebeltröte« zu nennen pflegte, damals, als sie noch redete, munter allen etwas vorplapperte, aber am meisten der schillernden, üppigen Frau, die ihre Mutter gewesen war. Der Frau, von der höchstwahrscheinlich auch der Spitzname Nebeltröte stammte, und es war absurd – wo Connie doch so schweigsam war.
Gut, das war das Kind jetzt auch. Und eigen. »Vielleicht ist sie nicht von ihm«, hatte JaneWatson neulich gesagt. »Schau mal genau hin. Keinerlei Ähnlichkeit mitTyler.«
Allerdings ähnelte die Kleine keinem Elternteil. Noch nicht. Nicht jetzt, während sie durch den Kies der Einfahrt schlurfte, die Faust um ein paar Eicheln geballt. Nichts deutete auf die Größe ihresVaters oder die Üppigkeit ihrer Mutter hin. Und obwohl sich mit den Jahren Stirn und Mund des Pastors in bestürzender Exaktheit im Gesicht seinerTochter wiederfinden sollten, hatte das Mädchen jetzt noch etwas fastTierhaftes, als käme es aus dem Nichts oder wäre ganz allein auf derWelt, lebte in derWildnis vonWurzeln und Nüssen: magere kleine Gliedmaßen und Haare, so fein, dass sie am Hinterkopf zu einem Dauernest verfilzt waren und vorn strähnig herunterhingen.
In der Schule strich die Lehrerin Katherine das Haar aus dem Gesicht. »Stört dich das nicht, Katie, wenn dir die Haare so in die Augen hängen?« Dann starrte Katherine sie mit dem gleichen leeren Blick an, mit dem sie jetzt auf die Spucke starrte, die sie im Mund gesammelt hatte und die auf der Spitze ihres verschrammten Schuhs gelandet war.
Aber hier war der Schuh ihresVaters, riesig und schwarz in dem knirschenden Kies, und hier war sein Gesicht, dicht vor ihrem. »Wie war’s heute in der Schule?« Er hatte sich vor sie hingekauert und teilte den Pony, der ihr über die Augen fiel.
Sie wandte das Gesicht ab.
»War heute was Besonderes in der Schule?«
Katherine warf ihremVater einen raschen Blick zu und sah dann wieder fort, an seinem abgewinkelten Bein vorbei zum Scheunentor, vor dem die Schwalben hin und her flitzten. Denn es war etwas gewesen in der Schule, etwas ganz und gar Unglaubliches. Eins von den Mädchen in der Klasse hatte zu ihrem rosa Kleid blaue Schuhe angehabt und ein anderes zu ihrem blauen Kleid rosa Schuhe. Katherine hatte ihnen den ganzenTag folgen müssen, völlig gebannt von einem solchen Aufeinandertreffen vertauschter Farben.
»Mrs. Ingersoll«, hatte das eine Mädchen gesagt, »Katie soll damit aufhören. Sie soll weggehen.«
»Lieb sein«, sagte Mrs. Ingersoll. Sie legte Katherine die Hand auf die Schulter und steuerte sie ein Stück fort, so dass Katherine den Hals verrenken musste, um richtig sehen zu können.
Sie lief zu ihnen zurück, sie wollte ihnen sagen, wenn sie einfach nur Schuhe tauschten, dann wäre alles gut. Aber die Mädchen befahlen ihr abzuhauen. Sie warfen ihre langen Haare nach hinten und sagten Heulsuse zu ihr, dabei heulte sie gar nicht. Sie lief zu Mrs. Ingersoll – und schrie.
»Katie«, sagte Mrs. Ingersoll müde und bückte sich, um einem Jungen die Nase zu putzen, »nicht schon wieder. Bitte.«
Und jetzt kauerte ihrVater vor ihr und fragte sie, ob in der Schule etwas Besonderes passiert sei, und das Besondere – die Unfasslichkeit dieser schönen, über Kreuz geratenen Kleider und Schuhe – erhob sich vor ihr wie ein Berg, und ihreWorte waren kleine Ameisen, die ihn nicht emporklettern konnten, nicht einmal ein Schrei konnte ihn emporklettern. Sie lehnte sich an den Arm ihresVaters.
»Mrs. Ingersoll hat angerufen und mir erzählt, dass du nicht mit den anderen Kindern spielst.« Er sagte es sanft und umfasste mit seiner großen Hand ihren Ellenbogen.
Katherine bewegte die Zunge. Spucke sammelte sich als warme Pfütze in ihrer Backentasche.
»Gibt es irgendein Kind in deiner Klasse, das du am liebsten magst?«, fragte ihrVater.
Katherine antwortete nicht.
»Würdest du nach der Schule gern mal mit zu MarthaWatson gehen? Oder sie zu uns mitbringen? Ich könnte ihre Mutter anrufen und fragen.«
Katherine schüttelte den Kopf, heftig.
Ein jäherWindstoß ließ um sie beide dürres Laub stieben. Der Pastor blickte auf, sah hinüber zu dem Ahornbaum neben der Scheune. »So was«, sagte er. »DerWipfel ist schon ganz kahl.«
Aber Katherine starrte auf den Schuh ihresVaters. Ein Batzen Spucke lief langsam an der Seite des Schuhs herunter, der so groß und so schwarz war, dass er von einem Riesen hätte sein können.
»Ich muss noch mal kurz weg«, sagte ihrVater und richtete sich auf. »Mrs. Hatch wird auf dich aufpassen.«
Immer zuerst an den anderen denken.
Im strengen Sinne dachteTyler vielleicht nicht zuerst an Mrs. Ingersoll, als er nun wieder in seinem roten Rambler saß und die schmale, baumgesäumte Straße entlangfuhr, aber er überlegte doch gewohnheitsmäßig, wie ihr in diesem Moment zumute sein mochte. Hatte sie Angst vor dem anstehenden Gespräch? Möglich. Schließlich waren sie und ihr Mann reine Feiertagschristen und besuchten den Gottesdienst nur anWeihnachten und Ostern, was freilich die geringste vonTylers Sorgen war. Er hatte einen niedrigeren Prozentsatz an Feiertagschristen als viele Gemeinden, und er war (Gott behüte) nie gegen sie zu Felde gezogen, wie man das von anderen Pfarrern hörte. In jedem Fall, nahmTyler sich vor, als er aus dem Auto stieg und den Parkplatz überquerte, würde er alles in seinen Kräften Stehende tun, um der jungen Frau die Befangenheit zu nehmen.
Mrs. Ingersoll saß an ihrem Pult. »Kommen Sie herein«, sagte sie und erhob sich. Sie trug ein rotes Strickkleid mit Flusen darauf.
Tyler streckte die Hand aus. »GutenTag.« Ihre Hand schien ihm verblüffend klein – als würde sie ihm statt ihrer eigenen die Hand eines Schulkinds hinhalten. »Schön, Sie zu sehen, Mrs. Ingersoll.«
»Danke, dass Sie gekommen sind«, erwiderte sie.
Sie nahmen auf kleinen Holzstühlen Platz, und von Beginn an war etwas an der Art der Frau, so ein wissendes Abwarten, dasTyler beunruhigend fand. Als sie mit ihrer hohen, klaren Stimme sagte: »Vielleicht erzählen Sie mir einfach mal, wie Katherine zu Hause so ist«, sah sieTyler mit so stetem Blick an, dass er wegschauen musste. Das Klassenzimmer mit seiner Korkwand voll leuchtend bunter Buchstaben, seinem Geruch nach Malfarben war für ihn von einer Spannung erfüllt, die ihn überraschte, als hätte er alsVorschulkind schrecklich gelitten und wüsste es nur nicht mehr.
»Schläft sie gut?Weint sie viel? Erzählt sie Ihnen, was sie erlebt hat?«
»Hmm«, sagte der Pastor, »mal überlegen.« Mrs. Ingersoll sah auf ihren Ärmel hinab, zupfte eine graue Fluse ab und richtete den Blick erneut aufTyler, der sagte: »Also, was sie erlebt hat, darüber redet sie eher nicht, muss ich sagen. Aber ich frage sie.« Er hatte gedacht, dazu würde sie vielleicht nicken, aber es kam nichts, also fügte er hinzu: »Ich versuche, nicht zu sehr in sie zu dringen – ich ermutige sie eher, mir aus eigenem Antrieb etwas zu erzählen, verstehen Sie?«
»Können Sie mir ein Beispiel geben?«, sagte Mrs. Ingersoll. »Von der Art Unterhaltung, die Sie beide führen?«
Er meinte, hinter ihrer abwartenden Art etwas Hartes, Apodiktisches zu spüren. Er sagte: »Ich frage, was sie in der Schule gemacht hat. Mit wem sie in der Pause gespielt hat.Wen von den Kindern in der Klasse sie besonders mag.«
»Und was sagt sie dann?«
»Nicht gerade viel, leider.«
»Wir haben ein Problem, Mr. Caskey.«
Der stechende Schmerz unter seinem Schlüsselbein meldete sich. »Na«, sagte er liebenswürdig, »dann schauen wir, dass wir es lösen können.«
»So einfach ist das leider nicht«, sagte die Frau. »Kinder sind keine Mathematikaufgaben, die sich mit einer richtigen Antwort lösen lassen.«
Mit grüblerischer Gebärde rieb er über die wehe Stelle.
»Katherine will ständig meine Aufmerksamkeit, und wenn sie sie einmal nicht bekommt, fängt sie zu schreien an und hört erst wieder auf, wenn sie völlig erschöpft ist.« Mrs. Ingersoll setzte sich ein bisschen schräg, strich mit der Hand über ihren Schoß. »Sie spielt mit niemandem, niemand spielt mit ihr. Und es ist schon etwas erschreckend, dass sie noch nicht einen einzigen Buchstaben kennt.« Mrs. Ingersoll nickte in Richtung der Korkwand. »Sie zeigt auch keinerlei Ehrgeiz, sie zu lernen. LetzteWoche hat sie eine schwarze Malkreide genommen und damit die Seiten in einem Bilderbuch beschmiert.«
»Sie schreit?«
»Sie klingen erstaunt.«
»Ich bin erstaunt«, sagteTyler.
»Wollen Sie damit sagen, dass sie zu Hause keine Schreianfälle hat?«
»Sie hat zu Hause keine Schreianfälle. Das will ich damit sagen, ganz richtig.«
Mrs. Ingersoll legte den Kopf schräg – eine übertrieben überraschte Pose, fandTyler. »Hmm, das ist interessant. Hier schreit sie. Und Sie müssen verstehen, ich habe noch andere Kinder, um die ich mich kümmern muss.«
Tyler blinzelte. Der Schmerz unter seinem Schlüsselbein schien sein Sehvermögen zu beeinträchtigen.
»Sie sehen, Reverend Caskey, wir müssen etwas unternehmen.«
Der Pastor straffte die Schultern, verschränkte die Arme.
»Wer badet Katherine?«, fragte Mrs. Ingersoll.
»Wie bitte?«
»Baden«, sagte die Frau. »Von wem wird Katherine gebadet?«
Der Pastor furchte die Stirn. »Von der Haushälterin normalerweise.«
»Mag sie sie?« Mrs. Ingersoll zog ein dünnes Kettchen unter dem Halsausschnitt ihres roten Kleides hervor und fuhr mit dem Finger daran entlang.
Er sagte: »Na ja. Bei Katherine kann man sich da manchmal nicht ganz sicher sein.«
»Ich meinte, ob die Haushälterin Katherine mag.«
Er sah, dass an dem Kettchen ein kleines silbernes Kreuz baumelte. »Oh. Natürlich. Connie Hatch ist eine Seele von Mensch. Grundanständig. Eine grundanständige Person.«
»Reverend Caskey, ich frage Sie das, weil Katherine manchmal keinen – nun ja, keinen ganz gepflegten Eindruck macht.«
Eine lange Zeit schwieg der Pastor. Er drückte sich den Daumen unters Kinn und lehnte sich zurück. »Ich kümmere mich darum«, sagte er schließlich. Sein Hinterkopf fühlte sich sehr warm an.
Mrs. Ingersoll sagte: »Ich habe mehrere Gespräche mit dem Rektor geführt, und wir sind beide der Meinung, dass es eine gute Idee sein könnte, Katie testen zu lassen, wenn es nicht besser mit ihr wird. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das wissen, aber Rhonda Skillings – Sie kennen sie, oder?«
Tyler nickte.
»Rhonda promoviert in Psychologie, überTraumata bei Kindern. Ein hochinteressantesThema – es gibt jetzt Studien über Kinder, die im Krieg aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Rhonda schreibt an ihrer Doktorarbeit, und sie ist beratend für uns tätig. Ehrenamtlich. Sie hat ein Sprechzimmer im Erdgeschoss, und wenn ein Kind – nun ja, Sie wissen schon – in der Klasse nicht so ganz zurechtkommt, profitieren alle Seiten davon, wenn Rhonda sich ein wenig um besagtes Kind kümmert.«
»Ich fürchte, ich kann nicht ganz folgen«, sagteTyler. »Ich fürchte, ich weiß nicht, was Sie meinen.«
»Ich habe gesagt, dass wir ein Problem haben, Mr. Caskey.«
»Ja. So weit habe ich Sie verstanden.«
»Und dass ich meinen Aufgaben nicht gerecht werden kann, wenn sie während des Unterrichts Schreianfälle bekommt.«
»Ja.«
»Und dass wir glücklicherweise Rhonda Skillings haben, die an denTagen, an denen Katherine Anpassungsschwierigkeiten hat, mit ihr arbeiten kann.«
Der Pastor betrachtete dieWandtafel, er betrachtete die kleinenTische und Stühle, das kleineWaschbecken in der Ecke. Als er wieder zu Mrs. Ingersoll hinsah, war es, als sähe er sie durch eine Glasscheibe – die roten Schultern ihres Kleids, das braune Haar, das sich an ihrem Schlüsselbein ringelte. Er fragte: »Warum haben Sie mir nicht eher Bescheid gesagt?«
Die Frau hörte auf, mit ihrer Halskette zu spielen. »Wir hatten gehofft, das Problem würde sich von allein lösen. Stattdessen hat es sich verschlimmert.«
Der Pastor stellte seine langen Beine gerade, setzte sich auf dem lächerlichen Stühlchen zurecht, schlug sie andersherum übereinander. »Katherine ist kein heimatvertriebenes Flüchtlingskind«, sagte er. »Und sie ist auch keinVersuchskarnickel.«
»Aber sie ist ein Störfaktor im Unterricht.« Mrs. Ingersolls Stimme bekam etwas Schrilles. »Sie fragen, warum wir Sie nicht früher verständigt haben, und ganz ehrlich, Mr. Caskey, es hat uns gewundert, dass Sie nie nachgefragt haben. Andere Eltern fragen ständig, wie ihr Kind den Übergang zurVorschule meistert. Und natürlich ist Katherines Situation …«
FürTyler folgte das Gespräch keiner Logik mehr; er wusste nur, dass etwas schiefgelaufen war und dass er am Pranger stand. Aber er konnte den Hergang nicht rekonstruieren. Er sah die bunten Farben der Buchstaben an der Korkwand, den Korb mitWachsmalstiften auf einemTisch, Mrs. Ingersolls rotes Kleid, an dessen Ärmel ein langes braunes Haar klebte.
»Bitte«, hörte er sie sagen. »Wir nehmen tiefen Anteil an IhremVerlust.Wirklich. Aber – ja – ich bin etwas erstaunt, dass Sie erstaunt sind, zu hören, dass es ein Problem gibt.«
Fast hätte er gesagt: Ich bin ein bisschen durch denWind dieserTage, aber dann dachte er:Wenn ich durch denWind bin, dann geht das niemanden etwas an. Und so ließ er den Blick nur durchs Zimmer wandern und überlegte, ob Rhonda Skillings bereits eingeschaltet war.
»Wir verstehen ja, wenn Sie vielleicht nicht so recht wahrhaben wollen, dass nicht alles glattläuft. Das ist nichts Ungewöhnliches.« Mrs. Ingersoll artikulierte überdeutlich, als wäre er ein Fünfjähriger mitWachsmalstift in der Hand. »Ich kann mir gut vorstellen, dass es leichter ist, zu glauben, mit Katherine wäre alles in Ordnung. Aber das ist es nicht. Sie hat Probleme.«
Wieder blinzelte er. Die junge Frau, stellte er fest, beobachtete ihn mit hochgezogenen Augenbrauen, als würde sie auf etwas warten. Er stand auf und trat ans Fenster. Draußen ging es auf den Abend zu; in wenigenWochen würde es um diese Zeit schon dunkel sein. Ein roter Sonnenuntergang lagerte über dem Horizont, gleich über den Bäumen hinter dem Pausenhof mit seinem grauen, stillen Schaukelgerüst.
»Noch ist sie nicht aus der Klasse geschickt worden«, sagte Mrs. Ingersoll hinter ihm. »Wir wollten nur, dass Sie Bescheid wissen.Vor ein paarTagen hat sie ein sehr hübsches Bild gemalt.« Er hörte ihren Stuhl über den Boden scharren, hörte das geschäftige Klacken ihrer flachen Pumps, als sie durchs Zimmer ging. Er drehte sich um und wartete, während sie ein großes Blatt auseinanderrollte. »Aber« – Mrs. Ingersoll streckte es ihm hin – »wie Sie sehen, hat sie alles schwarz übermalt.«
Tyler sagte leise: »Das lassen Sie schön bleiben.«
»Was?«
»Sie schicken Katherine nicht aus der Klasse, damit sie dreimal dieWoche psychoanalysiert wird. Niemand schreibt eine Fallstudie über mein Kind.«
Auf dem Korridor klapperte der Putzeimer des Hausmeisters.
Mrs. Ingersoll rollte das Bild wieder ein und tippte auf den Klebestreifen, der es zusammenhielt. Mit gedämpfter Stimme und niedergeschlagenen Augen sagte sie: »Niemand hat vor, Katherine zu psychoanalysieren. Aber darüber, ob wir beschließen, sie für ein paar Stunden dieWoche aus dem Klassenzimmer zu entfernen oder nicht, haben nicht Sie zu entscheiden. Das hier ist eine staatliche Schule, Mr. Caskey.Wenn die Schule der Meinung ist, dass IhreTochter Hilfe braucht, werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um ihr diese Hilfe zukommen zu lassen.«
Er hatte keine Ahnung, ob das derWahrheit entsprach.
»Wir halten Sie auf dem Laufenden, Mr. Caskey.«
»Danke«, sagte er. Er ging zu ihr und schüttelte ihre Kinderhand.
Je tiefer die Sonne über den Städten am Fluss sank, desto dunkler wurde das Blau des Himmels. Ganz oben am Zenit war es so tief und so satt, dass man mit in den Nacken gelegtem Kopf hätte stehen bleiben und staunen wollen, nur war dies keineTageszeit, zu der die Menschen den Blick nach oben richteten. Sie drückten das Kinn auf die Brust, wenn sie um dieseTageszeit Büros oder Läden verließen und über Parkplätze eilten, sie rafften die Mäntel um sich, als brächte die hereinbrechende Dunkelheit eine Art inneres Schrumpfen mit sich.
Und das war ein Jammer, denn es war ein beeindruckendes Farbenspiel, das sich dort oben am Himmel entfaltete, es veränderte sich selbst in der kurzen Zeit, die es dauerte, die Autotür zu öffnen, sich hinters Steuer zu setzen, dieTür zuzuschlagen. Bis der Motor ansprang, war das Blau womöglich noch tiefer geworden, noch dunkler.Welch Jammer auch fürTyler Caskey, denn unter anderen Umständen hätte er vielleicht einen raschen Blick für den Himmel übrig gehabt, und dann hätte er gedacht: Ja, die Himmel erzählen die Ehre Gottes, und die Feste verkündigt seiner HändeWerk.
Stattdessen fuhr der Mann langsam, eine Hand erhoben gegen das letzte Gleißen der Sonne, die massiv und strahlend überm Horizont hing und zu nichts anderem gut schien als dazu, ihn zu blenden. Langsam fuhr er vorbei an den Feldern und Farmen und Kürbisständen. Als er auf die Stepping Stone Road bog, als unter seinen Rädern der Schotter der Einfahrt knirschte, meinte er wieder die letztenWorte seiner Frau zu hören, damals vor über einem Jahr. »Tyler«, hatte sie gesagt, »du bist so ein Feigling, weißt du das?«
Da stand das Farmhaus, weiß und schmucklos bis auf die roten Fensterläden. In der anbrechenden Dämmerung glaubteTyler aus seinen schlichten Umrissen eine stumme Abbitte zu lesen, mühselig und beladen, so kam es ihm vor, beschwert von der stillenWürde seiner hundert Jahre. Aber es war nur ein Haus. Nur Ziegel und Balken und ein kaputtesVerandageländer. Als er neben der Scheune parkte, spürte er wieder den hartnäckigen Schmerz unterm Schlüsselbein – wie ein kleines Nagetier erschien er ihm nach all den Monaten, ein Nagetier, das in ihm lebte, mit winzigen, nadelspitzen Krallen.Tyler nahm seinen Filzhut vom Beifahrersitz und stieg müde aus.
Er trat durch die Hintertür und hörte nichts, deshalb ging er durch die leere Küche weiter insWohnzimmer. Connie Hatch kam dieTreppe heruntergeeilt. »Sie ist eingeschlafen«, sagte Connie. »Ich wusste nicht, ob ich sie lassen soll, falls Sie sie …«
»Ist schon gut, Mrs. Hatch.« Der Pastor stand im Mantel da, die breiten Schultern leicht hochgezogen. Er ließ die Autoschlüssel auf den Couchtisch fallen.
»Wie ist es gelaufen?«
Der Pastor antwortete nicht. Aber als er dem Blick seiner Haushälterin begegnete, erlebte er einen jener raren Momente unverhofften Erkennens, wenn sich einem, für einen Sekundenbruchteil nur, in einem Aufblitzen echter Übereinstimmung die Seele eines anderen Menschen offenbart. So ging es dem Pastor an diesem Herbstabend, in seinemWohnzimmer, dessen Rosa nun trübe und stumpf wirkte.Was für eine traurigeWelt, schienen die Augen der Haushälterin zu sagen. Und es geht mir nahe.
Und die Augen des Pastors sagten: Eine traurigeWelt, ja. Mir geht es auch nahe.