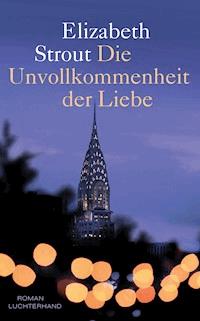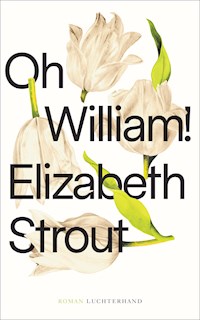11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Luchterhand Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Lucy-Barton-Romane
- Sprache: Deutsch
»Wer Elizabeth Strout einmal gelesen hat, will weiterlesen.« FAZ Der SPIEGEL-Bestseller der Pulitzer-Preisträgerin - erstmals im Taschenbuch.
»Welch eine Gnade, dass wir nicht wissen, was uns im Leben erwartet.« Elizabeth Strout schreibt die Geschichte von Lucy Barton weiter, ihrer feinsinnigen, von den Härten des Lebens nicht immer verschonten Heldin. Mit ihrem Ex-Mann William sucht sie während des Lockdowns Zuflucht in Maine, in einem alten Haus am Meer. Eine unvergessliche Geschichte über Familie und Freundschaft, die Zerbrechlichkeit unserer Existenz und die Hoffnung, die uns am Leben erhält, selbst wenn die Welt aus den Fugen gerät.
Sie hatte es so wenig kommen sehen wie die meisten. Lucy Barton, erfolgreiche Schriftstellerin und Mutter zweier erwachsener Töchter, erhält im März 2020 einen Anruf von ihrem Ex-Mann - und immer noch besten Freund - William. Er bittet sie, ihren Koffer zu packen und mit ihm New York zu verlassen. In Maine hat er für sie beide ein Küstenhaus gemietet, auf einer abgelegenen Landzunge, weit weg von allem. Nur für ein paar Wochen wollen sie anfangs dort sein. Doch aus Wochen werden Monate, in denen Lucy und William und ihre komplizierte Vergangenheit zusammen sind in dem einsamen Haus am Meer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Zum Buch
»Welche Gnade, dass wir nicht wissen, was uns im Leben erwartet.«
Sie hatte es so wenig kommen sehen wie die meisten. Lucy Barton, erfolgreiche Schriftstellerin und Mutter zweier erwachsener Töchter, erhält im März 2020 einen Anruf von ihrem Exmann – und immer noch besten Freund – William. Er bittet sie, ihren Koffer zu packen und mit ihm New York zu verlassen. In Maine hat er für sie beide ein Küstenhaus gemietet, auf einer abgelegenen Landzunge, weit weg von allem. Nur für ein paar Wochen wollen sie anfangs dort sein. Doch aus Wochen werden Monate, in denen Lucy und William und ihre komplizierte Vergangenheit zusammen sind in dem einsamen Haus am Meer.
Pulitzer-Preisträgerin Elizabeth Strout erzählt eine unvergessliche Geschichte über Familie und Freundschaft, die Zerbrechlichkeit unserer Existenz und die Hoffnung, die uns am Leben erhält, selbst wenn die Welt aus den Fugen gerät.
»Das ist das Geheimnis von Strout: Die Komplexität von Menschen so genau und wunderbar einzufangen.« DER SPIEGEL
Zur Autorin
Elizabeth Strout wurde 1956 in Portland, Maine, geboren. Sie zählt zu den großen amerikanischen Erzählstimmen der Gegenwart. Ihre Bücher sind internationale Bestseller. Für ihren Roman »Mit Blick aufs Meer« erhielt sie den Pulitzerpreis. »Oh, William!« und »Die Unvollkommenheit der Liebe« waren für den Man Booker Prize nominiert. »Alles ist möglich« wurde mit dem Story Prize ausgezeichnet. 2022 wurde sie mit dem Siegfried Lenz Preis ausgezeichnet. Elizabeth Strout lebt in Maine und in New York City.
Sabine Roth übersetzt Literatur aus dem Englischen, u. a. von Jane Austen, John le Carré, Hilary Mantel und V. S. Naipaul.
Elizabeth Strout
AM MEER
ROMAN
Deutsch von Sabine Roth
Luchterhand
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Lucy by the Sea« bei Random House, einem Imprint von Penguin Random House LLC, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2022 Elizabeth Strout
Copyright © der deutschen Ausgabe 2024
Luchterhand Literaturverlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: buxdesign | Ruth Botzenhardt
nach einem Entwurf von Duomo Ediciones unter Verwendung
eines Entwurfs und einer Illustration von © Stefania Infante
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-641-30698-4V002
www.luchterhand-literaturverlag.de
www.facebook.com/luchterhandverlag
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
Erstes Buch
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
II
1
2
3
III
1
2
IV
1
2
3
4
5
V
1
2
3
4
5
6
7
8
Zweites Buch
I
1
2
3
II
1
2
3
4
5
6
7
III
1
2
3
4
5
IV
1
2
3
4
5
6
7
V
1
2
3
4
5
6
7
8
VI
1
2
3
VII
1
2
3
VIII
1
2
3
4
5
6
Danksagung
Haben Sie Lust gleich weiterzulesen? Dann lassen Sie sich von unseren Lesetipps inspirieren.
Newsletter-Anmeldung
Für meinen Mann Jim Tierney
und meinen Schwiegersohn Will Flynt,
mit Liebe und Bewunderung für sie beide
Erstes Buch
I
1
Ich hatte es so wenig kommen sehen wie die meisten.
Aber William ist Naturwissenschaftler, und er sah es kommen; ihn überrumpelte es nicht so wie mich, das meine ich damit.
* * *
William ist mein erster Mann; wir waren zwanzig Jahre verheiratet und sind etwa ebenso lange geschieden. Wir stehen gut miteinander, ich habe mich all die Jahre hindurch immer wieder mit ihm getroffen; wir waren als Jungverheiratete zusammen nach New York gezogen und beide dort wohnen geblieben. Aber weil mein (zweiter) Mann gestorben und William von seiner (dritten) Frau verlassen worden war, hatte ich ihn im letzten Jahr öfter gesehen.
Etwa um die Zeit, als seine dritte Frau ihn verließ, entdeckte William, dass er eine Halbschwester in Maine hatte; er erfuhr von ihr durch ein Ahnenforschungsportal. Er hatte sich zeitlebens für ein Einzelkind gehalten, deshalb war die Erkenntnis ein ziemlicher Schock, und er bat mich, mit ihm für zwei Tage nach Maine zu fahren, um sie zu suchen. Wir fanden sie auch, doch die Frau – Lois Bubar heißt sie –, Lois Bubar also sprach zwar mit mir, zu ihm wollte sie jedoch keinen Kontakt, und das war sehr schmerzhaft für ihn. Auf dieser Reise nach Maine kamen außerdem Dinge über seine Mutter ans Licht, die ihn tief bestürzten. Sie bestürzten auch mich.
Seine Mutter war in bitterster Armut groß geworden, fanden wir heraus, in noch schlimmeren Verhältnissen als ich.
Jedenfalls fragte mich William zwei Monate nach unserem Ausflug nach Maine, ob ich ihn nach Grand Cayman begleiten würde. Auf den Kaimaninseln waren wir vor vielen, vielen Jahren mit seiner Mutter gewesen, Catherine, und als unsere Töchter klein waren, hatten wir einige Male mit ihnen und Catherine dort Urlaub gemacht. An dem Tag, als er bei mir ankam und fragte, ob ich mitkommen wolle, hatte er seinen riesigen Schnauzbart abrasiert und sein dichtes weißes Haar ganz kurz schneiden lassen – und erst später begriff ich, dass dies seine Reaktion auf die Abfuhr durch Lois Bubar sein musste, und auf die Enthüllungen über seine Mutter. Er war schon einundsiebzig, aber irgendwie stürzte ihn all das offenbar in eine Art Midlife- oder wohl eher Alterskrise: seine weitaus jüngere Frau war ausgezogen und hatte die gemeinsame zehnjährige Tochter mitgenommen, seine Halbschwester wollte nichts von ihm wissen, und nun war auch noch seine Mutter nicht die, als die er sie gekannt hatte.
Ich kam mit. Ich flog mit ihm Anfang Oktober für drei Tage nach Grand Cayman.
Und es war seltsam, aber nett. Wir hatten getrennte Zimmer, und wir gingen behutsam miteinander um. William war schweigsamer als sonst, und es war ungewohnt, ihn ohne seinen Schnauzbart zu sehen. Aber ein paarmal warf er doch den Kopf zurück und lachte laut auf. Beide nahmen wir sehr viel Rücksicht aufeinander, und so war es ein bisschen ungewohnt, aber nett.
Als wir zurück nach New York kamen, fehlte er mir. Und mir fehlte David, mein verstorbener zweiter Mann.
Mein Gott, fehlten sie mir beide, vor allem David. Meine Wohnung war so still!
* * *
Ich bin Schriftstellerin, und in diesem Herbst erschien ein neues Buch von mir, darum warteten nach unserer Rückkehr von Grand Cayman Leseauftritte im ganzen Land auf mich, die ich absolvierte; das war Ende Oktober. Für die erste Märzhälfte standen Termine in Italien und Deutschland auf dem Programm, aber Anfang Dezember – es wunderte mich selbst – beschloss ich, sie abzusagen. Ich sage nie Lesereisen ab, und die Verlage waren nicht eben erfreut, doch ich blieb dabei. Als der März näher rückte, sagte jemand: »Wie gut, dass du nicht nach Italien gefahren bist, da haben sie diesen Virus.« Und das war das erste Mal, dass ich Notiz davon nahm. Jedenfalls glaube ich das. Dass New York irgendwann betroffen sein könnte, kam mir nicht in den Sinn.
Aber William schon.
2
Wie ich später erfuhr, hatte William in der ersten Märzwoche unsere Töchter Chrissy und Becka angerufen und sie gebeten – förmlich angefleht – aus New York wegzugehen. Sie lebten beide in Brooklyn. »Und sagt eurer Mutter noch nichts davon, aber hört bitte auf mich. Ich bringe es ihr selber bei.« Also hatten sie mir nichts gesagt. Was interessant ist, denn ich bilde mir ein, eine enge Beziehung zu unseren Töchtern zu haben, enger als William, hätte ich gedacht. Aber sie nahmen ihn ernst. Chrissys Mann Michael, der Banker ist, nahm ihn sogar sehr ernst, und er und Chrissy beschlossen, fürs Erste in das Haus von Michaels Eltern in Connecticut zu ziehen – seine Eltern waren in Florida, darum stand das Haus leer –, aber Becka sträubte sich. Ihr Mann wolle nicht aus der Stadt weg, sagte sie. Und beide Mädchen wollten, dass ich von den Plänen erfuhr, und ihr Vater sagte zu ihnen: »Das übernehme ich schon, versprochen, aber macht bitte, dass ihr aus der Stadt kommt.«
Eine Woche später rief William mich an und erzählte es mir, und ich hatte keine Angst, es verwirrte mich nur alles. »Und sie ziehen allen Ernstes aufs Land?«, fragte ich, Chrissy und Michael, meinte ich, und William sagte Ja. »Bald werden alle von zu Hause aus arbeiten«, sagte er, und auch das verwirrte mich. Er fügte hinzu: »Michael ist Asthmatiker, da muss er besonders aufpassen.«
Ich sagte: »Aber er hat ja kein schweres Asthma«, und William schwieg einen Moment und sagte dann: »Wie du meinst, Lucy.«
Dann erzählte er mir, dass sein alter Freund Jerry mit dem Virus infiziert war und künstlich beatmet wurde. Jerrys Frau sei ebenfalls krank, allerdings nicht im Krankenhaus. »Ach, Pill, das tut mir so leid«, sagte ich, doch die volle Tragweite dessen, was da geschah, ging mir nicht auf.
Merkwürdig, wie das Hirn sich weigert, gewisse Dinge aufzunehmen, bis es bereit dafür ist.
Am Tag darauf rief William an und sagte mir, Jerry sei gestorben. »Lucy, lass mich dich aus der Stadt rausbringen. Du bist nicht mehr jung und sowieso viel zu mager, und Sport treibst du auch nicht. Du bist gefährdet. Ich hole dich ab, und wir fahren, ja?« Er ergänzte: »Nur für ein paar Wochen.«
»Aber was ist mit Jerrys Beerdigung?«, fragte ich.
Und William sagte: »Es gibt keine Beerdigung, Lucy. Wir … wir haben eine echte Krise.«
»Was heißt ›aus der Stadt raus‹?«, fragte ich.
»Aus der Stadt raus«, sagte er.
Ich sagte ihm, dass ich Dinge zu erledigen hätte, ich hatte einen Termin bei meinem Steuerberater, und zum Friseur wollte ich auch. William sagte, ich solle mir beim Steuerberater einen früheren Termin geben lassen und den Friseur absagen und in zwei Tagen reisefertig sein.
Ich konnte nicht glauben, dass Jerry tot war. Das meine ich wörtlich: Ich sah mich außerstande, es zu glauben. Ich hatte Jerry viele Jahre nicht mehr gesehen, vielleicht rührten meine Schwierigkeiten auch daher. Aber dass Jerry tot war, wollte mir nicht in den Kopf. Er war einer der Ersten in New York City, die an der Krankheit starben; das wusste ich zu der Zeit noch nicht.
Aber ich verlegte meinen Termin beim Steuerberater vor und den Friseurtermin auch, und als ich zu meinem Steuerberater ging, fuhr ich mit dem kleinen Lift hoch zu seinem Büro, der Lift hält auf jeder Etage (die Kanzlei liegt im vierzehnten Stock), und Leute drängen sich herein, Pappbecher mit Kaffee in der Hand, und schauen auf ihre Schuhe, bis sie wieder aussteigen, Stockwerk für Stockwerk. Mein Steuerberater ist ein großer, korpulenter Mann, wir sind beide gleich alt, und wir mochten uns von der ersten Sekunde an. Wir haben keinen privaten Umgang, deshalb klingt das vielleicht merkwürdig, aber er gehört zu meinen absoluten Lieblingsmenschen, er war so unsagbar gut zu mir über die Jahre. Als ich in sein Zimmer trat, sagte er: »Abstand« und winkte mir zu, und ich begriff, dass wir uns nicht umarmen würden wie sonst immer. Er witzelte über die Krankheit, aber ich merkte ihm an, dass er nervös deswegen war. Als wir mit allem durch waren, sagte er: »Wollen Sie vielleicht den Lastenaufzug nehmen, ich zeige Ihnen, wo er ist. Da wären Sie allein drin.« Ich war erstaunt und sagte, nein, nein, nicht nötig. Er wartete kurz, und dann sagte er: »Na gut. Adieu, Lucy B.«, und warf mir eine Kusshand zu, und ich fuhr mit dem normalen Aufzug nach unten. »Dann sehen wir uns Ende des Jahres«, sagte ich zu ihm, ich höre mich das noch sagen. Und dann stieg ich in die U-Bahn und fuhr zum Friseur.
Mit der Frau, die mir die Haare tönt, bin ich nie warm geworden. Ihre Vorgängerin, bei der ich jahrelang war, liebte ich heiß und innig, aber sie ist nach Kalifornien gezogen, und diese neue Frau – nein, sie war mir einfach unsympathisch. Und das war sie an diesem Tag auch wieder. Sie war jung und hatte ein kleines Kind und einen neuen Freund, und mir wurde an dem Tag klar, dass sie ihr Kind nicht liebte, sie war kalt, und ich dachte: Zu dir gehe ich nie mehr.
Ich weiß noch genau, wie ich das dachte.
Als ich nach Hause zurückkam, traf ich im Lift einen Mann, der sagte, er hätte gerade in den Fitnessraum im ersten Stock gehen wollen, doch der sei zu. Er klang ganz verwundert. »Wegen diesem Virus«, sagte er.
* * *
Am Abend rief William an und sagte: »Lucy, ich hole dich morgen früh ab, und wir fahren.«
Es war sonderbar; richtig beunruhigt war ich nicht, eher überrascht von seiner Beharrlichkeit. »Wohin denn überhaupt?«, fragte ich.
Und er sagte: »An die Küste von Maine.«
»Maine?«, sagte ich. »Machst du Witze? Wir fahren wieder nach Maine?«
»Ich erklär’s dir später«, sagte er. »Könntest du bitte einfach morgen früh fertig sein.«
Ich rief die Mädchen an, um ihnen zu berichten, was ihr Vater vorhatte, und sie sagten beide: »Es sind doch nur ein paar Wochen, Mom.« Wobei Becka ja gar nirgends hinfuhr. Ihr Mann – der Trey heißt und Dichter ist – wollte in Brooklyn bleiben, also blieb sie auch.
3
Am nächsten Morgen kam William mich abholen. Er sah wieder mehr so aus wie früher, die Haare waren nicht mehr so kurz, und seinen Schnauzbart ließ er auch wieder wachsen – fünf Monate war es jetzt her, dass er ihn abrasiert hatte –, aber es war kein Vergleich zu vorher, und ein bisschen fremdelte ich damit immer noch. Am Hinterkopf hatte er eine kahle Stelle. Ich konnte die rosa Kopfhaut sehen. Und er benahm sich so komisch. Er stand mit angespanntem Gesicht in meiner Wohnung, als dauerte ihm das alles hier viel zu lang. Er setzte sich aufs Sofa und sagte: »Lucy, können wir jetzt bitte los?« Also stopfte ich ein paar Anziehsachen in meinen kleinen lila Koffer und stellte das Frühstücksgeschirr in die Spüle. Die Frau, die mir im Haushalt hilft, Marie, sollte am nächsten Tag kommen, und ich lasse ihr ungern schmutziges Geschirr stehen, aber William saß wie auf Kohlen. »Pack deinen Pass ein«, sagte er. Ich drehte mich um und sah ihn an. »Warum das denn?«, fragte ich. Und er zuckte die Achseln und sagte: »Vielleicht fahren wir nach Kanada.« Ich holte also meinen Pass, und dann hob ich meinen Laptop auf und stellte ihn wieder hin. William sagte: »Nimm deinen Computer mit, Lucy.«
Aber ich sagte: »Nein, für die paar Wochen komme ich auch ohne aus. Das iPad reicht mir.«
»Nimm ihn lieber mit«, sagte er. Aber ich ließ ihn stehen.
William griff nach dem Laptop und nahm ihn unter den Arm.
Wir fuhren mit dem Lift nach unten, und ich rollte meinen kleinen Koffer zu seinem Auto. Ich trug den Frühjahrsmantel, den ich mir neu gekauft hatte, dunkelblau mit Schwarz – die Mädchen hatten mich dazu überredet, bei unserem letzten Treffen bei Bloomingdale’s wenige Wochen zuvor.
4
Aber es gab etliches, was ich an diesem Märzmorgen nicht wusste: Ich wusste nicht, dass ich meine Wohnung nie wiedersehen würde. Ich wusste nicht, dass eine Freundin von mir und jemand aus meiner Familie an dem Virus sterben würden. Ich wusste nicht, dass die Beziehung zu meinen Töchtern sich auf eine Weise verändern würde, die ich nie für möglich gehalten hätte. Ich wusste nicht, dass mein ganzes Leben von Grund auf anders werden würde.
Nichts von alledem ahnte ich, als ich an diesem Märzmorgen mit meinem kleinen lila Rollkoffer zu Williams Auto ging.
5
Als wir losfuhren, sah ich die Narzissen, die neben unserer Hauswand aufgeblüht waren, und rund um das Gracie Mansion standen die Bäume in Blüte; die Sonne badete alles in einer sanften Wärme, die Gehsteige waren belebt, und ich dachte: Oh, was für eine schöne Welt, was für eine schöne Stadt! Wir fuhren auf den FDR Drive, wo der Verkehr dicht war wie immer, und links von der Straße, auf einem Platz mit hoher Maschendrahtumzäunung, spielte eine Gruppe Männer Basketball.
Nachdem wir auf den Cross Bronx Expressway aufgefahren waren, teilte William mir mit, dass er ein Haus in einer Kleinstadt namens Crosby gemietet hatte, die dicht am Meer lag; Bob Burgess, Pam Carlsons Exmann von ganz früher, lebe jetzt dort und habe es ihm vermittelt. Pam Carlson ist eine Frau, mit der William über die Jahre hinweg ab und an etwas hatte, was aber keine Rolle spielt. Inzwischen, meine ich, inzwischen spielt es keine Rolle mehr. Pam ist bis heute gut Freund mit William, und mit ihrem Exmann Bob auch, und anscheinend arbeitete Bob in diesem Crosby als Anwalt. Jedenfalls hatte die Besitzerin des Hauses es vor Kurzem auf den Markt gebracht, ihr Mann war gestorben, und sie war in ein Seniorenheim gezogen und hatte Bob gebeten, ihr Eigentum zu verwalten. Bob sagte, wir könnten in dem Haus wohnen; die Miete dafür betrug nicht einmal ein Viertel meiner Miete in New York, aber William hat sowieso Geld.
»Für wie lange?«, wollte ich auch jetzt wieder wissen.
Er zögerte. »Vielleicht ja nur ein paar Wochen.«
* * *
Was mich im Rückblick so seltsam berührt, ist meine Ahnungslosigkeit damals.
* * *
Meine Stimmung war schon seit einigen Monaten recht gedrückt. Das hatte damit zu tun, dass ein Jahr vorher mein Mann gestorben war; außerdem werde ich gegen Ende einer Lesereise oft niedergeschlagen, und diesmal war es schlimmer als sonst gewesen, weil es keinen David mehr gab, den ich von unterwegs anrufen konnte. Das war für mich das Schwerste an dieser Reise: nicht täglich mit David telefonieren zu können.
Kurz zuvor hatte eine Freundin von mir, auch eine Schriftstellerin – sie heißt Elsie Waters und war unmittelbar vor mir Witwe geworden, was uns noch mehr verband –, mich zu sich zum Essen eingeladen, und ich hatte ihr gesagt, im Moment sei ich dafür zu erschöpft. Kein Problem, hatte sie gesagt, sobald du wieder fit bist, holen wir es nach.
Auch so etwas, was ich nie vergessen werde.
* * *
Einmal hielt William an, um zu tanken, und als ich zufällig auf die Rückbank schaute, lag da eine durchsichtige Plastiktüte mit OP-Masken darin und daneben eine Schachtel Einweghandschuhe. »Was ist das denn?«, fragte ich.
»Mach dir deswegen keine Gedanken«, sagte William.
»Trotzdem. Was ist das?«, fragte ich noch einmal, und er sagte: »Mach dir keine Gedanken, Lucy.« Aber er zog einen dieser Handschuhe über, bevor er den Zapfhahn berührte, das sah ich. Mir schien, dass er ziemlich überreagierte, und ich verdrehte im Stillen die Augen, sprach ihn aber nicht darauf an.
* * *
William und ich fuhren an diesem Tag also nach Maine, es war eine lange, sonnige Fahrt, und soweit ich mich erinnere, sprachen wir wenig. Aber William beschäftigte es, dass Becka in Brooklyn blieb. Er sagte: »Ich habe ihr gesagt, sie sollen sich ein Haus in Montauk mieten, ich zahl’s ihnen auch, aber sie wollen nicht weg.« Und er fügte hinzu: »Sie wird sowieso bald von daheim aus arbeiten, wart’s nur ab.« Becka ist Sozialarbeiterin bei der Stadt, und ich sagte, dass sie doch unmöglich von daheim aus arbeiten könne, worauf William nur den Kopf schüttelte. Trey, Beckas Mann, hat einen Lehrauftrag an der New York University, er unterrichtet Lyrik, und auch bei ihm hätte ich nicht gewusst, wie er das von daheim machen sollte. Aber das sagte ich nicht. In gewisser Weise fühlte es sich für mich nicht real an, glaube ich, hauptsächlich deshalb, weil mir das Ganze – seltsamerweise – keine so großen Sorgen machte.
6
Als wir in Maine von der Schnellstraße abfuhren und uns Crosby näherten, zog es plötzlich zu. Ich setzte die Sonnenbrille ab, aber alles blieb braun und trist, und doch hatte es etwas, diese Landschaft mit ihrem vielerlei Braun in den Gräsern am Wegrand; eine Ruhe ging davon aus. Dann erreichten wir die Stadt selbst, wo auf einem kleinen Hügel eine große weiße Kirche stand. Die Gehsteige waren gepflastert und die Häuser mit weißen Schindeln verkleidet, aber Backsteinhäuser gab es auch. Man konnte sehen, dass es ein recht hübsches Städtchen war, wenn man dergleichen mag.
Ich mag es nicht.
Wir hielten vor dem Haus von Bob Burgess, einem Backsteinhaus im Stadtzentrum. Die Bäume ringsherum waren grau und spindelig, völlig blattlos vor dem düsteren Himmel, und Bob kam heraus und blieb ein Stück vom Auto entfernt in der Einfahrt stehen. Er war ein großer Mann mit grauem Haar, und er trug ein Jeanshemd und ausgebeulte Jeans, er stand gebückt, um zu uns hereinschauen zu können – William hatte das Fenster heruntergefahren –, und er sagte, die Schlüssel seien auf der Veranda des Hauses, und beschrieb uns den Weg dorthin. »Ihr bleibt ja erst mal zwei Wochen in Quarantäne, oder?«, sagte er. Und William sagte, ganz genau. Bob sagte, die Lebensmittel, die er uns besorgt hatte, müssten uns eigentlich so lange reichen. Er kam mir furchtbar nett vor, soweit ich das an William vorbei sehen konnte, aber ich verstand nicht ganz, warum William nicht ausstieg und ihm die Hand gab, und als wir weiterfuhren, sagte William: »Er sieht uns als Gefahr. Wir kommen direkt aus New York. Für ihn sind wir verseucht. Was ja auch gut sein könnte.«
* * *
Wir fuhren eine schmale Straße entlang, die sich endlos hinzog; hier und da standen Nadelbäume, aber all die anderen Bäume waren kahl, und dann plötzlich bot sich mir durch das Autofenster ein erstaunlicher Anblick: Rechts und links der Straße war Meer, aber ein Meer, wie ich es noch nie gesehen hatte. Selbst bei dem bedeckten Himmel benahm es mir den Atem; es gab keinen Strand, nur dunkelgraue und braune Felsen und spitzige Nadelbäume, die direkt aus dem Stein zu wachsen schienen. Dunkelgrünes Wasser klatschte an den Felszacken hoch, und Seetang von bräunlich goldener Farbe, ein tiefer Kupferton fast, lag in Wellenlinien auf diesen Felsen, gegen die das dunkelgrüne Wasser schlug. Das übrige Meer war dunkelgrau, und weiter draußen sah ich sehr kleine weiße Wellenkämme, nichts als eine enorme Weite von Wasser und Himmel. Dann bogen wir um eine Kurve, und vor uns lag eine kleine Bucht mit vielen Fischkuttern, es schien so viel freie Luft um sie, um diese Kutter in ihrer kleinen Bucht, die alle in dieselbe Richtung zeigten, vor dem offenen Meer, und – doch, ja, ich fand es schön. Ich dachte: Das ist der Ozean! Es kam mir vor wie ein fremdes Land. Wobei die Wahrheit ist, dass mir fremde Orte Angst machen. Ich mag Orte, die mir vertraut sind.
* * *
Das Haus, in dem wir wohnen sollten, sah von außen sehr groß aus und lag am äußersten Ende einer Landspitze hoch auf einem Felsen, ganz allein lag es da; es war aus Holz und ungestrichen, verwittert. Eine sehr steile, steinige Einfahrt führte zu ihm empor, der Wagen schwankte von einer Seite zur anderen, als wir sie hinaufrumpelten. Kaum stieg ich aus, roch ich die Luft, und ich wusste, das ist das Meer, der Atlantik. Aber es roch nicht wie in Montauk an der Ostspitze von Long Island, wo wir Ferien zu machen pflegten, als die Kinder klein waren, oder wie auf Grand Cayman; das hier war ein beißender Salzgeruch, und ganz ehrlich, ich fand ihn unangenehm.
Das Haus hätte schön sein können, ich meine, früher war es sicherlich schön gewesen; es hatte eine riesige verglaste Veranda hoch über dem Wasser, aber als ich durch die Tür trat, empfand ich das Gleiche wie bei allen fremden Häusern, in die ich komme: Abwehr. Ich hasse es, wenn es nach dem Leben anderer Menschen riecht (und zu diesem Geruch kam noch der Meeresgeruch!); das Glas der Veranda war gar kein Glas, sondern dickes Plexiglas, und die Möbel waren seltsam, was heißt seltsam, es waren einfach herkömmliche Möbel, eine durchgesessene dunkelrote Couch, diverse Stühle und Sessel, ein Esstisch aus Holz mit vielen Kratzern darin, und im Obergeschoss gab es drei Schlafzimmer mit Patchworkdecken auf den Betten. Irgendetwas an diesen Patchworkdecken deprimierte mich zutiefst. Und kalt war es. »William, mir ist eiskalt«, sagte ich, ich rief es von der Treppe zu ihm hinunter, und er sah nicht hoch zu mir, aber er ging zum Thermostat, und nach wenigen Augenblicken hörte ich durch die Lüftungsschlitze am Boden entlang der Zimmerwände die Heizung anspringen. »Dreh sie ordentlich auf«, sagte ich. Das Haus war weniger groß, als es die riesige Veranda draußen vermuten ließ, und die Veranda machte es innen ziemlich dunkel. Die Veranda, und natürlich die Wolken. Ich ging durch die Zimmer und schaltete fast jede Lampe im Haus an.
Alles wirkte eine Spur klamm. Küche und Wohnzimmer blickten aufs Wasser hinaus, es erstaunte mich auch jetzt wieder, wie ich da stand, dieses offene Meer; das Ufer war felsig, und das dunkle Wasser strudelte über die Felsen, in Wellen, die weiß schäumten, wo sie sich an dem Stein brachen: was für eine Aussicht! Weiter draußen waren zwei Inseln, die eine klein, die andere ein Stück größer, es wuchsen einzelne Nadelbäume auf ihnen, und man sah die vorgelagerten Felsen.
Irgendwie berührte mich der Anblick der beiden Inseln, sie erinnerten mich an meine Kinderzeit in unserem winzigen Haus in der Kleinstadt Amgash in Illinois, an die Sojabohnen- und Weizenfelder ringsum, in deren Mitte ein einzelner Baum wuchs; ich hatte ihn als meinen Freund empfunden, diesen Baum. Und nun stand ich hier, und die zwei Inseln dort draußen lösten fast das gleiche Gefühl in mir aus wie damals der Baum.
»Welches Schlafzimmer willst du?«, fragte mich William, der unser Gepäck aus dem Auto hereintrug und im Wohnzimmer ablud.
Die drei Schlafzimmer waren nicht sonderlich groß, und bei dem hintersten reichten die Bäume bis dicht ans Fenster heran, also sagte ich William, bitte nicht dieses Zimmer, aber die anderen seien mir beide gleich recht. Vom Fuß der Treppe sah ich ihm zu, wie er meinen Koffer und eine Reisetasche mit seinen Sachen nach oben schleifte. »Du kriegst das mit dem Dachfenster«, rief er, und dann hörte ich ihn in eines der anderen Zimmer gehen, und kurz darauf erschien er mit seinem Wintermantel an der Treppe, warf ihn mir herunter und sagte: »Zieh den über, bis dir warm geworden ist.« Also zog ich ihn an, aber ich kann es nicht leiden, im Mantel in Innenräumen zu sitzen. Ich sagte: »Sehr vorausschauend von dir, deinen Wintermantel mitzunehmen. Woher wusstest du, dass du ihn brauchen würdest?«, und er sagte, schon auf dem Weg die Treppe hinunter: »Weil wir in Maine sind und damit nördlicher, und weil wir März haben und es hier kälter ist als in New York.« Ich hatte nicht das Gefühl, dass er es boshaft sagte.
Und so bezogen wir das Haus.
»Wir können zwei Wochen lang niemanden treffen«, sagte William.
»Was ist mit spazieren gehen?«, fragte ich.
»Spazieren gehen können wir, aber komm niemandem zu nahe.«
»Es wird niemand da sein, dem ich zu nahe kommen kann«, sagte ich, und William warf einen Blick aus dem Fenster und sagte: »Nein, vermutlich nicht.«
Ich war nicht gerade glücklich. Ich mochte das Haus nicht, es war mir zu kalt, und ich hatte gemischte Gefühle William gegenüber. Ich fand, er übertrieb es mit der Angstmacherei, und ich lasse mir nicht gern Angst machen. Wir aßen unsere erste Mahlzeit an dem kleinen runden Esstisch, Nudeln mit Tomatensoße. Im Kühlschrank waren vier Flaschen Weißwein, was mich überraschte. »Hat Bob die für uns besorgt?«
»Für dich«, sagte William, und ich fragte: »Hast du ihm das gesagt?« Und er zuckte die Achseln. »Vielleicht.« William trinkt fast nie.
»Danke«, sagte ich, und er zog nur die Augenbrauen hoch, und mir ging es ein bisschen wie auf unserer Reise nach Grand Cayman (die inzwischen Monate her war): Irgendwie fand ich sein Benehmen etwas merkwürdig, und sein Schnauzbart war auch noch nicht wieder der alte, und ich konnte mich immer noch nicht richtig daran gewöhnen.
Aber zwei Wochen würde es schon gehen, sagte ich mir.
Später ging ich in das hintere Schlafzimmer, das mit den Bäumen so dicht vor dem Fenster, und diesmal bemerkte ich – das hatte ich zuvor ganz übersehen – an der Wand gegenüber dem Fenster ein großes Regal voller Bücher, hauptsächlich Romane aus der viktorianischen Zeit und Geschichtsbücher, die meisten über den Zweiten Weltkrieg. Ich nahm die Steppdecke von dem Bett dort und legte sie über die Decke auf meinem Bett. Und als ich einschlief, schlief ich durch bis zum Morgen, was mich sehr wunderte. Es war ein Donnerstag, als wir ankamen, das weiß ich noch.
* * *
Das Wochenende brachten wir mit Spaziergängen hinter uns, gemeinsam und getrennt. Das Wetter war so grau, und es gab keinerlei Farben irgendwo, bis auf den kleinen grünen Rasenfleck an der Felskante neben dem Haus. Ich fühlte mich rastlos. Und ich fror immerzu. Ich hasse es, zu frieren. In meiner Kindheit hatte es an allem gefehlt, ich hatte permanent gefroren als Kind. Ich war jeden Tag nach Schulschluss im Klassenzimmer geblieben, nur um es warm zu haben. In diesem Haus jetzt trug ich zwei Pullover übereinander und zog noch Williams Strickjacke darüber.
7
Am Montagmorgen las William die Nachrichten auf seinem Laptop, und er sagte: »Kanntest du eine Schriftstellerin namens Elsie Waters?« Die Frage überraschte mich. »Ja«, sagte ich, und er schob mir seinen Computer hin. Auf diesem Weg erfuhr ich, dass die Frau, Elsie Waters, die Freundin, die mich zum Essen hatte einladen wollen und der ich wegen Müdigkeit abgesagt hatte – dass sie an dem Virus gestorben war.
»Um Gottes willen!«, sagte ich. »Nein!«
Elsie lächelte mir fröhlich vom Bildschirm entgegen. »Nimm das weg«, sagte ich und schob den Computer wieder zu William. Tränen waren mir in die Augen gestiegen, aber sie flossen nicht, und ich nahm meinen Mantel und steckte das Handy ein und ging nach draußen. Nein, nein, nein, dachte ich immer wieder; ich war so wütend. Und dann rief ich eine Freundin von ihr an, die ich auch kannte, und die Freundin weinte. Aber ich konnte nicht weinen.
Von der Freundin erfuhr ich, dass Elsie zu Hause gestorben war. Sie hatte noch den Notarzt gerufen, aber als er kam, atmete sie schon nicht mehr. Wir sprachen noch ein paar Minuten länger, und mir wurde klar, dass ich dieser gemeinsamen Freundin kein Trost sein konnte, so wenig wie sie mir.
Ich lief und lief, wie durch einen Tunnel; ich hätte gern geweint, aber ich konnte es nicht.
Bis zum Ende der Woche waren noch drei weitere meiner New Yorker Bekannten an dem Virus erkrankt. Mehrere andere hatten Symptome, konnten sich aber nicht testen lassen, weil kein Arzt sie bei sich in der Praxis haben wollte. Das erschreckte mich – dass Ärzte die Kranken nicht zu sich in die Praxis ließen.
Ich rief Marie an, meine Haushaltshilfe, und bat sie, vorerst nicht mehr zu kommen; ich wollte nicht, dass sie meinetwegen U-Bahn fuhr. Sie sei an dem Tag nach unserer Abreise da gewesen, sagte sie, aber ab jetzt käme sie nicht mehr. Ihr Mann war einer der Portiers in unserem Haus, und sie erzählte mir, dass er den Weg von Brooklyn jetzt mit dem Auto zurücklegte – mit der U-Bahn wollte er nicht mehr fahren – und dass er einmal die Woche meine große Zimmerpflanze gießen würde. Es ist die einzige Pflanze, die ich besitze, ich habe sie schon seit zwanzig Jahren – seit ich bei William ausgezogen bin –, deshalb hänge ich sehr an ihr. Ich dankte Marie überschwänglich dafür, für alles, was sie getan hatte. Sie klang sehr gefasst. Sie ist religiös, und sie sagte, sie würde für mich beten.
* * *
Ich hatte die Mädchen gleich nach unserer Ankunft angerufen, aber nun rief ich sie wieder an, und bei Chrissy schien alles in Ordnung zu sein, Becka dagegen hörte sich nicht gut an – nörgelig, so empfand ich –, und sie war nicht zum Reden aufgelegt. »Tut mir leid«, sagte sie zu mir, »irgendwie finde ich alles einfach nur zum Kotzen.«
»Das kann ich dir nachfühlen«, sagte ich.
* * *
In der Wohnzimmerecke stand ein großer Fernsehapparat, der dank Bob Burgess noch angeschlossen war. Ich sehe fast nie fern – sicher auch deshalb, weil es in meinem Elternhaus keinen Fernseher gab; ich kann einfach nichts damit anfangen –, aber William schaltete diesen Apparat jeden Abend ein, und dann sahen wir die Nachrichten. Das war mir recht; ich hatte das Gefühl, dass es mich (uns) mit der Welt verband. Es ging fast nur um die Krankheit, jeden Tag stieg in einem neuen Bundesstaat die Fallzahl, aber ich begriff noch immer nicht, was uns bevorstand. An einem der Abende sagte der Gesundheitsminister, die Lage würde sich noch verschlimmern, bevor sie besser würde. An diesen Satz erinnere ich mich noch genau. Und die Theater am Broadway waren da schon geschlossen, auch daran erinnere ich mich.
* * *
In einer Kiste auf der Veranda, einer alten Spielzeugkiste, die eng an die Hauswand gerückt war, entdeckten William und ich ein altes Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiel. Die Ecken der Schachtel waren so abgestoßen, dass sie Löcher hatten, aber William holte sie trotzdem heraus. Und ein Puzzle fanden wir, auch ziemlich alt, aber die Teile schienen uns alle da zu sein; es war ein Selbstporträt von Van Gogh. Ich sagte: »Ich hasse Gesellschaftsspiele«, und er sagte: »Lucy, wir haben einen Lockdown, hör auf, immer alles zu hassen.« Und er legte es auf einem kleinen Ecktisch im Wohnzimmer aus. Ich half ihm bei den vier Ecken und den Rändern, aber den Rest ließ ich ihn mehr oder weniger allein machen. Ich habe noch nie gern gepuzzelt.
Wir spielten ein paarmal Mensch-ärgere-ich-nicht, und ich dachte die ganze Zeit nur: Hoffentlich ist es bald zu Ende. Das Spiel, meinte ich.
Nein. Alles.
8
Nach exakt einer Woche rief ich einen meiner Ärzte in New York an. Er verschreibt mir mein Schlafmittel und auch Tabletten gegen meine Panikattacken, und ich rief ihn an, weil mir beides knapp wurde und ich, seit ich von Elsie Waters’ Tod gehört hatte, nicht gut schlief. Der Arzt hatte die Stadt ebenfalls verlassen, er war in Connecticut, und er riet mir, nach dem Einkaufen im Supermarkt meine Kleider zu waschen. »Ernsthaft?«, fragte ich, und er sagte: »Ja.« Ich sagte ihm, dass voraussichtlich William unsere Einkäufe erledigen würde, wenn wir unsere Quarantäne hinter uns hatten, und er sagte, dann solle eben William seine Kleider waschen, wenn er vom Einkaufen zurückkam.
Es schien mir so unfasslich. »Ernsthaft?«, fragte ich noch einmal, und er sagte, ja, so, wie man seine Sachen nach dem Sport ja auch wusch.
Ich sagte: »Aber wie lange soll das denn so gehen, meinen Sie?« Und er sagte: »Wir haben spät reagiert, über ein Jahr würde ich schon rechnen.«
Ein Jahr.
Das war der Punkt, als mir zum ersten Mal richtig – richtig – angst wurde, und doch brauchte es lang, dieses Wissen, um in meinem Hirn anzukommen, merkwürdig lang, und als ich William erzählte, was der Arzt gesagt hatte, antwortete er nichts, und mir wurde klar, dass es für ihn nicht überraschend kam. »Wusstest du das denn?«, fragte ich ihn, und er sagte nur: »Lucy, niemand von uns weiß etwas Gewisses.« Und mir dämmerte – langsam, so ungeheuer langsam –, dass ich New York lange, lange Zeit nicht wiedersehen würde.
»Und du sollst deine Kleider waschen, wenn du einkaufen warst«, sagte ich. William nickte nur.
Ich war todtraurig, auf eine ganz kindliche Art, und ich musste an die Geschichte von Heidi denken, die ich in meiner Jugend gelesen hatte – sie war in die Fremde geschickt worden, und vor lauter Heimweh begann sie zu schlafwandeln. Dieses Bild von Heidi kam mir immer wieder in den Kopf. Ich konnte nicht mehr nach Hause zurück, und mit jeder Sekunde sickerte das tiefer in mich ein.
* * *
Und dann sahen William und ich im Fernsehen zu, wie New York von einem Grauen überrollt wurde, für das mir die Worte fehlten. Abend für Abend sahen wir die fürchterlichsten Szenen, Bilder von Menschen in der Notaufnahme, Menschen an Beatmungsgeräten, Krankenhausmitarbeiter ohne die geeigneten Masken oder Handschuhe, und die Leute starben und starben. Krankenwagen jagten durch die Straßen. Dies waren Straßen, die ich kannte, es war mein Zuhause!
Ich sah das alles, und ich glaubte, was ich sah, ich zweifelte nicht an seiner Realität, meine ich, aber ich sah es mit einer schwer beschreibbaren Gespaltenheit. Es war, als läge ein Abstand zwischen dem Fernseher und mir. Was natürlich der Fall war. Aber mein Inneres, so schien mir, hatte einen Schritt rückwärts getan und verfolgte das Geschehen aus echter Distanz, während mich gleichzeitig das Entsetzen gepackt hielt. Selbst jetzt, viele Monate später, sehe ich im Geist seltsam blassgelbe Bilder vor mir, es müssen die Krankenschwestern in ihrer Schutzkleidung gewesen sein oder vielleicht in Decken gehüllte Menschen auf dem Weg ins Krankenhaus, doch in meiner Erinnerung liegt über sämtlichen Fernsehbildern aus jener Zeit dieser eigenartige Gelbschleier. Es wurde richtiggehend zur Sucht für uns (für mich) – schien es mir –, jeden Abend im Fernsehen die Nachrichten zu sehen.
Ich sorgte mich um die Rettungssanitäter, sie mussten sich doch alle anstecken, dachte ich, und das Personal in den Krankenhäusern auch. Ich musste an einen Blinden denken, dem ich manchmal an der Haltestelle vor unserem Haus aus dem Bus geholfen hatte, und auch um ihn sorgte ich mich: Traute er sich jetzt noch, jemandem seinen Arm zu geben? Und die Busfahrer! All die vielen Menschen, mit denen sie in Kontakt kamen!