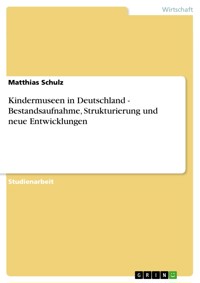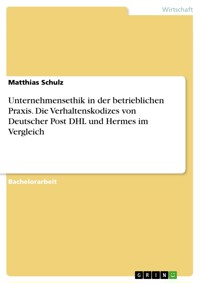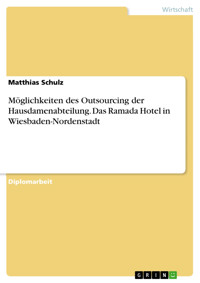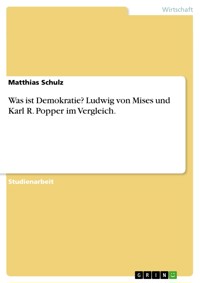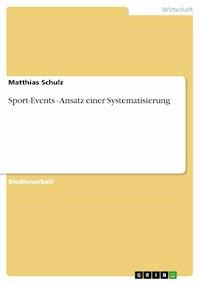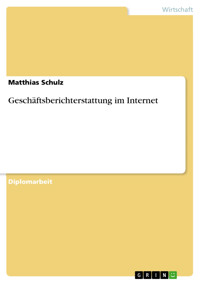Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Können Gebärdenlieder die Seele stärken helfen? Was bewegt gehörlose Menschen, wenn Mutter und Kind perfekt miteinander gebärden können? Welche Power kann eine sprachliche Minderheit entwickeln, wie die tauber Menschen? Wie wird der Tatort "Beratung" von gehörlosen Menschen und deren Familien erlebt? Und welche Schönheit besitzt die sogenannte "visuelle Liturgie" in gebärdensprachlichen Gottesdiensten? Fragen aus einem Gedankenaustausch, aus dessen Dialog das Büchlein "Fliegende Hände" im Zeitraum von mehr als zwei Jahren entstand. Aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven tauschen sich die Autoren aus. Das Besondere an diesem Buch ist seine Offenheit und der Blick auf einen Zeitraum von beinahe 30 Jahren gesellschaftliche Entwicklung zwischen Nichtbeachtung, Wertschätzung und Begeisterung für und mit gehörlosen, oder wie heute geschrieben wird, tauben Menschen und ihren Familien. Joachim Klenk und Matthias Schulz bemühen sich dabei, die Leserin und den Leser mitzunehmen in eine ungewöhnliche Welt mit ungewöhnlich interessanten Menschen und Momentaufnahmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Zwischen Erlangen, Roth und Istanbul
Tor, Tor – aufgewachsen neben der „Taubstummenschule“ – Joachim Klenk erzählt
„Ich will dabei sein!“ – Matthias Schulz antwortet
Deaf pride – Eine Minderheit findet sich
Herr B. auf der Suche nach Identität
„Mit meiner Tochter gebärde ich!“ – Elternsein neu erlebt
„Aber bitte mit Gebärden!“ – Gottesdienst und visuelle Liturgie
Einsam in einer lauten Welt – (k)ein Tabu?
„Hilfe, sie küsst mich!“ – zwischen Nähe und Distanz
Worauf es ankommt – Fortbildung für alle!
Tatort Beratung – präventiv handeln
„Es geht leider nicht!“ – Therapie im Fokus
Hilfe! Wer kommt da? Erfahrungen auf “B2”
Eine Hand voll Männer und eine Idee – ev. Gehörlosenseelsorge Bayern
CI, DGS, LBG, … – Fachbegriffe erklärt
Quellen und Literaturangaben
Schon gewusst? – Test für Neugierige
Gott sei Dank! – mit eurer Hilfe
Über die Autoren
Matthias Schulz und Joachim Klenk bei den Vorbereitungen zu diesem Buch im Sommer 2015
Begegnung – Zusammentreffen, Sehen, Berühren, Einfühlen, Teilen und Lieben, Verständigung, intuitives Erkennen durch Schweigen oder Bewegung, Sprache oder Gesten; mit allen Kräften und Schwächen, erfüllt von Spontaneität und Kreativität im Hier und Jetzt.
(J.L. Moreno 1959)
Für Birgit, Jonna Kristin und Henrike Svea
Mit diesem Buch danke ich euch, meinen liebsten und wichtigsten Wegbegleitern im Leben, für viele wertvolle Begegnungen, die uns oft stärken und verändern.
Ich danke euch für so manche Gebärden am Esstisch, liebevolles und gemeinsames Lachen, geteilte Zeit in Kunstausstellungen, Theater- und Ballettaufführungen, beim Musizieren, Tauchen und „Handwerkeln“, bei pastoralpsychologischen Fachgesprächen, in der Auseinandersetzung und Nähe.
Danke für viel gegenseitiges Verstehen, Ermutigungen zur Großzügigkeit und das Leben zu genießen. Und nicht zuletzt für die Unterstützung, dieses Buch zusammen mit meinem Freund Joachim zu schreiben.
Bei zahlreichen vergnüglichen Treffen haben wir es diskutiert und verändert, bis es wie bei einem wunderbaren Wein an Reife und Körper gewonnen hat.
Matthias Schulz, Erlangen im Februar 2016
„Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen“ Psalm 18,30b
Für Gerda, Katharina, Johanna, Theresa, Rolf und meinen Lebensbegleiter in himmlischen Sphären
Meine Teile dieses Buches sind auf einer schönen Terrasse und an einer schönen Waldlichtung entstanden. Orte, an denen all die Geschichten mein Herz fluteten, ein Espresso und ein Stück guter Schokolade stets dabei. Meinen Töchtern Katharina, Johanna und Theresa danke ich für ihre Geduld mit einem „verpeilten“ Vater. Meiner lieben Frau Gerda danke ich mit einer liebevollen Umarmung für die nötigen Freiräume zum Schreiben und meinem Vater, der mir ein warmherziger und ehrlicher Begleiter ist.
2013 machte ich mich gemeinsam mit meinem Freund Matthias auf den Weg dieses Buch zu schreiben. Auch ihm danke ich herzlich für diese gemeinsame und spannende Zeit. Wir wollten einfach mal „weise“ sein. Nicht um die Dinge besser zu sehen, sondern um aus einer ganz persönlichen Perspektive einen Zeitraum von über 20 Jahren zu beleuchten. Sapere aude – wage es weise zu sein – eine ergreifende Erfahrung. Vergessen will ich nicht den nötigen Hauch von Gottvertrauen.
Joachim Klenk, Roth im Februar 2016
Zwischen Erlangen, Roth und Istanbul
Wir schreiben das Jahr 1780. Es ist ein heißer Sommer am osmanischen Hof. Ein langer Gang im Gebäude der Verwaltungsbeamten schenkt Kühle. Die Türen zu den Gemächern der Beamten stehen offen. Haran ist ganz konzentriert in einen Text vertieft. Auf seinem Tisch liegen wichtige Dokumente, die der Wind leise hin und her wiegt. Haran steht als hoher Beamter seit mehr als zwei Jahrzehnten in Diensten der türkisch-osmanischen Sultane. Sie sind gekommen und gegangen, er ist geblieben. Und: Er kennt deren Vorliebe für die „Sprache der Hände“. Seit dem 16. Jahrhundert wird am Hof diese Kommunikation gepflegt. Haran arbeitet sehr gerne mit Kemal zusammen. Kemal ist gehörlos und beherrscht die „Sprache der Hände“ wahrlich meisterlich. Kemal ist einer von vielen gehörlosen Mitarbeitenden. Sie gehören zu den wichtigen Kommunikatoren am Hofe der Sultane. Denn Mauern haben Ohren. Aber Hände kommunizieren lautlos. Die ausgefeilte, nicht hörbare Mimik sorgt zudem für die angemessene „Tonlage“. Denn Haran und Kemal wissen: Jede Information hat ihre Tonlage. Genau das möchte Haran in diesem Moment nutzen. Auf dem Dokument, das auf seinem Tisch liegt, fährt Haran lautlos mit dem Zeigefinger einen geschrieben Satz nach, so als ob er ihn kopieren würde. Dann schaut er zu Kemal auf und gebärdet: „Diese Nachricht noch heute an den Minister. Und nutze die Sprache der Hände. Gebärde diese Information deutlich wahrnehmbar und dieses Wort hier – er zeigt nochmals mit dem Finger auf das Dokument – dieses Wort gebärde wohlwollend, damit meine Gedanken umfassend verstanden werden.“
Liebe Leserin, lieber Leser, so oder so ähnlich könnte es sich am Hofe der Sultane des osmanischen Reiches zugetragen haben, nicht nur um das Jahr 1780, der Zeit Ludwig van Beethovens, der selbst im hohen Alter ertaubte.1 Denn in den Jahren des 16. bis hin zum 18. Jahrhundert waren zeitweise bis zu 200 gehörlose Mitarbeitenden dauerhaft am Hofe der osmanischen Sultane beschäftigt. Sie gehörten auch zum Kreise der wichtigen Kommunikatoren und konnten die Feinheiten der Sprache der Hände am Hofe perfektionieren.2 Es gilt in diesen Zeiten am gesamten Hofstaat als chic Gebärden zu nutzen und zu beherrschen. Zugegeben, im Verhältnis zu den circa 11.000 Dauerbeschäftigten des osmanischen Hofes sind 200 gehörlose Mitarbeitende nicht einmal 2 Prozent. Doch bei wahrscheinlich durchschnittlich 0,01 Prozent gehörloser Menschen gemessen an der Gesamtbevölkerung, sind knapp 2 Prozent ein enormer Anteil. Und verglichen mit der aktuellen Zahl gehörloser Mitarbeitenden im Bundestag 2015 geradezu ein Inklusionswunder damaliger Zeit.3
Die Geschichte von Haran und Kemal ist frei erfunden. Die 200 gehörlosen Angestellten am osmanischen Hof sind dagegen geschichtliche Realität. Eine von vielen, kaum bekannten Realitäten der Gehörlosengemeinschaft.4 So wie sie uns auch in den Jahren unserer Tätigkeit als Gehörlosenseelsorger immer wieder begegneten und von denen wir Ihnen erzählen wollen. Es sind vor allem Geschichten von Menschen, die unser aller Leben und Bewusstsein auch heute noch berühren.
Würde Sie heute auf der Straße ein Fernsehteam zum Thema „gehörlose Menschen“ befragen, dann würden Ihnen Stichworte wie „Gebärdensprache“, „Gesten“ oder „taub“ einfallen. Zur Zeit des Mauerfalls um das Jahr 1990, gerademal zwei Generationen zurück, zeigt sich noch ein ganz anderes Bild. Die meist genannten Stichworte sind damals noch „taubstumm“, „Behinderte“ und „sie können nicht reden“5. In nicht einmal 30 Jahren hat sich, was gehörlose, oder wie wir heute sagen, taube Menschen betrifft, eine enorme Veränderung in unserem persönlichen und im gesellschaftlichen Bewusstsein entwickelt. Filme wie „Jenseits der Stille“6 lösten einen Boom von Gebärdensprachkursen aus und gehörlose Persönlichkeiten7 ermöglichen begeisterte Identifikation mit einer scheinbar ganz anderen Welt. Gebärdensprache ist wieder chic und die Gehörlosengemeinschaft versteht sich nicht als Behindertengruppe, sondern als sprachliche Minderheit. Natürlich tragen auch gehörlose Menschen durch ihr verändertes Verhalten dazu bei, indem sie Mut zeigen und selbstbewusst in der Öffentlichkeit „ihre“ Gebärdensprache pflegen, sie geschickt medial nutzen und uns Faszination und Respekt abverlangen.
Und: Die Gehörlosengemeinschaft besinnt sich in der neueren Zeit intensiv auf ihre kulturellen Wurzeln und Leistungen, entdeckt Geschichten und Persönlichkeiten. die selbst gehörlos sind, wie beispielsweise der weltbekannte österreichische Bildhauer Gustinus Ambrosi.8 Er porträtierte im 20. Jahrhundert beinahe alle Päpste. Oder eine schon vergessene Begebenheit im Leben von Charlie Chaplin, dessen Schauspielstil sehr wahrscheinlich von seinem gehörlosen Freund Granville Redmond stark beeinflusst wurde.9
Tauchen Sie mit diesem Buch mit uns ein in das Leben gehörloser Menschen, ihrer Gehörlosengemeinschaft, ihrer Kultur, ihrer Geschichte und ihrem Alltag, mit all seinen Chancen und Grenzerfahrungen.
Wir, das sind Joachim Klenk und Matthias Schulz. Wir sind beide Gehörlosenpfarrer und arbeiten seit vielen Jahren in unterschiedlichen Funktionen in der Gehörlosengemeinschaft.
In den Jahren 2013 bis 2015 ist dieses Buch aus einem Briefwechsel entstanden. Es ist kein Fachbuch, keine Brieflektüre, mehr ein ganz persönliches Betrachten von Entwicklungen in und außerhalb der Gehörlosengemeinschaft aus zwei unterschiedlichen Perspektiven über einen Zeitraum von mehr als zwanzig Jahren. Joachim Klenk berichtet aus der Perspektive eines Gehörlosenseelsorgers, der im nationalen und internationalen kirchlichen Bereich agierte.
Matthias Schulz hingegen erzählt aus der Perspektive eines Gehörlosenpfarrers an einer psychiatrischen Klinik, in der es eine spezifische Station für gehörlose und hörgeschädigte Menschen gibt.
Unser Anliegen ist Sie, liebe Leserin und lieber Leser, zu sensibilisieren und zu begeistern für all die positiven Entwicklungen in unserer Gesellschaft, um gehörlosen Menschen und ihren Familien die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Dieses Anliegen beinhaltet jedoch auch gesellschaftskritisch zu fragen, welche Rolle institutionelle Sozialangebote verinnerlicht haben und wo konzeptionelle Ausrichtungen auch nicht bedachte Folgen haben können. Uns bewegt im Dialog, wo und wann gehörlose Menschen leichtfertig, unbedacht oder gar fachlich inkompetent in Kategorien gesteckt werden, ohne wahrgenommen zu werden.
Wählen Sie sich einen schönen Abend für diese Lektüre und beginnen Sie mit dem in Fotos abgebildeten visuellen Gebärdenlied des Nürnberger Gebärdenchores. Stellen Sie einen wohlschmeckenden Wein eines gehörlosen Winzers bereit10 oder brühen Sie einen schmackhaften Gebärdentee auf11. Schauen Sie sodann gen Himmel, wo der Stern Algol II für Sie leuchtet, den zu Napoleons Zeiten der gehörlose Astronom John Goodricke12 entdeckte. Lassen Sie sich von uns gedanklich entführen. Freuen Sie sich auf interessante Einblicke in eine Lebenswelt, in der gehörlose-taube Menschen und ihre Familien ein anderes, dennoch völlig normales Leben führen.
Unser Buch ist zudem eine Verbeugung, verbunden mit großem Dank, vor den vielen tauben Menschen, ihre Familien, ihre Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, die wir kennenlernen durften und erleben. Nicht wenige sind heute gute Freundinnen und Freunde. Gott seis gedankt.
Joachim Klenk & Matthias Schulz
Grafik: Stefanie Lindnau, Grafikerin, gehörlos
Gebärdenlied „Gott ist unsere Hoffnung“
Gott ist unsere Hoffnung
Gott ist unsere Zuversicht
Gott ist unsere Stärke
Ich bin nicht allein
Du bist nicht allein
Gott ist da.
Gott ist gegenwärtig
Jetzt bin ich frei, frei, wirklich frei.
Gott …
… ist unsere Hoffnung
… ist unsere Zuversicht
… ist unsere Stärke.
Ich bin nicht allein, Du bist nicht allein
Gott ist gegenwärtig.
Jetzt bin ich frei, frei, wirklich frei.
Tor, Tor – aufgewachsen neben der „Taubstummenschule“ – Joachim Klenk erzählt
Foto: Klenk
Tor, Tor, jubelt der kleine 8-jährige Junge auf einem Bolzplatz in Würzburg. Wums, ein Schlag auf die Nase streckt ihn sogleich nieder. Ein anderer Junge hat seinen Gefühlen mit seinen kräftigen Armen Ausdruck verliehen. Das Tor hätte so nicht fallen dürfen, ist zu vermuten. Ein sportlicher Austausch darüber ist nicht möglich. Der 8-Jährige hört, kann aber nicht gebärden. Der andere Junge kann gebärden, aber nicht hören.
Hätten sich die beiden unterhalten können, wäre es vielleicht anders gekommen. Der taube Junge hätte vielleicht von dem großen blauen Haus nebenan erzählt, seiner Schule für gehörlose Kinder. Der 8-Jährige hätte sich vielleicht für die Gebärden und Gebärdensprache interessiert. Doch kommunizieren können sie nicht, nur mit den Fäusten. So kommt es wie es kommen muss: Tor und Wums!
JK
Der 8-jährige Junge in dieser kleinen Begebenheit bin ich, Joachim Klenk. Zufall oder nicht, ich bin neben der Gehörlosenschule in Würzburg aufgewachsen, die damals noch Taubstummenanstalt heißt. Keine 200 Meter von unserer Wohnung entfernt. Natürlich haben wir immer wieder mit gehörlosen Jungs Fußball auf dem Bolzplatz gespielt. Bis, ja bis ich am Boden lag. Dann wollte ich nicht mehr. Erst später beginne ich zu verstehen, dass wir zwei Jungs schlicht keine ausreichende Kommunikation zustande bringen. Vergessen habe ich diese Begebenheit nie. Das Gefühl einer ganz besonderen Welt mit ebenso besonderen Menschen begegnet zu sein, verliert sich nicht mehr in meinem Leben. Einschätzen kann ich all das erst als 25-jähriger Student, als ich bereits ein Praktikum in der Gehörlosenseelsorge hinter mir habe. Den anderen Jungen, Thomas ist sein Name, habe ich übrigens drei Jahrzehnte später in meiner Funktion als Gehörlosenpfarrer getraut. Symbolisch darf ich ihm nach der Trauung meine Faust auf seine Nase setzen. Seitdem sind wir quitt. Man trifft sich eben immer zweimal im Leben.
MS
Was oder wer hat dich nach diesem Erlebnis dann doch zur Mitarbeit in der Gehörlosenseelsorge inspiriert?
JK
Die Gebärdensprache zu lernen hat mich inspiriert. Ich finde es faszinierend visuell zu kommunizieren. Genauso wichtig ist mir die Frage der gesellschaftlichen Benachteiligung gehörloser Menschen. Vor allem durch meine Mutter hatte ich schon sehr früh besondere Antennen für diese Fragen entwickelt. Sie lehrte mich seit frühester Kindheit „sozial“ zu denken. So machte ich mir schon als Grundschulkind immer wieder Gedanken über Situationen, in denen Kinder ausgegrenzt werden. Ich fragte mich, was es bedeutet ständig an Grenzen zu stoßen, vieler Bildungsmöglichkeiten beraubt zu sein, subtile Diskriminierung tagtäglich zu erleben. Darüber nachzudenken, reizt mich bis heute. Die evangelische Gehörlosenseelsorge hat mir mit ihren unglaublich interessanten Handlungsfeldern die Möglichkeit gegeben über viele Jahre und fachlich sehr intensiv über solche Fragen nachzudenken.
MS
Hast du Menschen getroffen, Vorbilder, die dir heute noch wichtig sind?
JK
Ja, natürlich. Ich bezeichne sie lieber als „Leuchttürme“, die mir bis heute den Weg weisen. Dazu gehören im Gehörlosenbereich mein Förderer, Freund und Mentor Pfarrer Volker Sauermann1. Er war über 25 Jahre Leiter der evangelischen Gehörlosenarbeit in Bayern, ein fachlicher Kenner der Entwicklungen, ein theologisch fundierter Pragmatiker und einer, der Talente entdeckt. Pfarrer Sauermann gründete die bayerischen Gebärdenchöre, verfeinerte die Liturgie in Gebärden und sorgte erstmals für selbstbestimmte Mitbestimmung gehörloser Gemeindemitglieder in den Gehörlosengemeinden. Seine zukunftsweisenden Einschätzungen aus den 1980er Jahren sind weitgehend alle eingetreten. In den vergangenen Jahren kam noch ein nordischer zwei Meter großer Hüne hinzu, Terje Johnsen aus Oslo. Ein, nein der Gehörlosenpfarrer aus Norwegen und langjähriger Präsident der internationalen Vereinigung „International Ecumenic Working Group“ (IEWG)2. Er ließ mich den internationalen Horizont entdecken und führte mich in den internationalen Diskurs ein. Terje Johnsen setzte in Norwegen eigene Kirchen nur für Gehörlosengemeinden durch. Dazu eine verpflichtende universitäre Ausbildung von GehörlosenpfarrerInnen und die Anstellung von PfarrerInnen in seiner Kirche3, die selbst gehörlos sind. Die Anstöße beider Männer waren und sind bahnbrechend.
MS
Sind auch Frauen Vorbilder für dich?
JK
Natürlich auch Frauen, zwei, mir sehr liebe Kolleginnen und Gehörlosenpfarrerinnen. Zum einen Pfarrerin Babro Brattgard aus Schweden, die es in einzigartiger Weise versteht, gehörlose Mitarbeitende zu fördern, zu qualifizieren und zu Säulen kirchlicher Arbeit heranreifen zu lassen. Selten habe ich eine Pfarrerin erlebt, die mit solch einer begeisternden Ausstrahlung agiert, getragen von ausgezeichnetem fachlichem Wissen. Zum anderen muss ich Pfarrerin Sabine Fries aus Berlin erwähnen, die heute als Dozentin an Universitäten tätig ist. Sie ist die bisher einzige Pfarrerin in Deutschland, die selbst gehörlos ist. Eine ganz hervorragende Theologin, eine sensibel und zugleich angenehm fordernde taube Pfarrerin und eine strahlende Frau auf dem Parkett der Deaf Society. Durch ihre Dozententätigkeit an der Humboldt Universität und inzwischen auch in Landshut hat sie mir stets die Möglichkeit geschenkt, durch „ihre“ Augen zu sehen und immer wieder neu aus dieser Perspektive die Lebenssituationen gehörloser Menschen, darunter vieler meiner Freunde, zu begreifen. Ihre „weichen“ Gebärden, z.B. von Psalmen, sind reine Poesie nicht nur für meine Augen.
MS
Was und wo sind deine ersten Erfahrungen mit fehlgeleiteter Gehörlosenseelsorge?
JK
Leider ist es ein eindrücklich negativer Versuch eines Gehörlosenpfarrers bei einem Fernsehinterview auf dem Kirchentag 1995 in Hamburg. Der Kollege versuchte mit fragmentarischen Gebärdenkenntnissen ein Fernseh-Interview zu geben. Ich schlug damals innerlich die Hände über dem Kopf zusammen. Seine Gebärden spiegelten eine mir fremde innere Einstellung, die gehörlose Menschen unbewusst zu Objekten macht und als eigenständige Persönlichkeit nicht mehr wahrnimmt. Nicht gehörlose Menschen und ihre Lebensentwürfe standen bei ihm im Mittelpunkt, sondern er selbst. Ein Ärgernis, das ich erst einmal verarbeiten musste. Heute bin ich froh, dass mir damals junge gehörlose Mitarbeitende aus unserer Gehörlosenjugend bei eben demselben Interview ein ganz anderes Bild vermittelten: Selbstbestimmt, wissbegierig, selbstbewusst, fit in Glaubensfragen, verbunden mit einer großen Portion Charme. Ihre Gebärden begeisterten selbst die Fernsehleute. Diese Erfahrung ist mir sehr wichtig. Ich empfinde sie wie wohltuende Strahlen des Himmels.
MS
Wie muss man sich deine Ausbildung vorstellen?
JK
In Seminaren, Workshops und in Gehörlosengemeinden rund um den Globus. Am meisten habe ich in der bayerischen Gehörlosenseelsorge gelernt, daran gibt es keinen Zweifel. Mein Privileg war es, an der Seite von Pfarrer Volker Sauermann zu lernen. Zudem in ein Team eingebettet zu sein, das in einer Zeit des Umbruchs in den 1990er Jahren sehr innovativ agierte. Viele bundesweit beachtete Projekte haben wir entwickelt, gehörlose und hörende Fachmitarbeitende gemeinsam. Das war eine tolle Zeit. Wenn ich heute zurückschaue, dann entdecke ich eine Breite in meiner damaligen Ausbildung, die nur wenige in dieser Weise durchlaufen dürfen. In den letzten Jahren habe ich mich vor allem in der Linguistik, in Kommunikationstheorien und im Beraterbereich weitergebildet und Coachings durchgeführt.
MS
Wann hast du begonnen in der Gehörlosenseelsorge hauptamtlich zu arbeiten?
JK
1992, damals in Nürnberg, als erster Gehörlosenjugendpfarrer in Deutschland. Eine Stiftung finanzierte diese einmalige Stelle. Mein Auftrag war es, Organisationsstrukturen und praktische Angebote für gehörlose Kinder und Jugendliche bzw. deren Geschwister in ganz Bayern aufzubauen. Das hat auch funktioniert, aber nur weil wir von Anfang an gehörlose Jugendliche als Mitarbeitende schulten und aufbauten. Viele von ihnen sind heute als hauptamtliche Mitarbeitende in der evangelischen Landeskirche oder in Verbänden aktiv. Der andere Bereich ist die Projektentwicklung. Die CD ROM „Der barmherzige Samariter“ war ein solches Projekt mit einem Budget von DM 80.0004. Übrigens, die damals erste religiös-gebärdensprachliche CD-ROM im deutschsprachigen Raum.
MS
Was hast du vorher gemacht?
JK
In Studium und Beruf habe ich immer die besonderen Herausforderungen gesucht. Ich bin schlicht sehr neugierig, erfahre gerne vom Leben anderer. Zudem spreche ich viele „soziale Sprachen“. Das erleichtert mir den Zugang zu Menschen. All das und meine Zusatzausbildungen helfen mir beim Zugang zu Menschen bis heute.
MS
Was macht dich als Gehörlosenseelsorger aus?
JK
Aus meiner Sicht meine Fähigkeit zu erhöhter Empathie, großer Begeisterungsfähigkeit und einem angeborenen Talent für körperlichen und visuellen Ausdruck. Dazu eine große Portion Freude an der Kommunikation. All das sind Geschenke. Alles andere kann man lernen. Das ist dann harte Arbeit, Fleiß und Disziplin. Da ich aus dem Sport komme, ist Letzteres für mich nie ein Problem gewesen.
MS
Hast du einen speziellen Stil?
JK