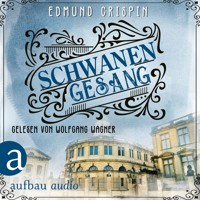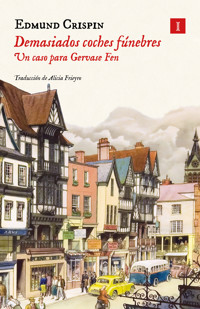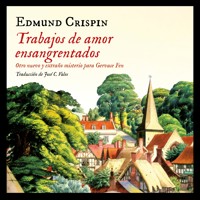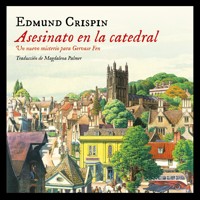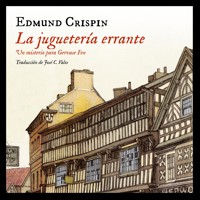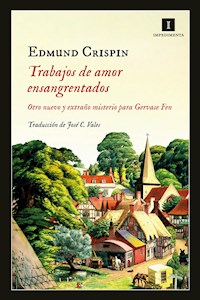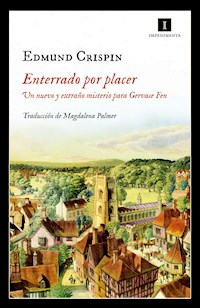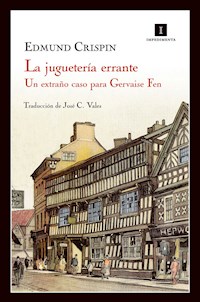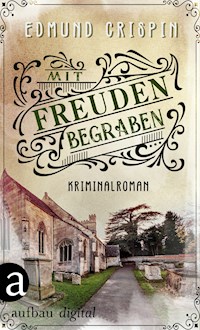
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Professor Gervase Fen ermittelt
- Sprache: Deutsch
»Im Grunde bin ich ein Naturwissenschaftler, den es reizt, Abstecher in die trügerische Literaturwissenschaft zu unternehmen. Das erkennen Sie auch an meinem klaren und präzisen Verstand.«
England Ende der 40er Jahre. Oxford-Professor und Exzentriker Gervase Fen, wie er selbst betont, der einzige Literaturwissenschaftler der Kriminalliteratur, der je Detektiv wurde, hat es sich in den Kopf gesetzt, Lokalpolitiker zu werden. Das Dörfchen Sanford, in das es ihn für seinen Wahlkampf verschlägt, erscheint zunächst ruhig und friedlich. Doch der Schein trügt. Der Ort verbirgt ein Geheimnis und wer der Wahrheit zu nahekommt, bereut es schnell. So ergeht es auch Fens unglücklichem Bekannten D.I. Bussy, der während geheimer Ermittlungen erstochen wird. Jetzt hat der Amateurdetektiv gleich zwei Probleme: Er muss nicht nur den Mörder finden, sondern ist obendrein auch noch zum aussichtsreichsten Kandidaten der anstehenden Wahl avanciert ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Edmund Crispin
Edmund Crispin (eigentlich Bruce Montgomery) wurde 1921 geboren. Er studierte an der Merchant Taylors School und am St. Johns College Oxford moderne Sprachen und war dort zwei Jahre als Organist und Chorleiter tätig. Nach kurzer Lehrtätigkeit widmete sich Crispin ganz dem Komponieren - hauptsächlich von Filmmusik - und dem Schreiben. Einige Jahre war er Krimi-Kritiker bei der Sunday Times in London. Bis zu seinem Tod im Jahre 1978 lebte Crispin in Devon.
Informationen zum Buch
Der Held: Gervase Fen ist begeisterter Professor für Englische Literatur und damit, wie er selbst betont, der einzige Literaturwissenschaftler der Kriminalliteratur, der je Detektiv wurde. Ein Exzentriker, der sein gewaltiges Weltwissen abwechselnd hinter Naivität und Arroganz verbirgt. Für ihn ist alles ein großes Spiel.
Der Schauplatz: Ende der 1940er Jahre im verschlafenen Sanford, unweit von Oxford.
Das Motto: »Im Grunde bin ich ein Naturwissenschaftler, den es reizt, Abstecher in die trügerische Literaturwissenschaft zu unternehmen. Das erkennen Sie auch an meinem klaren und präzisen Verstand.«
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Edmund Crispin
Mit Freuden begraben
Roman
Aus dem Englischenvon Eva Sobottka
Inhaltsübersicht
Über Edmund Crispin
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Impressum
Begraben am Montag – im Grab schön gesund,
Begraben am Dienstag – je Grab bloß ein Pfund.
Begraben am Mittwoch – am Grab sich zu laben,
Begraben am Donnerstag – mit Freuden begraben.
Begraben am Freitag – im Grab wie sonst keins,
Begraben am Samstag – begraben um eins.
Begraben am Sonntag im Mittagsgebimmel
Bekommst du den Priester und fährst in den Himmel.
Volksmund
Für Peter Oldham
Kapitel 1
»Sanford Angelorum, alles aussteigen«, rief der Stationsvorsteher. »Sanford Angelorum, alles aussteigen.«
Nach einer kurzen Denkpause fügte er hinzu: »Endstation«, dann verschwand er durch eine Tür mit der Aufschrift PRIVAT von der Bildfläche.
Gervase Fen, der allein in einem engen, stickigen Abteil vor sich hingedöst hatte, aus dessen Polstersitzen bei jeder Berührung schwarze Staubwolken aufstiegen, erwachte und setzte sich auf.
Er spähte durchs Fenster in die sommerliche Dämmerung hinaus. Ein kümmerlicher, buckliger Bahnsteig bot sich ihm dar, auf dessen gegenüberliegender Seite unkrautartige Gewächse wucherten, was man mit etwas gutem Willen als gartenbaulichen Versuch hätte weiten können. Ein leerer Süßwarenautomat lag wie das Opfer eines Roboterkrieges umgekippt auf der Seite und rostete vor sich hin. Daneben stand eine Packkiste, aus der der Kopf eines kleinen Huhns hervorschaute, das ein leises, empörtes Gackern hören ließ. Doch keine Spur menschlichen Lebens war zu entdecken, und hinter dem Bahnhof lag nichts Einladenderes als schier endlose Felder und Wälder, die in der sinkenden Dämmerung bläulich schimmerten.
Dieser Ausblick missfiel Fen; er fand ihn nichtssagend und langweilig. Allerdings blieb ihm außer Murren nichts übrig. Er murrte kurz und verließ dann mit seinem Gepäck das Abteil. Zunächst schien es, als sei er der einzige Fahrgast, der hier ausstieg, aber kurz darauf bemerkte er, dass dem nicht so war. Ein blondes, adrett gekleidetes Mädchen um die zwanzig war aus einem der anderen Waggons gestiegen. Sie blickte sich unschlüssig um und ging dann auf den Ausgang zu, wo sie ein rechteckiges Stück grünen Kartons in einen Mülleimer fallen ließ, auf dem FAHRKAHRTEN stand; dann verschwand sie. Fen ließ sein Gepäck auf dem Bahnsteig liegen und folgte ihr.
Auf dem Bahnhofsvorplatz, einer nicht weiter umgrenzten Kiesfläche, standen jedoch keine Transportmittel bereit, und abgesehen von den sich entfernenden Schritten des Mädchens, das in der gekrümmten Bahnhofsauffahrt außer Sichtweite verschwunden war, machte sich eine entmutigende Stille breit. Fen ging zum Bahnsteig zurück und suchte das Büro des Stationsvorstehers auf, wo der Stationsvorsteher an einem Tisch saß und mit trübsinniger Miene eine kleine, ungeöffnete Flasche Bier anstarrte. Bei der Störung blickte er resigniert auf.
»Besteht die Möglichkeit, dass ich ein Taxi bekommen könnte?«, fragte Fen.
»Wohin wollen Sie denn, Sir?«
»Ins Dorf Sanford Angelorum. Zum ›Fish Inn‹.«
»Tja, vielleicht haben Sie Glück«, räumte der Stationsvorsteher ein. »Ich will sehen, was ich tun kann.«
Er ging zum Telefon und sprach hinein. Fen sah von der Türschwelle aus zu. Hinter ihm stieß der Zug, mit dem er gekommen war, ein schwaches, asthmatisches Pfeifen aus und rollte rückwärts an. Bald darauf war er, leer, in die Richtung verschwunden, aus der er gekommen war.
Der Stationsvorsteher beendete das Gespräch und schleppte sich zurück zu seinem Stuhl.
»Das geht in Ordnung, Sir«, sagte er, und sein Tonfall klang leicht selbstgefällig, so wie der einer Hebamme, die die Nachricht vom glücklichen Ausgang einer schwierigen Geburt überbringt. »Der Wagen wird in zehn Minuten hier sein.«
Fen bedankte sich bei ihm, gab ihm einen Schilling und ließ ihn weiterhin die Flasche Bier anstarrend zurück. Fen kam der Gedanke, der Stationsvorsteher könnte eventuell dem Alkohol abgeschworen haben und nun in wehmütigen Erinnerungen an verbotene Gelüste schwelgen.
Das Huhn hatte seinen Kopf durch eine besonders enge Öffnung in der Packkiste gesteckt und war nun nicht mehr in der Lage, ihn wieder einzuziehen. Verwirrt starrte es auf ein recht neues Wahlplakat mit einem unvorteilhaften Foto und der Aufschrift: »Eine Stimme für Strode ist eine Stimme für den Wohlstand.« Der Zug war außer Hörweite; eine Krähenkolonie war auf dem Nachhauseweg zu ihrem Schlafplatz, dunkle Umrisse vor einem grauen Himmel. Schemenhaft flatternd verfolgte eine Fledermaus im Zickzackkurs ihr Abendessen. Fen setzte sich auf einen seiner Koffer und wartete. Er hatte seine Zigarette ausgedrückt und war gerade dabei, sich eine weitere anzuzünden, als ihn das Motorengeräusch eines Autos in rege Betriebsamkeit versetzte. Mit seinen Koffern beladen kehrte er auf den Bahnhofsvorplatz zurück.
Entgegen aller Voraussicht erwies sich das Taxi als neu und komfortabel, und auch der Fahrer stellte sich als überraschend attraktiv heraus – eine schlanke, hübsche junge Frau mit schwarzen Haaren, die blaue Hosen und einen blauen Pullover trug.
»Tut mir leid, dass Sie warten mussten«, sagte sie freundlich. »Manchmal passe ich diesen Zug ab, nur für den Fall, dass jemand ein Taxi braucht, aber an manchen Abenden sitzen nicht einmal Fahrgäste darin, sodass es die Mühe kaum lohnt … Kommen Sie, ich helfe Ihnen mit Ihrem Gepäck.«
Die Koffer wurden verstaut. Fen bat um die Erlaubnis, vorn sitzen zu dürfen, was ihm gestattet wurde. Sie fuhren los. In der zunehmenden Dunkelheit gab es außerhalb des Wagens wenig, was seine Aufmerksamkeit verdient hätte, und Fen betrachtete stattdessen seine Begleiterin, bewunderte, was er im Schimmer des Armaturenbrettes von ihren großen grünen Augen, ihrem vollen Mund und ihrem seidig glänzenden Haar erkennen konnte.
»Taxi zu fahren«, wagte er sich vor, »ist für eine junge Frau doch ziemlich ungewöhnlich?«
Für einen Moment wendete sie ihren Blick von der Straße ab, um ihn anzusehen. Sie sah einen hoch gewachsenen, schlanken Mann mit einem geröteten, fröhlichen, glatt rasierten Gesicht und braunem Haar, das ihm in widerspenstigen Stacheln vom Kopf abstand. Seine Augen mochte sie besonders. Sie verrieten Nachsichtigkeit und Verständnis, außerdem eine Vorliebe für Unfug.
»Ja, das mag schon sein«, stimmte sie zu. »Es ist aber gar nicht so übel, wenn man sein eigenes Taxi besitzt, so wie ich. Es war eine gute Investition.«
»Dann machen Sie das schon länger?«
»Nein. Eine Zeit lang habe ich bei Boots gearbeitet – in der Leihbücherei. Aber aus irgendeinem Grund war es nicht das Richtige für mich. Meine Haut wurde dort so trocken wie Pergament.«
»Ich fürchte, das ist unvermeidlich, wenn man den ganzen Tag von Büchern umgeben ist.«
Aus der Finsternis vor ihnen tauchte ein umgestürzter Baum auf. Er blockierte die Fahrbahn zur Hälfte. Die junge Frau stieß einen harmlosen Fluch aus, bremste ab und umfuhr das Hindernis vorsichtig.
»Ich vergesse jedes Mal, dass das blöde Ding da liegt«, erklärte sie. »Ein Sturm hat ihn umgeweht, und Shooter hätte ihn schon vor Tagen aus dem Weg räumen sollen. Es ist sein Baum, also ist es auch seine Pflicht. Aber seine Nachlässigkeit ist wirklich unverantwortlich.« Während sie wieder beschleunigte, fragte sie: »Waren Sie schon einmal in dieser Gegend?«
»Noch nie«, sagte Fen. »Sie scheint mir ziemlich abgelegen«, fügte er vorwurfsvoll hinzu. Er hatte für das Ländliche nichts übrig.
»Sie wohnen im ›Fish Inn‹?«
»Ja.«
»Nun, vielleicht sollte ich Sie lieber warnen …« Die junge Frau unterbrach sich. »Nein, schon gut.«
»Was soll das bedeuten?«, hakte Fen besorgt nach. »Was wollten Sie eben sagen?«
»Gar nichts … Wie lange werden Sie bleiben?«
»Es kann doch nicht gar nichts gewesen sein.«
»Nun, es macht ohnehin keinen Unterschied. Sie können nirgendwo anders unterkommen, selbst wenn Sie es wollten.«
»Werde ich es denn wollen?«
»Ja. Nein. Ich will damit sagen, es handelt sich wirklich um eine sehr nette Gaststätte, nur … Ach, verdammt, Sie werden es ja selbst sehen. Wie lange bleiben Sie?«
Da offensichtlich war, dass er keine weiteren Erklärungen erwarten konnte, beantwortete Fen die Frage. »Bis nach dem Wahltag«, sagte er.
»Oh! … Sie sind doch nicht etwa Gervase Fen?«
»Doch.«
Neugierig sah sie ihn an. »Ja, das hätte ich mir denken können …«
Nach einer Weile fuhr sie fort:
»Sie beginnen reichlich spät mit Ihrem Wahlkampf, wissen Sie das? Es bleibt nur noch eine Woche, und ich habe nicht ein einziges Flugblatt von Ihnen gesehen, oder ein Plakat oder sonst was.«
»Mein Agent«, sagte Fen, »kümmert sich darum.«
Über diese Antwort dachte die junge Frau schweigend nach.
»Hören Sie«, meinte sie, »Sie sind doch ein Professor aus Oxford, nicht wahr?«
»Für englische Literatur.«
»Nun, für was auch immer … Ich meine, warum lassen Sie sich zu den Parlamentswahlen aufstellen? Wie sind Sie auf den Gedanken gekommen?«
Sogar sich selbst konnte Fen nicht immer erklären, warum er tat, was er tat, und ihm fiel keine überzeugende Antwort ein.
»Es ist mein Wunsch«, sagte er feierlich, »dem Allgemeinwohl zu dienen.«
Die junge Frau warf ihm einen zweifelnden Blick zu.
»Zumindest«, verbesserte er sich, »ist das einer meiner Beweggründe. Außerdem hatte ich das Gefühl, in der Auswahl meiner Interessengebiete viel zu einseitig geworden zu sein. Haben Sie jemals die definitive Ausgabe der Werke von Langland besorgt?«
»Natürlich nicht«, sagte sie beleidigt.
»Ich aber. Ich bin soeben damit fertig geworden. So etwas hat merkwürdige psychologische Folgen. Man beginnt sich zu fragen, ob man verrückt ist. Und das einzige Heilmittel dagegen ist die Beschäftigung mit etwas vollkommen anderem.«
»Unterm Strich kommt dabei heraus, dass Sie sich für Politik nicht ernstlich interessieren«, sagte die junge Frau unerwartet streng.
»Nun ja, nein, so würde ich das nicht sagen«, entgegnete Fen abwehrend. »Nach meiner Wahl stelle ich mir vor, …«
Aber sie schüttelte den Kopf. »Wissen Sie, man wird Sie nicht wählen.«
»Warum nicht?«
»Dieser Sitz ist fest in konservativer Hand. Sie haben keine Chance.«
»Wir werden sehen.«
»Sie mögen den Ablauf ein wenig durcheinander bringen, aber letztendlich haben Sie keinen Einfluss auf das Endergebnis.«
»Wir werden sehen.«
»Wie es aussieht, können Sie sich glücklich schätzen, wenn Ihnen Ihre Kaution nicht flöten geht. Worauf genau basiert Ihre Kampagne?«
Fens Selbstvertrauen geriet ein wenig ins Wanken. »Ach, Wohlstand«, sagte er vage, »und Exporte und Freiheit und solche Dinge. Werden Sie für mich stimmen?«
»Ich bin nicht wahlberechtigt – zu jung. Außerdem mache ich Wahlkampf für die Konservativen.«
»Oh je«, sagte Fen.
Sie verfielen in Schweigen. Bäume und Gestrüpp tauchten für einen Augenblick schemenhaft aus der Dunkelheit auf und wurden dann wie von einer riesigen Hand wieder beiseite gewischt. Das Scheinwerferlicht fiel auf kleine Blumen, die im Heckendickicht schliefen, und die Luft jenes unvergleichlichen Sommers spülte in warmen Wellen durch die offenen Fenster herein. Kaninchen flohen Schutz suchend in ihre tiefen, sicheren Gänge, wobei ihre weißen Hinterteile fieberhaft auf und ab hüpften. Und nun fiel die Straße sanft ab; vor sich konnten sie zum ersten Mal die verstreuten Lichter des Dorfes erkennen …
Mit einem entschlossenen Tritt drückte die junge Frau die Bremse bis zum Anschlag durch. Der Wagen drehte sich um die eigene Achse und schleuderte sie in ihren Sitzen nach vorn, dann rutschte er ein Stück und kam schließlich ganz zum Stehen. Im gleißenden Scheinwerferlicht tauchte eine menschliche Gestalt auf.
Sie blinzelten, unfähig, ihren Augen zu trauen. Die Gestalt blinzelte zurück, allem Anschein nach nicht weniger verstört als sie. Dann warf sie ihre Arme in die Luft, gab ein bizarres, pfeifendes Geräusch von sich und stürzte auf die Dornenhecke am Straßenrand zu. Unter Schmerzen bahnte sie sich einen Weg durch eine kleine Öffnung und verschwand im nächsten Moment, aus einer Vielzahl von Kratzern blutend, aus ihrem Blickfeld.
Fen starrte hinterher. »Träume ich?«, fragte er.
»Nein, selbstverständlich nicht. Ich habe ihn auch gesehen.«
»Ein Mann – ein ziemlich großer, junger Mann?«
»Ja.«
»Mit einem Kneifer?«
»Ja.«
»Und vollkommen unbekleidet?«
»Ja.«
»Das erscheint mir ein wenig seltsam«, meinte Fen zurückhaltend.
Die junge Frau hatte jedoch nachgedacht, und ihre anfängliche Verwirrung war einer Erkenntnis gewichen. »Ich weiß, was das war«, sagte sie. »Das war ein entlaufener Irrer.«
Diese Erklärung erschien Fen zu abgedroschen, was er auch sagte.
»Nein, nein«, redete sie weiter, »der Punkt ist, dass es hier ganz in der Nähe tatsächlich eine Irrenanstalt gibt, Sanford Hall.«
»Andererseits könnte es jemand gewesen sein, der schwimmen war und dem seine Kleider gestohlen wurden.«
»Auf dieser Seite des Dorfes kann man nirgendwo baden. Nebenbei konnte ich erkennen, dass seine Haare trocken waren. Und sah er Ihrer Meinung nach nicht auch verrückt aus?«
»Doch«, gab Fen ohne Zögern zurück, »das tat er. Ich nehme an«, fügte er wenig begeistert hinzu, »dass ich jetzt eigentlich aussteigen und ihn verfolgen müsste.«
»Er wird mittlerweile über alle Berge sein. Nein, sobald wir im Dorf sind, werden wir es Sly melden, unserem Polizisten. Das ist alles, was wir tun können.«
Tief in Gedanken fuhren sie weiter bis nach Sanford Angelorum, und bald hatten sie das »Fish Inn« erreicht.
Kapitel 2
Vom architektonischen Standpunkt betrachtet machte das »Fish Inn« keinen sonderlich gewagten Eindruck.
Es handelte sich um einen ziemlich großen Würfel aus grauem Stein, durchbrochen von schmalen, symmetrisch angeordneten und recht gewöhnlich aussehenden Türen und Fenstern, umgeben von mysteriösen, unidentifizierbaren Haufen von etwas, das möglicherweise Baumaterial war. Auf dem Aushängeschild, sichtbar im Licht, das durch die mit Gardinen verhängten Fenster der Bar fiel, waren düstere Unterwassertiefen und sich schlängelnde Algen abgebildet. Von diesem Hintergrund hob sich ein silberfarbenes, nicht weiter spezifiziertes und im Profil abgebildetes Meerestier ab, das teilnahmslos auf irgendeinen Gegenstand jenseits des Schildes starrte.
Während Fens Taxi vor dem Eingang anhielt, drang Lärm aus dem Gebäude, der einen Tumult vermuten ließ; hin und wieder war deutlich eine durchdringende Frauenstimme herauszuhören.
»Für mich klingt das, als hätten sie bereits von dem Irren erfahren«, sagte das Mädchen. »Ich werde mit Ihnen hineingehen, nur für den Fall, dass Sly dort ist.«
Von innen erwies sich die Herberge als weitaus einnehmender als von außen. Es gab nur einen Schankraum, hatte man doch die mühselige Unterteilung in ›Gästelounge‹ und öffentliche Bar‹ vermieden. Dieser Schankraum jedoch war groß und weitläufig und erstreckte sich über die halbe Länge und fast die gesamte Breite des Hauses. Die Eichentäfelung, die offenbar von einem wesentlich älteren Gebäude stammte, war im Faltwerkstil geschnitzt. Verblichene, aber dennoch fröhliche Chintzvorhänge verhüllten die Fenster, unter der Decke durchzog ein schwerer Balken den Raum, und flache Kissen minderten die Unbequemlichkeit der Stühle und Bänke aus Eichenholz zumindest teilweise. Die Raumdekoration bestand zum größten Teil aus belanglosen Drucken von Jagdszenen aus dem neunzehnten Jahrhundert, auf denen feiste Gentlemen auf den Rücken unglaublich großer, knochiger Pferde zu sehen waren. Davon abgesehen hing über dem Kamin eine Leinwand, die so groß war, dass sie so etwas wie das Kronjuwel der Sammlung bildete.
Es handelte sich um ein Seestück. Im Vordergrund waren einige Männer in Ölzeug auf einem schmalen Streifen Strand damit beschäftigt, etwas an Land zu ziehen, das so ähnlich aussah wie ein einfaches Rettungsboot. Zur Linken lag ein Hafen mit einer Mole, und der bedrohliche Himmel darüber kündigte das Herannahen eines Unwetters an. Der Rest des zur Verfügung stehenden Platzes – und der war beträchtlich – wurde von einer sturmgepeitschten, mit weißen Schaumkronen bedeckten See eingenommen, auf der eine Reihe von Segelbooten in verschiedene Richtungen unterwegs waren.
Wie Fen erfahren sollte, stellte diese lebhafte Darstellung unter den Stammgästen des Inns einen unerschöpflichen Streitpunkt dar. Vom Standpunkt eines Seemannes aus betrachtet hatte sich eine solche Szene auf Gottes Erde nie zugetragen, und könnte es auch nie. Diese Möglichkeit schien jedoch in Sanford Angelorum noch keinem in den Sinn gekommen zu sein. Nach dem festen Glauben der Bewohner musste es sich, hatte der Künstler es doch auf diese Weise gemalt, auf ebendiese Weise zugetragen haben. In der Folge postulierte man verworrene und wenig einleuchtende Methoden der Navigation, um das Geschehen zu erklären. Zugegebenermaßen wurde die Diskussion in einem Fachjargon geführt, den die Sprecher ebenso wie die Zuhörer nur unzureichend beherrschten; der Durchschnittsengländer wird sich aber Unkenntnis in Fragen der Seefahrt ebenso wenig eingestehen wie seine Unkenntnis in Bezug auf Frauen.
»Nein, nein; ich sag dir doch, der Schoner da, der luvt die Leeküste an.«
»Und was ist dann mit dem Zweimaster? Was ist mit dem Zweimaster?«
»Das ist kein Zweimaster, Fred, das ist ’ne Ketsch.«
»Er war nicht komplett aufgetakelt, wenn er die Leeküste anluven wollte.«
»Hör mal, da ist Norden, siehst du, und das bedeutet, dass der Wind aus Nord-Nordost kommt.«
»Und wie zum Teufel willst du dann erklären, dass die Welle über die Mole schwappt?«
»Das ist die Strömung.«
»Die Strömung, sagt er. Stell dich nicht blöd, Bert, wie soll eine Welle denn eine Strömung sein?«
»Eine Strömung. Auch nicht schlecht.«
Zu dem Zeitpunkt, als Fen zum ersten Mal seinen Blick auf das Objekt richtete, hatte es jedoch für die Stammgäste des Inns vorübergehend seine Anziehungskraft verloren. Der Grund dafür war eine ältere Dame mit gelbbrauner Perücke, die inmitten eines Zuhörerkreises zusammengesackt auf einem Stuhl saß, ebenso aufgeregt wie wirr eine Geschichte zum Besten gab und währenddessen immer wieder an ihrem Brandy nippte.
»Ob ich Angst hatte?«, fragte sie gerade. »Und ob, ich wäre beinahe tot umgefallen vor Angst! Da war er, weiß und nackt lauerte er hinter den Ginsterhecken vor Sweetings Bauernhof. Und eben wie ich da vorbeigehen will, springt er geradewegs auf mich zu und macht ›Buh!‹, macht er, ›Buh!‹«
Daraufhin kicherte ein junger Flegel leise.
»Und was geschah dann?«, wollte jemand wissen.
»Ich hab nach ihm geschlagen«, gab die ältere Dame zurück, während sie zur Illustration herumfuchtelte, »mit meinem Schirm.«
»Haben Sie ihn getroffen?«
»Nein«, antwortete sie sichtlich zerknirscht. »Er entwischte mir und machte sich auf und davon, noch ehe ich ›papp‹ sagen konnte. Und wie es mir gelang, mich bis hierher zu schleppen erde ich mein Lebtag nicht erfahren. Ja, danke schön, Mrs. Herbert, ich nehme noch einen, wenn es Ihnen recht ist.«
»Muss ein Exhibizist gewesen sein«, kam ihr einer der Anwesenden zu Hilfe. »Wenn einer rumgeht und sich im Adamskostüm zeigt, sagt man Exhibizist dazu.«
Dieser Einwand rief, haftete ihm doch ein Beigeschmack von intellektuellem Snobismus an, nicht sonderlich viel Beachtung hervor. Ein stumpfsinnig wirkender Mann mittleren Alters, der die Uniform eines Schutzmannes trug, stand, ein Notizbuch in der Hand, daneben und sagte:
»Nun, ich denke, wir wissen alle, wer das war. Einer von diesen Spinnern ist von da oben aus dem Sanatorium ausgebrochen.«
»Seit zehn Jahren«, sagte ein finster dreinschauender alter Mann, »wusste ich, dass das irgendwann passieren würde. Habe ich es nicht immer und immer wieder gesagt?«
Die angewiderte Stille, mit der diese rhetorische Frage aufgenommen wurde, bestätigte nachdrücklich, dass er genau das gesagt hatte. Dieselbe Abneigung muss Kassandra nach dem Fall Trojas entgegengeschlagen sein; denn es ist ausgesprochen ärgerlich, wenn sich entgegen aller Vernunft herausstellt, dass jemand mit einer fixen Idee auch noch Recht hatte.
Der Experte in Sachen psychologische Fachterminologie sagte: »Wir sollten einen Suchtrupp auf die Beine stellen, das sollten wir tun. Wahrscheinlich ist der Kerl gefährlich.«
Aber der Schutzmann schüttelte den Kopf. »Ich schätze, darum wird sich Dr. Boysenberry kümmern. Ich werde ihn gleich mal anrufen, obwohl ich mir sicher bin, dass er schon über alles Bescheid weiß.« Er räusperte sich und sprach lauter. »Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung«, verkündete er. »Überhaupt keinen Grund zur Beunruhigung.«
Die Besucher des Lokals, die nicht das geringste Anzeichen eines solchen Gefühls gezeigt hatten, nahmen diese Ankündigung teilnahmslos auf, abgesehen nur von der älteren Dame mit der Perücke, die der Brandy inzwischen ein klein wenig vorlaut gemacht hatte.
»Tse!«, stieß sie hervor. »Das sieht dir ähnlich, Will Sly. Ein Vogel Strauß bist du, jawohl, der seinen Kopf in den Sand steckt. ›Kein Grund zur Beunruhigung‹, wie? Wenn er dich angefallen hätte, würdest du dich nicht hinstellen und sagen, es gäbe ›keinen Grund zur Beunruhigung‹. Da war er plötzlich, weiß und nackt, wie ein böser Geist …«
Ihr Publikum war jedoch an einer Wiederholung der Geschichte sichtlich uninteressiert. Es zerstreute sich und wandte sich wieder seinen wartenden Gläsern und Bierkrügen zu. Der finster dreinschauende Mann drängte sich den Gästen mit selbstzufriedenen Wiederholungen seiner weisen Voraussicht auf. Der Psychologe machte sich daran, mit leiser Stimme einem ausschließlich männlichen Zuhörerkreis einen ebenso detaillierten wie schlüpfrigen Vortrag über die Gewohnheiten von Exhibizisten zu halten. Und Konstabler Sly, gerade im Begriff, das Telefon des Lokals in Beschlag zu nehmen, entdeckte zum ersten Mal, seit sie und Fen die Bar betreten hatten, die junge Frau aus dem Taxi.
»Hallo, Miss Diana«, sagte er und grinste unbeholfen. »Nehme an, Sie haben schon gehört, was passiert ist?«
»Das habe ich, Will«, sagte Diana, »und ich glaube, dass ich Ihnen ein Stück weiterhelfen kann.« Sie erzählte von der Begegnung mit dem Verrückten.
»Ah«, entgegnete Sly. »Das könnte sehr hilfreich sein, Miss Diana. Er lief in Richtung Sanford Condover, sagen Sie?«
»Ja, soweit ich es sehen konnte.«
»Ich werde Dr. Boysenberry über diese Tatsache in Kenntnis setzen«, sagte Sly umständlich. Er wandte sich an die Frau, die hinter dem Tresen stand. »Kann ich mal das Telefon benutzen, Myra?«
»Du kannst das Telefon benutzen, mein Lieber«, sagte Myra Herbert, »wenn du zwei Pennies in die Kiste steckst.« Sie war eine lebhafte und attraktive waschechte Londonerin, Mitte dreißig, mit schwarzem Haar, einem gescheiten Zug um den sinnlichen Mund und grünen Augen, die ungewöhnlich, aber wunderschön geschnitten waren.
»Dienstgespräch«, erklärte Sly von oben herab. Myra machte keinen Hehl aus ihrer Verachtung. »Du und deine verdammten Dienstgespräche«, sagte sie. »Mein Gott!«
Sly ignorierte sie und drehte sich um, woraufhin das erste Opfer des Irren, seinen unmittelbar bevorstehenden Aufbruch vorausahnend, einen Anflug von Lethargie abschüttelte und fragte:
»Und was ist mit mir, Will Sly?«
Sly war gereizt. »Nun, Mrs. Hennessy, was ist mit Ihnen?« »Ich hoffe doch nicht, dass Sie vorhaben, mich allein nach Haus gehen zu lassen.«
»Mrs. Hennessy, ich habe Ihnen schon erklärt«, sagte Sly, während er mühsam um Fassung rang, »dass kein Grund zur Beunruhigung besteht.«
Mrs. Hennessy stieß ein schrilles, gekünsteltes Lachen aus. »Hören Sie sich den an«, beschwor sie Fen, der mit gebanntem Ausdruck seine potentiellen Wähler begutachtete. »Hören Sie sich Mister Besserwisser Sly an.« Plötzlich wurde ihr Tonfall drohend. »Wenn’s nach Ihnen ginge, Will Sly, hätte man mich vor meiner eigenen Haustür ermorden können, und wie stünden Sie dann da? He? Das möchte ich gern wissen. Und wozu mein Mann seine Steuern zahlt, würde ich gerne wissen. Ich habe ein Recht darauf, beschützt zu werden, nicht wahr? Ich habe …«
»Hören Sie, Mrs. Hennessy, ich habe meine Pflicht zu erfüllen.«
»Pflicht!«, wiederholte Mrs. Hennessy erbost. »Er sagt« – und an dieser Stelle wandte sie sich wieder Fen zu, diesmal im Tonfall einer Person, die ein kostbares Geheimnis preisgibt – »er sagt, er hätte seine Pflicht zu erfüllen … Und was für Pflichten du zu erfüllen hast, Will Sly. Was war denn, als Alf Braddocks Äpfel gestohlen wurden? He? Was war damit? Pflicht!«
»Ja, Pflicht«, sagte Sly, dem diese unsportliche Anspielung sehr zusetzte. »Und darüber hinaus werde ich, falls ich Sie noch einmal dabei erwische, wie Sie hier außerhalb der Schankzeiten Guinness zu bestellen versuchen …«
Diana unterbrach ihre Indiskretionen.
»Ist schon gut, Will«, sagte sie. »Ich werde Mrs. Hennessy nach Haus bringen. Es ist kein großer Umweg für mich.«
Dieses Angebot ließ wieder Frieden und den Anschein von Eintracht einkehren. Sly ging zum Telefon hinüber. Fen bezahlte Diana und holte sein Gepäck aus dem Taxi. Myra läutete den Feierabend ein. Die Gesellschaft leerte widerwillig ihre Gläser und zog von dannen, während Diana mit engelsgleicher Geduld einen neuen, noch hitzigeren Bericht von Mrs. Hennessys Abenteuer über sich ergehen ließ.
Fen stellte sich Myra vor, trug sich ins Gästebuch ein und wurde auf sein Zimmer geführt, welches komfortabel eingerichtet und peinlich sauber war. Er bestellte, bekam und verzehrte Bier, Kaffee und Sandwiches.
»Und wenn Sie nichts dagegen haben«, sagte er zu Myra, »würde ich morgen früh gerne bis zehn Uhr ausschlafen.«
Hierüber brach Myra zu seiner Verwunderung in schallendes Gelächter aus, und als sie sich endlich wieder beruhigt hatte, sagte sie: »Sehr wohl, mein Lieber. Gute Nacht!«, und tänzelte anmutig aus dem Zimmer. Fen blieb zurück und zerbrach sich bedrückt den Kopf darüber, was ihre unerwartete Reaktion zu bedeuten hätte.
An jenem Abend trug sich lediglich noch ein Zwischenfall zu, der für Fen von Interesse war. Während er das Badezimmer aufsuchte, erhaschte er einen kurzen Blick auf jemanden, der ihm irgendwie bekannt vorkam – einen dünnen Mann mit rotbraunem Haar, ungefähr in seinem Alter, der einen Bademantel trug und in einem der anderen Zimmer verschwand. Aber der Zusammenhang, der ganz sicher irgendwo in Fens Kopf bestand, wollte sich partout nicht herstellen lassen. Fen grübelte immer noch über das Problem nach, als er in sein Bett stieg, gab aufgrund mangelnder Erleuchtung schließlich aber doch auf. Als die Kirchturmuhr Mitternacht schlug, lag er in tiefem Schlaf.
Kapitel 3
Nach einer Weile, die ihm wie ungefähr zehn Minuten erschien, wurde er auf fürchterliche Weise durch eine Art eindringliches Hämmern geweckt, das von irgendwo aus einem der unteren Stockwerke zu ihm heraufdrang.
Er tastete nach seiner Uhr, richtete seinen Blick unter großen Schwierigkeiten auf das Zifferblatt und erkannte, dass es erst sieben war. Draußen vor dem Fenster herrschte strahlender Sonnenschein. Fen nahm das missvergnügt zur Kenntnis. Er war von Natur aus ein Spätaufsteher, und mit den Verheißungen jungfräulichen Tageslichts konnte er nur wenig anfangen.
Unterdessen schwoll der Lärm im Erdgeschoss an und vervielfältigte sich, so als träfen ständig neue Helfer ein. Und in diesem Moment wurde Fens benebeltem Verstand klar, dass hier vermutlich der Grund für Dianas rätselhafte Warnung lag, ebenso wie für Myras nicht zu unterdrückenden Frohsinn am Vorabend, als er gesagt hatte, er wolle ausschlafen. Er stöhnte entsetzt auf.
Das wirkte wie ein Signal.
Es klopfte an der Tür. Nachdem er ein ›Herein‹ gekrächzt hatte, trat ein Mädchen von so unglaublicher Schönheit ins Zimmer, dass Fen sich fragte, ob er träume.
Das Mädchen war von Natur aus platinblond. Ihre Gesichtszüge waren makellos. Ihre Figur bildete die Quintessenz aus allen Pin-up-girls. Und sie bewegte sich mit einer Natürlichkeit und ruhigen Gelassenheit, die verrieten, dass ihr ihre eigene Vollkommenheit – so unglaublich es auch schien – ganz unbewusst war.
Mit einem strahlenden Lächeln stellte sie ein Frühstückstablett auf dem Nachttisch ab und verließ den Raum, nur um gleich darauf mit Fens auf Hochglanz polierten Schuhen wiederzukommen. Sie lächelte ihm noch einmal zu, und im nächsten Moment war sie verschwunden wie ein Tragbild aus einem Märchen – obgleich er sich keine Prinzessin vorstellen konnte, nicht einmal in Tolkiens Erzählungen, die ihren Geliebten nach der Hochzeitsnacht mit ähnlichen Freuden überraschte.
Benommen zündete Fen sich seine Morgenzigarette an, und das wohlbekannte Gefühl des Unbehagens, das sich bei ihr stets einstellte, brachte für ihn so etwas wie Normalität zurück. Er nippte an seinem Tee und grübelte über das Hämmern nach, das unvermindert weitergegangen war. Bald darauf wurde es unterbrochen von einem Geräusch, das verdächtig nach dem Einsturz eines großen Gerüstes klang.
Eilig stand Fen auf, wusch sich, rasierte sich, zog sich an und ging nach unten.
Der ganze Haushalt war auf den Beinen – wie es auch anders nicht hätte sein können, außer man hätte zu einem starken Schlafmittel gegriffen. Fen fand Myra Herbert draußen im Hof, wo sie ein kleines, gräuliches, unansehnliches Schwein betrachtete. Scheinbar überlegte es gerade, was es mit dem Tag anfangen solle.
»Guten Morgen, mein Lieber«, begrüßte Myra ihn gut gelaunt. »Gut geschlafen?«
»Bis zu einem gewissen Punkt«, erwiderte Fen reserviert. Sie zeigte auf das Schwein. »Haben Sie so etwas schon mal gesehen?«
»Tja, nun, da Sie es erwähnen … nein, ich glaube nicht.« »Ich bin betrogen worden«, sagte Myra, und das Schwein grunzte, womit es scheinbar seine Zustimmung bekanntgab. »Ich habe mir ein junges Schweinchen hübsch und rosig vorgestellt, wissen Sie, und irgendwie fröhlich. Dieses hier allerdings … mein Gott. Ich füttere und füttere es, aber es wächst kein Stück.«
Gemeinsam dachten sie eine Weile über das Phänomen nach. Ein vorbeikommender Landarbeiter gesellte sich dazu.
»Wird auch nicht größer, was?«, bemerkte er.
»Was ist los mit ihm, Alf?«
Der Landarbeiter überlegte. »Es ist ’n Nichtsnutz«, lautete schließlich seine Diagnose.
»Ein was?«
»Ein Nichtsnutz. Sie vergeuden Ihre Zeit damit, es zu mästen. Es wird nie fetter werden, ’n Nichtsnutz setzt einfach nicht an. Am besten verkaufen Sie’s.«
»Nichtsnutz«, wiederholte Myra voller Abscheu. »Das ist ein verdammt netter und aufmunternder Gedanke, so früh am Morgen.«
Der Landarbeiter ging weiter.
»Eins muss ich ihm aber lassen«, sagte Myra, womit sie das Schwein meinte, »es ist sehr zutraulich, was meiner Ansicht nach zu seinen Gunsten spricht.«
Sie wandten sich wieder der Herberge zu. Myra regte an, dass Fen doch jetzt sein Frühstück bestellen könnte, und Fen stimmte zu.
»Aber was ist denn los?«, fragte er und wies in Richtung des Hämmerns.
»Renovierungsarbeiten, mein Lieber. Die Innenräume werden renoviert.«
»Aber Handwerker fangen nie so früh am Morgen an.«
»Oh, das sind keine Handwerker«, sagte Myra geheimnisvoll. »Das heißt …«
Sie kamen an eine Tür in einem Teil des Erdgeschosses, den Fen noch nicht kannte. Von hier schien der meiste Krach herzurühren. »Sehen Sie«, sagte Myra.
Die geöffnete Tür gab den Blick auf eine dichte Staubwolke frei, in der undeutlich Gestalten zu erkennen waren, die, so hatte es den Anschein, einer ausgesprochen destruktiven Beschäftigung nachgingen. Eine der Gestalten, ein Mann, tauchte plötzlich dicht vor ihnen auf. Er sah aus wie das Opfer eines Tüncheimers in einem Slapstick-Film.
»Morgen, Myra«, sagte er mit entwaffnender Herzlichkeit. »Alles in Ordnung?«
»Oh, durchaus, Sir.« Myra zeigte sich besonders höflich und respektvoll. »Der Gentleman hier wohnt bei uns, und er hat sich gefragt, was vor sich geht.«
»Morgen, Sir«, sagte der Mann. »Hoffentlich haben wir Sie nicht allzu früh aus den Federn geworfen.«
»Kein bisschen«, gab Fen kühl zurück.
»Ich fühle mich schon viel besser« – der Mann klang weniger überzeugt als entschlossen – »jetzt, wo ich jeden Morgen um sechs aufstehe … Es ist der sichere Weg zu guter Gesundheit, wie ich es immer gesagt habe.«
Er bekam einen heftigen Hustenanfall; sein Gesicht verfärbte sich zunächst rot, dann blau. Vorsichtshalber schlug Fen ihm zwischen die Schulterblätter.
»Nun denn, zurück an die Arbeit«, sagte er, als er sich wieder ein wenig erholt hatte. »Ich sage Ihnen eins, Sir: Wenn Sie eine Sache erledigt haben wollen, dann sprechen viele gute Gründe dafür, sie persönlich zu erledigen.« Jemand streifte ihn mit einer kleinen Spitzhacke am Arm. »Vorsicht, verdammt noch mal, das hat weh getan …«
Er ließ sie stehen, um sich im weiteren Detail über dieses Unglück auszulassen. Sie schlossen die Tür und gingen weiter.
»Wer war das?«, fragte Fen.
»Mr. Beaver, der Besitzer des Gasthauses. Ich bin nur der Manager. Eigentlich ist er Textilgroßhändler.«
»Ich verstehe«, sagte Fen, der nichts verstand.
»Essen Sie erst einmal was zum Frühstück, mein Lieber«, tröstete sie ihn, »ich erkläre es Ihnen später.«
Myra geleitete ihn zu einem kleinen Zimmer, in dem ein Tisch für drei gedeckt war. Zu seinem Entzücken versorgte sie ihn mit Speck, Eiern und Kaffee.
Er war gerade damit fertig geworden und zum Marmeladenteil übergegangen, als die Tür sich öffnete und er zu seiner großen Überraschung das blonde Mädchen erblickte, das im Zug seine einzige Mitreisende gewesen war.
Während sie sich am Tisch niederließ, musterte er sie unauffällig. Obwohl sie weder Dianas erfrischenden, burschikosen Charme noch Myras Munterkeit und auch nicht die filmreife Ausstrahlung seiner blonden Besucherin besaß, war sie trotzdem auf eine zurückhaltende und stille Art hübsch. Es hatte den Anschein, als mischten sich in ihren Gesichtszügen zwei unterschiedliche Linien. Zum Beispiel hatte sie eine ausgesprochen aristokratische Nase, während ihr großer Mund im Gegensatz dazu eine Spur vulgär wirkte. Ihre Augenbrauen verrieten Arroganz, die Augen hingegen Schüchternheit; und in einem Anfall trüber Fantasterei, der nur durch die ungewöhnlich frühe Stunde zu entschuldigen war, bildete Fen sich ein, dass, wenn ein König seine Kurtisane ehelichen würde, wahrscheinlich diese Tochter dabei herauskommen würde.
Außerdem hatte er den Eindruck, als sei das Mädchen nervös, beinahe so, als stünde ihr eine Prüfung mit ungewissem Ausgang bevor. Und ihre Kleidung bestätigte diesen Verdacht. Sie war gut und geschmackvoll, aber etwas an der Art und Weise, wie das Mädchen sie trug, ließ vermuten, dass es sich um ihre Sonntagskleider handelte, dass sie es sich nicht leisten konnte, sie jeden Tag zu tragen, dass sie sie heute trug, um … ja, das war es: um einen guten Eindruck zu machen.
Auf wen, fragte sich Fen. Auf einen potentiellen Arbeitgeber vielleicht? Wenn sie hier wäre, um sich in einem Vorstellungsgespräch um einen begehrten Posten zu bewerben, würde das ihre Anspannung zur Genüge erklären …
Aber würde es das wirklich? Irgendwie spürte Fen, dass es sich bei der Prüfung um etwas handelte, dass viel dringlicher und gleichzeitig viel persönlicher war.
Sie unterhielten sich ein wenig über belanglose Dinge. Fen fragte sie, ob sie schon von dem Verrückten gehört habe, und als er bemerkte, dass sie nichts darüber wusste, erklärte er ihr die Lage. Obwohl ihre Antworten höflich und recht gescheit waren, verrieten sie dennoch, dass sie viel zu abgelenkt war, um sich sonderlich für das Thema zu interessieren.
Er bemerkte, dass sie ihn unentwegt ansah, während er redete, so als versuche sie, seine Absichten von seinem Gesicht abzulesen. Und auch ihre eigene Ausdrucksweise lieferte weiteren Anlass für Mutmaßungen, sprach sie ihre Worte doch auf eine leicht fremdländische Art aus, die er nicht einordnen konnte. Sie war, danach zu urteilen, weder Deutsche noch Italienerin, Französin, Holländerin oder Spanierin. Auch war nicht der Hauch eines Akzentes herauszuhören, was den befremdlichen Effekt ihrer Aussprache erklärt hätte. Bei genauerem Nachdenken lief es darauf hinaus, dass sie, während ihre Vokale klar und akkurat klangen, eine Neigung hatte, die einzelnen Komponenten der jeweiligen Konsonantengruppen zu verwischen und zu vertauschen – Labiale, Gutturale, Sibilanten. Auf diese Weise unterschied sich das ›p‹ kaum vom ›b‹, ebenso wenig wie das ›s‹ vom ›z‹.
Fen musste zugeben, dass er nicht in der Lage war, eine Erklärung dafür zu finden, was ihn leicht gereizt machte.
Er trank seinen Kaffee aus und schaute auf die Armbanduhr. Halb neun. In drei Stunden hatte er einen Termin mit seinem Wahlagenten, aber bis dahin konnte er tun, was ihm beliebte. Und da der Renovierungslärm das »Fish Inn« bis auf weiteres unbewohnbar machte, beschloss er, in den Sonnenschein hinauszugehen und seinen Wahlkreis einmal persönlich in Augenschein zu nehmen. Deswegen verabschiedete er sich von dem Mädchen, wobei er annahm, sie wäre nicht gerade traurig darüber, ihn los zu sein – was er ihr jedoch nicht verübelte.
Vor der Tür begegnete ihm Myra, und er erkundigte sich nach dem Verrückten.
»Tja, mein Lieber, den haben sie noch nicht eingefangen«, sagte sie, »obwohl die vom Sanatorium die ganze Nacht hier herumgetapert sind.«
»Dann war es tatsächlich ein Verrückter?«
»Oh ja. Zuerst habe ich es ja nicht geglaubt. Mrs. Hennessy ist genau die Sorte von übergeschnappter alter Frau, die … wie sagt man doch gleich … sexuelle Zwangsvorstellungen von nackten Männern hat, die sie im Dunkeln anfallen.«
»Aber ich habe ihn auch gesehen«, gab Fen zu bedenken.
Myras Miene deutete an, dass sie nur aus reiner Höflichkeit darauf verzichtete, auch Fen sexuelle Zwangsvorstellungen zu unterstellen.
»Jedenfalls gibt es ihn wirklich«, sagte sie, »und sie haben verlauten lassen, er sei harmlos. Obwohl sie es aus Angst vor einer Massenpanik natürlich kaum zugeben würden, wenn er gefährlich wäre. Meine Meinung über Verrückte ist die: Wenn man wüsste, was sie als Nächstes vorhaben, wären sie nicht verrückt.«
Mit dieser düsteren Prognose ließ sie Fen stehen, nicht ohne ihn vorher noch beiläufig darüber zu informieren, dass die Bar um elf aufmachte.
Er wollte gerade hinausgehen, als sein Blick plötzlich auf das Gästebuch der Herberge fiel, das direkt neben ihm auf einem Tisch lag. Er schaute hinein und erfuhr, dass das Mädchen, mit dem er gefrühstückt hatte, Jane Persimmons hieß, Britin war und in Nottingham wohnte. Und plötzlich fiel ihm ein, dass er sich hier auch Klarheit über den Mann verschaffen konnte, den er am Abend vorher kurz gesehen hatte und dessen Aussehen ihm so bekannt vorgekommen war.
Er blätterte zurück und las interessiert den Eintrag, der unmittelbar vor seinem eigenen stand. Er lautete:
Major Rawden Crawley, Brite, 201 Curzon Street, London.
»Großer Gott«, murmelte Fen bei sich. »Entweder er schert sich nicht darum, oder er bildet sich tatsächlich ein, niemand in dieser Gegend hätte jemals Thackeray gelesen … Wie dem auch sei, vermutlich geht es mich sowieso nichts an.«
Er nahm zur Kenntnis, dass der so genannte Crawley vor zwei Tagen angereist war. Er klappte das Buch zu und ging hinaus in den Hof des Gasthauses.
Keine Wolke war am Himmel zu sehen, aber über Nacht hatte ein kurzer Regenschauer den Staub, der sich in den langen Wochen der Trockenheit angesammelt hatte, von Grashalmen, Blättern und Hecken abgewaschen und sie in ein frisches, lebendiges Grün getaucht. Das nichtsnutzige Schwein fraß geräuschvoll Kartoffeln. Fen überquerte den Hof und trat auf die Hauptstraße des Dorfes hinaus.