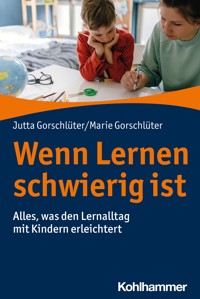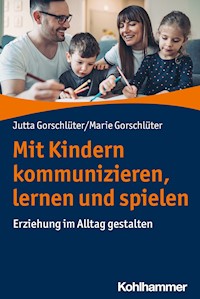
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Was benötigen Kinder, um ihre Talente, Fähigkeiten und Eigenarten zu entwickeln? Das Buch lenkt den Blick auf die alltäglichen Momente des Erziehungsgeschehens, in denen Eltern (aber auch Erzieherinnen und Erzieher) ohne großen Aufwand spielerisch Kompetenzen und Kernfähigkeiten der Kinder fördern. Kernthemen der Darstellung sind dabei der Beziehungsaufbau zwischen Eltern und Kind, die Gestaltung ihrer Kommunikation und die spielerische Festigung von Basiskompetenzen in den verschiedenen Lernbereichen. An ganz konkreten, realitätsnahen Situationen wird der erzieherische Blick geschärft, um daraus wirksame erzieherische Handlungsanleitungen zu entwickeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort
Der Schlüssel zum entspannten Alltag mit Kind
Sprache und Sprechen
»Guck mal, ein Wauwau!« – Macht Babysprache Sinn?
»Apfel, Amsel, Ananas!« – Was den Wortschatz wachsen lässt
»Was machst du da?« – Fragen eröffnen die Welt
Kommunikation und Erziehung
»Darf ich das?« – Regeln und Grenzen auf Augenhöhe
»Ja oder Nein?« – Die Wirkung positiver und negativer Sätze
»Wenn du nicht sofort ...!« – Was Strafen und Drohungen bewirken
»Ich möchte das!« – Was dürfen Kinder entscheiden?
»Ich bin wütend!« – Wie wir auf aggressives Verhalten unserer Kinder reagieren können
»Du Blödmann!« – Wie ein gelungener Umgang mit Schimpfwörtern aussieht
»Sei brav!« – Müssen Kinder sich »gut benehmen«?
»Sie ist so anstrengend!« – Was Kinderohren alles hören
»Gut gemacht!« – Tut Lob gut?
»... dann darfst du gleich fernsehen« – Die Sache mit den Belohnungen
»Aua, mein Bein!« – Was bei Ängsten und Schmerzen hilft
»Ich mag das nicht« – Wie wir die Grenzen unserer Kinder achten
»Ist alles gut?« – Wie wir unsere Kinder im Umgang mit ihren Gefühlen unterstützen
»Ein voller Bauch ...« – Der Wohlfühl-Akku
»Guck mal, eine Schnecke!« – Das wunderbare Tempo der Kinder
»Freitags ist Spaghetti-Tag!« – Wie Familienrituale Sicherheit geben
»Ich brauch mal 'ne Minute« – Entspannte Eltern
»Und nochmal durchsaugen ...« – Wie Haushalt mit Kind funktionieren kann
Psst, spielende Kinder! – Warum Lernen und Spielen dasselbe ist
»Grrrrr, ich bin ein Drache!« – Der kindliche Spielprozess
»Ich hatte das grade!« – Wie das Spiel unter Kindern entspannter wird
»Das ist meins!« – Müssen Kinder teilen?
Bauklotz, Bahn und Bobbycar – Was macht gutes Spielzeug aus?
»Was soll denn mein Kind nun alles können?« – Der lerntherapeutische Blick
Der Bereich der Sprache
Der Bereich der Logik
Der Bereich der Orientierung
Der Bereich der Feinmotorik
Der Bereich der Grobmotorik
Der Bereich von Konzentration und Gedächtnis
Auf den Punkt gebracht ...
Die Autorinnen
Nach langjähriger Tätigkeit als freie Bildungsreferentin und mehrjähriger Arbeit mit jugendlichen Schulverweigerern gründete Jutta Gorschlüter 2003 die lerntherapeutische Praxis »Spielraum Lernen« in Münster, Westfalen. Sie begleitet und unterstützt Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die eine lerntherapeutische Förderung benötigen, hält bundesweit Vorträge und bildet seit 2014 im Rahmen des »Spielraum Lernen«-Fernlehrgangs Lerntherapeut/innen aus. Daneben entwickelt sie Spiel- und Lernmaterialien.
Die Erziehungswissenschaftlerin Marie Gorschlüter arbeitet als Lerntherapeutin mit Kindern, die aufgrund biografischer Traumata, Lernbeeinträchtigungen oder mangelnder Förderung in den ersten Lebensjahren Auffälligkeiten zeigen. Sie ist selbst Mutter zweier Kinder und vermittelt Kindern und Eltern, wie Lernen entspannt und spielerisch ablaufen kann, wie ohne Druck wichtige Basiskompetenzen im Alltag gefestigt werden und was die Grundlagen für eine feste Bindung zwischen Eltern und Kind sind.
Die Bilder in diesem Buch stammen von der Illustratorin und Live-Zeichnerin Charlotte Hofmann. Sie studierte an der Fachhochschule Münster Design und gibt Comic-Zeichenworkshops in Deutschland und der Schweiz.
Jutta Gorschlüter, Marie Gorschlüter
Mit Kindern kommunizieren, lernen und spielen
Erziehung im Alltag gestalten
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.Illustrationen: Charlotte Hofmann
1. Auflage 2023
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:ISBN 978-3-17-042383-1
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-042384-8epub: ISBN 978-3-17-042385-5
Vorwort
Elternsein ist der großartigste, spannendste und oft auch der herausforderndste Job der Welt. Unsere Kinder kommen zu uns als kleine Wundertüten und wir können nur erahnen, was alles in ihnen steckt, welche Talente, Fähigkeiten und Eigenarten sie mit sich bringen. Die Beziehung zu unseren Kindern wird dabei natürlich in hohem Maße dadurch beeinflusst, wie wir mit ihnen sprechen, was wir ihnen vorleben, was wir in unserem Alltag mit ihnen für Prioritäten setzen.
Um zu zeigen, was dies ganz konkret heißt, ist dieses Buch vollgepackt mit Beispielen aus dem Eltern- bzw. aus dem Kinderalltag. Es soll Eltern in ganz konkreten Situationen mit praktischen Tipps zur Seite stehen. Als Lerntherapeutin ist mein Blick hier nicht nur der einer Mutter, sondern auch immer geprägt durch die vielen Momente und Erfahrungen aus der Praxis, die ich im Laufe der Jahre mit Kindern sammeln konnte.
Ich erlebe dort Kinder, die sich beim Lernen schwer tun. Großartige Kinder mit tollen Qualitäten, die jedoch oft mit einem enorm geringen Selbstwertgefühl vor mir sitzen. Die sich wenig zutrauen, nicht um ihre eigenen Stärken wissen und dementsprechend in vielen Bereichen wenig Motivation zeigen, sich auf Neues einzulassen. Kinder, die bei vielen Dingen an ihre Grenzen stoßen – insbesondere beim Lernen. Sei es im sprachlich-kommunikativen, logischen oder motorischen Bereich.
Dafür gilt es, zu wissen, dass die ersten Jahre unseres Lebens die Basis für alles, was noch kommt, ebnen: Für das Lernen, für die anhaltende Motivation Neues entdecken zu wollen, für Mut, Vertrauen, Stärke, Kreativität, Sprache, Logik und eben für viele Fähigkeiten, die für das Lernen und Leben unglaublich wichtig sind.
Was können wir als Eltern also tun, um die Beziehung zu unserem Kind von klein an zu festigen? Eine Beziehung, deren starke Basis weit über die Kindheit hinausgeht?
·Was können und sollten wir unseren Kindern mitgeben, damit sie zu verantwortungsbewussten, respektvollen und selbstsicheren Menschen heranwachsen können, die um ihre Stärken wissen und glücklich sind?
·Wie können wir unsere Kinder spielerisch, ohne viel Aufwand und ohne Druck im Alltag bei der Festigung vieler wichtiger Basiskompetenzen in den verschiedenen Lernbereichen unterstützen? Was bringen wir unseren Kindern bei und worauf kommt es tatsächlich an?
·Wie unterstützen wir unsere Kinder darin, ihren natürlichen Drang Neues auszuprobieren, ihren Mut, ihre Entdeckerfreude beizubehalten?
·Und wie gestalten wir den Alltag mit unseren Kindern so, dass die Kommunikation für beide Seiten entspannt und stressfrei stattfinden kann?
Schauen wir uns an, wo sich die unglaublich vielen Möglichkeiten und Momente verstecken, die uns helfen, eine liebevolle, einfühlsame und verständnisvolle Kommunikation im Alltag mit unseren Kindern zu führen, unsere Kinder und das Band, das sie mit uns verbindet, stark zu halten.
Das Buch ist an vielen Stellen in der Ich-Form geschrieben, da sich die beschriebenen Situationen zu einem Großteil auf Erfahrungen beziehen, die hauptsächlich an meine Person (Marie) geknüpft sind. Dennoch ist es mir sehr wichtig zu betonen, dass die Basis für dieses Buch, das gemeinsame Erarbeiten der Inhalte, der Austausch in einem hohen Maße an meine Mutter Jutta geknüpft sind. Ich danke ihr von Herzen für den regen Austausch und dafür, dass sie mir und meinen Brüdern von klein an all das Wissen vorgelebt hat, auf welches ich nun im therapeutischen und täglichen Umgang mit den Kindern zurückgreifen kann.
Der Schlüssel zum entspannten Alltag mit Kind
Viele Eltern sehen sich heute unter einer Flut von Ratgebern begraben, die ihnen sagen, wann sie ihr Kind wie zu fördern, zu erziehen und wann sie in die kindlichen Entwicklungsprozesse einzugreifen haben, um ihrem Kind das Beste zu ermöglichen. Da ist es verständlich, dass dies nicht selten zu einer völligen Verunsicherung darüber führt, wann jetzt welche Förderung, welche Methodik und welche Form der Erziehung richtig sei.
Wir Eltern planen und tun und machen. Doch häufig läuft eben nicht alles nach Plan, egal wie wunderbar dieser durchdacht ist. Denn, seien wir einmal ehrlich, Kinder sind nicht immer von dem begeistert, was wir uns »Spannendes« überlegt haben, der Alltag mit Kind ist eben oft unvorhersehbar und nicht wie im Bilderbuch. Und das ist auch gut so. Denn genau dieses Unvorhersehbare, dieses Spontane – so anstrengend es manchmal sein mag – birgt wundervolle Chancen, neue Wege mit unseren Kindern zu gehen.
Überhöhte Erwartungshaltungen und die leise Hoffnung auf den »perfekten Alltag« führen dabei nicht selten dazu, dass Eltern frustriert und enttäuscht sind, wenn das Leben mit Kind nicht der Wunschvorstellung entspricht, die sie bewusst oder unbewusst in ihren Köpfen hatten. Der gesellschaftliche Druck dabei, ein Kind zu »erziehen«, das sich »gut benimmt«, das seinem Alter entsprechend in der Lage ist, Dinge zu tun, das vielleicht auch in den Rahmen passt, den sein Geschlecht oder sein soziales Umfeld ihm vorgeben und das später in der Schule und beruflich Erfolge verzeichnen kann, ist dabei zusätzlich für viele nicht unwesentlich – oft tatsächlich, ohne dass man sich dieser Tatsache in all ihrem Ausmaß als Eltern immer bewusst wäre.
Doch so vorbildlich die Intention sein mag, ist die Frage, die sich hier stellt: Sollten wir wirklich planen, was »aus unserem Kind später wird«? Können wir das überhaupt? Können wir es in seinen Vorlieben beeinflussen, wenn wir der Ansicht sind, es sei besser für das Kind »so« oder »so« zu sein? Wenn wir das Kind in eine bestimmte Richtung »erziehen«, handeln wir auf diesem Wege wirklich im Sinne des Kindes?
»Erziehung« – eigentlich gibt dieses Wort nicht das wieder, was das alltägliche Spiel, das Hin und Her zwischen Eltern und Kindern beschreiben sollte. Erziehung klingt zu sehr nach »ziehen« – als würde man an einer Blume ziehen, damit sie höher, schöner, besser wächst. Wir wissen, dass das nicht funktioniert. Eine Blume wächst, wie sie wächst. Ein Ziehen würde wenn dann dazu führen, dass sie abknickt oder reißt und im schlimmsten Fall dann eben gar nicht weiterwächst, wie sie es eigentlich getan hätte.
Wir wollen alle das Beste für unser Kind, da sind wir uns sicherlich einig. Doch Kinder sind keine Projekte. Sie sind eigenständige, individuelle Wunderwerke, die unglaubliches Potenzial in sich tragen. Es ist daher nicht unsere Aufgabe, sie zu formen und ihnen vorzugeben, wie sie sein sollen. Im Gegenteil ist es ein großer Gewinn, wenn wir sehr bewusst darauf achten, dass wir unsere Kinder nicht zu Objekten elterlicher Erwartungen machen. Sich dies bewusst zu machen, ist nicht selten ein herausfordernder Prozess, denn es gilt, loszulassen an einem »Unser Kind soll ... Tennis spielen, so wie ich ... gut sein in Mathe, so wie Oma ... später etwas Künstlerisches machen, ... Arzt werden, wie Papa ...«. Solche oder ähnliche Wünsche trägt wohl jeder Elternteil bis zu einem gewissen Grad in sich. Mal mehr, mal weniger bewusst. Doch eine solche Herangehensweise birgt die Gefahr, viele andere Kompetenzen, Fähigkeiten und Talente unseres Kindes aus dem Blick zu verlieren. Wie traurig wäre es, würden wir unser Kind in eine Richtung drängen, für die es sich nicht von sich aus begeistern kann. Wir möchten doch, dass unsere Kinder vor allem eines sind: glücklich. Dafür sollten wir ihnen die Chance geben, sich in genau die Richtung zu entfalten, die sich für sie richtig anfühlt. Für sie. Nicht für uns. Diese Richtung kann und darf weit entfernt von dem sein, was wir gerne hätten.
Es ist also an uns, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich unser Kind sicher und frei zu dem entfalten kann, was es in sich trägt, was es wird, was es sein möchte. Es ist an uns als Eltern, den Kindern Raum zu lassen, sich zu dem entwickeln, was sie sein möchten.
Dass das nicht immer einfach ist, muss man sicherlich keinem Elternteil erzählen. Nicht selten erlebt man, dass Kinder für die Dinge, die den elterlichen Vorstellungen entsprechen, gelobt und vorangetrieben werden – sicherlich meist in den besten Absichten. Wir laufen dabei jedoch Gefahr, dass unsere Kinder selbst das Gefühl dafür verlieren, was eigentlich ihre innerste Vision wäre, was sie gerne können würden, wofür sie sich eigentlich begeistern würden – sie reagieren nur auf die Wünsche der Eltern und verbiegen sich, ohne es zu merken, in eine Richtung, in die sie vielleicht von sich aus niemals gelaufen wären. Je häufiger und länger dies passiert, desto weniger können sich diese Kinder auch im Laufe ihres Lebens gar nicht mehr darauf zurückbesinnen, was sie eigentlich einmal machen wollen, wo eigentlich einmal ihr ganz individueller Kern sie hingelockt hätte, wo sie sich eigentlich hätten verwirklichen wollen.
Wie gesagt, ich unterstelle allen Eltern an dieser Stelle eine durchweg positive Absicht. Und dennoch lohnt es sich, hier sehr wachsam zu sein. Hinzu kommt, dass man im Alltag mit Kind fast täglich auf Situationen stößt, in denen entweder die Eltern oder die Kinder an ihre Grenzen kommen – körperlich und emotional, weil Dinge eben nicht nach Plan laufen, weil es unterschiedlichste Konflikte gibt, die irgendwie gehandhabt werden müssen, weil irgendjemand einfach keine Energie mehr hat, erschöpft oder gelangweilt ist.
Und natürlich gibt es wohl niemanden, der in JEDER Erziehungssituation ALLE Grundregeln der gelungenen Kommunikation beachtet und IMMER vollkommen ruhig, entspannt und konsequent handelt – übrigens auch nicht die »Erziehungsprofis«. Jeder ist gelegentlich gestresst, übermüdet und reagiert mal »vollkommen daneben«. Und auch das ist in Ordnung. So sehr wir unsere Kinder lieben, Elternsein ist eben ein Fulltime-Job, der gelegentlich wirklich an den Nerven zerren kann.
Es ist jedoch viel gewonnen, wenn man sich die Basis einer entspannten Kommunikation bewusstmacht und darum weiß. Es geht bei dieser Basis niemals darum, die eine Erziehungsmethode gegen die andere in den Bewertungsvergleich zu stellen. Es ist vollkommen gut und richtig, dass wir als Eltern nicht alle vollkommen gleich erziehen.
Zunächst ist bei Erziehung erst einmal wichtig: Erziehung sollte sich richtig anfühlen. Sie sollte uns als Eltern ein Bauchgefühl vermitteln, das uns sicher sein lässt, unserem Kind – und somit indirekt auch uns – etwas Gutes zu tun. Unser Bauchgefühl, unsere Intuition, ist etwas, was in der heutigen Gesellschaft traurigerweise nicht mehr viel Beachtung bekommt – Rationalität und Logik haben der Intuition leider in vielen Situationen den Platz genommen. Dabei ist gerade dieses Bauchgefühl der beste natürliche Kompass, den wir haben, um herauszufinden, was »richtig« ist, was sich gut anfühlt, wie etwas sein darf, wie wir sein dürfen. Das mag in der Erziehung dann individuell bei den einen so aussehen, bei den anderen so. Denn sicher gibt es Eltern, die sich nicht an einem Hüpfen des Kindes auf dem Bett stören, während andere hier schon eine Grenze überschritten sehen.
Wenn es also gar nicht an einer konkreten Erziehungsmethode hängt, was wir unserem Kind mitgeben, was ist es dann? Eigentlich ist es ganz einfach:
·
Der Schlüssel zu einer gelungenen und harmonischen Familiensituation ... sind wir Eltern.
·
Der Schlüssel zu einem selbstbewussten Kind, das um seine Stärken weiß, das sich geliebt fühlt und mit offenem umsichtigen Blick durch die Welt geht, ... sind wir Eltern.
·
Der Schlüssel zu einem Kind, das auch im Erwachsenenalter noch zu uns kommt, sich uns anvertraut und unseren Rat sucht, ... sind wir Eltern.
·
Der Schlüssel zu einem glücklichen Kind, das seinen eigenen Weg geht, ... sind wir Eltern.
Denn die Basis für all das, was in diesem Buch an konkreten Tipps zu finden ist, bildet nur eines: Eine intensive und ehrliche Beziehung zu unserem Kind. Ein sicherer Hafen. Ein Ankerpunkt, zu dem unser Kind jederzeit zurückkommen und auf den es mit absoluter Sicherheit vertrauen kann. Ein Rahmen, in dem unser Kind so sein darf, wie es ist. In dem es mit all seinen Eigenarten gesehen, angenommen und angeregt wird, sich selbst und die Welt um sich in seiner kindlichen/kindischen Art im Spiel zu entdecken.
Spannend ist in diesem Zusammenhang, dass das Wort »kindisch« in Alltagssituationen häufig sehr negativ verwendet wird. »Sei nicht so kindisch!« klingt es dann etwa. Dabei ist gerade das »kindische« Verhalten, eben das Verhalten der Kinder, genau das, was sie zu dem Wunderbaren macht, was sie sind. Denn das »Kindische«, was die Kinder mit sich bringen, zeigt sich besonders in ihrer Spontaneität, ihrer Unvoreingenommenheit, Kreativität und ihrer schier grenzenlosen Begeisterungsfähigkeit für Kleinigkeiten.
Im Idealfall ist Erziehung daher nicht einseitig. Nicht nur die Kinder können von uns lernen. Im besten Fall lassen wir es zu, auch von ihnen zu lernen. Wenn wir es als Erwachsene schaffen, in dem einen oder anderen Alltagsmoment etwas »kindischer« zu sein und Situationen aus den Augen eines Kindes zu betrachten, können wir entdecken und erfahren, was ein solches Verhalten für wunderbare Möglichkeiten für die Eltern-Kind-Zeit in sich trägt.
Sprache und Sprechen
»Guck mal, ein Wauwau!« – Macht Babysprache Sinn?
Die meisten Eltern machen es intuitiv richtig, indem sie mit ihren Babys und Kleinkindern etwas langsamer sprechen, wichtige Wörter betonen und diese häufiger wiederholen. Sie bilden kürzere Sätze und sprechen bei Babys oft mit etwas erhöhter Stimme. Man hat herausgefunden, dass Babys diese etwas höhere Tonlage besser wahrnehmen können und als angenehmer empfinden.
Manchmal hört man jedoch auch, dass Eltern mit ihren Kindern sprechen, indem sie sogenannte »Babywörter« benutzen. Das klingt dann etwa so: »Heia machen«, »Aua haben«, »Ei ei machen« oder »Winke winke machen«, »Wauwau«, »Teita gehen« usw.
Hier passiert Folgendes: Das Kind soll lernen, dass Dinge und Tätigkeiten Namen haben. Das lernt es natürlich ohnehin. Ziel ist, dass ein Kind irgendwann weiß: »Das Tier da heißt HUND.« Wenn ich jedoch einem Kind zuerst ein »falsches« Wort beibringe, nämlich das Wort »Wauwau« für Hund, mache ich es ihm gar nicht, wie oft angenommen, einfacher. Denn das Kind lernt jetzt: »Aha, dieses Tier heißt Wauwau.« Und merkt sich das. Bis irgendwann jemand kommt und sagt: »Das ist ein Hund.« Jetzt muss das Kind das alte Wort aus dem Repertoire löschen und durch das neue richtige ersetzen. Das hat zur Folge, dass das Kind sich zweimal anstrengen muss, sich dieses Tier mit richtigem Namen zu merken. Vorteilhaft wäre es, ihm gleich beim ersten Mal das richtige Wort zu sagen.
Neurologisch ist seit Langem erwiesen, dass das Umlernen (also das zuerst Gelernte zu löschen und gegen das Neugelernte auszutauschen) für das Gehirn mit deutlich mehr Anstrengung verbunden ist, als es direkt korrekt abzuspeichern.
Für Kinder ist dieses Prinzip von »Das ist ein Hund und der macht wuff« übrigens wichtig für das spätere Erlernen der Buchstaben. Sie müssen nämlich irgendwann unterscheiden können: Dieser Buchstabe heißt F (gesprochen »eff«) und in einem Wort klingt der Buchstabe F, als würde die Luft aus einem Luftballon entweichen. Diese Unterscheidung ist essenziell, um richtig Schreiben und insbesondere Lesen zu können. Und das Prinzip ist eben dasselbe, wie bei »Das Tier heißt Hund und der klingt bzw. macht wuff«.
Zur Babysprache gehört auch, dass die meisten Eltern zunächst von sich und auch von dem Kind in der dritten Person sprechen.
·
Papa zum Kind gerichtet: »Papa hat auch Hunger.«
·
Mama zum Kind gerichtet: »Guck mal, Spatz, Mama hat dir eine Blume gemalt.«
·
Eltern an Frida gerichtet: »Na, möchte Frida auch etwas trinken?«
Da das Kind zunächst natürlich lernen soll, wie sein eigener Name lautet und wie die anderen heißen, ist diese Vorgehensweise durchaus nachvollziehbar. Auch weil Kinder natürlich erst einige Zeit brauchen, um das Konzept von »Ich«, »Du« etc. zu verstehen. Wichtig ist hier allerdings – spätestens nach dem zweiten Geburtstag – den Absprung zu schaffen, zu einer Sprache, wie wir sie normalerweise sprechen. Denn es sagt doch nicht Lara morgens zu ihrem Mann Claas: »Schatz, Lara hat Hunger. Hat der Claas auch Hunger?«
Das Kind soll auf diesem Wege auch den sicheren Umgang mit Personalpronomen (»ich«, »du«, »wir«, ...) ebenso wie mit besitzanzeigenden Fürwörtern (»mein«, »dein«, »unser«, ...) erlernen. Um hier Sicherheit zu erlangen, sollte in Gesprächen mit dem Kind diese Wörter auch als so normal verwendet werden, wie sie eben sind. Abgesehen davon hat eine Aussage wie »Die Mama möchte nicht, dass du ihr an den Haaren ziehst!« viel weniger Aussagekraft als ein »ICH möchte das nicht!«.
Auch mit kleinen Kindern und sogar Babys sollte man also schon sprachlich angemessen und »vernünftig« sprechen. Natürlich langsam, verständlich und ihrem Wortschatz angemessen, aber eben trotzdem »normal« und in dem Wissen, dass sie dadurch sehr schnell viel Neues lernen – und ohnehin schon viel mehr verstehen, als sie bis dahin aktiv sprechen können.
Denn der passive Wortschatz (also das, was ich verstehe) ist immer größer als der aktive (also das, was ich selber schon an Wörtern beim Sprechen verwenden kann). Dieses Phänomen kennt jeder, der schon einmal eine Fremdsprache gelernt hat. Man versteht schnell eine Menge. Das aber in eigene Sätze zu verpacken und selber frei zu sprechen, ist bekanntermaßen eine ganz andere Sache.
Kindern geht es ganz ähnlich. Nur weil sie viele Wörter noch nicht aussprechen und verwenden können, heißt das nicht, dass sie sie nicht verstehen. Man kann oft beobachten, dass Kinder, mit denen man seit Geburt sehr differenziert gesprochen hat, wenn sie dann selbst beginnen zu sprechen, plötzlich auf einen unglaublichen Wortschatz zurückgreifen können. Denn Kinder sind schon früh in der Lage, zu lernen, dass dies ein Dackel und der andere ein Dalmatiner ist. Und dass beides Hunde sind. Sie können sich ebenso sehr wohl merken, dass dies eine Butterblume und das da ein Löwenzahn ist.
Diese Unterscheidung ist außerdem so wichtig, weil Kinder auf diese Weise trainieren Ober- und Unterkategorien zu bilden: »Tisch, Stuhl, Bank und Sessel – das sind alles ... Möbel!« Diese Fähigkeit wird in fast allen Intelligenztests überprüft. Sie ist für das Lernen, wie auch allgemein im Leben, sehr wichtig. Wenn ich in Kategorien denken und damit Dinge einordnen kann, erkenne ich schneller Parallelen und logische Zusammenhänge, was wiederum allgemein bei der Orientierung hilft und somit Sicherheit gibt.
»Apfel, Amsel, Ananas!« – Was den Wortschatz wachsen lässt
Wenn ich mein Kind beim Sprechenlernen unterstützen möchte, hilft es, wenn ich schon früh damit beginne, sprachlich zu kommentieren, was ich gerade tue bzw. was das Kind gerade tut. So hört mein Kind wiederholt die Begriffe für Dinge und Tätigkeiten (und die logischen Abläufe dazu).
·
»So, jetzt schütte ich das Mehl in die Rührschüssel. Jetzt brauchen wir noch den Schneebesen. Oh, du hältst den ja schon in der Hand ...«
·
»Oh, da halten wir uns jetzt besser mit den Händen gut fest, wenn wir zusammen auf der Schaukel sitzen!«
·
»Schau mal, dieser Schraubendreher mit dem Kreuz passt zu unserer Schraube. Damit ziehen wir die Schraube ganz fest.«
·
»Jetzt warten wir noch fünf Minuten und dann kommt schon Opa. Lass uns mal auf der Uhr nachsehen, wo die Zeiger stehen. Oh, der eine ist auf der 8. Die sieht ja aus wie ein Schneemann.«
Kommentieren kann ich insbesondere auch Abläufe, die bei dem Kind vielleicht noch unsicher sind. »Hm, hast du eine Idee, warum der Klotz nicht in das eckige Loch passt? Siehst du ein anderes Loch im Holzwürfel, in das der Klotz hineinpasst?«
Tatsächlich ist es so, dass wir mit unserem Kind quasi von Geburt an sprechen sollten, als würde es alles verstehen. »So, jetzt ziehen wir mal die Windel aus. Oh, da ist dein Popo schon ganz nackt. Was brauchen wir denn jetzt? Hier ist eine Socke – schau mal, die hat Punkte.« Auch wenn selbstverständlich zunächst verbal wenig zurückkommt. Nach und nach werden wir an den Reaktionen unseres Kindes sehen, dass es uns versteht.
Ich rege mein Kind zusätzlich zum Sprechenlernen an, indem ich beim Kommentieren bewusst Adjektive und Erklärungen verwende. Anstatt zu sagen: »Schau mal, ein Hund« kann ich sagen: »Schau mal, ein alter Hund. Der läuft ganz langsam und hat schon graue Haare.« Anstatt zu sagen: »Oh, da fährt ein Trecker«, kann ich sagen: »Oh, da fährt ein grüner Trecker. Hat der aber dicke Reifen«. Schon habe ich dem Kind neue Adjektive beigebracht, hier konkret: verdeutlicht, woran man einen alten Hund erkennt bzw. eine Farbe mit dem Kind trainiert. Vertrauen Sie dabei auf die Kraft der Nachahmung! Glauben Sie mir, Sie werden sehr schnell an Ihrem Kind hören, welche Formulierungen Sie – bewusst oder unbewusst – häufig verwenden. Noch vor einigen Tagen hörte ich wie unser 3-Jähriger zu dem Baby einer meiner Freundinnen genau so sprach und seine Worte betonte, wie ich es mit seiner kleinen Schwester tue. »Hallo Nika, ja was machst du denn da, du kleine Maus? Möchtest du ein Stück Banane? Oh, das lässt du dir nicht zwei Mal sagen.«
In einigen Situationen ist es besonders wichtig, dass man sprachlich kommentiert, was man gerade tut. Dieser Zeitpunkt ist immer dann, wenn es darum geht, das Kind auszuziehen, es zu wickeln, das Gesicht sauber zu wischen, ihm die Nase zu putzen, es einzucremen etc. Denn: Ein Kind ist nun einmal kein Gegenstand. Es soll somit wissen, warum es jetzt ausgezogen wird. Es sollte vorgewarnt werden, bevor ein nasser Waschlappen oder eine kalte Creme in seinem Gesicht landet, bevor ihm die Hose zum Wickeln heruntergezogen wird etc. Wie unangenehm wäre es, wenn es jederzeit damit rechnen müsste, dass eine Hand angeschossen kommt und ihm unvermittelt im Gesicht herumwischt.
Allgemein gilt: Auch einem Eineinhalbjährigen darf ich bereits erklären oder zeigen, warum wir die Reifen des Autos im Winter wechseln, was der Handwerker dort macht, welche Gewürze ich in welches Gericht hineinrühre und welche Vogelart wie singt.
In den ersten Lebensjahren lernen Kinder so viele neue Wörter, wie nie wieder in ihrem Leben. Sie sind in diesen Jahren wie Schwämme, die alles Neue aufsaugen und abspeichern. Wieso also sollte man diesen Zustand nicht (selbstverständlich ohne Druck!) spielerisch nutzen, um die Kinder schon mit vielen Unterscheidungen und Begriffen vertraut zu machen? Irgendwann sollen sie es ohnehin lernen. Wer vieles dann bereits kennt, ist definitiv im Vorteil. Noch einmal zur Erinnerung: In diesen Situationen ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass Kinder viel mehr verstehen, als sie bereits sprechen können.
Ein großartiges »Werkzeug« auf dem Weg zu einem bunten, vielfältigen und großen Wortschatz, sind Geschichten. Diese dürfen frei erzählt oder vorgelesen werden. Es gibt ja bekanntermaßen unzählige Kinderbücher in allen nur denkbaren Ausführungen. Betrachtet man diese Auswahl aus der Sicht der Sprachförderung, gibt es einige Dinge, die man beachten kann. Wenn wir möchten, dass unsere Kinder einen großen Wortschatz entwickeln, kann ich das mit dem Vorlesen sehr gut erreichen. Wichtig ist dabei natürlich, dass die Bücher dem Alter des Kindes angemessen sind: Überfrachtete Bilder überfordern gerade kleinere Kinder häufig. Im Idealfall entsprechen die ersten Abbildungen, mit denen ein Kind in Büchern konfrontiert wird, der Realität so, wie sie das Kind selbst vorfinden könnte: Das heißt, die Tiere sehen aus wie Tiere – sie haben keine Kleidung an, wohnen nicht in Häusern und fahren auch kein Auto. Das Kind ist ja noch in der Phase, überhaupt zu verstehen, was etwa in Wald und Wiese alles lebt. Dabei helfen realistische Bilder, damit es Lebewesen und Dinge und ihren Bezug zueinander richtig einordnen kann.
Es gibt ebenso Bücher, die auf Knopfdruck naturgetreue Tierstimmen wiedergeben. Zunächst einmal spricht überhaupt nichts dagegen. Viele Kinder finden das sehr spannend. Man sollte sich allerdings bewusst machen, dass ein Buch mit Tierstimmen nicht den Gang durch den Wald ersetzen kann, bei dem man gemeinsam nach dem Specht horcht.
Grundsätzlich gilt: Je häufiger ich diesen Moment wahrnehme, in dem das Kind aufmerksam die Ohren spitzt, weil es etwas Interessantes gehört hat, desto mehr habe ich die Möglichkeit, hier etwas Wichtiges zu schulen: Die akustische Unterscheidung.
Je häufiger ich auf diesen »Oh, ich hab etwas gehört!«-Ausdruck meines Kindes reagiere und dann nachfrage »Was hörst du denn? War das ein Frosch?«, desto besser wird mein Kind erst Geräusche und bald schon kleine Klänge unterscheiden können. Denn Autos machen unterschiedliche Geräusche, ebenso wie die Tiere. Das sogenannte »differenzierte Hören« ist eine Fähigkeit, die für das Lesen- und Schreibenlernen von großer Bedeutung ist, denn dafür sind winzige akustische Klangunterschiede wahrzunehmen (wie etwa bei den Lauten d und b).
Viele Kinder mögen Bücher, in denen Alltagsabläufe vorkommen: Ein Buch über Pia, die mit Mama und Papa in den Park geht; ein Buch darüber, wie Pflanzen wachsen, wie Emil aufs Töpfchen geht usw. ... Alltagsthemen fordern die Kinder auf, das Verhalten im Buch auf ihr eigenes zu übertragen.
Reimbücher unterstützen ebenfalls das Sprechen, weil sie die Kinder auf noch stärkere Weise animieren, das letzte Wort einer Zeile selbst zu ergänzen: »Es war einmal ein Hase, mit einer roten ...«
Reimen zu können und Reimwörter bzw. Reimklänge zu erkennen, hilft, an vielen Stellen die Schreibweise von Wörtern besser abspeichern zu können. Wenn ich weiß, wie man »Hase« schreibt, ist das Wort »Nase« kein Problem mehr. Je mehr ich also Ähnlichkeiten und Reime heraushören kann, desto eher erkenne ich diese Parallelen auch in Schreibweisen, was einer Menge Anstrengung beim Rechtschreiblernen vorbeugt.
Um das Sprechen beim Vorlesen anzuregen, bietet es sich ebenfalls an, in einem Buch mit z. B. vielen Enten darin, auf jede Ente zu zeigen und zu sagen: »Hm, wo sehe ich denn überall Enten? Ach da – eine Ente, noch eine Ente, noch eine Ente, noch eine ...«, und dann das Kind das passende Wort, das es ja gerade wiederholt gehört hat, ergänzen zu lassen. Dafür braucht es an sich nicht einmal ein Buch, ein Schlafanzug oder irgendeine sonstige Abbildung täte es ebenso.
Es gibt Kinder, die bereits früh gerne auch über einen längeren Zeitraum beim Vorlesen zuhören und, auch ohne dass sie alles verstehen, einfach gerne während des Vorlesens entspannen. Andere Kinder blättern vielleicht mit hohem Tempo die Seiten durch und man kommt als Elternteil kaum dazu, einen Satz zu lesen. Hier lohnt es sich, genau zu schauen, für welche Themen sich das Kind besonders begeistern kann, was es spannend findet und dazu die Bücher passend auszuwählen.
Ganz kleine Kinder ahmen uns nach, sie hören die Laute, Silben und Wörter, die wir beim Lesen bilden. Je mehr sie dabei unsere Begeisterung spüren, desto aufmerksamer werden sie ihre Ohren spitzen. Dann ist auch der Inhalt des Buches nachgewiesenermaßen nur sekundär – selbst bei Texten, die für ein Kind vermeintlich noch zu anspruchsvoll sind, lauschen sie oft interessiert, solange der vorlesende Elternteil mit Elan bei der Sache ist.
Ein weiterer Tipp, der das Vorlesen für viele Kinder zu einem spannenden Erlebnis macht, ist der, dass wir als Eltern für die richtige Stimmung und Atmosphäre sorgen: Ein gemeinsames Einkuscheln in den Bettenberg mit Taschenlampe schafft einen Vorlesemoment, der nachhaltig unter die Haut geht. Ein Froschbuch, das mit den planschenden Kinder- und Elternfüßen im Wassereimer vorgelesen wird, prägt sich mit großer Wahrscheinlich als eine zauberhaft sorglose Erinnerung ein.
Die meisten Kinder – egal welchen Alters – lieben es ebenfalls sehr, wenn Mama oder Papa die Stimme bei den verschiedenen Figuren im Buch verstellt. Gleiches gilt übrigens auch für das Spiel mit Handpuppen, Kuscheltieren und Co.Beim Thema Vorlesen gibt es ein weiteres, spannendes Phänomen:
Jonas möchte zum 100. Mal vor dem Einschlafen das Buch »Die kleine Raupe Nimmersatt« hören. Mama und Papa hängt das Buch aber inzwischen so zum Halse heraus, dass sie bei dem Wort »Raupe« schon die Augen verdrehen. Jonas möchte jedoch partout kein anderes Buch hören.
Hier gibt es Eltern, die versuchen, das Kind von einem anderen Buch zu überzeugen. Schließlich wissen ja nun inzwischen wirklich alle, was die Raupe frisst. Allerdings wäre es durchaus vorteilhaft, Jonas' Wunsch nachzukommen und das gewünschte Buch oder auch die gewünschten Buchseiten so lange zu wiederholen, wie Jonas das möchte. Gleiches gilt für jegliche Art von Fingerspielen, Reimen und Kinderliedern.
Denn, was Kinder automatisch machen, wenn sie immer wieder denselben Text hören möchten, bis sie diesen mitsprechen können, ist: Sie trainieren unbewusst ihr akustisches Gedächtnis für Sätze.