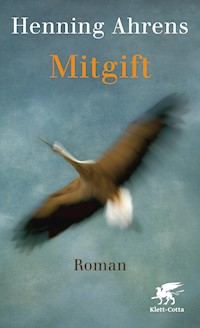
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2021 Ein großer Familienroman, der die Spuren deutscher Geschichte sichtbar macht Seit sieben Generationen in Folge bewirtschaften die Leebs ihren Hof in der niedersächsischen Provinz. Schließlich gilt es, das Familienerbe zu wahren – allen historischen Umbrüchen zum Trotz. Doch über die Opfer, die jeder Einzelne erbringen muss, wird geschwiegen. Henning Ahrens erzählt den Roman einer Familie und entwirft ein Panorama der ländlich-bäuerlichen Welt des 20. Jahrhunderts. Gerda Derking kennt sich aus mit dem Sterben. Seit Jahren richtet sie die Toten des Dorfes her, doch in jenem August 1962 würde sie die Tür am liebsten gleich wieder schließen. Denn vor ihr steht Wilhelm Leeb – ausgerechnet er, der Gerda vor so vielen Jahren sitzen ließ, um sich die Tochter von Bauer Kruse mit der hohen Mitgift zu sichern. Wilhelm, der als überzeugter Nazi in den Krieg zog und erst nach Jahren der Kriegsgefangenschaft aus Polen zurückkehrte. Der gegen Frau und Kinder hart wurde, obwohl sie jahrelang geschuftet hatten, um Hof und Leben zu verteidigen. Doch nun zeichnet sich auf seinem Gesicht ein Schmerz ab, der über das Erträgliche hinausgeht. Und Gerda Derking ahnt: Dieser Tragödie sind die Leebs ohne sie nicht gewachsen. In seiner epischen Familienchronik rückt Henning Ahrens den Verwundungen des vergangenen Jahrhunderts auf den Leib und erzählt ebenso mitreißend wie empathisch vom Verhängnis einer Familie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Henning Ahrens
Mitgift
Roman
Klett-Cotta
Impressum
Die Arbeit des Autors am vorliegenden Buch wurde vom Deutschen Literaturfonds e. V. gefördert.
Das Gedicht auf Seite 308 entstammt dem folgenden Band:
Johannes Bobrowski, Gesammelte Werke in sechs Bänden. Erster Band. Die Gedichte
© 1998, Deutsche Verlags-Anstalt, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: ANZINGER UND RASP Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung einer Abbildung von © Getty Images, Merche Portu, Flying stork
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
ISBN 978-3-608-98414-9
E-Book ISBN 978-3-608-11672-4
Für meinen VaterHeinrich Ahrens(1931–1989)
August 1962 – Die Totenfrau
Der Garten liegt noch im Schatten des Hauses, als Gerda Derking ihr Frühstück auf die Terrasse trägt. Nur ganz hinten, vor dem Hühnerstall, glitzert das taufeuchte Gras in der Vormittagssonne, funkeln die Rosen.
Sie stellt das Tablett mit den zwei Kaffeestreifen und der Kanne, die sich unter einer wattierten Haube verbirgt, auf die Wachstuchdecke, nimmt am Gartentisch Platz, schenkt sich Kaffee ein. Die Tasse, eines der wenigen Erbstücke, die sie als Tochter Zugewanderter besitzt, gehört zu einem Rosenthal-Service, das ihre Mutter Stück für Stück erwarb. Ihr Vater war Walzwerker, ihre Familie nie wohlhabend; jedes Luxusgut, so auch dieses Service, wurde mit Gewissensbissen erkauft. Gerda tunkt einen Kaffeestreifen in die Tasse und beobachtet, wie sich der Zuckerguss auflöst, lässt dann den ersten herb-süßen Happen auf ihrer Zunge zergehen. Mit diesem Ritual beginnt sie jeden Tag; und sie bedauert täglich, dass Kaffeestreifen nur auf einer Seite glasiert sind.
Da horcht sie auf. Ihr Kater, der graugetigerte Kämpe, streckt sich mit einem fauchenden Gähnen. Sie hat ihn Heini getauft, nach ihrem Verlobten, der 1918 fiel; seit dem Tod ihrer Eltern ist er ihr einziger Hausgenosse, mit seinen fünfzehn Katzenjahren obendrein älter als sie selbst. Gerda geht mit dem Jahrhundert.
Sie trinkt einen Schluck, tunkt den Streifen wieder ein. »Kannst du mir verraten, warum nicht beide Seiten glasiert sind, Heini?«, fragt sie. »Wäre noch leckerer, der Kaffee noch süßer. Ich vergesse jedes Mal, mich beim Bäcker danach zu erkundigen. Glaubst du, ich werde vergesslich?«
Heini trottet auf den Rasen und beginnt, sich zu säubern.
Gerdas Garten, der nicht breiter ist als drei aneinandergelegte Leinenlaken, wird rechts von der Kornscheune des Haarstickschen Hofes und links vom Wohnhaus des Leebschen Hofes flankiert, zu dem auch ihr kleines Grundstück gehört. Wilhelm Leeb senior hat ihr lebenslanges Wohnrecht zugesichert, und sie weiß, er wird Wort halten, in dieser Hinsicht ist er korrekt. Hätte sie Besitz in die Ehe einbringen können, dann hätte er sie damals, vor über dreißig Jahren, wohl auch geheiratet. Er war ihre zweite Liebe, sie jedoch eine Arbeitertochter, also nicht standesgemäß, und als er zu guter Letzt Käthe, die Hoferbin, zur Frau nahm, beschloss Gerda, allein zu bleiben – allein, aber selbstbestimmt. Das hat sie nie bereut. Der Mensch vermag nur ein gewisses Maß an Enttäuschungen zu ertragen.
Wie nichts im Übermaß erträglich ist. Ihre Arbeit als Deputatfrau, die sie bei den Leebs und ein, zwei anderen Landwirten ausübt, ist mit dem Alter beschwerlicher geworden, aber auszuhalten. Ihrer anderen Tätigkeit fühlt sie sich jedoch nicht mehr gewachsen: Sie ist die Totenfrau, so ihr Titel im Dorf. Wenn jemand gestorben ist, wird sie geholt; fast jede Familie stand vor ihrer Tür, Gerda betrat fast jedes Haus, und sie hat alle gesehen, ob jung oder alt, im Sterbebett oder dort, wo ein Leben sein Ende gefunden hatte, in der Stube, auf der Diele, im Stall. Sie hat die Verstorbenen gewaschen, frisiert, manikürt und gekleidet wie von den Angehörigen gewünscht, und sie hat sich manches anhören müssen, Kummer und Klagen, sogar Zorn.
Ja, sie hat alle gesehen, sie hat zu viele gesehen, es reicht. Sie ist bald Mitte sechzig, ihr eigenes Ende rückt näher, warum weiter Tote herrichten? Früher hatte kaum jemand Telefon, man besaß nur Kutsche, Fahrrad oder Schusters Rappen, holte also die Totenfrau, um sich nicht zum Bestatter in die Kreisstadt bemühen zu müssen. Inzwischen nimmt die Zahl der Autos stetig zu, sie fahren rund um die Uhr durchs Dorf, und nicht nur Zuckerrübenbarone besitzen eines, nein, auch die Arbeiter sind vielfach motorisiert.
Deshalb hat Gerda beschlossen, ihre Tätigkeit zu beenden. Sie lächelt, während sie am Kaffeestreifen knabbert. Ab jetzt wird sie sich den Lebenden widmen, vor allem ihren Freundinnen, mit denen sie oft und gern an diesem Tisch sitzt. Und sie wird noch mehr lesen als zuvor.
»Heini«, sagt sie zu ihrem Kater, der im Gras liegt und den Garten beobachtet, »ist das nicht herrlich?«
Er lässt wie als Antwort den Schwanz tanzen; in Wahrheit hat er ein Eichhörnchen im Visier, das durch den Haselnussstrauch turnt. Im Laufe seines Katzenlebens hat er unzählige Mäuse und leider auch manche Vögel erbeutet, ein Eichhörnchen aber nie, die flinken Tiere sind ihm über.
Hinter Gerdas Hühnerstall sind die Bäume im Obstgarten der Haarsticks zu sehen. Zwetschgen und Renekloden sind bald reif, ebenso Äpfel und Birnen. Annemarie Haarstick, ihre Nachbarin, weckt das Obst ein, verarbeitet es zu Marmelade und Mus und kocht vorzügliche Kaltschalen, die sie Gerda gelegentlich über den Zaun reicht; auch sie sitzt oft an diesem Tisch. Zu dieser Stunde ist Gerda jedoch nur in Gesellschaft Heinis, einer Amsel, die auf einem Zaunpfahl sitzt, und einiger Kohlmeisen, die sich im Flieder balgen. Das Eichhörnchen ist davongesprungen.
Nachdem Gerda den Kaffee ausgetrunken hat, steht sie auf, holt den Sack mit Hühnerfutter aus der Waschküche und tauscht ihre Schlappen gegen Lederschuhe mit Stahlkappen ein, die ihr Vater im Walzwerk trug. Sie hat seine Größe geerbt, 42, ein Nachteil, weil sie kaum Schuhe findet; andererseits trägt sie im Gegensatz zu Annemarie nie Trittchen, sondern begnügt sich mit Zweckmäßigem.
Während sie mit dem Futtersack in der Hand über die lange, schmale Rasenfläche geht, mustert sie die Blumenbeete und Rabatten auf beiden Seiten. Ihre Stockrosen sind verblüht, im Gemüsebeet dagegen, das sie vor dem Hühnerstall angelegt hat, gedeiht alles, und die Kartoffeln, deren Kraut zu welken beginnt, kann sie bald ernten. Als sie die Pforte im Maschendrahtzaun aufklinkt, laufen ihre Hühner gackernd auf sie zu, sieben rote Rhodeländer und ein Hahn. Der liebgewonnene muffige Geruch nach Staub und Kot steigt ihr in die Nase.
»Putt-putt-putt-putt«, ruft sie, greift in den Sack und streut den Hafer mit der schwungvollen Geste einer erfahrenen Säerin aus. Heini will ins Gehege schlüpfen, doch sie wirft die Pforte mit einem Fußtritt zu. »Du bleibst draußen«, sagt sie. »Zwischen dem Federvieh hast du nichts zu suchen, da kommst du nur auf dumme Gedanken.« Während ihre Hühner die Körner aufpicken, geht sie in den Stall und schaut nach Eiern.
Am Ende transportiert Gerda fünf Stück in der Tasche ihrer Kittelschürze. Sie wechselt die Schuhe, nimmt das Tablett und geht in die Küche, dämmerig wie alle Zimmer ihres Hauses, das im Schatten zweier Höfe liegt. Sie spült gerade die Tasse, als es klingelt. Bevor sie öffnet, trocknet sie die Hände am Geschirrhandtuch ab.
Zu ihrer Überraschung steht Wilhelm Leeb senior vor der Tür, in Schaftstiefeln, Reithose und Arbeitsjacke. Seine graublonden Haare sind zerzaust, sein Mund, sonst bleistiftschmal, ist ein verwackelter Strich. Den Hut hat er abgesetzt und knetet ihn mit beiden Händen.
»Gerda …«, sagt er und sieht sie hilfeheischend an.
Ihre Überraschung wird nicht geringer: Das ist untypisch für Wilhelm Leeb, diesen stolzen, oft hochmütigen Mann; das ist nicht der »General«, wie er im Dorf wegen seines Geltungsdrangs bissig genannt wird, nein, das ist der Soldat einer besiegten Armee.
»Was ist denn los, Wilhelm?«, fragt sie. »Du siehst ja furchtbar aus. Möchtest du einen Kaffee?«
Wilhelm Leeb, ein gestandener Mann, druckst herum, auch untypisch für ihn, weicht sogar ihrem Blick aus.
Hinter ihm, auf der anderen Straßenseite, äugt die Siedentoppsche durch einen Gardinenspalt, und Gerda sagt: »Komm doch rein.«
Leeb senior schüttelt den Kopf. »Danke. Nein.« Er klingt brüchig. »Gerda«, wiederholt er, »… wir brauchen dich.«
Sie erstarrt, denn es kann sich nur um eines handeln. Nach kurzem Zaudern erklärt sie: »Ich mache das nicht mehr, Wilhelm. Du rufst besser den Peiner Bestatter.« Während sie dies ausspricht, überlegt sie, wer gestorben sein könnte – gewiss Magda, Wilhelms fünfundachtzigjährige Mutter, was sein Verhalten erklären würde; er hat sie immer sehr verehrt.
»Gerda«, sagt er, »das kannst nur du. Ich will keine Fremden im Haus haben. Um der alten Zeiten willen? Bitte.«
Nun muss sie stutzen – so kleinlaut hat sie ihn noch nie erlebt, und ihr dämmert, dass es doch nicht um Magda geht. »Was ist denn passiert?«, will sie erneut wissen. »Gab es einen Unfall?« Und sie fügt in ihrer Sorge schroff hinzu: »Welche alten Zeiten? Was uns verbunden hat, das hast du damals weggeworfen – einfach so.«
Wilhelm Leeb räuspert sich; in seinem Blick erwacht der alte Stolz, und er entgegnet: »Das ist ewig lange her, Gerda, das ist ja wohl verjährt. Willst du nun helfen oder nicht?«
Sie steht da wie vor den Kopf gestoßen, dann knallt sie ihm die Tür vor der Nase zu. Im dunklen Hausflur versucht sie, ihre Beherrschung zurückzuerlangen. Sie holt Luft, schaut unwillkürlich in den Garderobenspiegel – eine gealterte Frau blickt ihr entgegen, die grauen Haare zum Dutt gebunden. Wilhelm hat recht, denkt sie schließlich, es ist ewig lange her. Wie jung und unverbraucht wir damals waren … Nach kurzem Nachdenken besinnt sie sich anders: Sie wird ihn jetzt nicht im Stich lassen, das wäre kleinlich. Noch dieser Freundschaftsdienst. Ein letztes Mal. Danach wird die Totenfrau Geschichte sein.
Als sie die Tür wieder öffnet, steht Wilhelm Leeb senior noch da. Er schwenkt fahrig und wie zur Entschuldigung eine Hand, schaut sie stumm an.
»Gut«, sagt Gerda. »Ich komme. Aber was ist denn passiert?«
Sie wird aschfahl, während sie seiner knappen, stockend vorgebrachten Erklärung lauscht. Anschließend ergänzt er: »Ich lasse dich holen, wenn es so weit ist.« Und als er sich zum Gehen wendet: »Danke, Gerda.«
Dann entfernt er sich gesenkten Kopfes, die Hände hinter dem Rücken verschränkt.
Gerda weicht in den Flur zurück und schließt ihre Tür.
April 1945 – Kacke am Dampfen
Sie haben Telefon, denn im Haus ist das SA-Büro, früher geleitet von Reitersturmführer und Jungbauer Ernst August Martin Wilhelm Leeb, bis 1933 Vorsitzender des lokalen Reit- und Fahrvereins sowie des Jungniedersachsenbundes »Holt Fast«, nun Sonderführer im Leutnantsrang oder wieder schlichter Soldat, wer kann das schon wissen, geht ja alles in die Binsen, und die Feldpost bleibt aus.
Sie haben also Telefon, aber an diesem grauen Morgen des neunten April ist die Leitung tot, und niemand weiß Genaues. Der Amerikaner kommt, so viel ist immerhin klar, denn in aller Frühe, Bäuerin Käthe Leeb stellte gerade die Milchkannen vor das Tor, rumpelte Vornefett, der Lumpensammler, mit dem Fuhrwerk durchs Dorf, trieb seinen Klepper, den sogar der Barras verschmäht hatte, mit Hieben und Flüchen an und rief Käthe zu, der Ami sei da, die Panzer stünden direktemang vor Peine, sie solle man besser alles verrammeln, denn der Feind, der werde nicht lange fackeln, der sei ganz wild auf alles, was glitzert und glänzt, und Korn und Schnaps solle sie am besten ihm zur Aufbewahrung geben, damit die »Alljierten« nicht alles aussaufen, wäre doch ein Jammer.
»Verkriech dich, Frau«, rief Vornefett, als er merkte, dass nur Milch zu holen war, »sonst geh’n sie dir an die blütenweiße Wäsche!« Und er fuhr die ansteigende Kopfsteinpflasterstraße hinauf. Er warnte auch Albrecht Kühne, den Schmied, mit schrillen Rufen und bot an, Wertsachen und Schnaps in Verwahrung zu nehmen, aber Kühne lachte nur.
Käthe sah dem Fuhrwerk nach, bis es hinter der Kuppe verschwand. Ihre Arme schmerzten vom Schleppen der zentnerschweren Last, als sie den Blick auf die Kannen senkte und sich fragte, ob man die Milch überhaupt abholen würde. Gegenüber, auf dem Siedentoppschen Hofe, wurde eine Tür zugeknallt, und Nachbarin Liselotte schrie ihren Mann an, der in Russland ein Bein verloren hatte. Eine Klitsche, der Hof, und Liselotte, diese mäkelnde Person, sprach schlecht über alle und jeden; Käthe Leeb beschränkte sich deshalb meist auf Gruß und Nicken.
Sie kehrte auf den Hof zurück, ging durch den kleinen Vorgarten, vorbei an den Obstbäumen, noch bleich vom Kalk, der im Herbst aufgetragen worden war, und trat durch die Tür des Vierständerhauses, zog Botten und Mantel aus. Im Flur roch es nach Muckefuck, eine Plörre, aber Bohnenkaffee war nur noch Erinnerung. Wie gut, in diesen Zeiten einen Hof zu haben, da hatte man wenigstens etwas zu essen, und natürlich schlachteten sie auch heimlich. Fleisch kam vor dem Vaterland, und alle schwiegen stille, denn jeder erhielt seinen Teil an Wurst und Brühe.
Nun schlurft sie in Puschen durch den Flur. Aus der Küche fällt Licht auf den Steinfußboden, und als sie eintritt, erblickt sie ihre vierundsiebzigjährige Mutter, Herta Kruse, die im Schlafrock am Tisch sitzt; sie macht stets das Frühstück, obwohl sie wackelig auf den Beinen ist, und hat schon für die ganze Familie gedeckt, sogar Eierbecher hingestellt.
»Wer war das auf der Straße?«
»Vornefett.« Käthe nimmt die Emailkanne vom Herd, in dem die Eierkohle glüht, und schenkt sich ein.
»Ach, so? Was wollte er denn?«
»Schnaps wollte er.«
»Na, das ist doch wohl …! Und sonst?«
Käthe Leeb nippt am Kaffeeersatz. Sie wird die Neuigkeit für sich behalten, bis alle anderen da sind. »Den Kühne hat er auch gefragt«, sagt sie nur.
»Diese Mannsleute«, murrt ihre Mutter. »Ist immer dasselbe mit denen.«
»Ja, ja«, sagt Käthe Leeb und setzt sich. Durchs Fenster sieht sie Beerensträucher, die schon wieder treiben, ach, das Obst, die viele Arbeit. Gewiss, da ist Josef, der Knecht, aber Frauenarbeiten sind unter seiner Würde, und es gibt Martin, den Franzosen, und Pawel, den Polen, die mit den anderen Kriegsgefangenen über Nacht im Dorfkrug eingesperrt werden. Die müssen ran, aber auch sie sind ungern im Garten zugange, streiten außerdem oft. Ihr alter Vater liegt siech im Bett, und ihr Sohn Wilhelm ist noch jung; sie weiß, dass er zu viel Verantwortung trägt, aber was bleibt ihr übrig? Sein Vater zog nach dem Frankreichfeldzug wieder in den Krieg – Geltung und Ansehen, ja das ist ihm wichtig. Er ist ehrgeizig, und sie bewundert ihn dafür, war auch stets stolz, wenn er eine Rede hielt oder mit dem Jungniedersachsenbund im Dorfkrug ein Theaterstück auf die Bühne brachte. Die Männer ihrer Schwestern und Freundinnen sind da kein Vergleich. Brave Kerle, ja, aber Armleuchter, wie ihr Wilhelm gern sagte, wenn ihm ein paar lütte Lagen die Zunge gelockert hatten. Dann musste sie lachen und nahm ihn in den Arm. Und nun … Sie hätte auf ihre Schwester hören sollen, die vor der Verlobung schrieb: Wenn man wüsste, dass Dein Kavalier das Versprechen, das er Dir gegeben hat, treu und ehrlich hielte, wäre er ein feiner Mann. Man muss aber warten und prüfen, liebe Käthe, prüfe, prüfe, sage ich Dir. Das leichte Blut fließt einmal in seinen Adern, und da kann man nicht vorsichtig genug sein.
»Das leichte Blut« – eine Anspielung auf ihren Schwiegervater und dessen Vater, Schwerenöter alle beide, jedenfalls in jüngeren Jahren.
»Ah, Willem«, sagt ihre Mutter. »Morgen, mein Junge.«
Da steht Käthes Ältester, blond und schmal und mit der ausladenden Stirn ihres Vaters, des alten Kruse. Er trägt einen Bademantel über dem Nachthemd, die langen Füße stecken in Wollsocken und Puschen, die blauen Augen sind schlaftrübe. Käthe steht auf und schenkt ihm Muckefuck ein, holt anschließend das Glas mit Zwetschgenmus aus dem Schrank, das sie für ihn aufgespart hat.
»Setz dich man erstmal, Willem, und iss was«, sagt sie.
»Immer so schmal, der Junge. Du musst essen, Willem, du willst doch groß und stark werden«, mahnt ihre Mutter.
»Aber ich bin doch stark«, sagt Wilhelm.
»Ja, zum Glück kannst du helfen, denn dein Vater muss Gott-weiß-wo gegen den Russen kämpfen.«
Wilhelm, der seinen Vater während der letzten sechs Jahre immer nur kurz erlebt hat, nickt. »Wir siegen«, erklärt er mit vollem Mund. »Der Führer wird unsere Feinde in Grund und Boden bomben, er wartet nur den rechten Zeitpunkt ab, sagt Otto.«
Und der Amerikaner steht vor Peine, denkt Käthe Leeb, sagt es aber nicht laut. Otto Grotewohl, Willems Freund in der Hitlerjugend, tönt gern rum. Sie mag ihn nicht; er hat seinen Vater angeschwärzt, weil der den Führer als böhmischen Gefreiten geschmäht hatte, und nun sitzt Grotewohl senior im Wolfenbütteler Gefängnis. Wie kann man den eigenen Vater einsperren lassen? Da ist ihr Wilhelm anders, der tut so was nicht, aber Otto imponiert ihm, und jetzt verbringen die beiden noch mehr Zeit miteinander, weil sie »Kohleferien« haben. Komisches Wort, denkt Käthe, denn man könnte meinen, die Kohle hätte Ferien oder man bekäme frei, um sie zu schippen oder zu holen. Tatsächlich ist Heizmaterial Mangelware, und in den Schulen ist es zu kalt fürs Lernen.
»Ja, Willem«, erwidert sie untypisch spitz. »Wir werden uns noch wundern, wenn die Wunderwaffen kommen.«
Da ertönen Stimmen im Flur, ihre Schwiegermutter naht, Magda Leeb, gefolgt von den beiden Ukrainerinnen, die der Hausherr beim letzten Fronturlaub mitgebracht hat, weil er sie in Sicherheit wissen wollte. Käthe kann ihre Eifersucht nicht unterdrücken, als sie die Mädchen erblickt, jung und drall, mit roten Wangen: das leichte Blut. Aber sie packen wenigstens mit an. Ihre Schwiegermutter, wie üblich in Schwarz, die Brille mit den runden Gläsern auf der Nase, zerzaust Willems Haare und begrüßt alle, schaut nach dem Feuer und weist eine Ukrainerin an, Eierkohlen nachzulegen. So ist sie, die Achtundsechzigjährige, sie hat das Heft in der Hand, das war auch in ihrer Ehe so, denn Willi, ihr verstorbener Mann, war nicht der beflissenste Landwirt und obendrein durch eine Verwundung beeinträchtigt, die er 1916 in der Schlacht am Naratsch-See erlitten hatte. Damals hatten die Russen eine Offensive begonnen, um das Blatt doch noch zu wenden.
»Vornefett ist mit seiner Schindmähre durchs Dorf gebollert, als säße ihm der Deibel im Nacken«, berichtet Magda Leeb, »und hat wirres Zeug geschrien. War wohl wieder besoffen, der alte Hallodri.«
»Ja, das hat Käthe schon erzählt. Eine Schande, sich so gehen zu lassen«, schimpft Herta Kruse. »Gut, dass mein Mann da anders ist.«
Magda Leeb schürzt die schmalen Lippen, denn sie hat Vorbehalte gegen die Familie Kruse. Die pütscherige Herta hat nie zugepackt, jammert auch zu oft, aber so geht das nicht, nee, man beißt die Zähne zusammen und macht weiter, beklagen kann man sich beim lieben Gott. Und Gustav, ihr Mann, der mit Grippe im Bett liegt, hat sich auch nicht krummgelegt. Wie soll man da was werden? Ihre Schwiegertochter wiederum ist brav und fleißig, hat aber etwas von ihrer Mutter – so was Weiches, Zerfließendes. Magda Leeb nimmt am Küchentisch Platz und schenkt sich Muckefuck ein. Ihre runden Brillengläser blitzen, als sie den Blick über die vier Frauen und ihren Enkel gleiten lässt, der ein Marmeladenbrot futtert.
Und als wollte Käthe die Vorbehalte ihrer Schwiegermutter entkräften, erklärt sie ebenso unvermittelt wie entschieden: »Der Ami steht vor der Tür. Kurz vor Peine.«
»Wer erzählt das?«, fragt Magda Leeb verblüfft.
»Vornefett.«
Ihre Schwiegermutter schnaubt verächtlich. »Der hat einen großen Prott, der Kerl, der schneidet bloß auf.«
»Warum sollte er das tun? Wir wissen doch alle, dass es bald so weit ist.«
»Pah!«
»Wenn der Amerikaner kommt«, fährt Käthe beharrlich fort, »und Wilhelms Jagdgewehre hier findet, dann kann das böse enden.«
»Die stellen uns alle an die Wand!«, klagt ihre Mutter.
»Nu mach mal halblang, Herta«, erwidert Magda Leeb. »So schnell wird keiner an die Wand gestellt. Und die Gewehre meines Sohnes, die kommen nicht weg, auf keinen Fall, die braucht er, wenn er zurück ist.«
»Wilhelm ist schon vor dem Krieg nicht mehr auf die Jagd gegangen. Die Flinten müssen weg. Auch die Pistolen. All der Kram im SA-Büro …« Käthe Leeb bleibt hart, denn sie bangt um ihre Kinder, den vierzehnjährigen Wilhelm, die zehnjährige Grete und den sechsjährigen Bruno. Sie holt die Flasche Klosterfrau Melissengeist aus dem Schrank, träufelt etwas auf den Zuckerwürfel, den sie auf einem Esslöffel balanciert, und schiebt ihn sich in den Mund. Sie atmet auf und wiederholt: »Muss alles weg. Zur Sicherheit. Denkt an die Kinder.«
Magda Leeb nippt grimmig am Muckefuck. Die Sachen ihres Sohnes? Alles, was ihm lieb und teuer ist, die Waffen, die Unterlagen, die Bilder? Die Fotoalben, auch das vom Reichsparteitag? Er wäre außer sich, nein, unmöglich, und sie erwidert: »Das geht nicht, Käthe. Das sind Wilhelms Sachen, da können wir uns nicht dran vergreifen.«
»Sie was verstecken.« Das schlägt Larissa vor, eine der Ukrainerinnen, die stumm gelauscht haben. »Im Garten begraben.«
»Das finden sie«, entgegnet Käthe. »Und dann wäre es noch schlimmer. Nein, das Zeug muss weg.«
Der junge Wilhelm blickt seine Mutter an. »Stimmt es, dass der Ami da ist?«, fragt er leise.
»Ja, Willem«, sagt sie, »das stimmt.«
»Besser der Ami als der Russe«, murmelt ihre Mutter.
Die Frauen in der Küche und der Vierzehnjährige versinken in Schweigen. Schon wieder April, denkt Käthe Leeb. Ja, es ist der immer gleiche Jahreslauf, und das seit Menschengedenken, und damit verbunden die immer gleichen Arbeiten, denen sie trotz aller Widrigkeiten nachgegangen sind. Der Krieg tobte in der Ferne und war bislang kaum zu spüren. Die hiesige Industrie – Peiner Stahlwerk und Ilseder Hütte – wurde nicht bombardiert, nur in den Wiesen hinterm Hof sind mal Bomben gefallen, warum, weiß keiner. Zu Schaden kam niemand, und die Kinder lasen später Schrapnells auf, als wären es Donnerkeile, das war’s.
Und nun soll alles anders werden? Das ist schwer vorstellbar, da spielt die Fantasie nicht mit. Larissa und Tanja, die Ukrainerinnen, ahnen jedoch, was ihnen bevorstünde, falls man sie zurückschickte, und sitzen voller Angst und Bangen da.
Die Standuhr in der guten Stube schlägt Klocke sieben.
»Nee, nee«, murmelt Magda Leeb. Dann sieht sie ihren Enkelsohn an, dem der Appetit vergangen zu sein scheint, und denkt: Ach, je, die Kinder … Wirkt doch alles so solide, der rotbraune Fliesenboden, der Tisch, an dem schon Generationen saßen, und in der Ecke der Spinnstuhl mit Anno 1751 auf der Lehne, dazu ein geschnitztes Herz mit den Initialen der Urururgroßmutter ihres Enkels; da ist der Schrank mit dem Alltagsgeschirr, da der Herd, darüber die Regale mit Töpfen und Schüsseln, die Eierkohlen glühen, zum Glück haben sie noch genug. Alles wie gewohnt, und nun? Sie spürt den besorgten Blick ihrer Schwiegertochter. Käthe scheint zu hoffen, dass sie das Heft in die Hand nimmt, und das schmeichelt ihr, denn jawohl: Sie fackelt nicht lange, im Gegensatz zu Herta, und dann gewinnt ihr Pragmatismus die Oberhand. Sie tippt wie als Schlusspunkt ihrer Überlegungen mit dem Zeigefinger auf den Tisch und sagt: »Na, denn … Wenn der Ami wirklich da ist, wie Vornefett, der Schluckspecht, behauptet … dann müssen wir wohl aufräumen. Der Ami ist unser Feind, und bevor wir uns Ärger einhandeln – weg mit dem Krempel.«
»Jetzt gleich?«, fragt Herta Kruse entgeistert.
»Wann denn sonst, Herta? Willst du warten, bis die Panzer in deine Stube schießen?«
»Aber wohin damit, Magda?«
Magda Leeb denkt kurz nach. Dann sagt sie: »Jauchegrube. Alles in die Jauchegrube.«
»Wilhelm hat die Grube im letzten Jahr leergefahren, im April, während seines Urlaubs«, gibt ihre Schwiegertochter zu bedenken. »Ist sie denn voll genug?«
»Die Tiere fressen, die Tiere kacken«, antwortet Magda Leeb. »Wenn man auf irgendwas zählen kann, dann darauf. Der Kram kommt in die Jauchegrube. Wer guckt da schon nach?«
Ihr Enkel sieht aus, als müsste er gleich heulen. Aber es ist beschlossene Sache.
Pawel und Martin werden aus dem Kuhstall geholt, Josef, der Knecht, muss das Striegeln der Pferde unterbrechen, und sobald alle im Hausflur versammelt sind, baut sich Magda Leeb vor Familie und Gesinde auf.
»Alle mal herhören«, sagt sie. »Der Feind rückt an, und wir müssen hier reinen Tisch machen, denn wer weiß, was in den Köpfen dieser fremdländischen Soldaten vor sich geht. Es kann zu Missverständnissen kommen, und wir sind im Krieg, da wird bekanntlich geschossen. Und ihr beide …« – sie zeigt mit einem rheumatischen Finger auf den Franzosen und den Polen – »… kommt mir bloß nicht auf dumme Gedanken! Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Also: Martin und Pawel, ihr öffnet schon mal die Luke der Jauchegrube. Josef, du stellst dich ans Tor und hältst Ausschau, und wenn der Amerikaner kommt, sagst du uns sofort Bescheid, verstanden?«
Josef nickt, obwohl er nicht weiß, wie er aussieht, der Amerikaner, denn er ist in seinem Leben nie über die Kleinstadt Peine hinauskommen, der Rest der Welt ist ihm unbekannt, und der Rest der Welt ist ziemlich groß. Er fragt also: »Und woran erkenne ich diese Amerikaner?«
Da muss sogar Magda Leeb überlegen.
»Sie haben Sterne auf den Panzern«, erklärt ihr Enkelsohn mit bebender Stimme. »Und manche Soldaten sind schwarz wie Kohle.«
»Der mit den Sternen«, ächzt Oma Kruse, »das ist doch der Bolschewik.«
»Der Ami hat auch Sterne«, beharrt Willem. »Nur sind die nicht rot, sondern weiß.«
»Da steig einer durch!«
Magda Leeb nimmt Josef ins Visier und fragt: »Verstanden? Weißer Stern, schwarze Soldaten.«
»Jawoll, Chefin«, sagt Josef, der Schwarze nur von Zigarettensammelbildern kennt. »Ich stelle mich vors Tor. Mit einer Grepe.«
»Wozu denn das?«
»Ich muss mich doch wehren können.«
»Niemand wehrt sich, sonst werden wir tatsächlich alle erschossen! Du lässt die Grepe gefälligst im Stall. Du kannst ja ein Taschenmesser einstecken.«
Josef nickt. Er hat stets ein Messer in der Tasche.
»Alle anderen«, fährt Magda Leeb fort, »sammeln ein, was weg muss. Ich hole Wilhelms Gewehre.«
»Und die Pistolen?«, fragt Käthe, ihre Schwiegertochter.
»Ja, die auch. Wo ist der Schlüssel für den Schrank im SA-Büro?«
»Da.« Käthe zeigt auf das Schlüsselbord neben der Küchentür. »Soll ich das machen?«
»Nein. Du gehst mit den beiden Mädchen durchs Haus, ihr sammelt alles mit Hakenkreuz ein, auch die Bilder des Führers. Wenn der Ami kommt, muss es aussehen, als hätte es das nie gegeben.«
Der junge Wilhelm blickt auf. »Das Koppel will ich aber behalten«, sagt er flehentlich. »Das darf nicht in die Jauche.«
»Muss auch weg«, blafft seine Großmutter.
»Vielleicht kann man das Emblem auf dem Schloss entfernen«, meint seine Mutter.
»Das ist Hitlerjugend-Kram, das kommt weg. Wenn schon, denn schon. Dein Großvater«, sagt Magda Leeb, an ihren Enkel gewandt, »der hat den Führer nie gemocht, Willem, der wäre stolz auf dich, wenn du das Zeug wegwirfst.«
»Vater hat oft gesagt, Großvater sei von gestern«, murmelt Willem mit gesenktem Kopf.
Seine Großmutter schnaubt; dann klatscht sie in die Hände und ruft: »Und nun los! Ab mit euch! An die Arbeit.«
Alle gehorchen. Sie selbst pflückt den Schrankschlüssel vom Bord und geht zum SA-Büro, untergebracht in einer der Kammern, die die lange Diele säumen. Dort wird selten geputzt, die Aktenschränke und der Schrank mit Rolljalousie sind staubig, ebenso der Schreibtisch, auf dem Papiere liegen, von ihrem Sohn säuberlich geordnet, und an den Hufen des Bronzepferds, das sich neben Tintenfass und Stiftablage aufbäumt, haben Spinnen ihre Fäden gewoben. Sie entdeckt eine leere Kiste, die sie vor den Schrank mit den Waffen stellt, und schließt auf. Da sind sie, die Jagdflinten, dazu Schachteln mit Schrotpatronen und Pistolenmunition, sogar Karabinergeschosse, und die zwei Pistolen, eingefettet, in Lappen gehüllt. Nun, da es zur Sache geht, zaudert sie. Was wird ihr Sohn sagen, wenn er heimkehrt? Er wird toben, ja, aber der Ami naht, und sie ahnt, diese Welt geht unter, und wie viel wird zu guter Letzt noch aus den Fluten ragen? Es geht darum, davonzukommen, da muss jeder Opfer bringen, auch ihr stolzer Sohn.
Sie lehnt die Gewehre gegen die Wand, bettet die Munition vorsichtig in die Holzkiste und legt eine Pistole daneben. Bei der zweiten zögert sie jedoch und denkt: Eine kann man behalten, die kann man verstecken, und der Ami, na, der wird das Haus gewiss nicht komplett auf den Kopf stellen, der ist nicht so gründlich. Und dann hat sie eine Idee – da gibt es diese Nische in der Speisekammerwand, hinter dem Vorratsschrank, die niemand kennt.
Und so verbirgt Magda Leeb, während ihre Schwiegertochter und die Ukrainerinnen alles einsammeln, was in den Augen des Feindes belastend sein könnte, nicht nur die Pistole nebst Holster und gefülltem Magazin in der Nische, sondern auch den Offiziersdolch und den SA-Dolch ihres Sohnes, das Album mit den Reichsparteitagsfotos und anderes mehr. Käthe Leeb wiederum tut ihrem Sohn einen Gefallen, indem sie Martin bittet, das Emblem vom Schloss des HJ-Koppels zu entfernen, und der Franzose erfüllt ihre Bitte gern, ist ja ein Klacks: ein Ruck mit der Kneifzange, fertig. Der junge Willem ist nicht froh, kann das Koppel aber wenigstens tragen. Und während Josef paffend am Tor steht, nervös sein Taschenmesser befummelt und sich fragt, aus welcher Richtung die schwarzen Soldaten mit dem weißen Stern wohl kommen, ob aus Peine, also von links, oder aus Groß Ilsede, also von rechts, schleppt man alles, was weg muss, durch die Durchfahrt zur Jauchegrube. Schließlich, der ganze Krempel ist da und der komplette Haushalt hat Aufstellung genommen, befiehlt Magda Leeb: »Rein damit!«
Sie lässt zuerst die Jagdgewehre in die Grube fallen. Dumpfes Platschen, kurzes Dümpeln, dann versinken die Waffen, mit denen ihr Sohn Hasen und Rehe schoss, in der stinkenden, zähen Masse. Alle schweigen beklommen, nur Pawel kann seine Genugtuung nicht verhehlen, als die Hitlerbilder, mit der Führer-Büste aus dem SA-Büro beschwert, in Scheiße und Pisse absaufen. Er grinst hämisch und murmelt etwas auf Polnisch, gut, dass ihn keiner versteht, nicht mal die Ukrainerinnen, die doch wahrhaftig Tränen in den Augen haben. Martin dagegen ist zu höflich, um sich etwas anmerken zu lassen, er sieht zum grauen Himmel auf, lässt den Blick danach über die Bäume im Obstgarten schweifen.
»Die Fahnen verbrennen wir«, sagt Magda Leeb, nachdem alles versenkt wurde. »Und wenn jemand noch was findet – weg damit.« Halb beschämt und halb triumphierend denkt sie an ihr Versteck in der Wand. Mit der Zeit wird sie die Sachen vergessen, denn es geschieht viel, und sie haben viel um die Ohren, und Magdas Gedanken gelten meist ihrem Sohn, der in polnischer Kriegsgefangenschaft ist, vier ganze Jahre werden es am Ende sein.
Die Luke der Jauchegrube fällt zu.
An diesem grauen neunten April bleiben die Amerikaner aus. Die Stadt Peine, drei Kilometer nördlich, wird erst am folgenden Tag übergeben, kampflos und unzerstört, dies aufgrund des Mutes und der Besonnenheit der Stadtoberen, aber auch durch ein Quäntchen Glück, denn am Morgen des zehnten April ist es nebelig, und so entgeht den alliierten Aufklärungsfliegern eine auf der Autobahn anrollende deutsche Panzertruppe; man kann ihren Kommandanten zur Umkehr überreden.
Der Amerikaner rückt erst in den folgenden Tagen in das Dorf Klein Ilsede ein, zur großen Überraschung von Bruno, Willems Bruder, der nicht nur die Angewohnheit hat, ein Zicklein an der Leine zu führen, sondern auch die, seine Geschäfte auf dem Misthaufen zu verrichten, umschmeichelt von warmen, würzigen Düften. Als er eines Mittags den gewissen Drang verspürt – er ist gerade heimgekehrt, denn er hat mit seiner Schwester einige Zeit bei der Tante verbracht –, bindet er die Ziege hinten auf dem Hof an einen Ackerwagen und erklimmt den Misthaufen, um sich ganz oben zu erleichtern, mit Blick auf den Obstgarten, die Eisenbahngleise, die Wiesen und natürlich auf sein Zicklein, das neben dem großen Ackerwagenrad steht und meckert. Er hockt versonnen da, die Ellbogen auf die Knie, das Gesicht auf die Hände gestützt, als es vorn auf dem Hof laut wird, Rufe und Motorenlärm, aber der kleine Bruno ist jetzt hochkonzentriert, er blendet die ganze Welt aus, und so kommt es, dass er fast vom Misthaufen purzelt, als ein Auto im Bogen über den Hinterhof braust. Das Zicklein sucht Zuflucht unter dem Ackerwagen, und dann hält der Jeep mit dem weißen Stern auf der Kühlerhaube, und ein helles und ein dunkles Gesicht, bekrönt von olivgrünen Stahlhelmen, richten die Augen auf den kleinen Kerl, dessen Tun selbst für Menschen von einem anderen Kontinent offensichtlich ist. Beide Soldaten brechen in schallendes Gelächter aus, rufen ihm Worte zu, die er nicht versteht, schwenken gar Gewehr und Maschinenpistole. Da könnte man vor Schreck glatt Dünnpfiff kriegen, aber die Arbeit ist ja schon getan, und der strohblonde Bruno schlittert vom Misthaufen, den Hosenbund in beiden Händen und steht vor dem Auto und den Männern, die immer noch lachen und ihm irgendwas hinhalten, aber man hat Bruno eingebläut, von Fremden nichts anzunehmen. Deshalb muss erst sein großer Bruder kommen, der ihm die Hosenträger über die Schultern legt und akzeptiert, was die fremden Soldaten offerieren, Drops und Schokolade. Und dann fahren sie wieder ab, vorbei an der Jauchegrube, die sie keines Blickes würdigen, nicht ahnend, was sich in den braunen Tiefen verbirgt.
März 1944 – Feind vor der Tür
Furchtbares Schneetreiben, so geht das schon den ganzen Monat. Jede Fahrt ist ein Wagnis, überall hohe Verwehungen, es sieht wüst aus, genau wie die Lage an der Front. Immerhin macht das Wetter den russischen Fliegern einen Strich durch die Rechnung. Das Auto, eine SIS-Limousine, kommt nur im Schneckentempo voran, Gott sei Dank haben sie Schneeketten, der Wischer schrappt hektisch über die Windschutzscheibe, und Alex, der ukrainische Fahrer, sitzt fluchend und verkrampft am Steuer, weil er die Straße im Gestöber kaum erkennen kann. Hoffentlich gibt der Wagen nicht wieder den Geist auf; sie müssten dann mit Pferden abgeschleppt werden, was bei diesem Wetter gewiss kein Zuckerschlecken wäre.
Wilhelm Leeb, als Landwirtschaftsführer der Zuckerzentrale zugeteilt, ist viel unterwegs. Er unternimmt Kontrollfahrten, inspiziert Zuckerfabriken und besucht Kreislandwirte im besetzten Gebiet, genauer im Umkreis des ukrainischen Chmelnyzkyj, nordöstlich von Czernowitz, am Südlichen Bug. Trotz Mantel und Handschuhen ist es eisig, der Wind pfeift durch jede Ritze des Autos, das ebenso zivil ist wie Leeb selbst. Er hat zwar den Rang eines Leutnants und trägt die entsprechende Uniform, doch sobald seine Tätigkeit endet, muss er sie ablegen, und das könnte rascher geschehen, als ihm lieb ist, weil der Feind vor der Tür steht. Vor drei Tagen musste er mit ansehen, wie man auf einer Kolchose das Vieh verteilte, um es vor den Russen zu retten.
Das erlebt er nun zum zweiten Mal. Seine erste Station, die Stadt Pyrjatyn im Oblast Poltawa, wurde schon im letzten Herbst von den Russen erobert. So hat er sich das im April 1942, als er von zu Hause aufbrach und im Windschatten der kämpfenden Truppe gut zweieinhalbtausend Kilometer zurücklegte, um als Landwirtschaftsführer eingesetzt zu werden, nicht gedacht, und bei manchen Gelegenheiten, so auch in dieser Schneehölle, fragt er sich, was ihn geritten hat, als er Frau und drei Kinder, Eltern und Schwiegereltern zurückließ, zumal er nach dem Frankreichfeldzug demobilisiert worden war, als Landwirt gar zu Hause hätte bleiben können. Doch er glaubte fest daran, dass Deutschland auch im Osten siegen würde; er wollte seinen Teil dazu beitragen, nach dem Sieg auch gern etwas abbekommen, am besten einen fetten Batzen fruchtbaren ukrainischen Bodens. Auf der Jungfernfahrt nach Osten war er euphorisch. Ob zerbombte Städte, niedergebrannte Dörfer, Panzerwracks oder Tote, nichts konnte seine Stimmung trüben, denn er sah sich als Teil eines gewaltigen historischen Ereignisses – die Wehrmacht bahnte ihm den Weg, sie trieb den Gegner vor sich her und kesselte ihn ein, sie zahlte es den Sowjets heim, deren deutsche Schergen, diese Sauhunde von Kommunisten, ihn 1924, bei der Rückkehr vom Deutschen Tag in Hannover, niedergeschlagen und seiner Fahne beraubt hatten. Wo gehobelt wird, fallen Späne, und im Krieg sind das Menschen, so ist das nun mal, auch er hat damals, als Artillerist in Belgien und Frankreich, Kameraden sterben sehen. Man tut, was getan werden muss, und sie müssen siegen, denn es wäre furchtbar, wenn alles umsonst gewesen wäre.
Draußen schemenhafte Bäume, alle schwer mit Schnee beladen. Sie waren gerade in Kamjanez-Podilskyj, dort hat Leeb zwanzig Liter Wodka besorgt und sich nach der Lage erkundigt. »Heikel«, hieß es. Das 120 Kilometer weiter östlich gelegene Winnyzja, eine Stadt, die er oft besucht hat, wurde schon vor Tagen erobert, und der Russe stößt weiter vor, nun ist er es, der die deutschen Truppen vor sich hertreibt. Alles deutet darauf hin, dass sie ihre Zelte bald abbrechen müssen.
»Gleich da, Herr Leutnant«, sagt Alex über die Schulter, als erste militärische Hinweisschilder und schließlich die Häuser Chmelnyzkyjs auftauchen. Er spricht gebrochen Deutsch, ist aber zuverlässig und ein erstklassiger Mechaniker, dieser Bursche mit der Russenmütze über dem verschmitzten Gesicht, und das ist eine weitere Sorge, die Leeb plagt: Was wird aus seinen Getreuen, wenn er abrückt? Man wird sie als Kollaborateure erschießen. Er sollte Alex mitnehmen, denkt er, ebenso Larissa, seine Dolmetscherin. Das Kriegsglück wird sich bald wieder zugunsten der Wehrmacht wenden, und dann braucht er die beiden; notfalls könnte er sie auf seinem Hof unterbringen, denn dort werden Arbeitskräfte benötigt; Käthe beklagt in ihren Briefen immer wieder, dass sie überlastet sei.
Mitten in Chmelnyzkyj lichtet sich das Schneegestöber ein wenig, graues Zwielicht sickert durch die Wolkendecke. Keine Zivilisten auf der Straße, obwohl es früher Nachmittag ist. Nur Landser, die die in die Stadt gespülten Panzer und Fahrzeuge bewachen, und anderes Militär. Bomben sind noch nicht gefallen; die Häuserruinen, die es gibt, stammen aus dem Juli 1941, als die Stadt von der Wehrmacht eingenommen wurde. Leeb lässt Alex vor der Kommandantur halten, die im Haus eines jüdischen Kaufmanns untergebracht ist. Die Juden sind alle verschwunden; Leeb weiß sehr wohl, was mit ihnen passiert ist. Er hat Berichte von Kameraden gehört, wurde auf seinen Fahrten auch Zeuge von Erschießungen und Deportationen, verschwendet aber keinen Gedanken daran, denn er hat andere Sorgen, nun die Frage nach der Lage, und so geht er zur Kommandantur. In den Schreibstuben ist man schon damit beschäftigt, Akten einzupacken oder zu vernichten, alle flitzen hektisch herum, und trotzdem verstellt ihm ein Gefreiter den Weg, mit Helm und Karabiner, und verlangt die Parole.
»Kenne ich nicht«, sagt Leeb. »Ich will nur kurz Major Bunzlau sprechen.«
»Die Parole«, wiederholt der Gefreite, ein kleiner, untersetzter Kerl.
Da tritt der Major aus seinem Zimmer, die Arme voller Dokumente und eine Maschinenpistole auf dem Rücken. Beim Anblick Leebs ruft er: »Wir haben Abmarschbefehl. Der Russe stößt im Bogen auf Czernowitz vor und schneidet uns den Weg nach Westen ab. Wir müssen weg.« Er lässt die Dokumente vor der Tür in eine Blechtonne fallen, in der schon Unterlagen brennen, und wirft die Zigarette hinterher.
»Jawohl«, antwortet Leeb, wie immer auf Haltung bedacht, und salutiert.
»Tja, Schluss mit lustig, Leeb«, sagt der Major, indem er eine Zigarette aus der Schachtel zieht. »Wir weichen nach Süden aus, nach Rumänien. Dort ist es ruhig. Hier flutschen die Russen durch wie Scheiße durch die Gans. Alles ist in Auflösung.«
Wilhelm Leeb eilt zum Auto. Sobald er sitzt, sagt er zu seinem Fahrer: »Wir rücken ab, Alex. Ich nehme euch mit, dich und Larissa. Holt eure Sachen und kommt danach mit dem Auto zu mir.«
Alex nickt erleichtert. Er setzt seinen Chef vor dessen Unterkunft ab und fährt weiter, um Larissa zu informieren.
Die Sachen sind rasch in die Holztruhe gepackt, darin hat Leeb inzwischen Übung. Er ist penibel, aber nicht übermäßig akkurat, legt auch gern Listen seiner Kleider und Habseligkeiten an und hält vieles schriftlich fest. Nun setzt er sich an den Tisch, holt seinen Kalender hervor, »Sonderausgabe für die besetzten Ostgebiete«, und trägt unter dem Datum des Tages mit Bleistift – sein Füller ist futsch – ein paar Sätze ein. Anschließend liest er ein Buch, eine Zigarette nach der anderen rauchend, und gönnt sich dabei ein Glas Wodka, denn Alex und Larissa lassen auf sich warten.
Seine Stube ist schmuddelig, doch er hat in schlimmeren Löchern gehaust, musste nach dem Rückzug aus Pyrjatyn, im September letzten Jahres, oft genug im Wagen oder auf dem Fußboden übernachten; drei Monate, dann hatte sich endlich alles wieder eingependelt. Hier, in Chmelnyzkyj, wird es nun lauter, man belädt Fahrzeuge und bereitet sie auf den Abmarsch vor, Rufe und Gebrüll dringen trotz des heulenden Windes zum Fenster herein, in Abständen wird probehalber ein Motor gestartet, das Dröhnen der Panzer ist unverkennbar. Die Front ist nicht zu hören, auch Bomben fallen nicht, dem lausigen Wetter sei Dank. Wenn es so bleibt, denkt Leeb, haben sie eine reelle Chance, den Russen zu entwischen.
Er tigert hin und her, denn die Zeit drängt. Wo bleiben Alex und Larissa? Dann horcht er auf, weil er meint, eine Detonation gehört zu haben, doch als er an das Fenster tritt, kann er nichts sehen; der Schneefall trübt die Sicht, und das Weiß, das alles bedeckt, verwandelt die nicht gerade kleine, aber triste Stadt … in ein Märchenland, wie Wilhelm Leeb denkt, in ein Reich weitab des Krieges. Er erinnert sich an die Jagden im Umland Pyrjatyns, die Strecke der Hasen, Rehe und Wildschweine auf der Schneedecke. Sechzehn Monate hat er dort verbracht, und damals schien alles so stabil, so dauerhaft zu sein. Er richtete eine künstliche Brutanstalt für 60 000 Eier ein, ließ in großem Maßstab Gemüse anbauen, bestellte in Kiew 175 000 Fischsetzlinge für die Teiche, beaufsichtigte obendrein den Getreideanbau auf 80 000 Hektar Land. Dazu Obstbaumplantagen und Viehzucht, sogar ein Gestüt für Orloff-Traber, für ihn ein Traum, denn Pferde liebt er über alles. Das war eine Dimension, die nicht mal ostelbische Junker kannten – von ihm selbst ganz zu schweigen, denn er bewirtschaftet daheim nur sechzig Morgen –, und trotz vieler Rückschläge ging es voran: Er konnte seinen Auftrag erfüllen und Heimat und Wehrmacht beliefern.
Alles vorbei, wer weiß, was nun kommt. Leeb neigt jedoch nicht zu düsteren Gedanken, noch nicht, er denkt bloß wehmütig an die Zeit, als alles im Lot war. Damals lebte es sich gut, wie oft feierte er mit den Pyrjatyner Kameraden. Da wurde gebechert und gelacht, da tanzten junge Ukrainerinnen halbnackt auf dem Tisch – nicht ganz freiwillig, wohl wahr, denn eine vorgehaltene Maschinenpistole half ihnen auf die Sprünge, aber: was für ein Vergnügen. All das ist nun gefährdet, die Fülle, die Erfolge, die Macht, dazu die drohende Schande, als Verlierer dazustehen. Es nagt und bohrt in Wilhelm Leeb, irgendwas quält ihn, vielleicht die Erschütterung dessen, woran er geglaubt hat, vielleicht die Schreckensbilder, die er in sich verschließt: die Erschießungen, die Hatz auf Partisanen, die Toten, die unzähligen Toten, die sinnlos niedergemähten Zivilisten, und nun erneut das Chaos eines überstürzten Rückzugs. Daran könnte man verzweifeln, aber – er drückt seine Zigarette energisch im Aschenbecher aus – das wird er sich nicht gestatten. Nie und nimmer. Was auch geschieht, er wird Haltung bewahren.
Gegen Abend, es dunkelt schon und draußen ist weiter der Lärm der Abmarschvorbereitungen zu hören, erscheint Alex endlich. Larissa, sagt er, wolle eine Freundin mitnehmen, Tanja, sei das möglich? Sie habe für einen anderen Sonderführer gearbeitet, einen Ingenieur, der überstürzt geflohen sei.
Leeb überlegt kurz, dann willigt er ein. Ob schon Truppen abgerückt seien, will er wissen, und Alex antwortet: Nein, noch nicht, er habe aber gehört, es gehe bald los, in Kolonne. Außerdem sei jetzt Gefechtslärm zu hören, und man habe ihm berichtet, dass russische Reiterei und Panzer anrückten. Er lässt seine Mütze in beiden Händen kreisen, hat offenbar Angst, und auch Wilhelm Leeb wird von einer leisen Furcht beschlichen, baut aber auf sein Glück, das ihn bislang nie im Stich gelassen hat. Er steht auf, zieht ein letztes Mal an der Zigarette, drückt sie aus und sagt: »Gut. Wir setzen uns schon mal ins Auto. Haben wir genug Sprit?«
Alex nickt. Er hat noch ein paar Kanister aufgetrieben, dafür hat er ein Händchen, das Schlitzohr. Sie tragen die olivgrün lackierte Holztruhe nach unten, und Leeb verabschiedet sich von seiner Hauswirtin, einer ergrauten Ukrainerin, die seine Hand mit feuchten Händen umschließt. »Ach, Herr Leutnant, was wird nun aus uns?«, fragt sie in gebrochenem Deutsch.
»Das liegt in Gottes Hand«, erwidert Leeb, der diesen Worten, obwohl er nicht gläubig ist, einen überzeugenden Ton zu verleihen vermag und obendrein militärische Haltung annimmt. Seine Hauswirtin nickt mit Tränen in den Augen und bekreuzigt sich, dann schaut sie zu, wie ihr Logiergast die Truhe mit Hilfe von Alex im Kofferraum verstaut, der schon das Gepäck der jungen Frauen sowie zwei Ersatzkanister mit Benzin und natürlich den Wodka enthält.
Es schneit noch, die Straßen sind nicht beleuchtet, und die Fahrzeuge, die sich zur Kolonne zu ordnen versuchen, fahren mit Standlicht. Man bemüht sich, das Durcheinander zu organisieren, das Befehlsgebrüll übertönt selbst die Motoren, zu Handgreiflichkeiten kommt es auch, denn die Nerven aller sind bis zum Zerreißen gespannt, jeder denkt nur an sich selbst, und so dauert es quälend lange, bis sich die ersten Fahrzeuge in Bewegung setzen. Alex lässt den Motor an, und sie brechen auf in die schneedurchtoste Dunkelheit, die zwei Männer und die beiden Frauen, eingeklemmt zwischen einem Panzerwagen und einem Lkw.
Chmelnyzkyj wird geräumt. Man schreibt den 23. März, es ist zwanzig Uhr dreißig.
August 1962 – Die Totenfrau
Wilhelm ist gegangen, er erwartet die Polizei und den Peiner Arzt, Doktor Fröbe. Gerda Derking sitzt an ihrem Küchentisch und versucht, den Schock zu verdauen. Sie erlebt dergleichen nicht zum ersten Mal, aber wer gewöhnt sich an so was? Da müsste man ja aus Stein sein, denkt sie, und wer aus Stein ist, der ist auch tot, ein wandelnder, brabbelnder Leichnam sozusagen. Die Küche ist schummerig, sie ist immer schummerig, egal wie hell die Sonne scheint, denn das Leebsche Wohnhaus nimmt ihr das Licht.
Gerda hat nur die Dorfschule besucht, so war das nun mal, denn man musste arbeiten gehen oder im Haushalt helfen, sich darauf vorbereiten, später eine gute Ehefrau zu sein. Wie oft pochte ihr Vater darauf, dass Klugheit nichts mit Rang oder Stand zu tun hat und dass auch Geld niemanden klüger macht. Entscheidend, erklärte er stets, sei die Klugheit des Herzens, und wenn er das sagte, legte er einen Arm um die Taille seiner Frau und sah sie liebevoll an, und Gerdas Mutter meinte dann: »Nu lass mal das Gedöns, Herbert«, aber lächeln musste sie trotzdem.
Und Gerda liest, auch das hat sie von ihren Eltern. Sie tut es heimlich, denn im Dorf ist Lesen verdächtig. Wer liest, der hat erstens nichts Besseres zu tun, ist also faul, und zweitens hält er sich für was Besseres, das hat Gerda oft gehört, sie hat noch den schnaubenden Ton der Empörung im Ohr, und insgeheim musste sie immer lachen, denn genau das will hier doch jeder: was Besseres sein, aber wehe, jemand anderer maßt sich das an! Lesen, das darf nur der Lehrer, muss er ja auch, und natürlich der Pastor, muss er ja auch, alle anderen haben das gefälligst zu unterlassen, die sollen Mist fahren oder Fußböden schrubben, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen oder sich irgendwas einbilden auf ihre Neunmalklugheit.
Gerda liest trotzdem. Wenn sie mal in Peine ist, geht sie in die Bücherei in der Werderstraße. Der Bibliothekar, Herr Mattenroth, kennt sie inzwischen, und er sagt jedes Mal: »Fräulein Derking, ich habe da was für Sie!«, und dann empfiehlt er ein Buch, und das leiht sie aus. Herr Mattenroth war im Krieg, zuletzt im Westen, und wenn sie allein sind, schimpft er auf die Nazis, hat auch manchmal Tränen in den Augen. »Sie ahnen ja nicht, was ich da alles erleben musste, Fräulein Derking«, sagt er bei diesen Gelegenheiten gepresst, »so viel Rohheit und Brutalität und vor allem so viel Dummheit. Alle hatten Augen, aber keiner hat sie aufgemacht, und wenn, dann hat der Blick nur bis zur nächsten Mahlzeit gereicht. Da verliert man wahrhaftig den Glauben an die Menschheit.«
Gerda nickt verständnisvoll, und er sieht sie dankbar an, das ergraute Fräulein mit Kopftuch und Kittelkleid, mit den groben Lederschuhen und der Segeltuchtasche, in die sie das Buch steckt.
»Schön, dass wir so offen sprechen können«, sagt sie aufrichtig erfreut.
Und der Bibliothekar erwidert: »Ja, das finde ich auch.« Er rückt seine Brille zurecht. »Gut, dass es Leserinnen wie Sie gibt«, sagt er und gibt ihr die Hand. »Und Menschen wie Sie, Fräulein Derking.«
Zu Hause liest sie dann. Das letzte Buch war kurz, das hatte ein Pastor geschrieben, ein Mann namens Albrecht Goes, es heißt Unruhige Nacht. »Das müssen Sie unbedingt lesen, Fräulein Derking«, hatte Herr Mattenroth gesagt, »das ist ein Guter!« Ja, nu – mit Pastoren hat sie es zwar nicht so, aber man hin.
Und wahrhaftig: Die Hauptperson, ein Feldseelsorger im Krieg, im Osten, der redet ihr oft zu geschwollen. Gerda hat das Buch trotzdem gern gelesen; sie litt mit dem jungen Soldaten, der zum Tode verurteilt worden war, obwohl er sich nur nach menschlicher Wärme und Liebe gesehnt hatte, und für so was wurde man erschossen, in einer Kiesgrube, gefesselt und mit verbundenen Augen vor einem Pfahl stehend. Der Einzige, der den armen Kerl verstand, das war der Feldseelsorger, aber der konnte auch nicht helfen, außer mit Verständnis und guten Worten, und er musste mit ansehen, wie man den Jungen mit Kugeln durchsiebte.
Aber da war noch etwas, das sie aufmerken ließ, und zwar ein Name: Chmelnyzkyj. Wilhelm Leeb hatte diesen Ortsnamen manchmal genannt, wenn er von seiner Zeit als Sonderführer erzählt und geprahlt hatte, er habe ein Gebiet verwaltet, »dreimal so groß wie Niedersachsen«. Viel mehr hatte er nie preisgegeben, sondern lieber über die Kriegsgefangenschaft geklagt, in der er so hatte darben müssen, dass er, von der Fron auf den Feldern heimkehrend, Kartoffelscheiben zwischen den Pobacken versteckt hatte, um sie in der Unterkunft zu braten.
Sicher, dachte Gerda, das war ja man schrecklich, aber warum hatte er sich auch mit den Nazis gemein gemacht und war obendrein in den Krieg gezogen? Hatte er sich doch alles selbst eingebrockt, der Mann, und hinterher wurde gejammert? Nee, nee. Und dann las sie, es war ein Gedanke des Feldseelsorgers: »Seit die Politik der Landausbeutung sich in ihrer ganzen Skrupellosigkeit durchgesetzt hatte und alles Gerede von Befreiung entlarvt war als Lüge und Gewäsch, hatten die Partisanen ihr Handwerk begonnen.« Sie dachte über diesen Satz nach, in ihrer Stube im Ohrensessel sitzend und ihren schlafenden Kater betrachtend. Schließlich fiel der Groschen: Das hatte er getan, der Wilhelm, er hatte das Land ausgebeutet, bis die Einheimischen irgendwann zu den Waffen gegriffen hatten, um sich zu wehren. Wilhelm behauptete gern, niemandem etwas zuleide getan zu haben, aber Ausbeutung war auch eine Form von Gewalt. Er hatte allen Menschen, denen er Äcker und Essen genommen hatte, etwas zuleide getan, das lag auf der Hand.
Der alte Heuchler, dachte sie.
Dann stand sie auf und ging in die Küche, um ein Glas Zwetschgenmus zu öffnen.
Vielleicht, ging es ihr durch den Kopf, während sie das Mus löffelte und den herbsüßen Geschmack genoss, ist es ganz gut, dass er Käthe geheiratet hat und nicht mich. Wir wären wie Hund und Katze gewesen.
Nun sitzt sie in eben dieser Küche, die Arme auf dem Tisch verschränkt, und starrt durchs Fenster auf die Mauer des Leebschen Hauses, verdrängt jedoch die Gedanken an das, was sich dahinter abspielt: eine Tragödie, deren Hintergründe und Vorgeschichte ihr unbekannt sind.





























