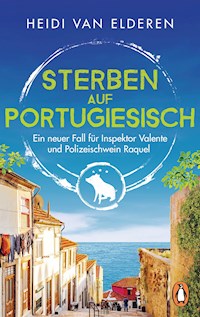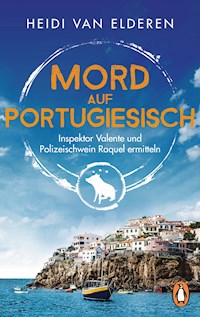
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die saustarke Krimireihe aus Portugal
- Sprache: Deutsch
Charmant, pfiffig und einfach sauspannend! Polizeischwein Raquels erster Fall.
Ein kleines Dorf in Portugal: Wie jedes Jahr an Weihnachten soll Fernando, ältester Sohn der Familie und Dorfpolizist, ein Schwein schlachten. Doch diesmal bringt er es nicht fertig, denn die liebenswerte Raquel ist ihm viel zu sehr ans Herz gewachsen. Und so befördert er sie kurzerhand zum ersten Polizeischwein Portugals – zum Entsetzen des ganzen Reviers. Aber dann stürzt eine Frau beim Angeln von den Klippen. Ein Unfall oder doch ein Mord? Fernando will den Fall unbedingt lösen und Raquels Fähigkeiten unter Beweis stellen – denn nur mit einem Ermittlungserfolg darf das Schwein im Polizeidienst bleiben. Sonst droht doch die Schlachtbank ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
HEIDI VAN ELDEREN, 1980 am Niederrhein geboren, ist Weltenbummlerin und freiberufliche Journalistin, hat ihren Lebensunterhalt aber auch schon als Apfelpflückerin und Aushilfsköchin verdient. Sie lebte in Nordschweden, dann vier Jahre lang im portugiesischen Alentejo, wo auch ihr Krimidebüt »Mord auf Portugiesisch« spielt. Heute wohnt die Autorin mit ihrem Mann und den zwei Töchtern in Neuseeland.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
HEIDI VAN ELDEREN
Inspektor Valente und Polizeischwein Raquel ermitteln
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen von Penguin Books Limited und werden hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2019 Penguin Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Covergestaltung: www.buerosued.de
Covermotiv: www.buerosued.de
Redaktion: Annika Krummacher
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-22844-6V002
www.penguin-verlag.de
1
Zu den Tatsachen, die diese Welt zu einem unerträglichen Ort machen, gehört unbestritten die, dass man Schweine schlachten muss, bevor man sie essen kann. Niemand wusste das besser als Inspektor Fernando Valente, der an jenem Samstag, an dem Raquel sterben sollte, ungewöhnlich früh und ungewöhnlich unglücklich erwachte. Die kaltfeuchte Dezemberluft und der wachsende Widerwille gegen den Lauf der Dinge waren ihm über Wochen in die Knochen gekrochen. Nun knirschten seine Gelenke, und seine Finger waren so steif, dass er daran zweifelte, ob er ihnen guten Gewissens ein Messer anvertrauen konnte.
Einen Moment hoffte er, dass sich der Schmerz ausbreiten, in seine Muskeln und Bronchien wandern und in einer Grippe explodieren würde. So wie es in den alten Häusern in jedem feuchtkalten Winter geschah. Seine Großmutter würde ihn mit einer Suppe zurück ins Bett schicken, wenn er über seiner ersten Bica zitterte, dem Espresso, der fester Bestandteil des portugiesischen Frühstücks war, und salzige Schleimklumpen in den Pyjamaärmel hustete.
Es war gar nicht so, dass der Inspektor nicht schlachten konnte. Wie es die Tradition im Alentejo vom ältesten Sohn verlangte, hatte Fernando Valente schon unzählige Schweine mit einem Stich ins Herz getötet. Und auf den ersten Blick unterschied sich Raquel mit ihren lehmverkrusteten Borsten, ihrer schwarzen Wampe und ihrem unstillbaren Heißhunger auf Eicheln nur wenig von all den Ferkeln, die er in den vergangenen Jahren getroffen, geschlachtet und gegessen hatte.
Aber Raquel hatte er mit der Flasche großgezogen. Er hatte mit ihr Fußball gespielt und erlebt, wie sie sich auf die Seite warf, mit den Beinen in der Luft ruderte, dabei Melodien grunzte und so schlechte Tage ein wenig besser machte. Er wusste, wie es sich anfühlte, wenn Raquel ihre lange Nase in seine Jackentasche steckte, um nach Karamellbonbons zu suchen. In den letzten zwei Jahren war sie zu einem stattlichen schwarzen Schwein, einem Porco preto alentejano, herangewachsen. Mit ihren rund hundertfünfzig Kilogramm brachte sie so viel auf die Waage wie ein ausgewachsener Eber dieser alten Rasse. Die Porco pretos lebten in der Regel halbwild in den weiten Korkeichenwäldern und fraßen dort Unmengen Eicheln, die ihrem Fleisch den typisch würzigen Geschmack verliehen. Raquel fraß zwar auch Unmengen Eicheln, lebte aber im großen Garten der Familie Valente und war alles andere als halbwild. Sie stand nachmittags am Tor und wartete auf Fernandos Heimkehr. Auf gar keinen Fall wollte er sie töten.
Fernando dachte nach. So eine Grippe ließe sich auch simulieren, bis auf den Schleim natürlich. Probeweise hustete er und freute sich, wie echt das klang. Im besten Fall könnte er so einige Wochen Schonfrist herausschlagen. Andererseits traute er seiner Mutter durchaus zu, das Messer an ihren Schwager, Onkel João, weiterzureichen. Der hatte Fernando vor gut zwanzig Jahren, kurz nach seinem achtzehnten Geburtstag, gezeigt, wie man präzise ins Herz sticht, dabei verfehlte er selbst sein Ziel jedoch auffallend häufig um Haaresbreite. Fast jedes Jahr hallten die Schreie seiner an-, aber eben nicht abgestochenen Schweine durchs Tal.
Der Inspektor befand das Risiko für zu groß. Und passieren musste es ja doch irgendwann. Er seufzte, entledigte sich der Decke, die sowieso zu kalt und zu klamm war, um ihn trösten zu können, und stand auf, um die Messer zu schärfen.
In der Küche fiel das erste Tageslicht durch die Ritzen der Fensterläden, und im Fernseher auf der Kommode sprach eine hübsche Frau darüber, dass die Regierung womöglich weitere Sozialabgaben kürzen wolle. Im offenen Kamin glühten ein paar Holzscheite. Gefährlich nah davor baumelten zwei Füße in pinkfarbenen Wollsocken. Sie gehörten zu Mafalda Valente, die in ihrem Lehnsessel thronte. Solange sich Fernando erinnern konnte, hatte seine Großmutter aus diesem Stuhl über den kleinen Bauernhof, die Quinta, regiert, sommers wie winters, tags wie nachts in mehrere Wolldecken gehüllt, die weißen Haare zum langen Zopf geflochten.
Obwohl er in die Aufklärung des Rätsels schon einiges an Zeit und Mühe investiert hatte, wusste der Inspektor immer noch nicht, ob Mafalda jemals schlief. Die wissenschaftlichen Fakten sprachen dafür, doch ihr Bett war seit Jahren unbenutzt, und auch im Sessel hatte niemand sie je bei einem Nickerchen erwischt. In diesem Moment sah es zwar danach aus, doch gerade als er einen Fuß über die Schwelle setzte, sagte sie mit wacher Stimme, aber ohne die Augen zu öffnen: »Fernando, mein Junge, du kommst gerade richtig. Lass uns doch einmal schauen, wie das Wetter heute wird.«
Der Inspektor rückte den Wäscheständer zur Seite, der in diesen Wochen oft tagelang vom Bad in den Flur auf die Terrasse und nachts auch in die zumindest dürftig beheizte Küche geschoben wurde, bis Hemden und Schlüpfer, Hosen und Laken zwar trocken waren, aber nach nassem Hund mufften. Dann öffnete er das Fenster und stieß die Fensterläden auf. Die Welt lag noch in sanften Grautönen und morgenfrisch da. Nichts verriet, dass sie in wenigen Stunden nach warmem Blut und Fett stinken würde.
Während Fernando auf die Holztür starrte, hinter der Raquel zu dieser Stunde vermutlich noch von offenen Futterkammern und ausgiebigen Streicheleinheiten träumte, zog Mafalda hörbar die Luft ein. Die Senhora hatte ein untrügliches Gespür für das Wetter. Eine Gabe, die sie selber einzig und allein ihrer wunderbaren, überdimensionierten Nase zuschrieb, die laut ihrer Schwiegertochter Teresa aber auch bedeutete, dass sie mit dem Teufel persönlich einen Pakt geschlossen haben musste. Doch anders als die arme Teresa, die der Liebe wegen ihr Dorf im Norden und damit die Region verlassen hatte, in der noch Heiligenbilder jedes Haus schmückten und man sonntags in die Kirche ging, kümmerten sich die Bewohner des Alentejo nicht groß um den Teufel oder seinen Widersacher. Wohl aber um das Wetter. Und so kamen sie, besonders in den Zeiten des Jahres, wenn das Wetter viel unbeständiger war als in den heißen, trockenen Sommern, mit schöner Regelmäßigkeit ins Haus der Valentes. »Dona Mafalda, müssen wir einen Schirm mit in die Stadt nehmen?«, »Können wir jetzt schon die Tomaten raussetzen?«, »Wie wird die Weinernte?«, »Riechen Sie Regen?«, »Wird es bald kalt?«. Und Mafalda wies Schwiegertochter oder Enkelsohn an, einen Kaffee aufzusetzen, einen Likör und Gebäck zu holen und das Fenster zu öffnen. Dann beugte sie den Kopf leicht zur Seite, schnüffelte an der Luft, die von draußen hereinwehte, und traf ihre Vorhersage, mit der sie – anders als der Wetterbericht im Fernsehen – erstaunlicherweise immer richtiglag.
Leider, befand Fernando, der einen Moment lang auf einen heftigen Gewittersturm biblischen Ausmaßes gehofft hatte, als Mafalda nun verkündete: »Nebel, kein Regen.«
»Und in der Küche wird es kalt und feucht, wenn wir noch länger das Fenster auflassen«, sagte Teresa im Hereinkommen. Was sie von Mafaldas Regenprognose hielt, hörte Fernando an dem Ruck, mit dem seine Mutter das Fenster schloss.
Wenig später kamen Onkel João und seine drei erwachsenen Söhne. Sie standen eine Weile in der Küche herum, klopften Fernando auf die Schulter, tranken mehrere Bicas, die bei jedem, der nicht von klein auf an übermäßigen Koffeinkonsum gewöhnt war, unweigerlich zu Herzrasen geführt hätten. Dann schnatterten die Frauen herein, in bunten Jogginghosen und Kittelschürzen. Küsschen links, Küsschen rechts. Der große Küchentisch verschwand unter einer geblümten Plastiktischdecke, mehreren Tüten voller Gebäck und Kuchenstücken, noch mehr Espressotassen und gewaltigen Frauenarmen in billigen Strickjacken aus Acrylwolle. Die Küche heizte auf. Und gerade als die Frauen die Männer auf den Hof scheuchen wollten, damit sie noch vor Mitternacht die Würste aufhängen und die Koteletts in die Gefriertruhe legen könnten, kam auch Patricia – Fernandos Zwillingsschwester und Vorgesetzte. Sie war nicht allein.
»Pedro«, seufzte Fernando. »Schon wieder.« Es war einige Monate her, dass er den Jungen dabei erwischt hatte, wie er ein Fahrrad stehlen wollte. Er hatte ihm ins Gewissen geredet und ihn dann laufen lassen, um ihm die Tracht Prügel zu ersparen, die ihm sein Vater ansonsten sicher verabreicht hätte. Seit diesem Vorfall tauchte der Zwölfjährige in allen passenden und unpassenden Momenten in seiner Nähe auf, verschwand aber meist wieder, ohne etwas zu sagen.
Diesmal war es anders. »Guten Morgen, Inspektor«, sagte Pedro brav und zog die Nase hoch.
»Schaut euch mal an, wen ich vor unserem Schuppen erwischt habe. Auf deinem Rad, Fernando«, sagte Patricia und lächelte. Fernando fand es erstaunlich, dass aus einem so liebreizenden Lächeln so viel Wut ins Zimmer fließen konnte.
»Ich hatte es mir gestern nur ausgeliehen, weil ich heute rechtzeitig wieder hier sein wollte, um beim Schlachten zu helfen«, murmelte der Angeklagte mit einem Augenaufschlag, der zumindest die Großmutter dahinschmelzen ließ.
»Lass das Kind los, Patricia«, sagte Mafalda. »Du bist hier nicht im Dienst. Er soll ein Stück Kuchen essen und sich dann nützlich machen.«
»Kuchen für Fahrraddiebe, ein interessanter Ansatz«, sagte Patricia mit einer Stimme, mit der man Knochen hätte zersägen können. Ihr rechtes Augenlid flatterte verdächtig. Großmutter und Enkelin schauten sich an – ein stummes Gefecht darüber, wer in diesem Haus das letzte Wort hatte. Wie immer gewann Mafalda. Patricia lockerte den Griff um Pedros Arm, und bevor Fernando sich versah, stand der Junge schon neben ihm.
Dann war es so weit. Fernando holte Raquel aus dem Stall, der von außen genauso aussah wie das einstöckige Wohnhaus. Sie waren, typisch für diese Region, weiß gestrichen, die Türen und die kleinen Fenster waren blau umrandet, hölzerne Fensterläden hielten im Sommer die Hitze und im Winter die Kälte ab.
Raquel war bester Dinge. Sie trabte neben Fernando über den Kies, geradewegs auf die Schlachtbank zu. Pedro stellte sich ihnen in den Weg.
»Inspektor«, begann er.
Aber der hatte jetzt wirklich keinen Kopf dafür. Es sollte vorbei sein, möglichst schnell vorbei sein. »Später, Pedro, später.«
Die vier Männer packten Raquels Beine und banden sie am Schlachttisch fest. Derweil zog Fernando am Kopfende den Dolch und wartete auf den Schrei. Diesen verzweifelten hohen Ton, den die Schweine sonst immer schon anstimmten, wenn sie von vier Seiten gepackt wurden, und der in dem Moment, in dem die Seile festgezogen wurden, eine unerträgliche Lautstärke erreichte. Ein Quietschen, das es einem erleichterte, den Schalter im Kopf umzulegen und zu töten, und wenn auch nur, damit es endlich vorbei war.
Aber Raquel, die kluge, schöne Raquel, machte keinen Mucks und schien ihn aus ihren braunen Augen – oder zumindest aus dem Teil, der unter den Speckwülsten zu sehen war – amüsiert anzuschauen. Hätte der Inspektor nicht gewusst, dass Tiere, vor allem solche, die man isst, keine solchen Emotionen kannten, hätte er genau das Wort verwendet: amüsiert.
»Du bist ein sehr spezielles Schwein«, sagte er stattdessen und kraulte der Sau die Brust, just an der Stelle, an der schon das Messer hätte stecken sollen. Raquels Kopf, der wie bei den Porco pretos üblich, recht schmal und lang gezogen, dafür aber mit überdimensional großen Ohren ausgestattet war, wackelte hin und her, während sie die Behandlung sichtlich genoss.
Pedro stand jetzt wieder neben ihm und zupfte an seinem Ärmel, doch Fernando ging nicht darauf ein, er war viel zu aufgeregt.
»Fernando, sie ist zwei Jahre lang nicht trächtig geworden«, versuchte João ihn zu überzeugen. »Und eine Sau, die nicht ferkelt, muss sterben. Egal, wie gern du sie magst.«
Fernandos Cousins schauten betreten zu Boden. Hinter ihnen öffnete sich knarrend das Küchenfenster. Fernando brauchte sich nicht umzudrehen, um zu sehen, wie seine Mutter dort stand, die Stirn gefurcht, die Arme in die Seite gestemmt, die Knöpfe der Kittelschürze bis zum Zerreißen gespannt, während sie mitverfolgte, wie ihr Sohn endgültig zum Gespött des Dorfes wurde. Man musste Teresa nicht besonders gut kennen, um zu wissen, dass sie jetzt gerne über den Hof gerannt wäre und ihm eine Ohrfeige verpasst hätte. Doch da dies dank Teresas Leibesfülle und Kurzatmigkeit nur schwer durchführbar gewesen wäre und weil sie vermutete, dass Mütter ihre erwachsenen Söhne in Anwesenheit anderer nicht körperlich züchtigen sollten, blieb sie, wo sie war. Stattdessen zischte sie über den Hof: »Stechen, nicht streicheln, Fernando Valente!« Dann schloss sich das Fenster wieder, wobei Fernando davon überzeugt war, dass sie sich nicht einfach an den Tisch zurücksetzen, sondern das Geschehen weiter beobachten würde.
Etwas flatterte durch Fernandos Brustkorb, panisch wie die Spatzen, die die beiden Katzen der Quinta manchmal zum Spielen ins Haus schleppten und die auf der Suche nach dem Ausgang so oft gegen geschlossene Fenster und Lampen prallten, dass sie schließlich auf den Boden fielen und gefressen wurden.
Inspektor Fernando Valente schaute Raquel an, sie schaute ihn an.
Dann steckte er den Dolch zurück in die Scheide, und ihm ging durch den Kopf, dass dies das Mutigste war, was er je in seinem Leben getan hatte. Ein erwartungsgemäß schlechtes Gefühl.
Weitaus unerwarteter kam ihm der kleine, kriminell veranlagte Pedro zu Hilfe. Er schob sich zwischen Raquel und João, dem durchaus zuzutrauen war, dass er die Tat kurzerhand eigenhändig vollbrachte.
»In Amerika sortieren sie solche Schweine immer für die Polizeischweinestaffel aus«, erklärte der Junge. »Und zwar solche Schweine, die nicht schreien, weil die ja offenbar ziemlich cool sind. Und die aussortierten Tiere kommen dann in die Polizeiausbildung.«
»Was redet der Junge da für einen Unsinn?«, wandte sich João an Fernando.
Pedro antwortete selbst: »Keine Ahnung, ob das so stimmt, aber in der Dokumentation im Fernsehen vor ein paar Wochen haben sie das so gesagt.«
»Im Fernsehen«, wiederholte Tito, der älteste, stärkste und dümmste der Cousins. Fernando wusste offenbar als Einziger in der Runde, dass Pedro aus Angst vor seinem ständig betrunkenen Vater, der wie festgeklebt vor dem Fernseher saß, nie auch nur in die Nähe des Apparates kam.
»Genug mit dem Unsinn!«, rief João. »Lass uns weitermachen, Fernando, bevor der Junge noch mehr Polizeischwein-Geschichten aus dem Hut zaubert.«
Aber Pedro ließ sich nicht beirren. »In Amerika haben sie schon große Polizeischweinestaffeln. Die finden Vermisste und Drogen und Sprengstoff, weil sie ja noch besser riechen können als Hunde«, erklärte er.
»Pedro hat recht, Onkel.« Fernando begann, Raquels Fesseln zu lösen. »Wir sollten ihr wenigstens die Chance geben, das erste Polizeischwein Portugals zu werden. Wenn sie die Ausbildung besteht, natürlich. Wenn nicht, können wir sie ja immer noch verwursten.« Fernando schnitt den letzten Knoten durch. Eigentlich hatte er Raquel mithilfe der anderen wieder vom Tisch heben wollen, aber bevor er die Männer auch nur auffordern konnte, mit anzupacken, war Raquel schon auf dem Bauch nach vorne gerobbt und auf dem Boden gelandet. Er steckte der Sau ein Karamellbonbon zu, und sie trottete kauend zu den Hühnern und Puten auf die Obstbaumwiese.
Fernando machte sich auf den Weg zur Küche, gefolgt von Pedro und Tito, während die anderen zurückblieben und so taten, als wären sie unglaublich beschäftigt. »Die haben Angst vor der Senhora«, flüsterte Pedro, als sie schon auf der Treppe waren.
»Sollten sie auch.« Patricias Stimme wehte wie ein eisiger Wind die Treppe herunter. »Jedenfalls, wenn du mit der Senhora mich meinst. Kann mir mal jemand erklären, warum dieses Schwein, für das ich meinen einzigen freien Tag des Monats geopfert habe, sich nun da draußen im Matsch suhlt, statt am Haken zu hängen?«
»Du solltest dich freuen, Schwesterlein. Raquel wird das erste Polizeischwein Portugals und als solches deine Staffel berühmt machen.« Der Inspektor versuchte ein Grinsen, aber ihm war nicht wohl dabei.
»In Amerika haben die das schon lange. Du musst doch auch davon gehört haben. Als Kommissarin. Ich hab da erst neulich was drüber im Fernsehen gesehen«, entgegnete Tito auf dem Weg in die Küche. Fernando unterdrückte den Impuls, seinen Cousin, von dem es hieß, dass er als Kind zu oft auf den Kopf gefallen sei, zu küssen.
Eine der Nachbarinnen wollte ebenfalls zu den Informierten gehören. »Ich hab das auch gesehen. Schweine sollen ja so intelligent sein. Und sie haaren nicht so stark wie die Schäferhunde, die sie bei der Polizei sonst immer haben.«
»Und warum sollte ausgerechnet diese übergewichtige Sau Polizeischwein werden?«, konterte Patricia. »Obwohl mein Bruder nicht mal einem Deutschen Schäferhund Sitz beibringen könnte?«
»Weil sie auf der Schlachtbank ruhig geblieben ist. Ein Zeichen für extrem hohe Stressresistenz, eine der wichtigsten Voraussetzungen für ein Polizeischwein«, sagte Fernando und schaffte es sogar, seiner Schwester dabei in die Augen zu schauen.
»Das ist doch absurd«, kommentierte Patricia.
Ja, dachte der Inspektor, absurd und wunderbar.
»Und was sollen wir Weihnachten essen? Stockfisch als Vorspeise und Hauptgericht?«, fragte Teresa.
Das war der Moment, in dem Mafalda beschloss, sich einzubringen. »Nun, meine Liebe, jetzt tu mal nicht so, als würdest du so ein ärmliches Weihnachtsessen nicht aus deiner Heimat kennen. Aber wir finden sicher noch einen Truthahn im Stall«, sagte sie mit süßer Stimme. »Tito, kümmere du dich doch bitte darum.«
»In meiner Staffel wird es kein Polizeischwein geben. Und wenn die Männer hier nicht Manns genug sind, ein Schwein ins Jenseits zu befördern, muss ich das wohl selber übernehmen«, beendete Patricia die Unterhaltung und zog ihre Dienstwaffe.
Die Frauen am Tisch wippten mit halb offenen Mündern hin und her – in freudiger Erregung angesichts des Schauspiels, das sich ihnen gerade bot und genug Gesprächsstoff für die nächsten zwei Wochen liefern würde.
Ein beinah orgiastisches Ächzen ging durch die Gruppe, als sich Mafalda erhob und erstaunlich behände zwischen die Tür und ihre Enkelin schob. »Auf meinem Hof werden Schweine weder mit Schusswaffen noch von Frauen getötet.« Es wäre vermutlich nicht nötig gewesen, noch einen draufzusetzen, aber Mafalda tat es trotzdem. »Und in deinem Zustand erst recht nicht. Im Süden sagt man, dass davon das Fleisch verdirbt.«
»Sie hat ihre Tage«, flüsterte Tante Sonya, die mit den ungeschriebenen Schlachtgesetzen offenbar vertrauter war als Fernando.
»Woher willst du wissen, in welchem Zustand ich bin?«, keifte Patricia. Die Großmutter hob nur ihre Nase in die Luft und machte Schnüffelgeräusche.
Während Patricia mit quietschenden Reifen vom Hof fuhr und der von Tito ausgewählte Truthahn kopflos unter den Feigenbäumen hin und her rannte, fragte sich der Inspektor zum ersten, aber nicht zum letzten Mal, wie er aus dieser Nummer wohl wieder herauskommen würde.
Abends saß er gemeinsam mit Pedro auf der Holzbank vor dem Stall, Raquel lag zu ihren Füßen. Onkel João und die Cousins waren in eine der Dorfkneipen weitergezogen, ein paar Frauen rupften in der Küche den Truthahn und sprachen über den Dokumentarfilm und die spannende Aussicht, dass das Fernsehen vielleicht eines Tages auch hier in Sonega drehen würde.
Die Sonne verschwand hinter den Hügeln, und auf den Nachbarhöfen begann das allnächtliche Gebell der Kettenhunde.
»Polizeischwein«, meinte der Inspektor und schüttelte lachend den Kopf. »Wie bist du nur so schnell darauf gekommen?«
»Ich wollte es Ihnen schon heute Morgen erzählen, aber Sie haben ja nicht zugehört.«
»Ich wollte erst diese Sache hinter mich bringen.«
»Haben Sie wirklich geglaubt, dass Sie sie schlachten könnten?«
Ganz schön frech für einen Zwölfjährigen, dachte der Inspektor. »Du ja offenbar nicht.«
»Nicht, seitdem ich Sie neulich gesehen habe, wie Sie mit ihr auf der Wiese gespielt haben. Mit einem rosa Ball.«
»Und du hast im Gebüsch gesessen?«
»So ähnlich. Sie hatten ja auch noch was gut bei mir. Also nach der Sache mit dem Fahrrad.«
»Und du spionierst Leute aus, die noch was gut bei dir haben?«
»Klar, nur so kann ich ja rausfinden, wie ich mich revanchieren kann«, antwortete Pedro mit entwaffnender Logik. »Es hat aber sonst niemand so viel gut bei mir wie Sie. Mein Vater hätte mir damals beide Arme gebrochen. Mindestens.«
»Ja, das hatte ich auch befürchtet.«
»Ich bin nur froh, dass sich am Ende doch noch alle an den Dokumentarfilm erinnern konnten. Mal abgesehen von Ihrer Schwester.«
»Du solltest Politiker werden.«
»Sie meinen, weil ich so viel weiß?«
»Weil du so grandios lügen kannst.«
Pedro dachte einen Moment nach. »Sagen Sie, Inspektor, verdienen Politiker viel Geld?«
»Die erfolgreichen schon.«
»Genug, um sich ein Fahrrad kaufen zu können?«
Fernando stand auf und ging zum Schuppen. Wenig später rollte er sein altes Rad nach draußen, pumpte die Reifen auf und stellte mit einem prüfenden Blick auf Pedro Lenker und Sattel ein.
»Probier mal«, sagte er und hielt dem Jungen das Fahrrad hin. »Jetzt brauchst du keins mehr auszuleihen. Und vom ersten Gehalt als Premierminister kannst du dir ein Auto holen.«
»Danke. Danke, Inspektor!«, rief Pedro und radelte auch schon freihändig den Feldweg hinauf. Dann drehte er noch mal ab und kam zurück. »Inspektor?«
»Ja?«
»Aber ich darf doch trotzdem noch manchmal vorbeikommen, oder?«
»Nicht, wenn du mich heimlich aus den Büschen beobachtest.«
»Ich könnte bei Raquels Training helfen.«
»Ich fürchte, dabei kann ich jede Hilfe gebrauchen.«
2
Am nächsten Morgen segelten nur wenige dicke weiße Wolken am Himmel entlang, und die Sonne schien so versöhnlich, wie es vielleicht nur in portugiesischen Wintern möglich ist. Die Möwen dösten auf den überraschend warmen Lichtflecken im Sand, erstaunlich unbeeindruckt von dem seltsamen Tier, das sie hier noch nie zuvor gesehen hatten. Es lag in einer Kuhle, kaute Eicheln und blickte aufs Meer.
Es war nicht ganz einfach gewesen, Raquel an den Praia do Malhão zu bringen. Sie hatte partout nicht auf die Ladefläche des Pick-ups klettern wollen, weder über eine Treppe aus Strohballen noch über eine improvisierte Holzrampe, ja, nicht einmal, nachdem Fernando eine Spur aus Karamellbonbons gelegt hatte. Vielleicht misstraute sie einfach dem angerosteten Metall der Ladefläche, Angst vor dem Auto hatte sie offenbar nicht. Denn als er schließlich eine der Seitentüren geöffnet hatte, war sie ohne Zögern eingestiegen, hatte ihre hundertfünfzig Kilogramm auf die Rückbank gehievt, die feuchte Nase an die Fensterscheibe gedrückt und während der Fahrt so entspannt gepupst, dass der Inspektor trotz der kühlen Außentemperaturen beide Fenster runterkurbeln musste.
Aber als Fernando Valente jetzt zum Strand zurückblickte, stellte er nicht ohne Stolz fest, dass sie sich geradezu vorbildlich benahm. Auch wenn er nicht sicher war, ob sie sein Kommando, auf ihn zu warten, verstanden hatte oder einfach müde von der Aufregung der letzten Tage war. Vielleicht ging es ihr aber auch so wie ihm, und sie fand den Strand so schön, dass sie ganz still davon wurde. Der Praia do Malhão, der der Steilküste einige Kilometer nördlich von Vila de Milfontes ein Stück Land abgerungen hatte, war genauso, wie ein Strand sein sollte – besonders an Tagen wie diesem, an denen am nördlichen Horizont noch ein Dunstschleier vor den hässlichen Industrieanlagen der Küstenstadt Sines hing.
Heller Sand, schwarze Felsen, die in der Sonne silbrig glänzten, gewaltige Wellen. Keine Häuser, keine Straße, der benachbarte Campingplatz war fast leer, und Badegästen war es jetzt sowieso zu kalt. Nur gelegentlich ein paar andere Surfer, die aus ganz Europa mit ihren alten bunten Bussen anreisten. Und natürlich Anabela, die hier fast jedes Wochenende mit den Hunden die Küste entlangwanderte. Manchmal fand er nur noch ihre Fußspuren im Sand, die immer so aussahen, als würde sie mehr auf den Zehenspitzen tänzeln statt laufen, begleitet von vier großen und vier sehr großen Hundepfoten. Manchmal waren sie auch zur selben Zeit da. Was das Glück, am Praia do Malhão zu sein, komplett machte.
Rund um den Inspektor glitzerte der Atlantik. Er lag auf seinem Surfbrett und schaukelte eine Weile mit den Wellen, rauf auf den Wellenkamm und wieder runter ins Tal. Wie die meisten Jungs an der Küste hatte er schon auf dem Surfbrett gestanden, bevor er richtig schwimmen konnte. Mehr als dreißig Jahre Training also, allerdings mit eher mäßigem Erfolg. Schon zwei Surflehrer hatten ihm angesichts seines unterentwickelten Gleichgewichtssinns, seiner Orientierungslosigkeit unter Wasser und der Häufigkeit, mit der er beim Auftauchen das Brett vor den Kopf bekam, dazu geraten, sich vielleicht einfach ein anderes Hobby zu suchen. Fernando Valente, der keineswegs zu den Männern gehörte, die am liebsten in der Kurve zum Überholmanöver ansetzen oder sich für einen Strandgalopp anmelden, obwohl sie noch nie auf einem Pferd gesessen haben, sah ein, dass dieser Vorschlag vernünftig war. Doch auch er hatte das Adrenalin gespürt, die Schwerelosigkeit, die durch die Adern rauscht, wenn man mit der Welle auf die Küste zuschießt.
Und so konnte er auch diesmal nicht anders, als sein Brett Richtung Strand zu drehen, als er eine Welle anrollen sah, die versprach, zu einem großen Brecher zu werden. Genauer gesagt, zu einem großen Brecher nach seinen Maßstäben. Ein Schulterblick: Drei Meter entfernt kam die dunkelblaue Wand. Er paddelte los, registrierte dabei noch kurz, dass sich seine Gelenke zehn Jahre jünger als am Tag zuvor anfühlten. Offenbar war es ein »Angst-vor-dem-Schlachttag-Rheuma« gewesen, das rein gar nichts mit dem nasskalten Wetter der letzten Wochen zu tun hatte.
Dann war sie auch schon da, die Welle, hob sein Brett an wie ein Stückchen Treibholz. Abstützen, Füße hoch, aufstehen. Er wackelte, kämpfte mit der Balance, fing sich. Jauchzte eine Sekunde über den Ozean. Doch dann bockte die Welle unter seinem rechten Fußgelenk, drehte das Brett nach vorne, kippte es über die Spitze und katapultierte den Inspektor mit einem Bauchplatscher in die Fluten. Anfängerfehler, dachte er, dann drückten ihn die Wassermassen nach unten, im Schleudergang. Er spürte den Meeresboden an der Schulter, zum Glück ohne Steine, dann Richtungswechsel, dahin, wo Licht war. Auftauchen, nach Luft schnappen, die Hände noch am Kopf, aber er hatte Glück. Das Surfbrett hatte ausnahmsweise mal nicht Kurs auf seine Nase genommen.
Er ließ sich zurück an den Strand spülen, aufgekratzt und keinen Wassertropfen näher zu seinem Traum, einmal die ganz großen Wellen zu reiten, durch die Röhre zu fliegen. Manchmal wunderte er sich selbst, wie er so viel Spaß an etwas haben konnte, das ihm ständig unter die Nase rieb, wie schlecht er war.
Er setzte sich neben Raquel, die die mitgebrachten Eicheln vertilgt hatte und nun wie die Möwen mit halb geschlossenen Augen in der Sonne duselte. Noch im Halbschlaf wandte sie ihm ihr Gesicht zu und schnüffelte am nassen Neoprenanzug.
»Tut mir leid«, sagte Fernando, »keine Taschen, keine Eicheln, keine Karamellbonbons.«
Zum Ausgleich kraulte er ihren Rüssel. Unglaubliche drei Milliarden Riechzellen steckten in einer Schweinenase, ungefähr tausendmal so viel wie beim Menschen. Das war das erfreuliche Ergebnis seiner nächtlichen Recherche am Laptop gewesen. Polizeischweinestaffeln in Amerika oder in sonst einem Land hatte er wie erwartet nicht aufspüren können, eine Fernsehdokumentation darüber natürlich ebenso wenig.
Seltsam eigentlich, dachte der Inspektor, mit so einer Schweinenase ließe sich doch ganz schön viel erschnüffeln. »Raquel, jetzt fängt das Training an«, entschied er und kramte einen Socken aus der Tasche. Vielleicht zu klein für den Anfang. Socke zurück, Hemd raus und dem Schwein vor die Nase. »Pass auf, du riechst jetzt daran. Ja, so, gutes Mädchen. Dann verbuddle ich es im Sand, und du buddelst es wieder aus. Okay, fertig? Gut, schön hiiierbleiben!« Er zog das Kommando in die Länge, wie er es manchmal bei Hundebesitzern gehört hatte. Dann stand er auf und ging Richtung Meer.
Raquel blieb tatsächlich da, wo sie bleiben sollte. Und obwohl man das vermutlich vor allem damit erklären konnte, dass sie einfach gerne faul in der Sonne lag, war es ein guter Anfang, befand Fernando Valente. Er ging noch ein paar Meter weiter und vergrub das Hemd im Sand. Zur Ablenkung kehrte er im Zickzackkurs zurück.
Er klatschte animierend in die Hände. »Wo ist das Hemd? Such! Suuuch!« Die Sau setzte sich in Bewegung, aber in die falsche Richtung. Sie umkreiste den Inspektor einmal, dann warf sie sich gegen seine Beine – mit einer Grazie, die den weniger schweinekundigen Beobachter sicher überrascht hätte, trotzdem ging der Inspektor zu Boden.
»Möchtest du sagen, dass du lieber ein Kampf- als ein Suchschwein werden willst?« Raquel rollte sich auf die Seite und quiekte melodisch. Ihre Art, um körperliche Zuwendung zu bitten. »Später. Jetzt suchen wir erst einmal. Komm, altes Mädchen, such das Hemd.«
Fernando stand auf und ging ein wenig hin und her. Der Strand sah plötzlich seltsam unberührt aus, als wäre dort nie ein Hemd vergraben worden. War er eben direkt Richtung Meer oder ein wenig nach links gelaufen? Die aufkeimende Sorge, gerade ein Hemd verloren zu haben, wurde von einem anderen Gedanken verdrängt. Was, wenn Raquel sich für den Polizeidienst als völlig untauglich erwies? Oder er völlig ungeeignet war, ein Schwein so auszubilden, dass es wenigstens den Anschein machte, es könnte der Polizei irgendwie nützlich sein?
Er ließ sich wieder neben Raquel in den Sand fallen. »Ich schätze, wir sollten jemanden fragen, der sich mit so was auskennt.«
Mathéo meldete sich schon nach dem ersten Klingeln. »Ha, gerade habe ich an dich gedacht – den Mann mit den unwiderstehlichen Wimpern. Bonjour, alter Freund.« Während ihm die Hitze ins Gesicht stieg, fasste sich Fernando unwillkürlich ans rechte Auge. Die Wimpern, tatsächlich lächerlich lang und dazu noch mädchenhaft gebogen, kitzelten seinen Zeigefinger. Seine Mutter, die sich außer der unwahrscheinlichen Rückkehr ihres Mannes kaum etwas so sehr wünschte wie Enkelkinder, hatte sich schon öfter bei ihm beschwert, dass Gott die Schönheitsattribute in ihrer Familie nicht gerade weise verteilt habe. Wären diese Wimpern nur beim richtigen Kind, nämlich bei Patricia, gewachsen, hätte diese schon längst einen Mann gefunden. Fernando dachte jedes Mal (und schämte sich im nächsten Moment dafür), dass selbst schöne Wimpern wohl niemanden über Patricias Biestigkeit hinweggetäuscht hätten. Aber zumindest in einem Punkt hatte seine Mutter recht. Bei Männern schienen seine Wimpern wirklich gut anzukommen, während sie ihm bei den Frauen kaum Glück gebracht hatten. Von Lúcia einmal abgesehen, aber das war ein Thema, mit dem er sich lieber nicht beschäftigte.
»Und jetzt tu dir bloß nicht leid, mein lieber Fernando«, fuhr Mathéo fort. »Es liegt nicht an deinen sexy Wimpern, dass dir die Damen nicht zu Füßen liegen.«
»Sondern?«
»An deiner Schüchternheit. Ich kann ja durch den Hörer sehen, wie du rot wirst. Wo wir beim Thema sind: Gibt es Neuigkeiten von der schönen …? Wie hieß sie gleich?«
»Raquel. Sie heißt Raquel, ist ein schwarzes Alentejo-Schwein, und ich sitze gerade mit ihr am Strand.«
Am anderen Ende der Leitung war es kurz still, dann klang Mathéos leises raues Lachen durch den Hörer. »Wie du meinst, dann fangen wir eben noch mal von vorne an. Bonjour, Fernando.«
»Bonjour, Mathéo. Wie läuft die Suche?«
»Gar nicht. Ich liege im Bett.«
»Im Dezember?«
»Sogar an einem sonnigen Sonntagmorgen im Dezember.«
»Die Grippe oder die Liebe?«
»Weder noch. Eine kleine Form von Manie vielleicht, nach unserem unglaublichen Fund vom Donnerstag. Es ist erst Dezember, und ich habe in dieser Saison schon mehr Geld verdient als sonst im März.«
»Echte Mélanos?«
»Echte und viele. So viele, dass ich allmählich fast glaube, dass mein Urgroßvater die Trüffel noch mit der Schubkarre aus dem Wald geholt hat. Hatte ich bislang immer für eine Familienlegende gehalten.«
»Und gestern war Markt in Richerenches.«
»Du sagst es. Mit Japanern. Die zahlen am besten.«
»Clara macht also immer noch einen guten Job.«
»Clara macht einen sehr guten Job, und zwar als Schinken auf meinem Frühstücksbrötchen. Ich bilde mir ein, dass er Trüffelaroma hat.«
»Um Himmels willen, du hast Clara geschlachtet?«
»Natürlich nicht. Ich bin doch kein Barbar. Der Metzger im Ort hat sie geschlachtet. Ich esse sie nur.«
»Mathéo!«
»Die Zeiten der Trüffelschweine sind vorbei. In Italien sind sie sogar verboten, weil sie den Boden so kaputt wühlen. Von da hab ich mir auch zwei Hunde geholt, Lagotto Romagnolos. Tolle Tiere. Sie haben vielleicht keine so gute Nase wie Clara und sind auch lange nicht so schlau, aber dafür versuchen sie auch nicht ständig, mir die Beute wegzufressen. Und machen auch kein Nickerchen mitten am Tag, wenn sie keine Lust mehr haben.« Eine Pause, ein Seufzer. »Aber sie fehlt mir schon.«
»Ich hatte gehofft, du könntest mir helfen.«
»Wobei?«
»Bei Raquels Ausbildung. Die ist nämlich nicht nur meine neue Herzensdame, sondern soll auch noch Polizeischwein werden. Und ob sie jetzt Verbrecher oder Trüffel finden soll – so viele Unterschiede kann es da doch nicht geben, dachte ich.«
»Das eben war also kein Witz? Und du sitzt wirklich mit einem Schwein am Strand?«
»War ich schon mal gut im Witzemachen?«
»Polizeischwein?«
»Ich konnte sie nicht schlachten.«
Mathéo begann wieder zu lachen. Es war ein Glucksen in höherer Tonlage, das dem Inspektor sehr bekannt vorkam. Von den zehn Sommern, in denen sich Mathéo an Portugals rauer, naturbelassener Westküste von der Trüffelsaison erholt hatte, wusste Fernando, dass dem Franzosen gerade die Tränen runterliefen. Er wusste auch, dass man solch einem Anfall am besten mit Langmut begegnete, und so tauchte er seinen Finger in den feuchten, kühlen Sand und malte kleine und große Kreise auf Raquels schwarzen Bauch.
Kurz darauf beendete er das Gespräch recht abrupt mit dem Satz: »Mathéo, ich muss schnell weiter, ich melde mich die Tage noch einmal.« Das lag keinesfalls daran, dass er dem Trüffelsucher seinen Lachanfall übel genommen hätte, es lag allerdings auch nicht daran, dass er wirklich weitermusste. Im Gegenteil, nahezu nichts hätte ihn in diesem Moment dazu bringen können, sich vom Fleck zu bewegen. Denn den steuerte gerade Anabela Lobo an.
Eine bunte Bommelmütze wippte auf ihrem Kopf, und ihr rundes Gesicht, von dem sich der Inspektor am liebsten ein Bild in sein Zimmer gehängt hätte, rahmte braunes, vom Wind verzotteltes Haar ein. Den leichten Rotstich im Haar und die vereinzelten Sommersprossen auf der Nase verdankte sie ihrem Vater, einem rothaarigen Iren, der Anabelas ebenso schöne Mutter vor vielen Jahrzehnten auf die Insel entführt hatte. Was ihm einige alte Herren im Dorf bis heute übel nahmen.
Anabela war keine Frau, die viel Zeit vor dem Kleiderschrank oder dem Spiegel zu verschwenden schien. Selbst der Inspektor, in Modefragen eher unbedarft, sah, dass die orangefarbene Windjacke und die pinkfarbene Wickelhose keine allzu geglückte Kombination waren. Anabela trug weder Strümpfe noch Schuhe und hatte kleine, aber auffallend breite Füße und vom Sand polierte Fußnägel, die wie Muschelscherben schimmerten.
»Sie ist einfach so unkultiviert«, tuschelten die Frauen der Umgebung, laut genug, damit es auch die Männer hören konnten. Man echauffierte sich über ihre nackten Füße und ihre seltsamen Angewohnheiten wie die, alleine im Restaurant essen zu gehen, im Regen herumzuspazieren, und das ohne Regenschirm, oder sich zusammen mit den Hunden für ein Nickerchen auf einer Decke unter einem ihrer Feigenbäume einzurollen. Es waren diese Angewohnheiten, die ihren Mann dazu brachten, lieber monatelang durch die Welt zu tingeln (ob zur Arbeit oder zu seinem Vergnügen, war unklar), statt ihr endlich ein Baby zu machen. So lautete zumindest die Version der Klatschweiber.
Fernando wusste es besser. Es konnte nur einen Grund geben, dass der Kanadier offenbar lieber in der Ferne weilte als bei seiner Frau, nämlich, dass er ein ausgemachter Idiot war.
»Sind Sie jetzt auch unter die Surflehrer gegangen, Inspektor?«, fragte Anabela statt einer Begrüßung und deutete lachend auf Raquel, die es sich in der Zwischenzeit auf Fernandos Surfbrett bequem gemacht hatte. Freki, der milchschokoladenbraune Labrador, und Geysa, eine schlaksige Hirtenhundmischlingshündin, die die Größe eines Shetlandponys hatte, beobachteten das Schwein skeptisch aus einigen Metern Entfernung. Raquel störte sich nicht groß an den Hunden, oder sie war zu kurzsichtig, um sie überhaupt zu bemerken.
»Nicht Surflehrer, sondern Polizeischweinausbilder. Obwohl Surfen vielleicht ein guter Ausgleichssport wäre. Falls Schweine schwimmen können.«
»Sogar tauchen können sie. Ich weiß aber nicht, ob sie das auch gerne tun.« Anabela beugte sich zu Raquel hinunter und streichelte ihre Stirn. »So, du wirst also das erste Polizeischwein Portugals und machst ganz Sonega berühmt. Und wenn erst mal die ganzen Fernsehteams kommen …«
Der Inspektor stöhnte. »Es hat also schnell die Runde gemacht.«
»Zumindest wurden die Neuigkeiten schon gestern Abend im Restaurante O Golfinho als Vorspeise serviert.«
»Was bedeutet, dass es jetzt das ganze Dorf weiß.«
»Was bedeutet, dass es jetzt schon alle umliegenden Dörfer wissen.« Anabela senkte ihre Stimme zu einem verschwörerischen Flüstern: »Zu Hause habe ich gleich recherchiert, konnte aber weder etwas über amerikanische Polizeischweinestaffeln finden noch über den legendären Aufnahmetest der Polizeischweine. Nicht einmal die Fernsehdokumentation habe ich entdeckt, obwohl mir gestern drei Damen ganz glaubhaft davon erzählt haben.«
Fernando legte den Zeigefinger an die Lippen. »Bitte nicht weitersagen.«
»Ich schwöre.« Sie überlegte eine Weile. »Da ist es ja ausnahmsweise mal gut, dass kaum jemand im Ort Englisch spricht und die älteren Herrschaften auch kein Internet haben. Und wenn Raquel erst einmal erfolgreich Verbrecher jagt, schert sich sowieso keiner mehr darum, was die Amerikaner machen.«
»Wollen wir es hoffen.«
»Was kann sie denn schon?«
»Ball spielen, im Auto mitfahren und am Strand warten, während ich surfe. Und wir haben geübt, Sachen zu suchen. Hat aber nicht so gut geklappt.« Plötzlich wurde dem Inspektor klar, in was für einer misslichen Lage er steckte. Ihm wurde ein wenig flau in der Magengegend.
»Gut Ding will Weile haben. Polizeihunde werden schließlich auch nicht an einem Tag trainiert.« Anabela tätschelte Raquel noch einmal, dann pfiff sie ihre Hunde zu sich. »Wir müssen weiter, wir haben nämlich alle drei Frühstückshunger.« Im Weggehen drehte sie sich noch einmal um. »Kommen Sie doch mal auf einen Tee vorbei. Und bringen Sie Raquel mit. Ich wollte immer schon mal ein Schwein auf meinem Küchensofa sitzen haben.«
Fernando Valente blickte ihr nach, bis er sie nicht mehr sehen konnte. Eine Einladung. Allein dafür würde er sich gerne zum Gespött des Dorfes machen. Er saß noch eine Weile am Strand und hing seinen Tagträumen nach, bis sich ein paar Wolken vor die Sonne schoben und ihn daran erinnerten, dass es im Dezember im nassen Neoprenanzug recht kühl werden konnte.
»Komm, Raquel, jetzt müssen wir mein Hemd finden. Und dann brauche ich auch dringend Frühstück.«
Zu beidem kam der Inspektor an diesem Tag nicht mehr. Patricia rief an, und zwar nicht als seine wütende Zwillingsschwester, sondern als Kommissarin. »Eine Frau ist von den Klippen gestürzt.«
3
Fernando legte sich vorsorglich auf den Bauch, um die Leiche in Augenschein zu nehmen. Hätte ihn jemand nach dem Grund für die vielleicht etwas übertriebene Vorsicht gefragt, hätte er erklärt, dass die Klippen schließlich dafür bekannt seien, sich in den unpassendsten Momenten von ihren Felsbrocken zu trennen. Was auch stimmte. Die ganze Wahrheit war aber, dass er schon lange genug als Inspektor arbeitete, um zu wissen, dass ihm von tiefen Abgründen, toten Menschen und ganz besonders der Kombination aus beidem furchtbar schwindelig werden konnte. Doch es war sowieso niemand da, der ihn fragen konnte. Manuel Marques, den Kollegen von der Guarda Nacional Republicana, der als Erster vor Ort gewesen war, hatte er ins Krankenhaus zu seiner Frau geschickt. Und der schottische Tourist, der die Leiche entdeckt hatte, saß blass und stumm neben Raquel, in sicherer Entfernung zur Steilküste.
Der Inspektor, der wegen des verschwundenen Hemdes einfach seinen Surfanzug anbehalten hatte, robbte also zur Kante und schaute hinunter. Die Frau lag auf einem Felsvorsprung. Auf dem Bauch, das Gesicht nach unten. Die langen Haare klebten in dicken Strähnen am Felsen, durchnässt von der Gischt der Wellen und vermutlich auch vom Blut, das Fernando zwar nicht erkennen konnte, das nach einem Aufprall aus geschätzt vierzig Metern aber sicher reichlich geflossen war. Die Arme der Frau waren ausgebreitet, als ob sie bis zum letzten Moment versucht hätte wegzufliegen. Und hätte sie es geschafft, nur ein Stück weiter vorne oder rechts oder links zu landen, wäre sie nicht auf den Steinen zerschmettert, sondern ins Wasser gefallen. Was an ihrem Tod sehr wahrscheinlich auch nichts geändert hätte. Jedes Jahr fielen fünf bis zehn Fischer von den Klippen in den Atlantik und ertranken.
Fernando schloss die Augen, weil ihm nicht gefiel, was er sah, aber auch, um dem aufkommenden Schwindel Einhalt zu gebieten. Er spulte zurück. Sah, wie die Frau auf der Klippe stand, ausrutschte und fiel – oder war sie gesprungen? Sie öffnete die Arme, als wären es Schwingen. Eine Haarspange löste sich, die Haare flatterten im Wind, die weiten Mantelärmel füllten sich mit Luft. Und dann, kurz bevor sie auf die Steine krachte, fing der Wind sie auf, wie einen der vielen Störche, die in dieser Jahreszeit zurückkehrten, um an der Steilküste zu nisten, trug sie gen Himmel, übers Meer. Vielleicht wäre sie so bis zu den Azoren gesegelt, vielleicht auch in einer Kurve zurück aufs Festland geflogen.
Fernando unterbrach seinen Gedankengang und rief sich zur Ordnung. Schließlich war er Inspektor und kein Dichter, auch wenn er diesen Umstand gelegentlich bereute. Er öffnete die Augen und suchte die Felskante ab. Nichts deutete darauf hin, dass ein Steinbrocken abgebrochen war und die Anglerin mit in die Tiefe gerissen hätte.
»Das kommt davon, wenn Frauen fischen gehen«, unterbrach eine bekannte Stimme seine Überlegungen.
Fernando setzte sich auf.
Gabriel musste bereits eine Weile hier sein. Im Sand, neben dem schwarzen Rucksack, lagen Socken und Stiefel, denn er hatte schon seine roten Kletterschuhe angezogen. Er war bei der Feuerwehr und verdiente sein Geld damit, Felsen rauf- und runterzuklettern und Brände zu löschen. In seiner Freizeit sprang er gerne Fallschirm.
Jetzt inspizierte er die Angelausrüstung an der Felskante, die ein wenig verloren aussah.
»Vielleicht sollte man Klippenangeln einfach verbieten, wenn jetzt sogar Frauen damit anfangen«, fuhr er fort und trat den noch leeren Eimer um, der wohl für die Fische gedacht gewesen war.
»Wie viele Klippenopfer habt ihr denn dieses Jahr schon geborgen?«
»Vier. Und bei den Kollegen in der Algarve waren es sieben. Aber das hier ist die erste Frau.«
»Hast du überhaupt schon mal eine Frau beim Klippenangeln gesehen? Ich nicht.«
»Zum Glück nicht. Und du siehst ja, wozu das führt. Nicht mal waghalsige Klettertouren gemacht, nicht in der Brandung gestanden, keinen Monsterfang an der Angel gehabt. Und trotzdem abgestürzt.«
Sie schauten beide nach unten. Der Atlantik schäumte und gurgelte und eroberte Stück für Stück des Felsvorsprungs zurück. Ihnen blieb nicht viel Zeit, bevor die Flut die Tote ins Meer ziehen würde.
»Die anderen müssten auch bald hier sein«, beantwortete Gabriel die unausgesprochene Frage, dann tippte er Fernando mit dem Finger auf die Brust. »Es ist übrigens nicht nur die erste tote Klippenanglerin, es ist auch das erste Mal, dass gleich die Kriminalpolizei vor Ort ist.«
»Manuel Marques von der Guarda Nacional Republicana hat uns angefordert. Er meinte, man könne nicht ausschließen, dass sie runtergestoßen wurde.«
Gabriel schaute sich suchend um. »Wo steckt er überhaupt?«
»Auf dem Weg nach Beja. Seine Frau liegt im Krankenhaus in den Wehen. Vermutlich kam ihm auch deshalb alles so verdächtig vor.«
Gabriel lachte. »Und vermutlich ist es das erste Kind. Da weiß er noch nicht, dass das Bergen von Leichen ein Spaziergang ist, verglichen mit dem Herauspressen von Babys. Selbst wenn man gar nicht selber presst, sondern nur zuschaut.«
Fernando wusste, dass sein alter Schulkamerad dreifacher Vater war. »Bist du bei der Geburt deiner Kinder dabei gewesen?«
Gabriels Antwort ging im Lärm des Hubschraubers unter. Wenig später war der Rest der Bodentruppe da, und Gabriel und ein Kollege hingen in den Seilen. Nachdem er schon nach unten verschwunden war, tauchte Gabriel noch einmal auf. Er winkte den Inspektor heran.
»Was zum Teufel macht eigentlich das Schwein dahinten?«, schrie er gegen den Lärm an.
Fernando grinste und brüllte zurück: »Passt auf unseren Zeugen auf.«
Und wie sie das tat. Sie hatte es sich mit den Vorderbeinen und ihrem Kopf, also mit satten fünfzig Kilogramm, auf dem Schoß des Fremden gemütlich gemacht und war eingeschlafen. Der Schotte, ein großer, schlaksiger Typ mit breitem Mund und großen Ohren, hatte eine Hand auf Raquels Rücken gelegt, sein Gesicht der Sonne zugewandt und die Augen geschlossen. Um sie herum breiteten sich Mittagsblumen aus, kleine Sukkulenten, deren fleischige Blätter in Rot- und Grüntönen leuchteten und die zu dieser Jahreszeit die ersten weißen, gelben und violetten Blüten zeigten.
Fernando blätterte in Manuels Notizbuch. George Lindington, 38, wohnhaft in Aberdeen, vor einer Woche in Lissabon gelandet, hielt sich seit drei Tagen im Casa Vermelha auf, im »Roten Haus«, einem kleinen Bed & Breakfast in Porto Covo. Er war spazieren gegangen, hatte die Angelausrüstung gesehen und über die Klippen geschaut. Dabei hatte er die Frau entdeckt und kurz vor zehn die Polizei alarmiert. Das war schon wieder fast zwei Stunden her.
»Mr Lindington? Ich bin Inspektor Fernando Valente, Kriminalpolizei.« Er streckte ihm die Hand hin.
Mr Lindington schüttelte sie und sagte etwas, was Fernando Valente nicht verstand. Er war enttäuscht – und das nach all den Stunden, die er mit John Irving (weil seine Bücher das Leben erträglicher machten) und Alice Munro (weil er sich von ihren Geschichten einen Einblick in das Wesen der Frau erhoffte – dafür nahm er sogar in Kauf, dass er beim Lesen melancholisch wurde) in der Badewanne verbracht hatte. Sein Nicht-Verstehen stand ihm wohl ins Gesicht geschrieben, denn der Schotte setzte noch einmal an.
»Entschuldigen Sie, Inspektor, mein schottischer Akzent«, sagte Lindington jetzt so langsam, als würde er eine Sprachlern-CD für Anfänger einlesen. »Ich habe gesagt, dass ich gerne aufstehen würde, um Ihnen die Hand zu geben. Aber Ihr Schwein lässt mich nicht.«
»Komm, Raquel, komm hierher.«
Raquel drehte kurz die Nase in seine Richtung, zwinkerte ihm zu und ließ sich mit einem wohligen Seufzer zurückfallen.
Der Inspektor seufzte auch.
»Sie mag meine Ohrenmassage«, erklärte Lindington. »Ich habe früher als Masseur gearbeitet.«
»Und was machen Sie jetzt?«
»Yogalehrer.«
»Aha.«
»Sollten Sie auch mal probieren. Verbessert unter anderem die Balance und hilft gegen ganz vieles – von Schwermut bis zu schmerzhaften Gelenken.«
Der Inspektor kratzte sich am Kinn. Die Wendung, die dieses Gespräch nahm, gefiel ihm nicht. Entweder war George Lindington ein begnadeter Yogalehrer, oder er hatte nur zufällig richtig getippt. Vielleicht waren Fernandos Schwächen aber auch extrem offensichtlich.
George Lindington deutete auf die Klippen. »Hat sie da schon lange gelegen?«
»Wohl nicht, sonst wäre sie im Meer verschwunden. Wir hatten Glück, dass Sie sie gefunden haben. So viele Leute kommen hier ja nicht entlang.«
Der Zeuge schaute sich um. »Kein Haus, keine Straße und, bevor Sie alle aufgetaucht sind, keine Menschenseele. Nur ein Sandweg, Klippen, das Meer. Als ob zwischen Porto Covo und Vila Nova de Milfontes das Ende der Welt liegen würde.«
Ein denkbar schlechter Ort, um abzustürzen, dachte der Inspektor, aber fast perfekt, um jemanden ohne großes Aufsehen von den Klippen zu schubsen.
»Waren Sie schon öfters in Portugal? Kennen Sie hier jemanden?«
»Zweimal nein.«
Der Inspektor nahm sich vor, bei der Hausherrin im Casa Vermelha mal nachzufragen, wann der Schotte an diesem Morgen seine Herberge verlassen hatte. Aber sollte es überhaupt einen Täter geben, so hielt Fernando es doch für sehr unwahrscheinlich, dass es George Lindington war.
»Wie lange wollten Sie noch bleiben?«
»Zwei Wochen.«
»Gut. Vielleicht muss ich noch mal mit Ihnen sprechen. Und rufen Sie mich bitte an, wenn sich an Ihren Reiseplänen etwas ändern sollte.«