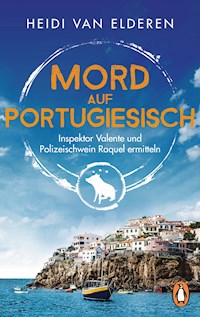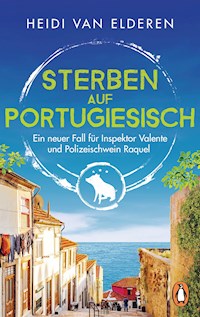
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die saustarke Krimireihe aus Portugal
- Sprache: Deutsch
Ein rätselhafter Mord an der portugiesischen Küste - Inspektor Valente und Polizeischwein Raquel ermitteln wieder - humorvoll und mit viel Herz!
Es ist Sommer an der portugiesischen Alentejo-Küste. Während sich die Touristen am Meer tummeln, haben Inspektor Valente und Polizeischwein Raquel keine Zeit sich auszuruhen. Ein Zauberkünstler wird tot am Strand aufgefunden – bis zur Brust im Sand begraben und mit Handschellen gefesselt. Ein missglückter Entfesselungstrick oder Mord? Als es kurz darauf einen weiteren Toten am Strand gibt, weiß Valente: Das kann kein Zufall sein. Was für ein Glück, dass Raquel dringend abspecken muss: Während er seinem Schwein das Schwimmen beibringt, ermittelt er intensiv am Tatort. Und ahnt nicht, dass er sich damit in tödliche Gefahr begibt ...
Polizeischwein Raquel hat immer den richtigen Riecher!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
HEIDI VAN ELDEREN, 1980 am Niederrhein geboren, ist Weltenbummlerin und freiberufliche Journalistin, hat ihren Lebensunterhalt aber auch schon als Apfelpflückerin und Aushilfsköchin verdient. Sie lebte in Nordschweden, dann vier Jahre lang im portugiesischen Alentejo, wo auch ihr zweiter Krimi Sterben auf Portugiesisch spielt. Heute wohnt die Autorin mit ihrem Mann und den zwei Töchtern in Neuseeland.
Außerdem von Heidi van Elderen lieferbar:
Mord auf Portugiesisch. Inspektor Valente und Polizeischwein Raquel ermitteln, Krimi.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
HEIDI VAN ELDEREN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeiftung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen..
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen von Penguin Books Limited und werden hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2020 by Penguin Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Umschlag: www.buerosued.de
Redaktion: Annika Krummacher
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-22845-3V001
www.penguin-verlag.de
1
Das Zusammenleben mit einem Schwein ist nicht immer einfach, macht aber froh. Und wenn nicht froh, dann zumindest weniger unglücklich. Was manchmal schon mehr ist, als man erwarten darf, dachte Inspektor Fernando Valente, während er mit einem Lächeln Raquel betrachtete.
Es war einer dieser verrückt heißen Augusttage im Alentejo. Fernando saß auf der mit Bambus überdachten Veranda seiner Lieblingsfrau, der wunderbaren Anabela Lobo. Ihm schräg gegenüber, in dem alten hellblauen Sessel, saß Anabelas Mann. Gary Watson. Fernando war ihm bislang nur einmal ganz flüchtig begegnet, das ganze vergangene Jahr hatte der kanadische Arzt im Jemen verbracht. Bis er ganz in der Nähe des Krankenhauses am Straßenrand in ein Loch gefallen war. Jetzt war er wieder da, das rechte Bein bis zur Hüfte eingegipst, den Arm in einer Schlinge und mit einer frischen roten Narbe an der linken Schläfe.
Anabela klapperte in der Küche mit dem Geschirr.
Fernando seufzte.
»So schlimm?«, fragte Gary.
Schlimmer, dachte Fernando, viel schlimmer. Und er fragte sich, wie lange es wohl dauern würde, bis Gary Watson wiederhergestellt und auf dem Weg in sein nächstes Einsatzgebiet war.
»Ein neuer Fall?«, vermutete der Kanadier.
»Die Hitze«, entgegnete Fernando und log dabei immerhin nur ein bisschen.
Gary schaute über seine Schulter zum großen Thermometer, das an der Hauswand hing. »Neununddreißig Grad im Schatten«, stellte er fest und klang dabei so, als ob auch er das viel zu heiß fände.
Netter Versuch, dachte Fernando, aber wenig überzeugend. Denn während ihm der Schweiß von der Stirn tropfte, obwohl er nur Shorts und T-Shirt trug, wirkten Gary und sein helles Leinenhemd, als wären sie frisch gewaschen in eine klimatisierte Lounge spaziert. Überhaupt sah Anabelas Mann mit seinen grauen, wachen Augen, den vielen Lachfältchen und den markanten Gesichtszügen trotz seiner Blessuren ärgerlich gut aus.
Besser gar nicht hinschauen, befand der Inspektor und wandte den Blick wieder seinem Schwein zu.
Raquel lag wenige Meter von der Veranda entfernt in einer schattigen Kuhle unter dem Feigenbaum. Vor gut zweieinhalb Jahren hatte Fernando sie als Ferkel adoptiert und mit der Flasche aufgezogen. Damals war sie so klein gewesen, dass sie in seine Jackentasche gepasst hatte. Inzwischen war sie mehr als ausgewachsen. Für alle, die das erste und einzige Polizeischwein Portugals nicht näher kannten, mochte sie aussehen wie ein ganz gewöhnliches, wenn auch auffällig fülliges Porco preto alentejano. Also wie eines der vielen schwarzen Schweine, die halbwild in den dünn besiedelten Korkeichenwäldern lebten, bis sie im Alter von etwa zwanzig Monaten geschlachtet wurden. Doch für Fernando war Raquel unvergleichlich liebenswert und schöner als alle anderen Schweine, auch wenn er selber nicht genau wusste warum. Vielleicht war es die Anmut, mit der sie ihre große Wampe durch die Welt schaukelte, vielleicht das haarige Doppelkinn, das ihre lange und schmale Nasenpartie besonders elegant wirken ließ, vielleicht die kleinen klugen Augen.
In diesem Moment konnte der Inspektor allerdings weder Raquels Rüssel noch ihre Augen sehen: Sie steckte bis zu den Ohren in einer riesigen Wassermelone. Abwechselnd schmatzte und grunzte die Sau, in ihrer ganz eigenen Fressmelodie, die sie immer dann anstimmte, wenn es ihr schmeckte und sie sich besonders wohlfühlte.
»Hoffentlich ist es nicht zu heiß fürs Polizeischweine-Training?«, nahm Gary die Unterhaltung wieder auf. »Während meine Knochen wieder zusammenwachsen, will ich mir das nämlich unbedingt einmal anschauen.«
Auch das noch, dachte Fernando. Laut sagte er: »Es ist nicht besonders spektakulär.«
»Anabela hat mir erzählt, dass Raquel ausgesprochen klug ist.«
»Klug und trainingsresistent«, erwiderte Fernando und stellte dann endlich die Frage, die in seinem Kopf herumspukte: »Wie lange bleibst du?«
»Diesmal vielleicht für immer. Die Lust auf Auslandseinsätze ist mir gründlich vergangen«, antwortete der Arzt leichthin.
Ein übel gelauntes Stachelschwein zog in Fernandos Magen ein. Er nickte, stand auf, sagte: »Ich schau mal, ob Anabela Hilfe braucht«, und ging ins Haus.
In der bunten Wohnküche war es schummrig. Fernando nahm seine Sonnenbrille ab und legte sie auf den großen Esstisch, neben das Durcheinander aus Papieren, Büchern und Kisten mit Tomatensetzlingen. In der Mitte des Tisches erspähte Fernando einen Apfelkuchen, der noch ein bisschen dampfte. Seine nackten Zehen berührten etwas Warmes, Flauschiges. Er sah hin und entdeckte Anabelas Hunde, Freki und Geysa, die unter dem Tisch auf der Seite lagen, alle viere von sich gestreckt, so als versuchten sie, möglichst viel Körperfläche auf die einigermaßen kühlen Fliesen zu bringen. Normalerweise wären sie aufgesprungen, um sich streicheln zu lassen. Aber an diesem Tag waren sie so lethargisch, dass sie nur müde mit ihren Schwänzen wedelten.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes stand Anabela mit dem Rücken zu ihm an der Spüle. Durch das kleine quadratische Fenster, das Anabela ein wenig schief in die Lehmwand des ehemaligen Eselstalls eingebaut hatte, fiel Sonnenlicht auf ihre rotbraunen Haare. Bis auf den alten Ofen hatte sie fast alles in der Küche selbst gebaut. Die Küchenschränke waren eine gewagte Kombination aus Holz, Lehm und alten Apfelkisten, ihr Inhalt wurde von umfunktionierten Duschvorhängen verborgen. Schon oft hatte Fernando sich gewundert, wie etwas so Provisorisches so gemütlich aussehen konnte.
Er räusperte sich, doch Anabela blickte nicht einmal auf, sondern polierte ein Glas so intensiv mit dem Küchenhandtuch, dass jemand, der sie weniger gut kannte, auf die Idee hätte kommen können, dass sie zu den Frauen gehörte, die sich um Wasserflecken auf dem Geschirr scherten. Fernando trat zu ihr, nahm ihr das Glas aus der Hand und stellte es zu den zwei anderen auf ein Holztablett.
»Ich dachte, er würde erst nächste Woche kommen«, murmelte sie leise, obwohl Gary ihnen ohnehin nicht folgen konnte, wenn sie so schnell Portugiesisch sprachen. Der Kanadier hatte die Sprache seiner neuen Wahlheimat bislang nicht gelernt, vermutlich auch deswegen, weil er kaum zu Hause war.
Fernando duckte sich unter einigen Sträußen mit Basilikum und wildem Oregano hindurch, die an einer Leine zum Trocknen hingen. Dann öffnete er den Kühlschrank, nahm einen Krug mit Wasser, Zitronenscheiben und frischen Minzblättern heraus und stellte ihn zu den Gläsern. »Er will bei Raquels Training zuschauen«, sagte er und fand selbst, dass er vorwurfsvoll und weinerlich klang, fast so schlimm wie seine Mutter. Aber vielleicht konnte man gar nicht anders sprechen, wenn es in der Magengegend so pikste.
»Was soll ich denn machen, Fernando?«
Es ihm sagen, dachte er, sprach es aber nicht aus. Er wusste ja selbst, dass das nicht ging. Sie konnte es ihm nicht sagen, nicht, nachdem er gerade fast von der Erde verschluckt worden war. Und später vermutlich auch nicht, wenn sie ihre Ehe retten wollte.
Er trat an die Spüle und schaute aus dem Fenster in den Gemüsegarten. Hinter dem Maschendrahtzaun, der die Ernte vor Wildschweinen schützen sollte, wucherten grüne Wasser- und gelbe Honigmelonen. Über einige Tomatenpflanzen hatte Anabela einen großen Schirm aufgespannt. Die Früchte, die nicht in seinem Schatten hingen, waren in der Sonne aufgeplatzt. Fernandos Blick folgte dem geschwungenen Pfad, der am Gemüsegarten entlang verlief, bis er schließlich zwischen den Dornen einer struppigen Hecke verschwand. Das dichte Grün versperrte die Aussicht auf die Senke am Ende von Anabelas riesigem Grundstück. Aber Fernando hatte dort in der Wirklichkeit und in seinen Tagträumen so viel Zeit verbracht, dass er die schattige Enklave in Gedanken vor sich sah. Die Birnen- und Pflaumenbäume, den Hibiskus und den kleinen Bachlauf, der selbst im August noch ein wenig Wasser führte. Und die große Korkeiche. Unter ihrer dunkelgrünen Krone, auf einem hängenden Bett aus hellblauen Holzpaletten, hatten Anabela und er vor einigen Monaten einen Nachmittag verbracht. Hinterher hatte sie ein schlechtes Gewissen gehabt, aus der Schaumstoffmatratze Hundebetten gemacht und die Paletten in einem Schuppen für Gartengeräte verbaut.
Eine Weile waren Fernando und Anabela sich aus dem Weg gegangen, aber seit Raquel vor einigen Wochen auch offiziell zum Polizeischwein ernannt worden war, hatten sie sich wieder öfter getroffen. Um mit Raquel zu trainieren, auch wenn »spielen« es vielleicht besser traf. Und um zusammen auf der Veranda zu sitzen und zuzuschauen, wie die Wiese unter der Sommersonne immer gelber und lichter wurde, bis von ihr schließlich nur noch einige dünne ockerfarbene Halme auf rissigem Grund übrig waren.
Anabelas überraschend kühle Hand legte sich auf seinen Oberarm. Er drehte sich um und sah sie an. Nach so vielen Monaten unter wolkenlosem Himmel war ihr Gesicht von Hunderten entzückender Sommersprossen bedeckt – ein Andenken an ihren irischen Vater, der Anabelas schöne Mutter einst dazu gebracht hatte, ihr Heimatdorf Sonega zu verlassen. Sie zwirbelte an einer Haarsträhne, die sich aus ihrem Knoten am Hinterkopf gelöst hatte – wie immer, wenn sie nicht so recht wusste, was zu sagen oder zu tun war.
»Ich schätze, wir sollten wieder nach draußen gehen«, sagte er, obwohl er sie viel lieber geküsst hätte. Er unterdrückte ein Seufzen, nahm das volle Tablett von der Anrichte und ging hinaus, Anabela folgte mit dem Apfelkuchen. Gary wartete mit entspanntem Lächeln. Raquel schluckte das letzte Stück Melone hinunter und rülpste.
»Honey, du weißt gar nicht, wie sehr ich mich in den letzten Wochen auf deinen Kuchen gefreut habe«, sagte Gary nach dem ersten Bissen. Der zweite fiel ihm auf dem Weg in den Mund von der Gabel. Anabela wollte aufstehen, aber Gary stoppte sie. »Lass mal, so hat die Schweinedame auch was davon.« Er rief nach Raquel.
»Sie ist auf Diät«, wandte Fernando ein.
Raquel erhob sich träge von ihrem Schattenplatz, stapfte mit schaukelndem Gang die Stufen der Veranda hinauf und ging auf Gary zu. Er begann zu lachen. »Im Liegen habe ich ja gar nicht gesehen, wie dick sie ist. Aber egal, auf das eine Stückchen Kuchen kommt es ja dann auch nicht mehr an.« Er deutete auf das Kuchenstück am Boden. »Hier, für dich.«
Raquel, die normalerweise keinen Leckerbissen ausschlug, bewegte ihren Rüssel nicht mal in die Richtung des Kuchens. Stattdessen setzte sie sich auf ihr Hinterteil, legte den Kopf ein wenig schief und schaute Gary an.
»Du möchtest wohl lieber gekrault werden, was?« Gary streckte die Hand aus, aber Raquel wich ihr aus. Fernando war mit einem Mal sehr stolz auf sein Schwein.
»Vermutlich ist ihr dein Gips unheimlich«, sagte Anabela.
»Vermutlich mag sie es einfach nicht, wenn man sie auslacht und dick nennt«, sagte Fernando.
Raquel erhob sich, drehte sich auf den Hinterfüßen um und verschwand um die Hausecke. Fernando vermutete, dass sie sich unter dem Schatten der Obstbäume ein neues Schlafplätzchen suchen würde.
»Jetzt sah sie wirklich ein bisschen beleidigt aus«, meinte Gary.
»Würde mich nicht wundern«, sagte Fernando und starrte auf die Gabel in seiner Hand, die wenige Zentimeter über dem unberührten Stück Apfelkuchen schwebte. Das stachlige Ding in seinem Bauch hatte sich so breitgemacht, dass kein einziger Krümel daneben Platz gefunden hätte.
Noch während er über eine Ausrede nachdachte, mit der er das Feld räumen könnte, klingelte sein Telefon.
»Hallo, Patricia!« Er begrüßte seine Zwillingsschwester, die gleichzeitig seine Vorgesetzte war, ein wenig enthusiastischer als sonst. Ihr Verhältnis war nicht immer ganz einfach, aber heute hatte sie ein perfektes Timing.
»Wo bist du gerade?« Sie sprach über die Freisprechanlage, im Hintergrund hörte er Motorengeräusche.
»In Sonega, bei Anabela.«
»Perfekt, dann kannst du in fünfzehn Minuten am Fundort sein. Praia da Samoqueira, Südende, in der kleinen Bucht hinter dem Tunnel. Die Kollegen von der Guarda Nacional Republicana und die Spurensicherung sind schon dort, ich komme in einigen Stunden nach.«
»Was ist passiert?«
»Ein Muschelsammler hat am Strand einen Kopf gefunden.«
Patricia fuhr offenbar in ein Funkloch, jedenfalls brach die Verbindung ab.
»Igitt«, entfuhr es Fernando. Er stand auf. »Ich muss leider weg. Was Dienstliches.«
Auf dem Weg zum Auto rief er nach Raquel, doch sie kam nicht. Er griff nach der Tasche, die unter dem Beifahrersitz lag, und zog eine Jeans und ein Hemd heraus. Seit er bei seinem letzten Fall einmal mit Surfanzug am Tatort erschienen und dann auch noch von einer Reporterin fotografiert worden war, hatte er immer Wechselkleidung im Wagen, für alle Fälle.
Anabelas Häuschen lag an einem kaum genutzten Feldweg und so weit von den Nachbarhöfen entfernt, dass er sich problemlos in der Einfahrt hätte umziehen können. Doch weil er in Eile war, zog er die Jeans kurzerhand über seine Shorts. Er hörte, wie Anabela hinter dem Haus nach Raquel rief. Offenbar hatte sie beschlossen, ihm bei der Suche zu helfen. Ihre Stimme näherte sich, dann tauchte Anabela hinter den üppigen Oleanderbüschen auf.
»Keine Spur von Raquel. Dabei ist sie doch gar nicht der Typ Schwein, der einfach abhaut.«
Fernando schaute auf die Uhr. Seit Patricias Anruf waren schon knapp zehn Minuten vergangen.
»Ich muss wirklich los.« Es gefiel ihm gar nicht, ohne Raquel aufbrechen zu müssen. Nicht dass sie so ein talentiertes Polizeischwein gewesen wäre (das war sie entgegen zahlreicher Presseberichte nämlich gar nicht), doch die schrecklichen Sachen, die ihm in seinem Beruf zwangsläufig begegneten, ließen sich in Raquels Gesellschaft besser ertragen. Und dass auf einem der schönsten Strände der Region ein Kopf lag, war eine besonders schreckliche Sache.
»Ich schreibe dir eine Nachricht, sobald sie wiederauftaucht. Vermutlich versteckt sie sich einfach irgendwo im Schatten«, sagte Anabela.
Also fuhr der Inspektor allein und mit dem sicheren Gefühl, dass dieser Tag nichts Gutes mehr bringen würde, zum zehn Kilometer entfernten Strand zwischen Porto Covo und Sines.
2
Der Praia da Samoqueira trug sein Sommergewand. Bonbonfarbene Sonnenschirme leuchteten im gleißenden Licht, auf dem hellgelben Sand verwoben sich wild gemusterte Handtücher zu einem riesigen Patchworkkleid, geschmückt mit blauen Kühltaschen, rosa und roten Plastikschaufeln, Bällen, glitzernden Bikinioberteilen und Sonnenhüten. So voll war es hier nur im August, wenn man es wegen der Hitze am ehesten am Wasser aushielt. In dieser Zeit hatte fast ganz Portugal Ferien und fuhr an die Küsten.
Während der Inspektor vom Parkplatz über eine Holztreppe hinunter in die Bucht stieg, schaute er aufs Meer. Es schien, als hätte die Hitze selbst den sonst so wilden Atlantik träge werden lassen. Nur gelegentlich schwappten kleine Wellen gegen die riesigen Kalksteinfelsen, die auf dem Teil des Strandes standen, der bei Ebbe zum Land und bei Flut zum Meer gehörte. In der Nachmittagssonne glänzten sie so, als hätte jemand sie mit einer dünnen Schicht Blattgold überzogen.
Am Fuß der Treppe stand ein Polizist. »Boa tarde, Inspektor«, begrüßte ihn der Kollege von der Guarda Nacional Republicana.
»Vielleicht hätten Sie besser am Südende des Strandes parken sollen. Die Treppe dort führt ja quasi direkt zum Fundort.«
»Ich weiß. Aber ich wollte mir noch einen Überblick verschaffen«, sagte Fernando. Das war allerdings nur die halbe Wahrheit. Die ganze war, dass er seine Begegnung mit dem Kopf so lange wie möglich hinauszögern wollte, auch wenn es sich höchstens um Minuten handeln konnte.
Er fragte sich, ob der junge Kollege schon in der Bucht gewesen war, und schaute ihm prüfend ins Gesicht. Doch statt der Augen seines Gegenübers sah er in der schwarzen Sonnenbrille nur sein eigenes leicht verschwommenes Spiegelbild. Obwohl an diesem Tag Windstille herrschte, waren seine kurzen Locken zerzaust. Die Ohren standen leicht ab, und da er seine eigene Sonnenbrille auf Anabelas Küchentisch vergessen hatte, musste er die Augen zusammenkneifen, um im grellen Licht überhaupt etwas sehen zu können.
»Waren Sie schon da?«, erkundigte er sich.
Der Kollege schüttelte den Kopf und sagte dann, als hätte er in Gedanken schon das Protokoll geschrieben: »Um 15.40 Uhr ist der Anruf in der Zentrale eingegangen. Wir sind um 16.00 Uhr angekommen, eine halbe Stunde später war auch die Spurensicherung da. Wir haben den hinteren Teil des Strandes abgesperrt. Bruno befragt gerade die Strandbesucher, ob jemandem etwas aufgefallen ist.« Er deutete auf einen weiteren Polizisten, der rund hundert Meter von ihnen entfernt im Sand stand und sich mit einem Pärchen unterhielt.
»Was erzählt er ihnen denn?«
»Dass wir eine Leiche gefunden haben. Ihre Schwester hat uns die Anweisung gegeben, es erst einmal so vage zu halten. Aber vermutlich ist ohnehin schon etwas durchgesickert. Sie wissen ja, wie das ist.«
Fernando sah sich um. Der Ausdruck schauriger Erregung, den er einigen Gesichtern ablesen konnte, bestätigte die Vermutung des Kollegen. Und noch etwas anderes fiel ihm auf: Außer einem braun-weiß gefleckten Hund planschte niemand mehr im Atlantik. Zwei Kinder schnappten sich ihre Eimerchen und machten sich auf den Weg zum Wasser, wurden aber von ihren Müttern sofort mit schrillen Stimmen zurückgerufen. Ganz so, als lauere das Böse im Meer.
Fernando ließ den Kollegen stehen und schlängelte sich an den Menschenmassen vorbei. Auf dem freien Sandstreifen, der noch dunkel und hart von der letzten Flut war, lief er Richtung Süden und erreichte wenig später die schöne Bucht, die nur bei Ebbe begehbar war.
Artur Alvas von der Spurensicherung kreuzte seinen Weg. An diesem Tag trug er keinen Schutzanzug, sondern nur lange weiße Handschuhe. Er hob eine Hand zum wortlosen Gruß, bevor er sagte: »Ich organisiere schnell ein paar Schaufeln und Verstärkung.« Ohne eine weitere Erklärung drehte er ab und stieg die steile Steintreppe hinauf.
Fernando wandte sich nach rechts dem Tunnel zu, den das Meer einst in den Felsen gegraben hatte und durch den man zu zwei weiteren kleinen Buchten gelangte, die nur bei Ebbe besucht werden konnten. Es war wirklich purer Zufall gewesen, dass ein Muschelsammler den Kopf gefunden hatte.
Er stieg über das Absperrband der Polizei und betrat kurz darauf das einige Meter lange Gewölbe, in dem er gerade noch stehen konnte. Es war überraschend kühl und dunkel. Wasser tropfte von den Felsen, der Sand unter seinen Füßen knirschte. Bald darauf stand er wieder unter sattblauem Himmel in der ersten kleinen Bucht. Links von ihr führte ein kurzer, schmaler Pfad, der seitlich von hohen Kalksteinwänden begrenzt wurde, aber oben offen war, in die zweite Bucht, bestehend aus einem winzigen halbmondförmigen Sandstrand, der sich dicht an die Steilklippen schmiegte. Und dort lag oder, besser gesagt, stand der Kopf.
Fernando sah ihn zuerst von hinten. Ein schwarzer, kurzer Pferdeschwanz, Blickrichtung zum Meer. Der Hals, falls überhaupt noch vorhanden, steckte im Sand. Fernando ging an den Felsen entlang um den Kopf herum, hockte sich hin und blickte in das Gesicht eines jungen Mannes, das nicht allzu lange im Wasser gelegen haben konnte, weil es kaum entstellt war. Die Augen waren geschlossen, das Kinn ruhte auf dem Sand. Der Teint war auffallend frisch, wie bei jemandem, der gerade gerannt ist. Sonnenbrand, dachte Fernando, doch als er näher ging, sah er, dass es Akne war, die die Wangen rot gefärbt hatte.
Er zog ein Paar Latexhandschuhe aus der Hosentasche und streifte sie über. Gegen die aufsteigende Übelkeit atmete er ein paarmal tief ein und aus, dann umfasste er den Kopf hinten und am Unterkiefer und hob ihn ein Stückchen an. Das heißt, er wollte ihn anheben, aber er steckte fest. Deshalb also die Schaufeln. Fernando kniete sich auf den Boden, strich Sandkörner zur Seite und legte so nach und nach einen muskulösen Nacken frei, bis ihn eine wohlbekannte Stimme unterbrach.
»Wie viel Zeit bleibt uns noch?«
Fernando überlegte nur kurz. Er surfte zwar längst nicht so oft und so gut, wie es ihm lieb gewesen wäre, aber den Gezeitenkalender kannte er nahezu auswendig. »In spätestens zwei Stunden bekommen wir nasse Füße, und gegen zwanzig Uhr steht hier alles unter Wasser.« Er stand auf und drehte sich zu Dr. José Rosa um.
Der Rechtsmediziner trug eine graue Jogginghose, ein Polohemd und einen großen Rucksack, als hätte er gerade zu einer Wanderung aufbrechen wollen. »Schön, Sie zu sehen, Inspektor«, sagte er, weil er ihn bei fast jeder Begegnung so begrüßte und es auch so meinte, ganz gleich, ob sie sich an einem Leichenfundort, bei einer Obduktion oder zum Essen trafen. Rosa umrundete den Kopf zweimal, dann ging er vor ihm in die Hocke, zog Handschuhe über und öffnete dem Toten behutsam die Lippen. Kleine Bläschen quollen heraus.
Kurz darauf kehrte Artur Alvas mit einem Kollegen, einer Trage und vier Spaten zurück.
»Wäre es nicht sinnvoller, die Feuerwehr zu holen?«, fragte Rosa.
»Die sind alle in Beja und versuchen, Waldbrände zu löschen«, erklärte Artur. »Ihr Rucksack tropft übrigens, Dr. Rosa.«
»Richtig, das habe ich ganz vergessen.« Der Rechtsmediziner stellte den Rucksack auf den Boden und zog einen tropfnassen Kühlakku und einige Flaschen Wasser und Cola hervor. »Habe ich mitgebracht, weil wir bei der Hitze etwas Kühles trinken sollten.« Als Fernando ihn erstaunt ansah, lachte Dr. Rosa leise. »Ja, Inspektor, Sie haben recht. Natürlich würde ich nie an so etwas denken, aber deshalb bin ich ja verheiratet. Also unter anderem deshalb.« Er wühlte wieder im Rucksack und hielt kurz darauf einen Apfel hoch. »Ich habe immerhin einen Apfel für Raquel eingepackt. Wo ist sie überhaupt?«
»Hoffentlich in Anabelas Garten«, sagte Fernando, zog sein Handy aus der Tasche und las eine Nachricht von Anabela: Raquel ist noch nicht wieder aufgetaucht. Soll ich sie im Dorf suchen? Oder ist sie vielleicht zu euch nach Hause gelaufen?
Danke, aber das musst du nicht, tippte Fernando. Du musst dich ja schon um Gary kümmern. Dann löschte er den zweiten Satz wieder und schrieb stattdessen: Du hast eh schon genug zu tun. Ich schicke Pedro los.
Pedro war ein Junge aus dem Dorf, der Fernando überhaupt erst auf die Idee gebracht hatte, Raquel zum Polizeischwein zu befördern. Seitdem hatte der Junge unzählige Stunden mit Raquel Ball gespielt, ihren Rücken gebürstet und beim Training geholfen. Er würde sich mit Sicherheit auf die Suche nach Raquel machen. Vorausgesetzt, er war gerade im Dorf und nicht mit Fernandos altem Fahrrad ans Meer gefahren.
Fernando wählte die Festnetznummer der Quinta, in der er zusammen mit seiner Mutter, seiner Großmutter und seinem Schwein wohnte. Im nächsten Moment hatte er seine Mutter am Ohr.
»Sag mal, Mãe, ist Pedro bei euch?«, erkundigte er sich.
»Wie fast jeden Tag in den Sommerferien. Beinahe könnte man meinen, er hätte gar kein eigenes Zuhause mehr«, antwortete Teresa Valente und fügte hinzu: »Er versucht übrigens gerade, deiner Großmutter einen Zopf zu flechten.« Sie betonte jedes einzelne Wort so, dass ihr Sohn auch ohne weiteren Zusatz verstand, wie unpassend sie das fand.
Dann hörte er ihre Schritte und kurz darauf die Stimme des Dreizehnjährigen. »Ja?«
»Pedro, ich brauche deine Hilfe. Heute Mittag ist Raquel abgehauen, als ich mit ihr bei Anabela war, und seitdem ist sie verschwunden.«
»Ich finde sie«, sagte Pedro und legte auf.
Fernando ging zurück zu den Männern und griff nach dem Spaten, den Artur Alvas ihm entgegenstreckte.
»Wir sollten uns beeilen, damit wir ihn vor der Flut draußen haben. Und schön vorsichtig, damit wir die Leiche nicht beschädigen«, ermahnte der Rechtsmediziner noch, dann fingen sie an. Sie legten die Schultern frei und bald darauf die Hände, die zu Fäusten geballt gegen den oberen Brustkorb gepresst waren.
»Vielleicht hat er noch versucht rauszukommen«, mutmaßte Artur.
Dass das jedoch ein aussichtsloses Unterfangen gewesen war, erkannten die Männer, als sie die Handgelenke ausgegraben hatten. Der Tote war mit Handschellen gefesselt.
»Interessant«, kommentierte Rosa.
»Hatte er überhaupt eine Chance?«, fragte Fernando.
»Für einen Normalsterblichen ist es fast unmöglich, sich aus so einem festen Sandgrab zu befreien. Selbst wenn einem der Sand nur bis zum Hals reicht.«
Der Sand war feucht und ließ sich deshalb relativ gut zur Seite schaufeln. Trotzdem war die Arbeit bei diesen Temperaturen eine Tortur und dauerte länger als geplant, was auch daran lag, dass der Tote fast senkrecht im Sand stand. Seine Fußgelenke waren mit einem dicken Seil zusammengebunden. Er trug nur eine dünne Leinenhose, deren Taschen leer waren. Als sie ihn endlich vollständig ausgebuddelt und auf die Trage gelegt hatten, schwappte ihnen schon die Brandung um die Knöchel.
»Nichts wie weg hier«, sagte Artur. »Bevor uns die Wellen an die Klippen schmeißen.«
Sie trugen die abgedeckte Leiche durch den Tunnel zurück an den Hauptstrand, der inzwischen bis auf einige Polizeibeamte leer war. Gleichzeitig mit den beiden Bestattern, die den Toten in die Gerichtsmedizin in Setúbal bringen würden, kam auch Patricia die Treppe herunter.
»Ausgerechnet Anfang August«, stöhnte sie.
Fernando wusste, was sie meinte. Ein rätselhafter Todesfall so früh in der Hauptsaison war nicht gerade gut fürs Image.
»Und fast alle Kollegen sind verreist«, fügte sie hinzu. Dann schlug sie das Laken zurück und schaute dem Toten ins Gesicht. »Wenigstens hängt der Körper am Kopf und schwimmt nicht in Einzelteilen im Meer herum, wie ich befürchtet hatte. Wissen wir schon, wer er ist?«
»Wir haben weder Papiere noch einen Autoschlüssel in seinen Taschen gefunden.«
»Und eine Tatwaffe?«
»Er war an Händen und Füßen gefesselt und bis zum Hals eingegraben, weshalb es erst einmal auch so aussah, als würde da nur ein Kopf liegen. Höchstwahrscheinlich ist er bei der letzten Flut ertrunken. Die Obduktion verrät hoffentlich mehr«, fasste Dr. Rosa zusammen.
»Wir suchen also eine Schaufel.«
»Oder mehrere Schaufeln«, meinte Fernando. »Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Einzelner ihn gegen seinen Willen hätte einbuddeln können. Fesseln hin oder her.«
»Die Spurensicherung soll sich darum kümmern«, bestimmte Patricia. »Auch wenn ich bezweifle, dass der oder die Täter dumm genug waren, die Schaufeln hier zu deponieren, statt sie einfach im Meer zu entsorgen.« Sie wandte sich an Rosa. »Wann können wir mit den Ergebnissen der Obduktion rechnen?«
»Morgen früh, ich kümmere mich noch heute Abend darum.«
Patricia nickte und befand, dass vor Ort außer für die Spurensicherung nichts mehr zu tun sei.
Fernando wollte sich gerade verabschieden, als es in seiner Tasche klingelte. Er schaute auf das Display seines Handys und erkannte die Festnetznummer der Quinta. »Das ist sicher Raquel«, sagte er und verbesserte sich gleich in Gedanken: Das ist sicher wegen Raquel.
Aber da sagte Patricia schon zu Dr. Rosa: »Inzwischen telefoniert er anscheinend schon mit diesem Schwein.«
»Schlau genug ist sie ja«, antwortete der Rechtsmediziner, ohne eine Miene zu verziehen. »Ich bin mir nur nicht sicher, wie sie es schafft, so ein modernes Gerät zu bedienen. Das setzt ja doch allerhand an Fingerfertigkeit voraus.«
Fernando grinste schief und ging ein paar Meter zur Seite: »Hast du sie gefunden, Pedro?«
»Ja, sie sitzt im Café in Sonega. Aber sie hat sich geweigert, mit mir nach Hause zu kommen.«
3
Als Fernando zwanzig Minuten später auf Sonegas Hauptstraße parkte, saß Raquel nicht mehr im Café, sie lag schon. Durch die offene Tür hörte er ihr Schnarchen, sehen konnte er nur ein Stück ihres Bauches, der sich wie ein dicker behaarter Blasebalg rhythmisch auf und ab bewegte. Die Sicht auf den Rest seines Schweines war von einer Gruppe Touristen versperrt. Ein Mann lachte laut. »Pssst«, machte eine Frau und sagte dann noch etwas in einer Sprache, die Fernando nicht verstand.
Er setzte sich auf die Terrasse, gleich hinter das riesige Schild, in dessen linker Ecke ein schwarzes Schwein saß, das Raquel nicht unähnlich war. Café do Porco Polícia stand daneben, Café zum Polizeischwein.
Rodrigo Pinto hatte das Café im vergangenen Herbst eröffnet. Weil es schon das zehnte Café in dem kleinen Dorf war, hatte – außer Rodrigo – kaum jemand erwartet, dass es den Winter überleben würde. Und als er es dann nach Raquel, dem Polizeischwein, benannt hatte, waren auf den Bänken am alten Marktplatz noch Wetten darauf abgeschlossen worden, was zuerst passieren würde: Raquels Verwandlung in einen Berg leckerer Chouriço-Würste oder Rodrigos Rückkehr zu den Gabelstaplern im Hafen von Sines.Jetzt, ein knappes Jahr später, konnte von beidem keine Rede mehr sein. In Rodrigos Café hingen jede Menge Presseartikel über Raquel, die vom Premierminister persönlich zum Polizeischwein ernannt worden und – das zählte in Sonega noch mehr – sogar schon im Fernsehen gewesen war.
Für Touristen war Sonega früher nicht mehr als eines der vielen kleinen verarmten Alentejo-Dörfer am Weg in die Algarve gewesen. Nun hielten sie an, um im Café do Porco Polícia Kaffee zu trinken, dazu Pastéis de Nata zu essen, die leckeren Blätterteigtörtchen mit Puddingfüllung, und ein Foto zu machen. Offenbar deckten sich manche auch im Laden schräg gegenüber mit Proviant ein, dachte Fernando und beobachtete seine frühere Schulkameradin Sonya, die gerade die Tür ihres Geschäfts schloss und auf einen nagelneuen roten Roller stieg.
»Wenn es so weitergeht, müssen wir alle Provision an Raquel zahlen«, bemerkte Rodrigo Pinto, als er sich kurz darauf zu Fernando setzte. Er stellte zwei Gläser und eine Flasche ohne Etikett auf den Tisch. »Du kannst dir kaum vorstellen, wie die Leute ausgeflippt sind, als Raquel vor ein paar Stunden hier hereinspaziert ist. So leise sind sie jetzt nur, weil Raquel eingeschlafen ist und sie Angst haben, sie aufzuwecken.«
Rodrigo lachte, Fernando nicht. Er griff nach der Flasche, schraubte den Verschluss ab und hielt seine Nase über die Öffnung. Der Cafébesitzer war bekannt dafür, im weiten Umkreis den besten Aguardente de Medronho zu brennen, und dieser Jahrgang roch besonders gut. Der Inspektor füllte beide Gläser mit dem Schnaps aus den Früchten des Erdbeerbaums, leerte seines in einem Zug und fragte dann: »Wie viel hat sie gegessen?«
Rodrigo schenkte ihm nach. »Schlechten Tag gehabt?«
»Wie viel, Rodrigo?«
Aus der Tasche seines schwarzen Hemdes zog Rodrigo einen kleinen Block und las ab: »Bestellt haben die deutschen Touristen da drinnen drei Baguettes mit Käse und Schinken, eines mit Hühnchen, zweimal Obstsalat sowie diverse Gebäckstücke. Aber die Hälfte davon haben sie selber gegessen.«
»Du weißt doch, dass sie auf Diät ist.«
»Deshalb hatte das arme Schwein vermutlich so großen Hunger. Ich weiß, wie das ist«, sagte Rodrigo und strich sich über seinen Bauch, der in den letzten Monaten ebenfalls stetig gewachsen war. Dann sah er Fernandos Gesichtsausdruck und stand auf. »Ich glaube, ich geh da drinnen mal abrechnen.«
Zehn Minuten später kam der Erste der Reisegruppe nach draußen, nur um nach einem kurzen Blick auf Fernando gleich wieder auf dem Absatz kehrtzumachen. Fernando sah durchs Fenster, wie er an die Wand mit den Zeitungsartikeln ging und dann mit seinen Mitreisenden tuschelte. Er befürchtete Schlimmes. Tatsächlich blätterte der Mann, als er zurück auf die Terrasse kam, in seinem Sprachführer. »Desculpe«, entschuldigte er sich in holprigem Portugiesisch und fuhr dann in kaum weniger holprigem Englisch fort. Ob er nicht der berühmte Inspektor sei, der zu dem noch berühmteren Schwein gehöre?
»Können wir ein Autogramm bekommen?«, fragte eine Frau von hinten.
Fernando winkte ab. »Tut mir leid, aber das auf dem Foto ist mein Cousin. Wir sehen uns nur ähnlich.«
Der Mann kniff die Augen zusammen und schaute ihn prüfend an.
»Sehr ähnlich«, betonte Fernando. Die Touristen gaben auf und verschwanden um die Ecke. Wenig später bog das erste Wohnmobil auf die Hauptstraße ab. Als die Rücklichter des letzten Gefährts hinter Sonegas einziger Ampel verschwunden waren, streckte sich Raquel wohlig aus. Sie rollte mit einer Menge Schwung auf den Bauch, drohte kurz auf die Seite zurückzukippen, fing sich dann aber und stand auf. Sehr langsam ging sie nach draußen auf die Terrasse und blieb neben Fernandos Tisch stehen. Der Inspektor beachtete sie nicht. Sie quiekte leise, was zugleich Begrüßung und eine Aufforderung war, ihr den Rücken zu kraulen. Fernando verschränkte die Arme vor der Brust. Raquel warf ihm von schräg unten einen abschätzenden Blick zu und ließ sich auf ihre dicken Hinterbacken plumpsen.
Eine Weile saßen sie schweigend da, der Inspektor und sein Schwein, und schauten zu, wie das Nachtblau das letzte Tageslicht schluckte und immer mehr Menschen in Vitors Restaurant am Ende der Hauptstraße strömten.
»Das war eine total doofe Aktion von dir, einfach abzuhauen«, sagte Fernando schließlich.
Raquel schaute ihn an, die Fettwülste über ihren Augen wackelten dabei ein wenig, so als würde sie ihre Stirn in Falten legen wollen. Dann schob sie ihre lange schwarze Nase unter seinen Ellbogen, bis Fernando schließlich seine verschränkten Arme löste und ihr den Nacken kraulte.
»Aber du hattest natürlich recht, ihn so blöd zu finden«, sagte er, dann stand er auf. »Komm, Süße, wir fahren nach Hause.«
Die kleine Quinta, die einst von Fernandos Urgroßeltern gebaut und bis zum heutigen Tag von seiner Großmutter Mafalda regiert wurde, lag auf einer kleinen Hügelkuppe zwischen ein paar anderen Höfen, Gärten und Korkeichenwäldern, rund anderthalb Kilometer von Sonega entfernt und war nur über einen langen, holprigen Feldweg zu erreichen.
»Da ist er ja endlich«, hörte Fernando seine Mutter ausrufen, kaum hatte er den Motor ausgestellt und die Tür geöffnet. Am Ton und an der Lautstärke erkannte er bereits, dass sie Besuch hatten. Und er ahnte auch schon welchen.
»Als wäre dieser Tag nicht schon schlimm genug gewesen«, flüsterte er Raquel zu, als er ihr die Autotür aufhielt. Die Sau robbte von der Rückbank, ließ sich auf den Boden plumpsen und folgte dem Essensduft bis in den Hof hinter dem Haus. Vor der weiß-blau gestrichenen Lehmwand stand ein großer Tisch, darauf einige Windlichter. In ihrem schwachen Licht erkannte Fernando erst eine Flasche Rotwein und dann eine große Ofenform mit Bacalhau, dem Stockfisch, der zusammen mit geriebenen Kartoffeln in einem See von Olivenöl schwamm.
Als er Lúcia am Tisch sitzen sah, wusste er für einen Moment gar nicht, was ihn mehr ärgerte – dass seine Mutter nicht aufhörte, die arme Lúcia zum Essen einzuladen, oder dass Lúcia nicht aufhörte, diese Einladungen anzunehmen und darauf zu hoffen, dass sie doch noch ein Paar werden könnten. Bedauerlicherweise suchte Pedro immer das Weite, wenn Lúcia auftauchte, sie war nämlich seine Lehrerin.Und der Junge gehörte zu den wenigen Menschen, die Fernando an diesem Abend gerne gesehen hätte.
»Ach, da ist ja auch die süße Raquel«, flötete Lúcia, obwohl alle Anwesenden wussten, dass sie das gar nicht so meinte, und streckte ihre Hand nach der Sau aus. Die wich mit einem überraschend anmutigen Hüftschwung aus und trabte schnurstracks zu Mafalda, die am Kopfende des Tisches auf ihrem Stuhl thronte. Fernandos Großmutter trug zwei ungleichmäßig geflochtene Zöpfe, für die wohl Pedro verantwortlich war, und ein hellblaues Rüschenkleid. Es raschelte ein bisschen, als sie sich zu Raquel hinunterbeugte und sie zur Begrüßung unter dem Kinn kraulte.
»Du bist also ausgerissen«, sagte sie, und es klang eher anerkennend als vorwurfsvoll.
»Bring sie bloß nicht auch noch auf die Idee, dass du das gut finden könntest«, sagte Fernando, dann wandte er sich der Besucherin zu. »Boa noite, Lúcia«, sagte er und küsste sie auf beide Wangen.
»Wir haben mit dem Essen extra auf dich gewartet«, sagte sie.
»Das ist nett, aber ich habe gar keinen Hunger.«
»Ist dein neuer Fall so schlimm?«
»Unsinn«, mischte sich Teresa ein. »Natürlich musst du etwas essen. Setz dich hin, Junge.«
Fernando nahm Platz, stand aber gleich wieder auf. »Ich bin todmüde und muss morgen sicher wieder früh raus. Und ich habe wirklich keinen Hunger.«
Während er, gefolgt von Raquel, über den Kies ging, hörte er, wie seine Mutter laut einatmete.
»Der Junge ist neununddreißig, Teresa«, erinnerte Mafalda ihre Schwiegertochter.
»Auch Neununddreißigjährige müssen essen.«
»Vielleicht kann ich ihm später noch etwas bringen, wenn er sich ein wenig ausgeruht hat«, schlug Lúcia vor.
Fernando verdrehte die Augen und ging ins Haus. Weil das Küchenfenster vom Hof aus einzusehen war, machte er das Licht nicht an, sondern schlich im Halbdunkeln zum Kühlschrank. Er legte ein paar Oliven, Ziegenkäse und zwei Stücke Brot auf einen Teller, füllte ein großes Glas mit Wasser und verschwand gemeinsam mit Raquel in seinem Zimmer. Vorsorglich schloss er die Tür ab, bevor er sich bis auf die Boxershorts auszog. Im Schein der kleinen Nachttischlampe aß er schnell und ohne rechten Appetit, dann löschte er das Licht und legte sich aufs Bett. Raquel streckte sich am Boden auf der Decke aus, die Mafalda extra für sie genäht hatte.
Der Wecker tickte leise, draußen besangen Hunderte Grillen die ungewöhnlich warme und windstille Nacht. Viermal wurde das nächtliche Sommerkonzert vom Ruf einer Eule unterbrochen, dann klopfte Lúcia an die Tür. Als weder Fernando noch Raquel reagierten, drückte sie die Klinke nach unten.
»Abgeschlossen«, stellte sie bedauernd fest und fragte dann etwas lauter, ob sie noch etwas für ihn tun könne. Doch Fernando antwortete nicht. Er hörte, wie sie »Tatsächlich schon eingeschlafen« murmelte, dann entfernten sich ihre Schritte.
In Wahrheit konnte von Schlaf in dieser Nacht lange keine Rede sein. Die stickige Hitze klebte an Fernando wie ein Wickel aus schweren, feuchten Handtüchern. An seinem rechten Ohr summte es hell und penetrant, in seinem Kopf grinste Gary Watson ihn kuchenessend an, dann wurde der Tote vom Strand wieder lebendig und versuchte, aus seinem Sandloch zu klettern.
Irgendwann, lange nachdem Lúcia nach Hause und Mafalda und Teresa zu Bett gegangen waren, erhob sich Raquel mit einem Ächzen von ihrer Decke und stellte sich vor die Zimmertür. Fernando öffnete ihr und hörte zu, wie ihre Hufe durch den gefliesten Flur zum Hauseingang klackerten. Im Sommer ließ Mafalda die Tür häufig weit offen stehen, um etwas Luft hereinzulassen. Raquel ging hinaus, vermutlich, um sich einen kühleren Schlafplatz im Gras zu suchen. Seit ihrem Einzug ins Haus war es das erste Mal, dass sie nicht in Fernandos Zimmer schlief.
Er überlegte kurz, ob er sich zu ihr nach draußen legen sollte, dachte dann jedoch an all die Krabbeltiere, die im Garten lebten, und ließ es bleiben. Es reichte schon, dass er es drinnen mit den Mücken aufnehmen musste. Er knipste das Licht an und ging auf die Jagd, doch die Blutsauger waren unfassbar schnell. Dann probierte er es mit einer kalten Dusche, schwitzte aber schon wieder, bevor er die Matratze auch nur berührt hatte. Er schaltete das Licht aus, schlug in die Luft, traf aber keine Mücke, sondern nur sein rechtes Ohr.
Erst Stunden später, als draußen zum ersten Mal der Hahn krähte, seine Füße zerstochen waren und die Mücken blutschwer an der Wand hingen, erwischte er sie und schlief endlich ein. Viel zu wenige Stunden später klingelte ihn sein Telefon zurück in die unerfreuliche Realität.
»Schön, dass Sie schon wach sind, Inspektor«, sagte Dr. Rosa am anderen Ende der Leitung.
»Bin ich gar nicht«, murmelte Fernando.
»Gleich aber schon«, kündigte der Rechtsmediziner an und legte eine kleine Kunstpause ein, in der Fernando immerhin schon genug zu Sinnen kam, um zu bemerken, dass die Wand neben seinem Bett voller Blutflecken war.
»Ich habe gerade den Toten vom Strand auf dem Tisch. Und ich habe in seinem Magen einen Schlüssel gefunden.«
»Den Schlüssel zu den Handschellen?«
»Es könnte durchaus ein Schlüssel zu irgendwelchen Handschellen sein, aber in diese Handschellen passt er nicht.«
Fernando war mit einem Satz aus dem Bett. In seinem Kopf vernahm er ein alarmierendes Dröhnen, ähnlich dem dumpfen Grollen, mit dem die Erde im Alentejo manchmal ein Beben ankündigte.
»Was machen wir jetzt?«, fragte er.
»Ich würde sagen, Sie stehen jetzt auf und trinken zwei, drei Tassen Kaffee. Sie klingen so, als bräuchten Sie Koffein. Und dann finden Sie schnell heraus, wer der Tote eigentlich ist.«
4
Wirklich schnell ging es dann aber nicht. Drei Tage lang vermisste niemand den jungen Mann, der am Strand ertrunken war, oder zumindest nicht genug, um zur Polizei zu gehen. Seine Fingerabdrücke waren nicht gespeichert, seine Beschreibung passte auf keine bereits vorhandene Vermisstenanzeige, weder in Portugal noch bei Interpol.
»Das heißt, er ist weder vorbestraft, noch wurde er bereits vor längerer Zeit als vermisst gemeldet«, erklärte Patricia und trommelte mit den Fingern auf ihre Schreibtischplatte. Es nervte sie hörbar, dass sie nicht vorankamen.
»Vielleicht hat er hier nur Urlaub gemacht«, schlug Fernando vor, obwohl er am Vortag schon alle Hotels und Pensionen der Region angerufen und nach einem männlichen Gast mit langen Haaren und Aknenarben gefragt hatte. Aber niemand hatte einen Mann von Anfang bis Mitte zwanzig beherbergt (auf dieses Alter hatte ihn Dr. Rosa nach der Obduktion geschätzt), auf den die Beschreibung gepasst hätte.
»Und ein verlassenes Wohnmobil oder einen VW-Bus haben die Kollegen von der GNR auch noch nicht gefunden. Nicht mal ein herrenloses Auto«, gab Patricia zu bedenken.
»Er könnte zu Fuß unterwegs gewesen sein und wild gecampt haben.«
»Wäre er bei dieser Hitze gewandert, wäre er vermutlich schon lange vor dem Praia da Samoqueira tot umgefallen. Nein, ich würde die Touristentheorie zwar nicht ausschließen wollen, aber sehr wahrscheinlich ist sie nicht. Schon deshalb nicht, weil es nicht danach aussieht, als wäre er mal eben so, also völlig spontan und willkürlich, am Strand eingegraben worden.«
Fernando nahm den Obduktionsbericht vom Tisch und fächelte sich damit Luft zu. Er kam generell nicht besonders gerne und auch nicht besonders häufig nach Setúbal in die Alentejo-Zentrale der Polícia de Segurança Pública. Viel lieber ermittelte er vor Ort, als Akten zu wälzen,und Patricia ließ ihn, meistens zumindest. Doch in diesem Fall, in dem sie zunächst mal Vermisstenregister kontrollieren und unendlich viele Telefonate führen mussten, war ihm nichts anderes übrig geblieben, als jeden Tag den etwa einstündigen Weg von Sonega in die Distrikthauptstadt zurückzulegen. Ein Umstand, der ihn und Raquel gleichermaßen betrübte, denn um Patricia nicht unnötig aufzuregen, ließ er das Schwein an den Bürotagen zu Hause. Zweimal schon war Raquel ausgerissen, um sich in ihrem Stammcafé von Touristen auf ein Törtchen einladen, fotografieren und an den Ohren kraulen zu lassen. Er dachte daran, was ihm Dr. Rosa über starkes Übergewicht bei Schweinen und die negativen Folgen für Gelenke und Herz erzählt hatte. Spätestens wenn dieser Fall gelöst war, würde er sich um ein Diät- und Fitnessprogramm für Raquel kümmern müssen.
Patricia nahm ihm den Obduktionsbericht aus der Hand und blätterte darin herum.
Die Obduktion hatte bestätigt, dass der junge Mann noch gelebt haben musste, als die Flut kam, ihm Welle für Welle die Luft zum Atmen nahm, erst nur kurz, dann immer öfter und länger, bis die steigende Kohlendioxidkonzentration im Blut den Atemreflex auslöste. Das Salzwasser in den Bronchien hatte sich mit Luft und Sekret gemischt und war als weißer Schaum die Atemwege hochgestiegen.Zu diesem Zeitpunkt, so die Ausführungen von Dr. Rosa, hatte der Ertrinkende endlich das Bewusstsein verloren. Kurz darauf war sein Herz stehen geblieben.
»Wenn der Arme wenigstens unter Drogen gestanden hätte …«, bemerkte Fernando.
»Ja, das wäre für ihn sicher angenehmer gewesen. Aber Rosa hat nichts gefunden, keinen Alkohol, keine Tabletten, kein Haschisch. Nur diesen mysteriösen Schlüssel.«
»Ich habe auch keine Ahnung, was der bedeuten könnte«, meinte Fernando. »Vielleicht sind wir schlauer, wenn wir endlich wissen, wer der Tote eigentlich ist.«
»Hoffen wir es«, sagte Patricia, dachte einen Moment nach und fügte dann mit grimmiger Miene hinzu:»Wenn wir ihn nicht bis morgen Abend identifizieren können, müssen wir die Presse um Unterstützung bitten.«
Fernando wusste, dass sie genau das eigentlich vermeiden wollte. Wie durch ein Wunder waren bislang noch keine grausigen Details über den Leichenfund veröffentlicht worden, und wenn es nach dem Willen von Patricias Vorgesetzten und allen Hotelbesitzern ging, sollte das auch so bleiben – jedenfalls bis die vielen Touristen wieder weg waren.
Am frühen, aber schon heißen Morgen des 9. August, vier Tage nachdem man die Leiche in der Bucht gefunden hatte, stürzte ein kleiner, kahler Mann namens Diego Sousa in Fernandos Büro. Auch er sorgte sich um die Touristen, allerdings aus ganz anderen Gründen. Sein Koch, der junge Simão Gomes, sei verschwunden, und das sei jetzt in der Hochsaison eine Katastrophe, erklärte er aufgebracht.
»Ich habe drei Monate, um mit meinem Restaurant O Barco Azul genug Geld fürs ganze Jahr zu verdienen. Aber wie soll das gehen ohne Koch?«
»Sie wollen also eine Vermisstenanzeige aufgeben?«, fragte Fernando.
»Meine Frau will, dass ich eine Vermisstenanzeige aufgebe, und zwar persönlich. Sie macht sich wirklich große Sorgen, dass dem Jungen etwas passiert ist. Sie wissen ja, wie Frauen sind, Inspektor. Sie wäre auch selber gekommen, hat aber keinen Führerschein. Außerdem muss ja jemand die Fische ausnehmen. Und weil ich heute sowieso nach Setúbal musste, um eine neue Küchenmaschine abzuholen …«
Sousa holte kurz Luft.
»Setzen Sie sich doch«, schlug Fernando vor.
»Keine Zeit«, erwiderte der Restaurantbesitzer und blieb stehen.
Auch gut, dachte Fernando. »Und Sie?«, fuhr er fort. »Machen Sie sich keine Sorgen, dass Ihrem Koch etwas passiert sein könnte?«
Sousa machte eine wegwerfende Handbewegung. »Hätte er einen Unfall gehabt, dann hätte doch sicher irgendjemand die Eltern und den Arbeitgeber informiert. Und Sie wissen doch, wie die jungen Männer sind. Wahrscheinlich ist er mit irgendeiner feschen Backpackerin durchgebrannt.«
»Hat er so etwas denn früher schon mal gemacht?«
Sousa schüttelte den Kopf. »Eben deshalb will ich auch gar nicht so sein und ihn nicht gleich rausschmeißen, wenn Sie ihn hoffentlich bald irgendwo finden und zurückbringen.«
»Wo liegt denn Ihr Restaurant?«
»In Vila Nova de Milfontes, also eine gute Stunde südlich von hier. Ich muss deshalb auch gleich wieder los, meiner Frau in der Küche helfen.«
Fernando überging die Bemerkung und erkundigte sich stattdessen, wann der Restaurantbesitzer Simão Gomes zum letzten Mal gesehen habe.
»Am Donnerstag war er im Restaurant, bis etwa elf Uhr abends. Freitag hatte er frei, da hat meine Frau gekocht. Am Samstagmittag hätte er wieder arbeiten sollen. Aber er ist einfach nicht aufgetaucht.«
»Haben Sie versucht, ihn zu kontaktieren?«
»Natürlich, wir brauchen ja dringend einen Koch. Ausnahmsweise springt meine Frau zwar mal ein, aber sie hat Rheuma in den Beinen und kann nicht so lange stehen. Und ich kann nicht kochen. Ich habe ihn also angerufen, ziemlich oft sogar, aber sein Handy war aus. Am Sonntag bin ich bei seinem Apartment vorbeigegangen, aber da war er auch nicht.«
»Haben Sie einen Schlüssel?«
»Seine Vermieterin, eine alte Dame namens Maria Abreu, hat mir aufgeschlossen, als er nicht aufgemacht hat.«
»Er lebt also allein?«
»Ja.«
»Haben Sie bei seinen Eltern nachgefragt?«
Sousa schüttelte den Kopf. »Von denen habe ich keine Telefonnummer, ich habe sie auch noch nie kennengelernt. Aber ich glaube, sie leben in Almograve.«
Fernando zog die Augenbrauen hoch. Almograve war nur etwa fünfzehn Kilometer von Vila Nova de Milfontes entfernt, also nah genug, um mit dem Mofa oder sogar mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Es war mehr als ungewöhnlich, dass ein junger Mann von zu Hause auszog, wenn er nicht unbedingt musste. Zum einen verließ man in Portugal die Familie nur, wenn es der Beruf oder die Ehefrau zwingend erforderlich machte. Zum anderen war es bei den bescheidenen Gehältern und noch bescheideneren Renten unvernünftig bis unmöglich, allein zu leben.
Aber bevor er sich weiter Gedanken über Gomes’ Verhältnis zu seinen Eltern machte, musste er klären, ob der verschwundene Koch und die Strandleiche identisch waren.
»Haben Sie ein Foto von ihm dabei?«, fragte er.
»Warum sollte ich?«, entgegnete Sousa.
»Dann beschreiben Sie ihn, bitte.«
Sousa blickte auf seine Armbanduhr, dann seufzte er. »Einen halben Kopf kleiner als ich, also so gut einen Meter siebzig. Einen Zopf hat er außerdem, auch wenn ich ihn mehrfach aufgefordert habe, sich endlich eine vernünftige Frisur zuzulegen.«
»Und sein Gesicht?«
»Sieht ziemlich ruiniert aus. Vielleicht hatte er mal schlimme Akne. In einer offenen Küche kann er damit keinen Job bekommen.«
Der Inspektor zog ein Porträtfoto aus der Schublade und legte es vor Sousa auf den Schreibtisch. Obwohl die Strandleiche äußerlich relativ unversehrt wirkte, war anhand der geschlossenen Augen, der leicht geöffneten Lippen und des aufgedunsenen Gesichts eindeutig erkennbar, dass es sich um das Bild eines Toten handelte. »Ist er das?«
Jetzt setzte sich Diego Sousa doch. Nach einem kurzen Blick auf das Foto ließ er das Gesicht in die offenen Hände sinken und drückte mit seinen Fingerspitzen gegen die geschlossenen Lider, als wollte er die Tränen zurückdrängen. Vielleicht hatte Sousa doch mehr Herz, als er nach außen hin zeigte, dachte Fernando einen Moment lang. Doch diese Idee verflog so schnell, wie sie gekommen war, als Sousa sich kurz darauf erhob – mit einem Ruck und den Worten: »O meu deus, wo soll ich denn mitten im August noch einen neuen Koch auftreiben?«
5
Eine halbe Stunde später waren Fernando und Patricia auf dem Weg zu Gomes’ Eltern. Sie hatten Patricias Dienstwagen genommen, weil er über eine Klimaanlage verfügte.
»Aber die Rückbank ist eigentlich zu klein für ein Schwein. Jedenfalls für ein großes Schwein«, bemerkte Fernando.
»Auch für ein kleines Schwein, glaub es mir«, sagte Patricia, die Raquel ursprünglich lieber in der Wurst als im Dienst gesehen hätte. Dass diese dann über ihren Kopf hinweg auch offiziell zum Polizeischwein befördert worden und überdies noch zu einer nationalen Berühmtheit avanciert war, hatte sie trotzdem sportlich genommen – eine Tatsache, die ihr Fernando hoch anrechnete. Und eines Tages, davon war er überzeugt, würde sie auch noch Raquels Charme erliegen.
»Martins und Figo schauen nachher übrigens in der Wohnung des Opfers vorbei«, fuhr Patricia fort. »Und die Spurensicherung ist auch informiert. Wobei meine Erwartungen eher gering sind. Falls es dort einen Hinweis auf den oder die Täter gab, war in den letzten Tagen genug Zeit, um alle Spuren zu verwischen.«
»Sollten die beiden nicht erst in zwei Wochen aus dem Urlaub zurückkommen?«
»Ich habe sie gestern zurückbeordert.«
Die einzige größere Straße, die man von Setúbal nach Almograve nehmen konnte, führte mitten durch das Heimatdorf der Geschwister. Sonega lag rund neun Kilometer landeinwärts, das nächste größere Dorf Porto Covo war rund zehn Kilometer entfernt, bis zum Städtchen Sines war es doppelt so weit. Das Hinterland mit seinen sanft geschwungenen Hügeln und ursprünglichen Korkeichenwäldern, in denen man höchstens mal einen Ziegenhirten mit seinen Tieren oder ein Wildschwein traf, war bezaubernd. Das Dorf Sonega lag in einem Dornröschenschlaf. Die meisten Bewohner waren weggezogen, und die Alten, die geblieben waren, saßen auf dem verwaisten Marktplatz und ließen die Zeit verstreichen.
Doch an diesem Donnerstagvormittag war das anders. Schon von Weitem hörte Fernando, wie in der Dorfmitte gelacht und gerufen wurde. Aus dem Seitenfenster sah er schließlich, dass sich halb Sonega am Springbrunnen versammelt hatte. Etliche schwarz gekleidete alte Witwen standen da und versuchten, sich die Sonne mit Regenschirmen vom Leib zu halten. Ein paar alte Männer stützten sich auf ihre Gehstöcke und lachten breit und zahnlos. Fernando erkannte in der Menge seinen Onkel João und Salvador, den Holzhändler. Drei Kinder kurvten auf ihren Rädern um den Menschenauflauf.
»Schau mal«, sagte Fernando.
Patricia schaute und trat auf die Bremse. »Was ist denn hier los?«, sagte sie und parkte gleich neben dem Café do Porco Polícia.
Rodrigo lehnte am Zaun der kleinen Terrasse. Als er Fernando sah, hob er die Hände. »Ich habe damit nichts zu tun. Rein gar nichts.«
»Womit hat er nichts zu tun?«, erkundigte sich Patricia.
»Ich will es vielleicht gar nicht wissen«, behauptete Fernando und fand seine böse Vorahnung einige Meter weiter bestätigt. Mitten in der Menschenmenge ragte eine schwarzgraue Schweinenase in die Höhe. Raquel lag im Springbrunnen und ließ sich das Wasser auf den Rücken plätschern. Der Rummel um sie herum schien sie nicht zu stören, ja, wenn Fernando den Gesichtsausdruck seines Schweines richtig interpretierte, genoss sie ihn sogar.
Als sie ihr Herrchen sah, blinzelte sie und ließ ihr Maul zu ihrem Begrüßungslächeln aufklappen. Wäre es nicht sein Schwein gewesen, der Inspektor hätte über den Anblick lachen müssen. Aber so war er besorgt. Im Brunnen konnte Raquel nicht bleiben. Obwohl die Porco pretos mit ihrer dicken schwarzen und behaarten Haut weitaus besser gegen UV-Strahlung gewappnet waren als ihre kahlen rosa Verwandten, befürchtete er, dass sie beim allzu lange andauernden Bad in der Mittagshitze einen Sonnenbrand bekommen könnte. Aber er wusste zu gut, dass dieses Argument bei seiner Zwillingsschwester nicht ziehen würde. Er konnte sich sogar ihre Entgegnung lebhaft vorstellen: Ist doch prima, wenn ihre Schwarte schmerzt, würde sie sagen. Dann lernt sie vielleicht, in Zukunft zu Hause zu bleiben.
Fernando schaute durch die Menge, konnte aber Pedro, der ja immerhin so etwas wie sein Assistent beim Schweinetraining war, nirgends entdecken.
»Ich glaube, da hat jemand Spaß am Ausreißen gefunden«, sagte einer der Männer, an denen er sich auf dem Weg zum Brunnen vorbeischob, und klopfte ihm auf die Schulter.
»Vielleicht wäre so ein Deutscher Schäferhund doch besser für den Polizeidienst gewesen. Die sind ja nicht nur schlau, sondern auch sehr folgsam«, murmelte eine der Witwen.