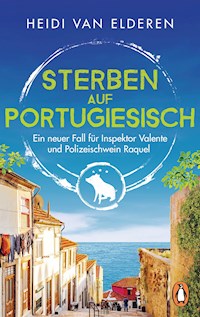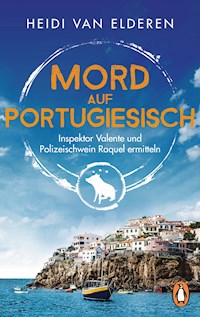9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die saustarke Krimireihe aus Portugal
- Sprache: Deutsch
Dieses Polizeischwein löst jeden Fall!
Etwas außerhalb des portugiesischen Dorfes, in dem Inspektor Valente und Polizeischwein Raquel leben, gibt es eine kleine Kommune, in der Yoga und Frieden großgeschrieben werden. Das harmonische Miteinander findet jedoch ein jähes Ende, als die Leiche einer Kursteilnehmerin auftaucht. Inspektor Valente und sein Polizeischwein Raquel müssen ihre innere Mitte finden, um den Mord an der jungen Frau aufzuklären. Doch dann verschwindet auch noch Raquel und der Inspektor bekommt ein abgetrenntes Schweineohr samt Lösegeldforderung zugeschickt – hat der Mörder das geliebte Polizeischwein entführt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Autorin
HEIDI VAN ELDEREN, 1980 am Niederrhein geboren, ist Weltenbummlerin und freiberufliche Journalistin, hat ihren Lebensunterhalt aber auch schon als Apfelpflückerin und Aushilfsköchin verdient. Sie lebte in Nordschweden, in Neuseeland und auch vier Jahre lang im portugiesischen Alentejo, wo ihre Krimireihe spielt. Heute wohnt die Autorin mit ihrem Mann und den zwei Töchtern wieder in Schweden.
Außerdem von Heidi van Elderen lieferbar:
Mord auf PortugiesischSterben auf Portugiesisch
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.deund Facebook.
HEIDI VAN ELDEREN
Die saustarke Krimireihe aus Portugal
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2022 by Penguin Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Umschlag: Bürosüd
Umschlagmotiv: Bürosüd
Redaktion: Annika Krummacher
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27081-0V002
www.penguin-verlag.de
1
Kein anderes Tier ist dem Menschen vom Wesen her so ähnlich wie das Schwein. Das Borstenvieh ist intelligenter als viele andere Säugetiere, trifft aber häufig dumme Entscheidungen. Es frisst quasi alles, ist verspielt, gierig und selbstsüchtig, gelegentlich aber überraschend sozial. Und es ist unendlich faul.
Für die Zusammenarbeit im Polizeidienst sind all diese Eigenschaften nicht immer hilfreich (vermutlich einer der Gründe, warum Polizeistaffeln öfter auf Hunde als auf Schweine setzen), für das Zusammenleben schon.
So kamen Inspektor Fernando Valente und Raquel, erstes und bislang einziges Polizeischwein Portugals, ohne Worte überein, diesen perfekten, leuchtend grünen Frühlingsmorgen mit Nichtstun zu verbringen. Fernando lag lang ausgestreckt auf der Wiese im Obstgarten. Der Boden war noch ein bisschen kühl, aber die Wärme der Sonne fühlte sich nach einigen feuchtkalten Winterwochen im Alentejo wie eine zarte Umarmung an. Raquel suhlte sich ein paar Meter daneben in einer saftigen Lehmkuhle. Es roch nach Orangenblüten und Zistrosen. Die Mehlschwalben, gerade erst aus dem Süden eingetroffen, zwitscherten. Raquel grunzte glücklich, Fernando summte leise vor sich hin, in der Ferne spielte jemand Klavier.
Es dauerte eine Weile, bis Fernando begriff, dass die Musik aus seiner Hosentasche kam. Er merkte selbst, dass seine Stimme ein wenig schläfrig klang, als er sich meldete.
»Liegst du gerade in der Sonne?«, fragte Patricia am anderen Ende der Leitung.
Fernando öffnete die Augen und setzte sich aufrecht hin. Es war nicht immer praktisch, die eigene Zwillingsschwester zur Chefin zu haben.
»Es ist ein schöner Tag«, sagte er, auch wenn er das ungute Gefühl hatte, dass der schönste Teil des Tages gleich schon vorbei sein würde.
»Im Kräutergarten der Sundance Community liegt eine Leiche«, sagte Patricia.
»Du meinst die Sundance Community?«
»Genau die. Vor São Luís links ab.«
Der Inspektor steckte sein Telefon wieder ein, stand auf und klopfte sich ein paar Grashalme von der Hose.
»Raquel, es gibt zu tun«, sagte er.
Raquel, ein so auffallend schönes wie liebenswürdiges Porco Preto Alentejano, wühlte ihren langen schwarzen Rüssel noch etwas tiefer in den rotbraunen Schlamm.
Natürlich hätte der Inspektor auch ohne sein Schwein fahren können, es war für die Ermittlungen eigentlich nicht besonders wichtig. Für seinen Seelenfrieden aber schon. Der Inspektor konnte den Anblick von Toten generell schlecht ertragen. Waren sie sehr jung oder übel zugerichtet, traf ihn das mit so einer Wucht, dass er auch mal aus der Kurve flog. Und dann konnte ihn kaum etwas so sicher und schnell zurück in die Spur bringen wie ein kleiner Nasenstüber von Raquel.
»Los geht’s, Süße, die Arbeit ruft!«, rief er in seiner fröhlichsten »Zeit zum Ballspielen!«-Stimme und klatschte in die Hände.
Raquel blinzelte ihm zu, ließ ihren Kopf auf die Seite sinken und blieb reglos liegen.
»Als ob je ein kluges Schwein durch die Aussicht auf Arbeit motiviert worden wäre«, sagte Mafalda, die plötzlich neben ihm stand. Seine Großmutter trug ein sonnengelbes Kleid, eine hellgrüne Strickjacke und eine altrosa Häkelblume in ihrem langen schlohweißen Zopf.
»Was schlägst du vor?«
»Bestechung«, flüsterte Mafalda und zog ein Karamellbonbon aus der Tasche ihrer Strickjacke.
»Das ist so schlecht für ihre Zähne«, wandte Fernando ein.
»Du könntest es natürlich auch mit einem Apfel versuchen, aber ob das funktioniert?«
Fernando streckte die Hand aus, Mafalda legte das Bonbon hinein. Es raschelte leise, als Fernando es aus dem goldenen Papier wickelte. Raquels linkes Ohr, das nicht im Schlamm lag, zuckte. Als Fernando den Leckerbissen auf der flachen Hand in ihre Richtung streckte, bewegte sich auch ihre Nase.
»Kleiner Snack?«, lockte Fernando.
Der Schlamm schmatzte, als sich Raquel erhob und aus der Pfütze stieg. Kaum etwas liebte sie so sehr wie Karamellbonbons. Mit vollem Maul folgte sie Fernando kurz darauf zum alten Pick-up.
Hinter ihnen öffnete sich knarrend das Küchenfenster. »In diesem Zustand kann sie sich doch nirgendwo blicken lassen!«, rief Teresa Valente. Sosehr Fernandos Mutter es mit ihrem Putzfimmel manchmal übertrieb – in diesem Fall hatte sie definitiv recht. Wenig später stand Raquel unterm Gartenschlauch, und Fernando schrubbte ihr mit einer Wurzelbürste den gröbsten Modder von der Haut. Raquel schloss die Augen und genoss. Nach fünf Minuten hingen zwischen ihren Zehen noch ein paar Erdklumpen, aber Fernando drehte das Wasser ab. »Sonst kommen wir zu spät«, sagte er und zog Raquel das Brustgeschirr an, mit dem er sie im Auto anschnallen und unterwegs anleinen konnte. Er hielt ihr die hintere Beifahrertür auf, und ohne Widerstand kletterte die Schweinedame auf die Rückbank.
2
Die Leiche lag zwischen Lavendel und Majoran. Catarina Brito war eine Frau um die fünfzig mit kinnlangen braunen Haaren. Ihre Augen waren geschlossen, die Wangen schlaff und eingefallen, ihr Mund stand weit offen. Der Tod nahm den Menschen jegliche Ausstrahlung, die sie zu Lebzeiten gehabt hatten, fand Fernando. Sein Blick wanderte über ihre fleischigen Arme und das bunte Batikkleid, das aussah, als hätte sie es für wenig Geld auf einem der Sonntagsmärkte gekauft. An Brust und Bauch spannte es ein wenig. Sie trug einen breiten goldenen Ehering, der so tief ins Fleisch gesunken war, dass sie ihn vermutlich mit ins Grab nehmen würde. Anders als ihr Körper wirkten ihre Hände eher muskulös als dick. Fernando nahm die Rechte der Toten und drehte sie vorsichtig, bis er die Handinnenseite sah. Sie war schwielig und wies schwarze Furchen auf, ebenso wie ihre Füße, die an den Fersen und Ballen von dunklen Rissen durchzogen waren. Gartenerde, vermutete Fernando.
Raquel, wenig beeindruckt von der Leiche, legte sich neben ihr Herrchen auf den Kiesweg.
»Ich tippe auf einen Herzinfarkt«, sagte der Notarzt, ein grauer, schlaksiger Mann. Er und Fernando waren sich schon häufiger an Tatorten begegnet, beide vergaßen aber ständig den Namen des anderen. Der Mediziner berichtete, dass Catarina Brito in der vergangenen Nacht an einer Ayahuasca-Zeremonie teilgenommen hatte.
»Oha«, sagte Fernando. Er wusste nicht viel über den Pflanzensud aus Südamerika, der wörtlich übersetzt so viel wie »Liane der Geister« hieß. In den letzten Jahren war die Nachfrage in Portugal gestiegen, spirituelle Gemeinschaften und selbst ernannte Schamanen boten die Ayahuasca-Zeremonien an. Gestorben war dabei seines Wissens allerdings noch niemand.
»Der Notruf ist um Viertel nach acht eingegangen. Ich war eine Dreiviertelstunde später vor Ort«, erzählte der Notarzt.
Fernando nickte. Für hiesige Verhältnisse war eine Dreiviertelstunde gar nicht schlecht, insbesondere wenn man so weit draußen lebte. Es gab wahrlich bessere Gegenden, wenn man Herzprobleme hatte.
Als hätte er Fernandos Gedanken erraten, fügte der Notarzt hinzu, dass er sowieso nichts mehr hätte ausrichten können. »Selbst wenn ich nur zwei Minuten gebraucht hätte.«
»Wann ist sie Ihrer Einschätzung nach gestorben?«
»Etliche Stunden vor meiner Ankunft. Genaueres kann Ihnen sicher der Rechtsmediziner sagen.« Der Notarzt deutete hinter Fernando. »Da kommt er schon.«
Raquel stand auf und quietschte begeistert. Auch Fernando freute sich, als er den kleinen Mann sah, der immer ein wenig zerstreut und sehr zerzaust wirkte, ganz so, als hätte er gerade bei starkem Wind stundenlang Drachen steigen lassen. Früher einmal war Dr. José Rosa Tierarzt gewesen. Dann hatte er sich zu oft über verantwortungslose Tierhalter geärgert und war stattdessen Rechtsmediziner geworden.
Er trat durch das kleine hölzerne Tor in den Kräutergarten, pflückte im Vorbeigehen einen Strauß Petersilie und überreichte ihn Raquel. Dann begrüßte er Fernando wie gewohnt mit den Worten: »Inspektor, wie schön, Sie zu sehen.«
»Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Das letzte Mal muss schon ewig her sein«, erwiderte Fernando. Im Alentejo war lange nicht gemordet worden.
Dr. Rosa zog ein Paar Gummihandschuhe aus der Tasche seines abgewetzten Cordjacketts und beugte sich über die Leiche. Was jetzt bevorstand, das Befühlen von Körperöffnungen, das Hochschieben von Kleidung, die Totenflecken – das alles wollte der Inspektor lieber nicht sehen.
»Ich schaue mich mal um, ob ich nicht jemanden finde, der erzählen kann, was hier passiert ist«, verkündete er.
»Die Senhoras, mit denen ich bei meiner Ankunft gesprochen habe, warten da drinnen«, sagte der Notarzt und zeigte auf ein einstöckiges weißes Lehmhaus gleich hinter den großen Rosmarinbüschen.
Fernando ging hinein und traf auf zwei junge Frauen in einer farbenfrohen Küche. Die eine saß am Tisch und sah aus wie jemand, der die halbe Nacht vergeblich in der Kälte auf den Bus gewartet hatte. Die andere stand im Raum, als wäre sie auf der Durchreise, nur kurz aus einem Märchenbuch in die Realität getreten. Schulterlange, blonde Korkenzieherlocken, weiche Gesichtszüge, rosa Pfirsichbäckchen und eine entzückende Stupsnase inklusive. Sie trug ein knöchellanges, hellgrünes Kaftankleid, das trotz des weiten Schnitts nicht verbarg, dass sie zierlich, aber dennoch gut trainiert war.
»Bom dia, ich bin Inspektor Fernando Valente, und das hier ist Raquel.«
Die schöne Fee blickte erst Raquel, dann ihn an. »Der Inspektor mit seinem berühmten Polizeischwein«, sagte sie und lächelte. »Warum sind Sie hier?«
»Weil in Ihrem Kräutergarten eine tote Frau liegt, Senhora.«
»De Vries. Mein Name ist Mieke de Vries.«
Fernando hatte schon viel über die Niederländerin gehört, gesehen hatte er sie noch nie. Zusammen mit ihrem Bruder Alo hatte sie vor rund zehn Jahren das Gelände der Sundance Community gekauft. Sie sah aus wie höchstens dreißig, musste aber in seinem Alter, also gut zehn Jahre älter sein.
»Der Notarzt hat gemeint, dass Catarina wahrscheinlich einen Herzinfarkt hatte. Dafür braucht man doch keine Polizei.«
»Reine Routine, Senhora de Vries, reine Routine«, entgegnete Fernando beschwichtigend, obwohl das nicht ganz stimmte. Er hatte seine morgendliche Frühlingsfaulenzerei abbrechen müssen, weil Drogen im Spiel waren und der Notarzt eben nicht sicher war, ob die Frau wirklich an einem Herzinfarkt gestorben war. Aber da Mieke de Vries das offenbar nicht wusste, wollte er es ihr nicht auf die Nase binden. Vielleicht gab es hier noch mehr Drogen, und die sollte sie möglichst nicht vernichten, bevor die Kollegen mit ihren Spürhunden eintrafen.
»Ich bin Jill«, stellte sich nun auch die Frau am Küchentisch vor. Ihre Stimme zitterte, und sie hielt sich den Bauch. Vermutlich waren ihr die Geschehnisse auf den Magen geschlagen.
»Erzählen Sie mir, was passiert ist«, sagte Fernando, nahm sein Notizbuch aus der Tasche und setzte sich auf einen der freien Stühle. Raquel legte sich neben ihn. Jill begann zu weinen.
»Haben Sie sie gefunden, Senhora?«, erkundigte sich Fernando.
Jill nickte, schluchzte lauter und vergrub das Gesicht in ihren Händen.
Raquel stand auf, und Fernando nahm ihre Leine ab. Sie konnte zwar weniger, als die meisten Menschen von einem Polizeischwein erwarteten, aber trösten und jemanden von einem Schock ablenken, das konnte sie so gut wie sonst kaum jemand.
»Jill wollte Minze aus dem Garten holen, um Tee aufzuschütten«, erklärte Mieke. Ihr Gesicht blieb ganz ruhig, aber Fernando meinte, einen leichten Ärger herauszuhören oder vielleicht auch nur zu spüren. Über den ausgefallenen Tee? Oder weil Jill und nicht sie die Leiche gefunden hatte?
»Erzählen Sie mir doch bitte, wie so eine Ayahuasca-Zeremonie abläuft«, bat er.
»Tagsüber und abends bereiten sich die Teilnehmer mit Meditation und Yoga vor. Um Mitternacht trinken sie das Ayahuasca. Nach etwa einer Stunde tritt die Wirkung ein. Alo begleitet die Zeremonie mit schamanischen Gesängen.«
»Warum um Mitternacht?«
»Nachts gibt es weniger visuelle Reize und Geräusche, die die Teilnehmer auf ihren spirituellen Reisen ablenken könnten. Die Wirkung des Ayahuascas hält etwa vier bis sechs Stunden an, danach fällt man in einen sehr tiefen Schlaf.«
Fernando rechnete nach. Wenn der Notarzt mit seiner Einschätzung richtiglag, war Catarina Brito während ihres Trips gestorben. »Und Sie lassen die Teilnehmer alleine draußen rumlaufen?«
»Nur die Teilnehmer, die schon Erfahrungen mit Ayahuasca gesammelt haben. Dann kann man das Einswerden mit Mutter Erde unter freiem Himmel noch intensiver erleben.«
»Ist denn niemandem aufgefallen, dass Catarina Brito so lange weg war?«
»Offensichtlich nicht, sonst hätten wir ja nach ihr geschaut.«
Raquel hatte unterdessen ihre lange Nase unter Jills Arm geschoben. Sie grunzte leise. Jill nahm ihre Hände vom Gesicht, mit einer kraulte sie Raquels Kopf, mit der anderen zog sie ein Papiertaschentuch aus ihrer Haremshose und putzte sich die Nase. Dann erzählte sie, dass sie den Notarzt gerufen habe, sobald sie die Tote gefunden hatte. »Erst dann habe ich Mieke Bescheid gegeben.«
Jill sprach überraschend gutes Portugiesisch, obwohl sie, wie der Inspektor ihrem Akzent entnahm, von den Britischen Inseln stammen musste.
»Wie lange leben Sie schon hier, Jill?«, fragte er.
»Drei Jahre.«
»Und Catarina?«
»Catarina hat gar nicht hier gelebt. Sie war nur für eine Woche zu Besuch, um zu meditieren, Yoga zu machen und die Ayahuasca-Zeremonie zu erleben«, sagte Mieke.
»War das ihr erster Besuch hier?«
Jill schüttelte den Kopf. »Catarina war im Oktober zum ersten Mal hier. Sie war so nett und lustig.«
Mieke warf Jill einen Blick zu, den Fernando nicht richtig einordnen konnte. Jill, die ausgesehen hatte, als wollte sie noch mehr sagen, verstummte sofort.
»Wo hat Catarina denn sonst gelebt?«, wollte Fernando wissen.
»Das müsste im Anmeldeformular stehen. Ich kann die Unterlagen gleich holen«, meinte Mieke.
»Gerne. Und bitte auch eine Liste mit allen anderen Teilnehmern des Ayahuasca-Retreats. Außerdem brauche ich die Namen von allen, die in der Community leben.«
Mieke nickte und verließ mit wallendem Kleid den Raum.
»Mochten Sie Catarina?«, erkundigte sich Fernando bei Jill, um sie wieder zum Reden zu bringen.
Jill kraulte Raquels Doppelkinn und schaute ihn nicht an, als sie antwortete: »Ja, aber ich kannte sie natürlich nicht sehr gut.«
Mieke kam zurück und gab ihm ein ausgeschaltetes Mobiltelefon und einen Stapel loser Papiere.
»Das ist Catarinas Handy.«
»Wieso haben Sie das?«
»Sie hat es nach ihrer Ankunft ausgeschaltet und mir gegeben, das machen alle unsere Gäste so. Digital Detox, Sie wissen schon.«
Fernando wusste es nicht genau, konnte es sich aber vorstellen. Auch ihm ging es ziemlich gut, wenn er sein Mobiltelefon ausschalten und in eine Schublade legen konnte. Das tat er nur viel zu selten.
Er steckte das Handy der Toten ein und widmete sich den Papieren. Ganz oben lag eine von Catarina Brito unterschriebene Bestätigung. Darin erklärte sie, dass sie weder unter Herz- noch Kreislaufproblemen leide und auch ansonsten körperlich wie psychisch völlig gesund sei. In den letzten vier Wochen habe sie keine Medikamente oder Drogen eingenommen. Über die möglichen Nebenwirkungen des Ayahuascas sei sie ausführlich informiert wurden und habe sich in den letzten drei Tagen vor der Zeremonie streng an die empfohlene Diät gehalten.
»Diät?«, wunderte sich Fernando.
»Kein Alkohol, kein Fleisch, keine dunkle Schokolade und noch einiges andere. Bei den Unterlagen befindet sich auch die ausführliche Liste, wir haben sie allen Teilnehmern bei der Anmeldung und auch noch einmal eine Woche vor dem Retreat per E-Mail zugeschickt«, erklärte Mieke.
»Und was passiert, wenn man sich nicht daran hält?«
»Zu den möglichen Nebenwirkungen gehören Kopfschmerzen und starke Übelkeit.«
»Ein bisschen übel wird einem sowieso immer«, warf Jill ein.
»Wo sind all die anderen?«, sagte Fernando und tippte auf die Namenslisten.
»Von unseren ständigen Bewohnern sind heute nur Jill, mein Bruder Alo und ich hier. Die anderen sind gestern nach dem Abendessen nach Nazaré gefahren, um den Big Wave Surf anzuschauen. Sie kommen erst heute oder morgen zurück.«
»Und was ist mit den Namen in Klammern?«
»Das sind diejenigen, die im Winter in ihre alte Heimat gefahren sind. Viele verdienen in Deutschland oder London dann ein bisschen Extrageld.«
»Und die anderen Teilnehmer der Ayahuasca-Zeremonie? Wo sind die?«
»Die schlafen noch in der Maloka, genau wie Alo.«
»Wo bitte?«
»In der Maloka, das ist eine runde Hütte nach dem Vorbild der südamerikanischen Naturvölker, speziell für die Ayahuasca-Zeremonien gebaut. Sie steht hinter den Pinienbäumen«, erklärte Mieke.
»Übernachten sie dort die ganze Woche?«
Mieke schüttelte den Kopf. »Nur heute. Sonst haben wir Besucher-Tipis.«
»Auf Catarinas Tipi ist eine große Sonne abgebildet«, ergänzte Jill.
Fernando blätterte weiter in den Unterlagen, bis er auf der letzten Seite Catarina Britos Adresse fand: Rua da Atafona 1, Monsanto. Das vielleicht berühmteste historische Dorf Portugals.
»Wissen Sie etwas über Catarinas Familie und ihr Privatleben?«
»Sie war verheiratet und hatte, wenn ich mich richtig erinnere, keine Kinder. Sollen wir eigentlich ihren Mann anrufen? Oder machen Sie das?«, fragte Mieke de Vries im Plauderton, als würden sie nicht über eine Tote, sondern über ein neues Stockfisch-Rezept sprechen. Fernando fühlte sich unwillkürlich an eine böse Fee erinnert, die sich jedoch als eine gute verkleidet hatte.
»Das übernehmen die Kollegen in Monsanto«, erwiderte er. Mit leichtem Grauen dachte er daran, dass er doch selbst fahren müsste, falls Catarina Brito keines natürlichen Todes gestorben war. Es gab nur eines, was ihm in seinem Beruf mehr zusetzte als der Anblick von Leichen: die Benachrichtigung ihrer Angehörigen.
3
Fernando und Raquel suchten die Maloka. Das heißt, Fernando suchte die Maloka, während Raquel nebenherlief und den Boden nach Eicheln und anderem Essbaren absuchte. Natürlich hätte er sich den Weg auch von Mieke de Vries zeigen lassen können, sie hatte es ihm sogar angeboten. Aber der Inspektor zog es vor, das fünfzig Hektar große Gelände der Community allein zu erkunden. Er lief an einigen runden, mit Mustern bemalten Lehmhäusern vorbei. Sie sahen hübsch aus, sehr hübsch sogar, und waren ganz sicher ohne Genehmigung gebaut wurden. Im Alentejo hielten Bewohner wie Behörden das noch relativ locker. Vermutlich wohnten hier die ständigen Bewohner der Community.
Hinter der Wiese mit den Lehmhäusern begannen die Gärten. Fernando hatte gehört, dass sich die Sundance Community unter anderem durch den Verkauf von Obst und Gemüse finanzierte. Allerdings war ihm nicht klar gewesen, dass sie das Obst und Gemüse in Gärten anbauten, die zu den schönsten des Landes zählen mussten. Überall plätscherten Bachläufe, die zu kleinen und größeren Seen führten. Fernando nahm an, dass sie künstlich angelegt worden waren, aber sie sahen aus, als wären sie schon immer hier gewesen. Die Wasserlandschaft war von riesigen Avocado- und Feigenbäumen, Palmen, Blumen und einigen Obstbäumen umgeben, die Fernando noch nie gesehen hatte. Kiwipflanzen rankten sich an Tunnelbögen empor, der Boden war mit Blumen und Kräutern bedeckt. Eine Iberische Smaragdeidechse saß auf einem großen Stein und sonnte sich, verschwand aber im Dickicht, als ihr Raquels feuchte Nase zu nahe kam.
Mieke hatte gesagt, die Maloka befinde sich hinter den Pinien. Fernando schaute sich um und entdeckte auf einem kleinen Hügel drei ausladende Baumkronen, die wie aufgespannte Regenschirme aussahen und alle anderen Bäume überragten. Ein schmaler gewundener Pfad führte zu einem Bambushain, in dessen Mitte die runde Maloka lag. Der untere Teil der Wände bestand aus gestampftem Lehm, der obere Teil war wie das Dach aus Bambus gebaut. Fernando schob einen Vorhang aus kleinen Muscheln zur Seite und trat zusammen mit Raquel ein. Durch das schmale Fenster fiel nur mattes, schummrig grünes Licht, sodass Fernando für einen kurzen Moment das Gefühl hatte, auf dem Boden eines Waldtümpels gelandet zu sein. Probehalber atmete er einmal tief ein. Das ging, schmeckte aber etwas sumpfig.
Im Kreis angeordnet lagen acht Matratzen, vier Menschen lagen darauf und schliefen. Neben einem Mann mit Glatze und rotem Bart hockte der Notarzt. »Ich habe mal nachgeschaut, wie es dem Rest der Truppe geht. Für den Fall, dass mit der Ayahuasca-Mischung etwas nicht in Ordnung war«, erklärte er. »Sie machen aber alle einen stabilen Eindruck.«
»Können wir sie aufwecken?«
»Falls Sie mit ihnen sprechen wollen, würde ich an Ihrer Stelle lieber später wiederkommen.«
»Wozu sind die hier?«, fragte Fernando und zeigte auf die bunten Plastikeimer, die am Kopfende jeder Matratze standen.
»Spuckeimer. Erbrechen und Durchfall sind quasi Teil der Zeremonie«, erklärte der Notarzt.
»Sie machen Witze.«
»Keineswegs. Ayahuasca-Anhänger glauben, dass das Teil des Reinigungsprozesses ist.«
Auf einer der Matratzen lagen zerwühlte Decken, vermutlich war das Catarina Britos Lager gewesen. Fernando ließ Raquels Leine los und schaute nach, ob auf der Matratze irgendetwas Interessantes lag. Fehlanzeige.
Hinter ihm rumpelte es.
»Das war Ihr Schwein«, sagte der Notarzt. Fernando drehte sich um. Raquel hatte offenbar versucht, auf einen Stapel Decken und Kissen zu steigen, war dann aber abgerutscht und auf eine Sammlung von Plastikflaschen gefallen. Nun schnüffelte sie an ihnen, wählte eine aus und begann, sie wie einen Ball mit der Nase über den Holzboden zu rollen. Fernando stoppte die Flasche mit dem Fuß, dann fing er Raquel ab. »Zu Hause können wir Ball spielen, hier müssen wir arbeiten.«
Er nahm die Flasche hoch und betrachtete den Rest der trüben hellbraunen Flüssigkeit, die aussah wie das schlammige Wasser des Barragem de Campilhas nach einem langen trockenen Sommer. Als er den Deckel öffnete, schlug ihm ein erbärmlicher Gestank entgegen. Wenn das Ayahuasca war, und was sollte es sonst sein, überraschte es ihn gar nicht, dass man davon spucken musste. Dass es Menschen gab, die das Zeug freiwillig tranken, wunderte ihn hingegen schon. Er zog eine Plastiktüte aus seiner Hosentasche und packte die Flaschen ein.
Beim Notarzt piepste es. »Ich muss weiter«, sagte er, drückte Fernando seine Visitenkarte in die Hand und eilte von dannen.
»Wir müssen auch weiter, ich will mir noch Catarinas Tipi anschauen«, sagte Fernando zu Raquel oder zu sich selbst. Er wusste nicht so recht, was er bedenklicher fand: Gespräche mit einem Schwein oder Gespräche mit sich selbst.
Die Besucher-Tipis lagen jenseits des Maloka-Hügels auf einer Lichtung zwischen uralten Korkeichen. Schon bald hatte Fernando das Tipi entdeckt, in dem Catarina Brito geschlafen hatte. Es war das einzige, auf dessen Zeltwand eine Sonne gemalt war. Fernando rollte den schweren imprägnierten Baumwollstoff vor der Eingangsluke hoch, bückte sich und stieg ein. Drinnen war es überraschend hell und freundlich. Auf dem hellen Holzfußboden standen ein niedriges Bett mit großem Moskitonetz, ein kleiner Ofen und ein rotes Meditationskissen. Strom gab es nicht, dafür aber eine kleine Öllampe. Am Fußende des Bettes stapelten sich einige Hosen und Pullover, daneben befand sich eine halb volle Reisetasche.
Fernando zog Handschuhe an und durchsuchte sie. Ein Waschbeutel, ein ausgeleiertes Flanellnachthemd, Unterwäsche, Jeans, Pullover, T-Shirts, ein paar bunte Hippiekleider und, ganz unten, eine ungeöffnete Packung Butterkekse. In einem Seitenfach steckten zwei edle Kugelschreiber – ein Notizbuch oder Papier suchte der Inspektor vergeblich. Er packte alle Sachen in die Tasche und schloss den Reißverschluss. Je nachdem, was Dr. Rosa bei der Obduktion herausfand, würde er die Tasche entweder ins Labor oder zu Catarinas Mann schicken.
Als Fernando und Raquel wieder in den Kräutergarten kamen, war Dr. Rosa gerade fertig mit der ersten Inspektion der Leiche. Erstaunt beobachteten sie die Ankunft eines jungen Mannes, der das Grundstück von der Südseite aus betreten hatte. Er sah aus wie ein Tennisspieler aus besserem Hause, in der einen Hand das Telefon, in der anderen eine Arzttasche aus braunem Leder. Er bewegte sich im Stechschritt, stoppte aber abrupt neben der Petersilie, als er die Leiche sah.
»Was ist passiert?«, erkundigte er sich bei Dr. Rosa und klang ein wenig fassungsloser, als es Ärzte beim Anblick von Toten normalerweise sind.
»Kannten Sie die Tote?«, fragte Fernando.
»Nein, aber …«, begann der Mann, dann hielt er inne und warf Raquel, die sich auf dem Kiespfad wälzte, einen irritierten Blick zu. »Mein Name ist Diego Fosco, ich bin Arzt in São Luís.«
»Ich wusste gar nicht, dass es dort ein Gesundheitszentrum gibt«, bemerkte Dr. Rosa, woraufhin Fosco erklärte, dass er vor einem Jahr eine private Praxis in São Luís aufgemacht habe.
»Und davon kann man leben?«, wunderte sich Dr. Rosa. In dieser Gegend konnten sich nicht viele leisten, einen Arzt aus eigener Tasche zu bezahlen.
Fosco errötete leicht. »Ich brauche nicht viel. Außerdem kann ich, anders als viele Ärzte im Gesundheitszentrum, ziemlich gut Englisch sprechen. Das ist insbesondere für ausländische Touristen von Vorteil, und natürlich auch für die vielen Briten und Deutschen, die hier in der Gegend leben. Es lernen ja leider nicht alle so gut Portugiesisch wie die Bewohner der Sundance Community.«
»Und warum sind Sie hergekommen, Dr. Fosco?«, erkundigte sich Fernando.
Diego Foscos Hals und Wangen wurden röter. »Viele Mitglieder der Community sind meine Patienten. Mir hat jemand im Ort erzählt, dass ein Notarztwagen in diese Richtung abgebogen ist. Ich hatte frei und wollte schauen, ob ich helfen kann.«
»Leider nein«, stellte Dr. Rosa nüchtern fest. »Da ist nichts mehr zu tun.«
»Wie ist sie denn gestorben?«, hakte Dr. Fosco nach.
»Das wissen wir noch nicht.«
Dr. Fosco nickte und verabschiedete sich.
Fernando gab dem Rechtsmediziner die Tüte mit den Plastikflaschen, die er in der Maloka eingesammelt hatte. »Da sind noch Ayahuasca-Reste drin.«
»Prima, ich bringe Sie in Setúbal gleich im Labor vorbei«, sagte Dr. Rosa.
Um kurz vor zwölf kamen zwei wortkarge Bestatter und legten Catarina Brito in einen Metallsarg. »Bitte in die Rechtsmedizin nach Setúbal«, sagte Dr. Rosa. Einer der Männer nickte, der andere brummte. Der Sarg wurde in den schwarzen Wagen geladen, dann fuhren die Bestatter davon.
»Was denken Sie?«, wollte Fernando wissen.
»Todeszeitpunkt: zwischen ein und drei Uhr letzte Nacht. Bei der Todesursache tippe ich wie der Notarzt auf einen Herzinfarkt oder auf Herzversagen, könnte mich aber auch irren.«
»Kann der Konsum von Ayahuasca denn zu Herzproblemen führen?«
»Unwahrscheinlich.«
»Könnte jemand nachgeholfen haben?«
»Nicht auszuschließen.«
Dr. Rosa und Fernando gingen zu ihren Wagen, Raquel trabte hinterher.
»Sind es nicht die Leute von der Sundance Community, die mit freier Liebe den Weltfrieden fördern wollen?«, fragte Dr. Rosa.
»Richtig«, sagte Fernando. »Woher wissen Sie das?« Er konnte kaum glauben, dass dies selbst in der über neunzig Kilometer entfernten Distrikthauptstadt ein Thema sein sollte.
»Sie wissen doch: Klatsch und Tratsch können im Alentejo unerwartet weite Strecken zurücklegen. Ganz besonders, wenn es um Sex geht.«
»Auch wahr. Und was halten Sie von diesem Ansatz?«, erkundigte sich Fernando, obwohl er sicher war, dass Dr. Rosa persönlich wenig damit anfangen konnte. Er war seit Jahrzehnten mit der Biologin Joana Galioto verheiratet. Jedes Mal, wenn er von ihr sprach, leuchtete er ein bisschen vor Glück.
Doch Dr. Rosa antwortete nicht als Ehemann, sondern als Wissenschaftler: »Bei den Bonobos klappt es ziemlich gut. Die lösen alle ihre Konflikte, indem sie Sex haben.«
»Sind die nicht sehr eng mit uns verwandt?«
»Stimmt. Trifft aber auch auf die aggressiveren Schimpansen zu, bei denen sich die Männchen gelegentlich zerfleischen und die Weibchen zu Sex genötigt werden.«
»Klingt, als ob an der Philosophie der Sundance Community was dran sei«, bemerkte Fernando.
»Theoretisch ja. Praktisch fürchte ich, dass das mit der freien Liebe langfristig auch nur selten funktioniert. Aber wer weiß, vielleicht können wir uns hier ja eines Besseren belehren lassen.«
Fernando dachte an die wunderbare Anabela Lobo, Raquels Trainerin und seine Lieblingsfrau. Schon seit Wochen weilte sie bei der Familie ihres Vaters in Irland. Über Weihnachten hatte sie dort sicher auch ihr Mann Gary besucht. Der war zwar Kanadier, als Arzt aber gerade in Georgien stationiert. Fernando musste unwillkürlich seufzen. »Manchmal fürchte ich, dass Liebe überhaupt nur selten funktioniert.«
Dr. Rosa kannte Anabela nicht, aber er hatte mitbekommen, dass Fernando unheilbar und möglicherweise auch unerwidert in eine verheiratete Frau verliebt war. Und weil er ein kluger Mann war und den Inspektor sehr schätzte, legte er ihm eine Hand auf die Schulter und schlug das einzig Sinnvolle vor: »Was halten Sie von einem Mittagessen?«
4
Das Dorf São Luís lag in der gleichnamigen Gemeinde im Hinterland, rund fünfzehn Kilometer von der wild-romantischen Steilküste des Alentejo entfernt. Das Leben war ruhig in den Hügeln, in denen sich halbwilde Schweine unter den Korkeichen satt fraßen, Familien in den kleinen, weit verstreuten Quintas ihren eigenen Wein und Käse herstellten und die Alten stundenlang zusammen auf dem Marktplatz saßen. Etlichen allerdings war es offenbar zu ruhig: Nur etwa zweitausend Menschen lebten in der hundertfünfzig Quadratkilometer großen Gemeinde, in den 1950er-Jahren waren es noch mehr als doppelt so viele gewesen.
Während die meisten jungen Portugiesen ihrer Heimat den Rücken kehrten, um woanders Arbeit zu finden, wurde die dünn besiedelte Gegend bei Aussteigern aus Deutschland, Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich und Israel zunehmend beliebter. Immer mehr von ihnen kamen und kauften verlassene Höfe, die zwar im Vergleich zur Algarve noch günstig, für hiesige Verhältnisse aber völlig überteuert waren. So brachten sie zwar Geld ins Land, sorgten aber auch dafür, dass sich Einheimische, die bleiben wollten, mit einem normalen Job schon lange nicht mehr ein Haus oder eine Quinta leisten konnten. Die meisten Touristen blieben in den kleinen, schmucken Küstenorten, auch dieser Umstand führte dazu, dass im Dorf São Luís kaum Geld für Renovierungen oder Neubauten vorhanden war.
Von vielen der weiß getünchten Häuser blätterte der Putz ab, die Straßen waren voller Schlaglöcher. Vor allem an nasskalten Wintertagen, wenn Menschen in kaum heizbaren Räumen hinter geschlossenen Fensterläden saßen und nur ein paar einsame vierbeinige Streuner durch die Straßen strichen, empfand Fernando das Dorf als ausgesprochen deprimierend. Aber als er und Dr. Rosa an diesem frühlingshaften Sonntag im Februar am Straßenrand parkten und ausstiegen, wirkten die alten Gassen von São Luís geradezu romantisch. Im weichen Sonnenlicht glänzten auch die verfallensten Häuser. Die reifen Orangen an den Bäumen schienen zu glühen, so tief orangerot waren sie. Rund um den Springbrunnen steckten ein Dutzend Männer die Köpfe zusammen. Auf einem Balkon strickte eine alte Frau an einem bunten Wollschal, der lang über das Geländer hing. Irgendwo übte jemand Geige, Kinder lachten, und es duftete nach gegrilltem Fleisch. Vor den Fenstern, auf den Dachterrassen und in den Gärten der schmalen, zweistöckigen Häuser flatterten Bettlaken, Handtücher und Wolldecken – ein weiteres sicheres Zeichen, dass der Frühling Einzug hielt.
»Wir gehen zu Dona Carla, ich lade Sie ein«, sagte Fernando und deutete auf ein Haus gleich hinter dem Spielplatz in der Ortsmitte. Das Gebäude war zweistöckig, mit weißen Wänden und traditionellen azurblauen Umrandungen von Fenstern und Türen. Bis auf die drei Tische vor dem Haus wies nichts darauf hin, dass man hier essen gehen konnte.
Dr. Rosa setzte sich in die Mittagssonne, Fernando steckte den Kopf durch die offene Eingangstür. Er brauchte ein paar Sekunden, bis sich seine Augen an das schummrige Licht gewöhnt hatten. In der linken Ecke befand sich der kleine Tresen mit fünf Barhockern. In einer Vitrine lagen noch ein paar Stücke Gebäck vom Morgen, vielleicht auch vom Vortag. An der Wand über dem Regal mit den Spirituosen hing ein Bildschirm, der möglicherweise mehr gekostet hatte als der Rest des Mobiliars zusammen. Es lief eine brasilianische Telenovela, in der gerade Tränen flossen. Wie viele Cafés im Alentejo erfüllte auch das von Dona Carla gleich mehrere Zwecke: Morgens auf dem Weg zur Arbeit kaufte man sich hier einen Kaffee und eine süße Kleinigkeit. Mittags und abends aß man, und zwischendurch gab es große Portionen Klatsch und Tratsch.
Die rot-grauen Bodenfliesen glänzten feucht gewischt, auch die Tische waren sauber. Für ein Mittagessen waren sie ziemlich spät dran.
»Boa tarde, Dona Carla«, begrüßte Fernando die Wirtin, die Köchin, Kellnerin und Putzfrau in einem war und gerade anfing, die Tische neu einzudecken.
»Inspektor!«, rief sie, kam zur Tür und begrüßte ihn mit zwei Wangenküsschen. Sie hatte den Gang und den Körper einer Langstreckenläuferin, auch wenn sie im Leben noch nie woanders gerannt war als zwischen Markt und Küche, Küche und Gästen. Fernando wusste, dass sie zwei erwachsene Kinder hatte, die inzwischen in Lissabon lebten. Sie hatte sie überwiegend alleine großgezogen, nachdem ihr Mann mit dem Motorrad verunglückt war. Erst vor gut drei Jahren hatte sie erneut geheiratet, einen Maurer aus Odemira, den Fernando nur flüchtig kannte.
»Sie habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Was führt Sie her?«
»Hunger. Vorausgesetzt, Sie haben Ihre Küche für heute Mittag nicht schon geschlossen.«
»Meine Küche ist nie geschlossen. Es gibt Pastéis de bacalhau und danach Sopa Alentejana.« Fernando fiel auf, dass die Wirtin ihre aschgrauen Haare schwarz getönt hatte, vermutlich erst am Vorabend, denn auf der Stirn, gleich unter dem Haaransatz, war noch ein blasser schwarzer Streifen zu sehen.
»Das nehmen wir«, sagte Dr. Rosa. Dazu bestellten sie sich den roten, leicht säuerlichen Hauswein, den Carlas Schwager in seinem Hinterhof kelterte.
»Und für Raquel?« fragte Carla.
»Sie hat heute schon zweimal gegessen«, erklärte Fernando.
Raquel, die sich neben den Tisch in die Sonne gelegt hatte, schaute ihr hinterher und quiekte leise. Kurz darauf wurde das Quieken von dem durchdringenden Geräusch der Martinshörner übertönt.
»Polizei?«, wunderte sich Dr. Rosa.
»Die Kollegen vom Drogendezernat in Beja. Sie sollen mal nachschauen, was die Sundance Community noch so auf Lager hat.«
»Mit Blaulicht?«
Fernando lachte. »Ich vermute, die Kollegen sind jung und wollen ein bisschen Spaß haben.«
»Das wird Senhora de Vries aber gar nicht freuen.«
»Soll es auch nicht«, erwiderte Fernando. »Wie ist so ein Ayahuasca-Trip eigentlich?«
»Da fragen Sie den Falschen. Wenn es um Drogen geht, bleibe ich lieber bei gutem Rotwein und dunkler Schokolade.«
Carla brachte zwei kleine Teller mit Pastéis de bacalhau, den goldbraun gebackenen Stockfisch-Küchlein, und eine Metallschüssel mit Reis, gebackenem Tintenfisch, Bohnen und Tomaten.
»Sie sah wirklich noch hungrig aus«, entschuldigte sie sich bei Fernando, als sie die Schüssel vor Raquels Nase stellte.
Raquel stand zum Fressen auf, die beiden Männer blieben sitzen. »Eigentlich wäre das hier ja ein Fall für die Kollegen in Beja«, sagte Dr. Rosa zwischen zwei Fischküchlein.
»Stimmt. Aber der Rechtsmediziner hatte einen Bandscheibenvorfall, und fast das ganze Revier hilft gerade in Porto aus oder ist anderweitig beschäftigt.«
»Das hat mir Ihre Schwester heute Morgen auch schon erklärt. Was ist da eigentlich gerade los in Porto? Aus der Zeitung weiß ich nur, dass es eine unschöne Mordserie gab.«
»Die brasilianische Mafia ist los, deshalb haben die Kollegen Unterstützung angefordert. Fast die gesamte Truppe aus Beja ist gerade im Norden, Tomás Martins und Daniel Figo aus unserem Team sind ebenfalls gefahren.«
»Und Sie?«
Fernando warf einen Blick auf Raquel, die die letzten Reiskrümel aus der Schüssel saugte.
»Die wollten Raquel nicht?« In Dr. Rosas Stimme schwang eine wohldosierte Portion Fassungslosigkeit mit.
»Dumm, nicht wahr?«
»Mehr als dumm«, fand Dr. Rosa.
Fernando zuckte mit den Schultern. Ein paar Tage lang hatte er geglaubt, ein Ortswechsel auf Zeit würde ihm guttun. Einmal rauskommen aus Mafaldas Quinta und dem kleinen Dorf Sonega, in dem ihn jeder kannte und wo ihn alles an Anabela erinnerte.
»Im Grunde genommen ist mir Porto sowieso viel zu groß und die brasilianische Mafia viel zu gefährlich«, erklärte er.
Carla brachte die deftige Tomatensuppe mit Wurst, Brot und Ei. Raquel legte ihr haariges Doppelkinn auf Fernandos Oberschenkel und quiekte jämmerlich, als hätte sie tagelang gehungert.
»Das kann nicht dein Ernst sein«, sagte Fernando, obwohl er eigentlich wusste, dass es ihr immer sehr ernst war, wenn es ums Essen ging. Raquel verstand aber auch, wann es Zeit war, sich geschlagen zu geben. Sie wandte sich ab und versuchte es bei Dr. Rosa. Der versuchte ihr zu vermitteln, dass sie lieber eine Runde ums Dorf rennen solle.
Raquel rannte nicht. Kein kluges Schwein hätte das freiwillig und ohne hinreichenden Grund getan, besonders nicht mit gefülltem Magen. Stattdessen schlenderte sie zur Mitte des Spielplatzes, legte sich neben die Schaukel und quiekte noch einmal kurz, aber besonders laut. Keine Minute später öffnete sich das erste Fenster, und ein kleiner Junge kletterte hinaus. »Das ist deine gute Hose«, schimpfte ihm seine Mutter hinterher, aber da saß er schon neben der großen schwarzen Schweinedame und hatte seine Arme um ihren Hals geschlungen. Nach und nach kamen mehr Kinder und patschten mit ihren kleinen Händen auf Raquels borstiger Haut herum, bis sie vor Wonne ihre Augen schloss.
Fernando und Dr. Rosa löffelten schweigend ihre Suppe. Erst als Carla die Bica brachte – zwei kleine Tassen mit brühend heißem, pechschwarzem Espresso –, begann Dr. Rosa wieder ein Gespräch: »Was haben Sie in den letzten Wochen gemacht? Viel zu tun gab es im Alentejo ja nicht.« Er leerte seine Tasse in einem Schluck.
»Ich erledige Papierkram, lese Romane und versuche Raquel beizubringen, einen Ball auf ihrer Nase zu balancieren.« Während er sprach, rührte Fernando eine ordentliche Portion Zucker in seinen Kaffee – nicht umsonst war der Name Bica ursprünglich die Abkürzung des Werbeslogans »Beba Isto Com Açúcar« gewesen (»Trink dies mit Zucker«).
Dr. Rosa musterte ihn. »Und Sie surfen viel.«
Fernando lächelte und straffte augenblicklich seine Schultern. Er war ein leidenschaftlicher, wenn auch nicht besonders talentierter Surfer und hatte seine Nachmittage in den letzten Monaten tatsächlich oft in den Wellen verbracht. Ihm selbst war es zwar noch nicht so aufgefallen, aber ja, ganz sicher hatte er dabei mehr Muskeln bekommen.
»Die Blessuren in Ihrem Gesicht sind nicht zu übersehen«, fuhr der Rechtsmediziner fort. »Die haben Sie immer, wenn Sie bei rauer See ins Wasser gehen.«
»Verstehe.« Fernando begutachtete sein Spiegelbild in der Fensterscheibe. Tatsächlich waren da Spuren von den letzten Zusammenstößen mit seinem Brett und dem Meeresboden zu sehen: ein Kratzer auf der Nase und ein blauer Fleck am Unterkiefer. Seine Locken standen in alle Himmelsrichtungen ab und bedeckten so immerhin seine leichten Segelohren. Trotzdem war es bald wieder Zeit für einen Haarschnitt. Seine Schultern sahen gar nicht mal so schlecht aus, befand er, aber dieser Bauch …
In diesem Moment erklang aus dem Restaurant ein kurzer Entsetzensschrei.
Die beiden Männer sprangen auf, um ihre Hilfe anzubieten, blieben dann aber an der Eingangstür stehen. Dona Carla stand an der kleinen Theke, mit der einen Hand drückte sie sich den Telefonhörer ans Ohr, mit der anderen hielt sie sich den Mund zu. Diskret kehrten Fernando und Dr. Rosa an ihren Tisch zurück. Der Rechtsmediziner schaute auf seine Uhr und stand gleich wieder auf.
»Falls Sie die Obduktionsergebnisse morgen haben wollen, muss ich jetzt los.« Er bedankte sich für das Mittagessen und verabschiedete sich.
Der Inspektor zog sein Handy aus der Hosentasche und rückte in den Schatten der Hauswand, um zu schauen, was es über die Sundance Community im Internet zu lesen gab. Es dauerte lange, bis sich die Seite öffnete, und ganz kurz, bis sie wieder verschwand. Der Akku war leer, der Bildschirm schwarz.
Fernando legte das nutzlose Gerät vor sich auf den Tisch und winkte der Wirtin, die bald darauf die Rechnung brachte. Ihr Dekolleté war voller roter Flecken.
»Schlechte Nachrichten?«, erkundigte sich Fernando.
Die Flecken krochen ihr den Hals hoch.
»Meine Schwester ist …« Sie stockte einen Moment. »… sie ist schwer erkrankt.«
»Das tut mir aufrichtig leid. Wohnt sie hier in der Nähe?«
Carla guckte etwas verstimmt. Vielleicht, dachte der Inspektor, weil sie ihm schon einmal ausführlich erzählt hatte, wo und mit wem und wie genau ihre Schwester wohnte. Er vergaß solche Details manchmal. Er hatte ja sogar vergessen, dass Dona Carla überhaupt eine Schwester hatte.
»Sie lebt in Kanada«, sagte Carla schließlich und verschwand im Haus.
Fernando schaute auf die Rechnung, einen vergilbten Zettel mit ein paar handgeschriebenen Zahlen. Zweimal sieben Euro für das Mittagsmenü, dazu kamen vier Euro für den Wein und ein Euro für Kaffee – insgesamt neunzehn Euro. Das Essen für Raquel hatte sie gar nicht berechnet. Er nahm fünfundzwanzig Euro aus seiner Tasche und ging hinein. Dona Carla war nirgendwo zu sehen. Er klemmte die Geldscheine zusammen mit der Rechnung unter das altmodische weiße Tastentelefon. Dann holte er Raquel vom Spielplatz, versprach sechs enttäuschten Kindern, dass sie sicher bald wiederkommen werde, und fuhr nach Hause.
5
Noch während sein Pick-up über den buckeligen Feldweg auf die heimatliche Quinta zu hüpfte, sah Fernando Mafaldas Nase. Sie ragte ein kleines Stück aus dem offenen Küchenfenster: eine lange, energische, ja, eine überaus imposante Nase vor einem Stück azurblauer Wand. Sie war nicht nur von stattlicher Größe und unerwarteter Eleganz, sie war auch weit über die Dorfgrenzen Sonegas hinaus bekannt für ihre Fähigkeiten: Mafalda konnte das Wetter vorherriechen.
»Die beste Nase im ganzen Alentejo«, bescheinigten die Leute immer wieder. Woraufhin Mafalda geschmeichelt lächelte, ihre hüftlangen schlohweißen Haare in den Nacken warf und widersprach: »Die beste Nase hat Raquel.«
Das mochte sogar stimmen. Fest stand aber auch, dass Raquels feines Riechwerkzeug, allen Trainingsversuchen zum Trotz, selten dem Gemeinwohl diente. Sie setzte es vorrangig dafür ein, Leckerbissen aufzuspüren.
Fernandos Großmutter dagegen streckte seit Jahrzehnten jeden Morgen und, wenn es Besucher wünschten, auch zu jeder anderen Tageszeit ihre Nase nach draußen, schnüffelte und sagte dann mit beängstigender Zuverlässigkeit voraus, ob man in den nächsten Tagen und Wochen mit Regen, Sonne oder Temperaturveränderungenrechnen musste. Fernandos sehr katholische Mutter Teresa fürchtete, dass ein schwarzer Zauber, wenn nicht gar der Teufel persönlich dahintersteckte. Die kaum bis gar nicht religiösen Bauern und Winzer, die vor Aussaat und Ernte regelmäßig in der Küche der Valentes saßen, empfanden Mafaldas Nase als ein Geschenk Gottes.
An diesem Tag war Salvador gekommen, um Rat zu suchen. Schon von Weitem erkannte Fernando den großen hellblauen Transporter, mit dem Salvador im Winter Brennholz lieferte und im Sommer auch mal Sofas, Kartoffeln oder Schafe transportierte. Auch Patricias privater Wagen, ein alter silberner Audi, stand vor dem weiß-blauen Haus mit rotem Ziegeldach. Fernandos Zwillingsschwester, die zugleich seine Vorgesetzte war, wohnte in einem Apartment nahe der Polizeizentrale in Setúbal, kam sonntags aber meist zum Familienessen nach Sonega.
Fernando stellte seinen alten Pick-up ab, stieg aus, öffnete die hintere Beifahrertür und löste den schwarzen Nylonriemen, der den Anschnallgurt des Autos mit Raquels Brustgeschirr verband. Sie robbte ein Stück vor, ließ sich auf die rotbraune Erde plumpsen und hob prüfend die Nase. Unglaubliche drei Milliarden Riechzellen steckten in ihrem Rüssel, genug, um damit Personen, Gegenstände und vor allem alles Essbare sogar dann zu erschnüffeln, wenn sie etliche Meter weit weg oder gar vergraben waren. Aber diesmal musste sie sich nicht besonders anstrengen. Sogar Fernando, als Mensch mit nur zwanzig, höchstens dreißig Millionen Riechzellen ausgestattet, roch, dass seine Mutter schon jetzt, Stunden vor dem Abendessen, Brot backte, Zwiebeln anbriet und Kohlblätter dünstete. »Morgen müssen wir Sport machen«, sagte Fernando zu sich selbst und zu Raquel, aber die war schon auf dem Weg zum Herd.
Patricia und Salvador saßen am Küchentisch. Vor dem Holzhändler stand eine volle Flasche Aguardente de Medronho. Jedes Jahr im Dezember wanderte er durch die Hügel, sammelte die roten Früchte der wilden Erdbeerbäume und brannte Schnaps. Mit einem Teil davon wollte er nun offenbar Mafalda für die Wettervorhersage entlohnen. Er stand auf, als er Fernando erblickte.
»Was macht die Arbeit? Hat Raquel heute schon einen Mörder gefasst?«, begrüßte er den Inspektor, lachte dröhnend und klopfte ihm so beherzt auf den Rücken, als wolle er mit bloßer Hand ein Stück Holz spalten.
Fernando konnte sich gerade noch beherrschen, um nicht in die Knie zu gehen. »Heute nicht, aber morgen bestimmt«, sagte er und wandte sich Patricia zu.
»Das will ich sehen«, knurrte sie und küsste ihn flüchtig auf die Wangen. Sie war am Anfang strikt dagegen gewesen, ein Schwein in ihr Team aufzunehmen, inzwischen hatte sie sich aber einigermaßen an die eigenwillige Mitarbeiterin gewöhnt, die ja ohnehin sehr selten wirklich mitarbeitete. Ein bisschen war ihr die Schweinedame sogar ans Herz gewachsen.
»Gib ruhig zu, dass du sie liebst«, sagte Fernando.
»Nicht, bevor sie gut gewürzt auf meinem Teller liegt.«
Patricia klemmte sich ihre schwarzen kinnlangen Haare hinter die Ohren und hob die dünnen Augenbrauen, bis ihre Stirn in vielen kleinen Falten lag. Fernando entschlüsselte die Mimik seiner Schwester sofort. Sie wollte wissen, ob die Tote in der Sundance Community eines natürlichen Todes gestorben oder einem Mörder zum Opfer gefallen war.
»Dazu erfahren wir morgen hoffentlich mehr«, antwortete er ebenso kryptisch, weil es keine gute Idee war, vor einem der klatschsüchtigen Dorfbewohner über einen Fall zu reden, auch dann nicht, wenn man noch gar nicht sicher war, ob es überhaupt ein Fall war.
»Hoffen wir das Beste«, entgegnete Patricia. Sie hatte sich in den letzten Wochen sehr gelangweilt, und Fernando erinnerte sich an das, was sie kürzlich gesagt hatte: Wenn nicht bald ein Verbrechen passiere, würde sie eventuell eigenhändig jemanden umbringen.
Teresa, die vor der Arbeitsfläche neben dem Herd stand und Kartoffeln schälte, ließ das Messer sinken, wischte ihre Hände an der grau-blau karierten Kittelschürze ab und schaute erst die Geschwister, dann ihre Schwiegermutter an.
»Mafalda, deine Enkelkinder sprechen in Rätseln«, sagte sie. Seit Fernando denken konnte, schwankte Teresas Stimmlage zwischen leicht beleidigt und sehr bitter – je nachdem, an wie viele unglückliche Umstände in ihrem Leben sie gerade dachte. Es gab genug davon: die ausbleibenden Enkelkinder, den Ehemann, der noch vor der Geburt der Zwillinge in Brasilien verschollen war, die herrische Schwiegermutter, die sich unmöglich kleidete, und natürlich auch die Tatsache, dass ihr die meisten Kittelschürzen schon wieder zu eng geworden waren. Aber an diesem Tag klang sie richtiggehend aufgekratzt.
Patricia und Fernando wechselten einen besorgten Blick. Richtig alarmiert waren sie ein paar Sekunden später, als Teresa, die sonst strikt dagegen war, dass Schweine in der Küche oder aus der Hand gefüttert wurden, Raquel eine halbe Möhre zusteckte.
Mafalda nahm noch einen tiefen Atemzug der Februarluft. Dann drehte sie sich in ihrem Lehnstuhl um, von dem aus sie seit Jahrzehnten die Quinta regierte, nickte Fernando zu und sagte: »Da bahnen sich in den nächsten Wochen und Monaten einige Donnerwetter an.«
Fernando stieg über Raquel, die nun mitten in der Küche vor dem Herd lag und ihre Möhre kaute, ging zu seiner Oma und küsste sie zur Begrüßung auf die Stirn.
»Gewitter bringen Regen und Segen«, folgerte Salvador.
»Das mit dem Segen wäre mir neu«, sagte Patricia.
Salvador strahlte in die Runde: »Geldsegen. Ich überlege, meine Ersparnisse zu investieren und auf der Hälfte meiner Felder Avocadobäume anzupflanzen. Wisst ihr, dass manche Landwirte Avocados als das grüne Gold bezeichnen?«
Mafalda deutete mit ihrer kleinen, blau geäderten Hand auf die Schnapsflasche und nickte ihrer Enkeltochter zu. Patricia stand auf, nahm fünf Gläser aus dem Schrank und schenkte ein. Die Alte nippte an dem klaren Destillat, lächelte und leerte den Rest des Glases. Dann sagte sie: »Avocadobäume sind sehr durstig, und unsere Stauseen sind auch nach dem Winter halb leer.«
Patricia nahm ihr Handy und googelte. »Tausend Liter Wasser gehen für ein Kilo Avocados drauf«, las sievor.
»Aber in der Algarve gibt es doch riesige Avocadoplantagen«, versuchte Salvador, seinen Traum vom großen Geld zu retten.
»In der Algarve gibt es riesige Dummköpfe. Investieren Sie lieber in Kaktusfeigen, die gedeihen auch noch, wenn es hier in zwanzig Jahren richtig heiß und trocken ist«, sagte Mafalda, und damit war das Thema beendet.
Alle tranken noch einen Schnaps, dann zog Salvador von dannen. »Kaktusfeigen«, murmelte er noch, während er die Tür schloss.
»Wo ist Pedro?«, erkundigte sich Fernando. Pedro war ein Junge aus dem Dorf, den er einst beim Fahrraddiebstahl erwischt und laufen gelassen hatte. Kurz darauf hatte Pedro maßgeblich dazu beigetragen, dass die kluge Raquel nicht wie geplant zum Weihnachtsschinken, sondern zum Polizeischwein geworden war. Seitdem hatte Pedro so viele Stunden mit Raquel gespielt und in der Küche der Valentes gesessen, dass er fehlte, wenn er einmal nicht da war.
»Pedro verabschiedet sich von Nelia, sie fliegt doch morgen früh für ein halbes Jahr nach Cambridge«, erinnerte Mafalda ihn.
Draußen röhrte der Motor von Salvadors hellblauem Transporter davon, als hätte er auch ihn mit Selbstgebranntem betankt.
»Was war denn nun eigentlich los heute?« fragte Patricia.
»Ich weiß vermutlich nicht viel mehr als du. Die Verstorbene hat gestern Abend bei einer Ayahuasca-Zeremonie mitgemacht, mittendrin ist sie offenbar nach draußen gegangen und im Kräutergarten tot umgefallen.«
»Und das hat niemand gemerkt?«
»Angeblich nicht. Die anderen waren entweder selber im Drogenrausch oder haben geschlafen.«
»Was sagt Dr. Rosa dazu?«
»Wahrscheinlich das Herz.«
»Klingt nicht sehr aufregend«, sagte Patricia, und sie wirkte ein wenig enttäuscht.
»Wo ist die arme Frau denn gestorben?«, erkundigte sich Teresa.
»Bei São Luís, in dieser Sundance Community.«
Teresa bekreuzigte sich und steckte eine sturmwolkengraue Haarsträhne zurück unter ihr Kopftuch. »Da geht es zu wie in Sodom und Gomorrha. Die nehmen nicht nur Drogen, die sollen auch alle miteinander …« Teresa versagte die Stimme.
»Freie Liebe oder Polyamorie nennt man das – wenn man der Sundance-Philosophie Glauben schenken will, ist das ein möglicher Weg zum Weltfrieden«, erklärte Patricia.
»Das ist Sünde«, beharrte Teresa.
»Lass doch den jungen Leuten ihren Spaß«, meinte Mafalda.
Fernando dachte an die märchenhaft schöne Mieke, die wegen der toten Catarina nicht mal ein bisschen die Fassung verloren hatte, die sich aber über irgendetwas anderes zu ärgern schien. Er dachte auch an Jill, die so verloren ausgesehen hatte. »Ich bin gar nicht mal sicher, dass die da so viel Spaß haben«, sagte er.
6
Als Fernando am nächsten Morgen aufwachte, dachte er an die tote Catarina Brito. Nicht sofort, denn vorher dachte er wie immer an Anabela. Dann auch an Raquel und ans Meer und daran, dass er Frühstückshunger hatte und sein Kopf wehtat. Aber richtig wach war der Inspektor noch nicht, als ihm einfiel, was passiert war und dass er Dr. Rosa wegen der Obduktionsergebnisse anrufen sollte. Schlaftrunken und mit halb geschlossenen Augen griff er nach seinem Handy. Es grunzte, und statt des kühlen Geräts berührte die Hand des Inspektors warme, raue Schweinehaut.
Fernando knipste das Licht an, setzte sich auf und schaute Raquel an, die nicht wie gewohnt auf ihrer Matte lag und schnarchte, sondern neben seinem Bett stand, ihren Kopf auf dem Nachttisch abgelegt. »Seit wann stehst du denn so früh auf?«, fragte er, bevor ihm aufging, dass es gar nicht mehr so früh sein konnte. Durch die Ritzen der geschlossenen Fensterläden fiel immerhin schon Licht ins Zimmer.
Er schob Raquels Kopf zur Seite, dann schaute er auf dem Boden nach seinem Telefon, durchsuchte sein Bett und schließlich auch die Taschen der Jeans, die in der Ecke über einem Stuhl hing.
»Sag nicht, du hast mein Handy aufgefressen«, sagte er zu seinem Schwein und setzte sich zurück aufs Bett. Raquel rieb ihre Schulter an Fernandos Knie. Schweine waren, jedenfalls wenn es um dumme Witze ging, in der Regel sehr nachsichtige Tiere.