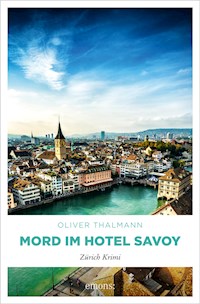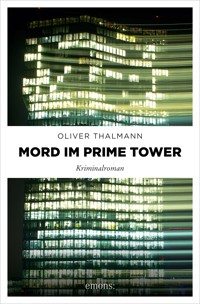Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Monti
- Sprache: Deutsch
Mord ist die beste Medizin Ein mitreißender Kriminalroman in bester »Whodunit«-Manier. Ein Toter im Beichtstuhl, brutal erstochen – Kommissar Monti steckt in seinem wohl ungewöhnlichsten Fall. Das Opfer arbeitete in einer psychiatrischen Klinik, wo Monti es mit gleich elf Verdächtigen zu tun bekommt. Dumm nur, dass sie sich gegenseitig wasserdichte Alibis geben. Kurzerhand zieht Monti in die Klinik ein, um den Mörder aufzuspüren. Doch je tiefer er gräbt, desto gefährlicher wird es – bis er am Ende selbst im Krankenbett landet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oliver Thalmann wurde 1975 geboren und wuchs in Hergiswil bei Willisau im Kanton Luzern auf. Seine Kriminalromane »Mord im Landesmuseum«, »Mord im Prime Tower« und »Mord im Hotel Savoy« landeten auf Anhieb in den Top Ten der Bestsellerliste. Er lebt mit seiner Ehefrau und seinen zwei Kindern im Kanton Zürich.
www.oliverthalmann.ch
Instagram: oliverthalmann.ch
Facebook: oliverthalmann.ch
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, 50667 Köln
www.emons-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: istockphoto.com/Rafael Wiedenmeier, www.wiedenmeier.ch, Psychiatrische Universitätsklinik Zürich, shutterstock.com/elegeyda
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
E-Book-Erstellung: Geethik Technologies Pvt Ltd
ISBN 978-3-98707-318-2
Originalausgabe
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Nicht die Ungleichheit ist das wirkliche Übel,sondern die Abhängigkeiten.
Voltaire
1
Monti schloss den obersten Knopf seines Hemdes. Der Kragen drückte auf den Kehlkopf. Vor ihm lagen fünf Krawatten, und er wählte die rote. Als er sich im Spiegel betrachtete, rümpfte er die Nase. Zwar gefiel ihm der Schlips, aber das kräftige Rot konnte bei seinem Gesprächspartner als zu aggressiv wahrgenommen werden, weshalb er sie zurücklegte und gegen eine azurblaue austauschte, die farblich zu seinem Anzug passte. Blaue Farben signalisieren dem Menschen Sauberkeit, Vertrauen und Loyalität, hatte er einmal gelesen. Genau diese drei Eigenschaften konnte er an diesem Montag gut gebrauchen.
Zuletzt wollte er etwas für die Nase, besser gesagt für die Nase seines Gesprächspartners, tun. Er öffnete den Spiegelschrank, nahm die Parfümflasche und besprühte sein Hemd.
Ein entscheidender Tag stand für ihn an. Einer, an dem er die Weichen für seine Zukunft in die richtige Richtung stellen musste. Deshalb wollte er bella figura machen, wie es seine Mutter immer genannt hatte. Schon als Kind hatte sie ihm anerzogen, sich für besondere Ereignisse wie Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und Gottesdienstbesuche herauszuputzen und dem Anlass angemessen zu kleiden. Es habe noch nie geschadet, sich schön anzuziehen und dem Gastgeber so Respekt zu zollen und nebenbei, und das war eigentlich wichtiger, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Zeitlebens fuhr er mit diesem Ratschlag gut durch das Leben, obwohl sich um ihn herum die meisten Leute, sei es im Privaten als auch im Beruf, je länger, desto weniger um ihr äußeres Erscheinungsbild kümmerten und der Schlabberlook sich ausbreitete wie ein Virus.
Heute fand das Treffen mit dem Staatsanwalt statt. Für einmal saß Monti bei einer Einvernahme auf der anderen Seite des Tisches, musste er doch als Zeuge aussagen. »Einvernahme« war streng juristisch betrachtet der falsche Ausdruck, denn es handelte sich nicht um ein Verhör im Sinne der Strafprozessordnung, sondern um eine inoffizielle Befragung, die das Gesetz so nicht vorsah: ein Gespräch unter vier Augen – ohne Protokoll. Es fand auch nicht in einem der Vernehmungsräume der Staatsanwaltschaft an der Güterstraße, sondern im »Nocciolina« am Bleicherweg statt. In dieser kleinen Bar schätzten sie beide – ohne es auszusprechen – das Risiko als gering ein, dass ihnen ein Beamtenkollege über den Weg laufen und so von ihrer Zusammenkunft erfahren würde.
Die leidige Geschichte, die dieses Treffen erforderte, hatte vor drei Monaten begonnen. Die Kriminalpolizei hatte unter der Leitung von Monti einen Mordfall in der Kunstszene mit Bravour gelöst. Die Verhaftung verlief hingegen weniger erfolgreich, denn der Mörder hatte sich selbst gerichtet. Dies ersparte den Zürcher Steuerzahlern einen Gerichtsprozess, aber es gab eine Nebenwirkung, die ihm bis zum heutigen Tag starke Kopfschmerzen bescherte. Der Täter hatte unmittelbar vor seiner Verhaftung eine E-Mail an die Polizei mit einer Audioaufnahme im Anhang versandt, die es in sich hatte und die Montis Privatleben ins Ungleichgewicht stürzte. Der Mörder warf in der Nachricht Christian Huber vor, ihn erpresst und zum Mord angestiftet zu haben. Und Huber war kein Geringerer als der Vater von Nicole, die Monti eigentlich vor sechs Wochen heiraten wollte. Die Polizei hatte die Mitteilung an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, die sich des Falles annahm.
Für einmal hatte sich Monti juristisch vorbildlich verhalten und sich umgehend vom Fall zurückgezogen. Dennoch brach ein Rattenschwanz von Problemen auf ihn und sein Privatleben ein. Huber hatte den Kontakt zu ihm abgebrochen. Was aber noch viel schlimmer war, er sprach auch nicht mehr mit seiner Tochter, und die sonst üblichen Einladungen zum sonntäglichen Mittagessen blieben aus.
Das Ende seiner Beziehung mit Nicole stünde bevor, hatte Monti befürchtet. Ihre Liebe würde zerbrechen wie ein Krug, der zu Boden fällt. Die Geburt ihres ersten Kindes nahte, und sie stand unter einem schlechten Stern. Müsste er die Hochzeit schon wieder verschieben oder gar absagen? Dürfte er eine Tochter eines Verurteilten heiraten, wenn er weiterhin Leiter Gewaltkriminalität bei der Kantonspolizei Zürich bleiben wollte? Gab es da nicht eine Regel für Polizeibeamte betreffend einwandfreien Leumund in der Familie?
Die Sache mit Nicole gestaltete sich wie ein Wellenbad. In einer ersten Reaktion war ihm eine Druckwelle entgegengekommen. Ausdrücke flogen in seine Richtung, von denen er gar nicht wusste, dass sie in Nicoles Vokabular existierten. Nachdem sich ihr Frust an ihm entladen hatte, profitierte er von dem mildernden Umstand der Schwangerschaft, denn eine alleinerziehende Mutter wollte sie nicht sein. Zudem konnte er ihr zwei Sachen glaubhaft erklären: Erstens, die Erhebung des Tatverdachts gegen ihren Vater kam nicht von ihm oder einem Polizeikollegen, sondern von außen. Und zweitens, und das schätzte Nicole am meisten, dass er sich für Huber einsetzen würde. Letzteres entsprach zwar nicht den Weisungen, den Polizisten unterstellt waren, aber Monti konnte jetzt nicht auf Formalitäten Rücksicht nehmen. Sie schmiedeten zusammen einen Plan, wie man die Situation ausbaden wollte. Monti sollte im Hintergrund die Fäden ziehen, wie er ihr versprach, um auf eine Einstellung des Verfahrens gegen Huber bei der Staatsanwaltschaft hinzuwirken.
Bisher hatte die Staatsanwaltschaft keine Anklage gegen Huber erhoben, und sein Schwiegervater saß weder in Untersuchungshaft, noch hatten die Behörden ihm Auflagen erteilt. Der Fall lag beim »Alten«. So wurde Staatsanwalt Dr. Fritz Kopp liebevoll genannt, in Anlehnung an den Kommissar in der gleichnamigen deutschen Krimiserie. Kopp stand kurz vor dem Ruhestand, verkörperte den Staatsanwalt alter Schule, wie ihn Monti schätzte. Ein Mann, dem sein gesunder Menschenverstand als Kompass bei seinen Entscheidungen diente, meist mit Erfolg. Kopp war für seine Effizienz bekannt. Während seine Kollegen Anklageschriften über Hunderte von Seiten verfassten, gestalteten sich seine Papiere so kurz und bündig wie ein Protokollauszug einer Vereinsversammlung. In letzter Zeit war es ruhiger um ihn geworden. Die Fälle mit Prestige wurden anderen, jüngeren, hungrigen Staatsanwälten zugeteilt. Monti schrieb es der nähernden Pensionierung zu, die anscheinend auf die Motivation und Ambitionen des Alten gedrückt haben musste.
Staatsanwalt Kopp schien den Fall Huber mit der nötigen Sorgfalt und Diskretion zu behandeln. Die Presse bekam auf jeden Fall nichts davon mit, denn zweifelsfrei hätten sie den erfolgreichen Wirtschaftsanwalt Dr. Christian Huber, der trotz Pensionsalter immer noch Verwaltungsratsmandate für Konzerne ausübte, mit Freude auseinandergenommen. Monti war überzeugt, dass Kopp den Fall in Kürze zu den Akten legen und auf eine Anklage verzichten würde. Nicole war anderer Meinung. Sie warf Monti Gesetzesparagrafen an den Kopf. Eine langjährige Gefängnisstrafe würde ihrem Vater im Fall einer Verurteilung drohen. Denn wer jemanden zu einer Straftat anstiftet, musste mit demselben Strafmaß wie der Täter rechnen, das wusste Monti bereits, bevor ihn Nicole auf Art. 24 im Strafgesetzbuch aufmerksam machte.
Monti argumentierte, dass ein Faktor für seinen Schwiegervater sprach: Der Anklagende konnte nicht mehr vorsprechen, lag er doch zwei Meter tief unter der Erde auf dem Friedhof Uetliberg. Anzeigen von Toten hatten noch nie hohe Priorität bei den Staatsanwälten, und wenn es sich bei dem Verstorbenen noch um einen Mörder handelte, würde kein Normalsterblicher diesen Fall vor einem Gericht vertreten wollen. Nun gut, Nicole konnte er nicht vollständig damit überzeugen. Und eine Restunsicherheit blieb auch bei ihm bestehen.
Kopp hatte ihn am Freitag, also vor drei Tagen, auf dem Flur an der Güterstraße angesprochen und ihm gesagt, dass er alle Fakten auf dem Tisch habe, um zu einem Entscheid zu gelangen. Zuvor wolle er aber an Monti als Direktbeteiligten noch ein paar Kontrollfragen richten. Das deutete Monti als gutes Zeichen. Hätten die Indizien gegen Huber gesprochen, würde Kopp nicht eine Extraschlaufe mit ihm drehen. Deshalb hatten sie den dritten Versuch für ihre Hochzeit auf den 20. November terminiert. Und dieses Datum rückte immer näher.
Der Showdown stand bevor. Auf keinen Fall dürfte es im Gespräch mit Kopp nach Nepotismus aussehen. Das war die Sorge Nummer eins, die Monti hatte. Er war befangen, nicht neutral, aber er kannte den Fall als Insider wie kein anderer. Das wusste Kopp alles, trotzdem oder gerade deshalb wollte er ihn zum Fall befragen. Das rechnete Monti ihm hoch an.
Sich auf ein Gespräch vorzubereiten, bei dem er weder eine Traktandenliste noch einen Fragenkatalog zur Vorbereitung erhalten hatte, gestaltete sich schwieriger für ihn, als er sich vorgestellt hatte. Mit Nicole hatte er am Vorabend das Gespräch simuliert. Sie war als Journalistin und Fernsehmoderatorin die ideale Sparringspartnerin. Sie kannte den Fall, war die Tochter des Beschuldigten, konnte hartnäckig und kritisch auftreten, hatte ihm Fragen, die unterschiedlicher nicht sein konnten, gestellt, und auch solche, die ein Ermittler nie stellen würde. Es fühlte sich für ihn an, als schlüge sie in ihrer Vernehmung härter zu, als es Mike Tyson zu seiner besten Zeit im Boxring getan hatte. Sie kannte seine Schwächen, nutzte sie aus und führte ihn das eine oder andere Mal aufs Glatteis. Er schwankte, fiel aber nicht um, wie sie ihm zugestand.
»Wie sehe ich aus?«, fragte er, als Nicole das Zimmer betrat.
Sie richtete seinen Hemdkragen und musterte ihn. »Am Aussehen sollte es nicht scheitern.«
Monti schaute auf die Uhr. Acht Uhr. In dreißig Minuten musste er im »Nocciolina« sein. Als er sein Veston angezogen hatte und Nicole einen Abschiedskuss auf den Mund drückte, läutete sein Telefon. Der Drache leuchtete auf dem Display. Das bedeutete nichts Gutes.
»Monti, Sie müssen ausrücken. Wir haben einen Toten im Burghölzli. Es sieht nach Mord aus«, sagte Polizeikommandantin Angela Bitterli in dem ihr angeborenen harschen Ton.
»Kann das nicht Urech übernehmen? Ich muss dringend –«
Bitterli fiel ihm ins Wort. »Wo sind wir denn hier? Das ist kein Wunschkonzert, Monti. Gewaltverbrechen fallen in Ihren Zuständigkeitsbereich, wenn ich mich nicht täusche. Zudem hat Herr Urech heute freigenommen.«
Monti stellte das Telefon auf stumm und fluchte, während die Kommandantin sich über seine Haltung beklagte und etwas von Ferienabsenzen und Personalmangel faselte. Er überlegte sich, Urech anzurufen und ihn zu bitten, seinen Dienst zu übernehmen. Als er auf seine Uhr blickte, verwarf er die Idee umgehend, denn es war der 1. November: Allerheiligen. Die Katholiken gedachten ihrer Toten, und sein Dienstkollege ging wie jedes Jahr zu seiner Familie ins Luzerner Hinterland, um genau das zu tun.
Nicole, die das Gespräch mitgehört hatte, stand wie paralysiert neben ihm.
»Die Spurensicherung und die Rechtsmedizin sind bereits vor Ort. Jetzt ist Tempo gefragt. Machen Sie sich auf den Weg!« Bitterli beendete das Gespräch, bevor Monti ihr widersprechen konnte. Es ertönten nur noch die Impulstöne in der Leitung. Das Drachenbild verschwand vom Display, und er legte das Smartphone auf den Tisch.
Nicole starrte ihn an. »Was gedenkst du zu tun?«
Monti entledigte sich der Krawatte. »Ich rufe Kopp an, und wir verschieben den Termin. Auf einen Tag mehr oder weniger kommt es jetzt auch nicht mehr an.«
So viel zu bella figura machen.
Nicole schüttelte den Kopf, sagte nichts und lief von ihm weg.
Schlechter hätte der Tag nicht beginnen können.
2
Ein Windstoß schlug Monti ins Gesicht, als er die Seefeldstraße entlanglief. Der Herbst hatte Einzug gehalten. Trotz der Kälte entschied er sich, zu Fuß an den Tatort zu gehen. Sein Smartphone zeigte ihm eine Marschzeit von fünfundzwanzig Minuten an, mit dem Tram hätte er fünf Minuten gespart, aber er versuchte, zwei Fliegen auf einen Streich zu schlagen. Während seines Marschs zur Klinik wollte er frische Luft tanken und Kopp anrufen, um dessen Fragen zum Fall Huber am Telefon zu beantworten.
Er erreichte Kopp auf Anhieb, dieser saß bereits im »Nocciolina« und wartete auf ihn. Nachdem der Alte zuerst spürbar verärgert über die Absenz reagiert hatte, brachte er am Schluss doch noch Verständnis für den Notfall auf, dem Monti den Vorrang gab. Das Gespräch zum Fall Huber hingegen wollte Kopp mit Monti nicht über die Telefonleitung führen, sondern von Angesicht zu Angesicht. So vereinbarten sie, sich in drei Tagen, am Donnerstag, zur selben Uhrzeit am selben Ort zu treffen. Montis Plan war gescheitert. Die Ungewissheit blieb bestehen.
Er griff zum Telefon und rief Nicole an, teilte es ihr mit, versuchte dabei, das Ganze als Erfolg, als Schritt in die richtige Richtung zu verkaufen, was sie anders sah. Sie fluchte, wieder würde wertvolle Zeit vergehen, ohne dass sie wüssten, wie das Verfahren für ihren Vater weiterginge. »Das geht doch nicht. Kann er sich ewig Zeit nehmen für die Untersuchung? Gibt es keine Fristen, die ein Staatsanwalt einhalten muss?«
Nein, das hatte die Legislative vergessen festzulegen oder, wie er vermutete, mit Absicht unterlassen, in den Gesetzen festzuhalten. »Es kommt alles gut. Wenn es einen Hauch von Zweifel an der Unschuld deines Vaters gäbe, hätte Kopp schon längst Anklage erhoben und würde nicht mit mir über den Fall sprechen.«
»Du bist und bleibst ein Optimist, Fabio.« Es tönte nicht, als ob sie es als Kompliment gemeint hätte.
So waren ihre Charaktere verschieden: er ein Daueroptimist, sie die Journalistin, die alles immer kritisch hinterfragte.
Monti beendete das Gespräch, als er die Lenggstraße erreicht hatte. Den Blick nach oben zum Hügel gerichtet, sah er das Ziel seines Marsches: das Burghölzli. Das war der Name, den der Volksmund für die Psychiatrische Universitätsklinik, die PUK, verwendete. Natürlich kannte er die Umgebung. Die Klinik, in seiner Kindheit verwendeten die meisten Personen umgangssprachlich den Begriff Irrenanstalt, hatte er weder privat noch beruflich je von innen gesehen. Sie thronte auf einer Anhöhe. Ein Zaun trennte sie auf der Westseite vom Wald und einem Rebberg, auf dem statt Blauburgunder nun die Biosorte Souvignier Gris angebaut wurde, wie er auf einer Tafel las. Ein Spazierweg führte zwischen der Klinik und dem Rebberg hindurch. Ein Verbotsschild signalisierte die Feuerwehrzufahrt. Das erinnerte ihn an die Brandkatastrophe vom 6. März 1971. Achtundzwanzig Menschen verloren dabei ihr Leben, da die Feuerwehr die eingesperrten Patienten hinter den verschlossenen Türen und vergitterten Fenstern nicht retten konnte.
Als er den Vorplatz betrat, sah er auf dem Parkplatz die ihm vertrauten Karosserien seiner Dienstkollegen. Die Absperrbänder fehlten hingegen. Weshalb hatten die Polizisten vergessen, den Tatort abzuriegeln? Das irritierte ihn, er schrieb es einer Nachlässigkeit zu, die bei ihm am Montagmorgen ein gewisses Verständnis weckte.
Die Nummer 31 hing am Haupteingang der Klinik. Die Tür war verschlossen. Er blickte durch die Scheibe. Leer. Die Rezeption war nicht besetzt.
Monti nahm sein Telefon und rief Michael Hafner von der Spurensicherung an, der ihn abholte. Der Empfangsbereich verfügte über einen Marmorboden. Sie liefen die sechs Treppen hoch, ein Schild zeigte eine Verzweigung an. Sie gingen nach rechts, am Empfangsschalter vorbei, bogen links ab und liefen durch einen schmalen, überdachten Gang im Innenhof, der mit Steinplatten und Kopfsteinpflastermosaik versehen war. Sie passierten die Trakte A, B, C und D, wo die Patienten ihre Zimmer hatten, bis sie durch eine Türe nach draußen in den Hinterhof traten. Sie schritten am Feuerwehrgebäude und an der Kantine vorbei. Dort erblickte Monti zwei uniformierte Polizisten, die vor einem Absperrband patrouillierten. Von wegen Nachlässigkeit.
Eine Kirchenglocke läutete dreimal. Es war Viertel vor neun. Sie schritten zur Kapelle. Diese lag auf der Westseite des Geländes versteckt hinter der Kantine und grenzte an den Waldhügel. Vor der Eingangstür blieben sie stehen, und Monti studierte die angebrachte Tafel.
Gottesdienst jeweils am Mittwoch, 19.00 Uhr,
und am Sonntag, 9.00 Uhr.
Beichten jeweils Dienstag, 17.00–18.30 Uhr.
Hafner öffnete die Tür, und sie traten ein.
Monti traute seinen Augen nicht. Mitten im protestantischen Zürich stand ein katholisches Gotteshaus mit Prunk, so weit das Auge reichte. Die bemalten hohen Fenster, der prächtige Orgelflügel, der über ihm ragte, und die Engelsbilder an der Decke faszinierten ihn immer wieder aufs Neue. Einzig die Sitzkissen, die heutzutage in allen Kirchen dem Allerwertesten mehr Komfort boten, gab es früher noch nicht. Die Kapelle musste zu einer Zeit gebaut worden sein, als der Katholizismus noch aus dem Vollen schöpfen konnte. Die heutigen Neubauten, davon gab es erstens sehr wenige, und zweitens waren sie für seinen Geschmack zu spärlich bestückt und erinnerten ihn eher an protestantische Kirchen, die über eine dezentere Ausstattung verfügten.
Die Absätze der Lederschuhe der beiden hallten, als sie den Mittelgang erreichten. Monti stoppte beim Weihwasserbecken, tauchte zwei Finger hinein und bekreuzigte sich. Eine Angewohnheit, die ihn seine Eltern beim ersten Betreten einer Kirche gelehrt hatten. Als gläubig durfte er sich im Gegensatz zu seinen Eltern nicht bezeichnen, dafür sah er die Innenseiten der Kirchen viel zu selten. In seiner Jugendzeit lag die Situation anders, nahmen ihn seine Eltern am Sonntagmorgen immer zum Gottesdienst mit. Damals erschien es ihm als notwendiges und langweiliges Übel, er hatte keine andere Wahl, und er ließ das Ganze über sich ergehen, um den Familienfrieden nicht zu untergraben. Mit zunehmendem Alter wurden seine Messebesuche rarer, dafür gefiel ihm die Atmosphäre in der Kirche besser als früher. Die Langeweile wich der Ruhe, die er nun schätzte. Hier konnte man für eine Stunde innehalten, niemand störte einen, und man konnte seine Gedanken zu seinem eigenen Leben kreisen lassen.
Es roch nach Lavendel, Zimt und Fäulnis. Letzteren Geruch kannte er von den vielen Leichen, die er in seinem Leben bereits gesehen hatte. Man wurde nie immun gegen diesen Gestank.
Ein Blitz riss ihn aus seinen Gedanken. Der Fotograf von der Spurensicherung schoss mit seiner Spiegelreflexkamera Bilder vom Beichtstuhl, der aus drei Kabäuschen ohne Türen bestand. Unter der linken Kabine ragte eine Blutrinne hervor. Die dunkelgrauen Gardinen versperrten Monti die Sicht auf die Innenseite, wo gewöhnlich die Beichtenden und der Beichtvater ihre Plätze einnahmen.
Monti lief auf die andere Seite. Jetzt erblickte er den Toten. Ein Mann mit kurzen braunen Haaren und einem Dreitagebart lag auf der Kniebank: regungslos, zusammengesackt, abgedreht und blutüberströmt. Das Opfer starrte zur Decke, als ob es sich Hilfe vom Himmel erhofft hätte. Vergeblich. Die Rettung von oben war ausgeblieben. Der Mann wurde erstochen.
Er trat näher an die Leiche heran. Der Mund des Toten war weit aufgerissen, als sei er überrascht gewesen, wer ihn umbringen wollte. Auf der Höhe des Brustkorbes hatten sich Blutflecken zentriert. Von dort aus rann das Blut hinunter und zeichnete einen Streifen, der einem Wasserfall glich. Die schwarze Lederjacke, die mit Nieten überzogen war, wies Einstichlöcher auf. Die Bluejeans hatten nicht mehr viel von ihrer Ursprungsfarbe übrig, das lag weniger am Blut, das sie tränkte, sondern daran, dass sie verwaschen waren.
Die Blutspur am Boden war eingetrocknet, die Farbe bereits von Rötlich zu Bräunlich übergegangen, aber noch nicht zu Dunkelbraun. Die Tat musste sich vor weniger als zwölf Stunden ereignet haben, sagte ihm seine Erfahrung.
3
»Wer hat die Leiche gefunden?«, fragte Monti.
Hafner drehte den Kopf zur Seite und zeigte zur Person, die auf der Treppe vor dem Altar kniete und betete. Sie liefen zum Betenden, der sie nicht bemerkte, als sie hinter ihm standen.
Monti hustete.
Der Mann bekreuzigte sich, stand auf, wandte sich ihnen zu und reichte Monti die Hand. Er trug ein weißes liturgisches Gewand mit einem großen goldenen Kreuz, das auf seiner Brust lag, und eine weiße-beige Stola hing um Hals und Schultern. Er hatte einen hohen Haaransatz und gewellte braune Haare. Er war etwas kleiner als Monti, dafür etliche Kilos schwerer.
»Xaver Waldvogel«, stellte er sich vor und reichte ihnen die Hand. »Ich bin der Pfarrer.« Der Diener Gottes sprach mit ruhiger und bedächtiger Stimme, so wie es Monti von dem Seelsorger in seiner Kindheit in Erinnerung hatte.
»Was ist passiert?«, fragte Monti.
Pfarrer Waldvogel umfasste das Kreuz, das um seinen Hals hing. »Als ich heute Morgen die Kapelle betrat und zum Altar lief, sah ich die Blutspur.« Jetzt drückte er seine Hand zur Faust um das Kreuz. »Dann bin ich zum Beichtstuhl gelaufen und habe Herrn Benz gesehen. Ich fühlte seinen Puls am Hals und am Handgelenk. Es war zu spät. Gott hatte ihn bereits zu sich gerufen.«
»Sie kannten den Toten?«, fragte Monti.
»Natürlich. Herr Benz amtete als Sigrist hier, und er war Hauswart.«
»Um welche Zeit haben Sie ihn gefunden?«
»Um halb sieben.«
»Waren Sie allein?«
»Ja, um diese Zeit ist niemand in der Kapelle.«
»Und dann haben Sie die Polizei kontaktiert?«
Waldvogel schüttelte den Kopf. »Nicht sofort, muss ich gestehen. Ich rannte zum Eingang der Klinik, ich wollte den Chefarzt Herrn Professor Dr. Oechslin herbeirufen, aber der war nicht da.«
»Weshalb hätte er bereits in der Klinik sein sollen? Um diese Zeit arbeitet doch noch niemand?«
»Oh, da täuschen Sie sich. Professor Dr. Oechslin ist ein Frühaufsteher wie ich.«
»Na gut. Was haben Sie dann unternommen?«
Waldvogel schilderte, wie er den stellvertretenden Klinikdirektor Dr. Huggenberger auf dem Vorplatz der Klinik antraf und sie gemeinsam zurück in die Kapelle gingen.
»Der Klinikdirektor weilt zurzeit in Behandlung im Ausland. Er ist schwer krank. Aber Herr Huggenberger ist auch ausgebildeter Mediziner und wollte sich selbst ein Bild von der Situation verschaffen. Er meinte, vielleicht könne er Benz noch retten. Er fühlte den Puls des Opfers und kam leider zum selben Schluss wie ich: Herr Benz war tot. Und dann rief ich die Polizei an.«
Waldvogel führte sie durch die Kapelle und zeigte ihnen die Empore, wo die Orgel stand, die Sakristei und den Umkleideraum der Ministranten. Als die Führung durch das Gotteshaus beendet war, bemerkte Monti, wie Waldvogel eine Träne über die Wange hinunterlief. Dieser schien es selbst zu bemerken und wollte sich von den Ermittlern verabschieden.
»Herr Waldvogel, Sie müssen noch hierbleiben.« Monti wollte DNA und Fingerabdrücke vom Pfarrer nehmen, aber die Anweisung dazu blieb in seinem Hals stecken.
Waldvogel nickte. »Ich verziehe mich in die Sakristei, falls das genehm ist.«
Monti bejahte.
Hafner und Monti gingen zurück zum Tatort, und Hafner sagte mit leiser Stimme: »Den Pfarrer scheint es ziemlich mitgenommen zu haben.«
»Wie würdest du reagieren, wenn in deiner Kapelle eine Leiche auf dem Beichtstuhl sitzt? Es ist keine einfache Zeit für die katholische Kirche. Die Mitglieder laufen reihenweise davon, ein Missbrauchsskandal jagt den anderen, und jetzt kommt noch ein Mord hinzu.«
»So spielt das Leben manchmal. Die Probleme kommen nicht immer im gleichen Rhythmus auf einen zu, sondern häufig in konzentrierter Form, als ob sich alles gegen einen verschworen hätte.«
»Was sagt der Rechtsmediziner? Sind Substanzen im Spiel?«
Hafner unterbrach ihn. »Benz ist ganz sicher kein Junkie, maximal Alkoholiker, wenn du mich fragst.« Er deutete auf die dicke rote Nase des Opfers. »Der Rechtsmediziner wollte zu beidem noch nichts sagen. Erst nach der Obduktion würde er eine Aussage dazu machen.«
Etwas anderes hätte Monti überrascht. Die Rechtsmediziner waren vorsichtige Menschen, die gerne in Ruhe ihre Arbeit verrichteten, um keine voreiligen Schlüsse zuzulassen. Monti konnte im Gegensatz zu Hafner nicht beurteilen, ob der Mann Drogen oder Alkohol konsumiert hatte.
Sie liefen zurück zum Beichtstuhl. Die Blutspur, die aus der Beichtnische auf den Steinboden lief, verlief gewellt wie eine Schlange. Monti kniete nieder. Die Linie auf dem Boden war höchstens dreißig Zentimeter lang.
»Der Kampf fand im Beichtstuhl statt«, sagte Monti zu Hafner. Daran bestand kein Zweifel. Wenn der Täter das Opfer in den Beichtstuhl gezogen hätte, wäre die Blutspur dicker und länger gewesen.
Das Opfer musste sich im Inneren des Beichtstuhls nicht lange gewehrt haben, als der Täter es von hinten oder von der Seite überrascht und zugestochen hatte. Denn an den Wänden konnten die beiden Ermittler wenig Blut und nur ein paar Spritzer und Flecke ausmachen. In der mittleren Kabine, wo der Pfarrer normalerweise saß, gab es keine Spuren, die auf einen Kampf hinwiesen. Die rechte Kabine war ebenfalls makellos.
Weshalb war Benz nach Mitternacht zum Beichtstuhl gegangen? So spät in der Nacht wollte doch selbst der gläubigste Katholik nicht beichten. Und weshalb wusste der Mörder, dass das Opfer sich in der Kapelle aufhielt? Hatte er ihm aufgelauert? Oder gingen sie gemeinsam zum Tatort?
Montis Hirn tat, was es immer tat, wenn es an einen Tatort gelangte. Es begann zu spekulieren, stellte Hypothesen auf, bevor er die Fakten auf dem Tisch hatte. Er rekonstruierte den Tatablauf. Erstens, der Mörder hatte seine Tat in diesem Gehäuse verübt. Zweitens, der Leichenfundort entsprach dem Tatort. Drittens, der Täter verzichtete darauf, die Leiche an einen anderen Ort zu schleppen oder gar zu verstecken, was die Aufgaben der Ermittler erleichterte.
Er malte sich zwei Szenarien aus, was sich vor der Tat abgespielt hatte.
Szenario eins: Benz hatte sich mit dem Täter in der Kapelle verabredet. Das Weshalb blieb abzuklären.
Szenario zwei: Benz ging tatsächlich zur Beichte: allein, eine Angewohnheit, ein Ritual. Und das war dem Mörder bekannt, und er hatte dem Benz aufgelauert, folgte ihm zum Beichtstuhl, überraschte ihn und metzelte ihn dort nieder.
Das zweite Szenario hielt er für weniger wahrscheinlich. In der Kapelle hallte es. Benz hätte die Schritte seines Vollstreckers hören müssen und wäre gewarnt gewesen. Sicherlich hätte er sich zum Beichtstuhl rausgelehnt und geschaut, wer um diese Zeit noch die Kapelle betrat.
Ein Schrei riss Monti aus seinen Gedankengängen. Das Echo im Gotteshaus schien die Lautstärke zu erhöhen.
Er drehte sich um.
»Kommen Sie!« Waldvogel winkte ihnen wie wild zu. »Ich habe etwas gefunden.«
Hafner und Monti rannten die Treppe hinauf am Altar vorbei zum Pfarrer, der vor dem Taufbecken stand. Dort, wo sonst Babys schreiend ins Wasser getaucht wurden, lag keine Flüssigkeit, sondern ein Gegenstand, der nicht dorthin gehörte: ein Kruzifix.
»Sehen Sie sich das an«, sagte Waldvogel und zeigte auf die Blutspuren, die das Kreuz aufwies und die dessen Goldlegierung überdeckten. »Die Tatwaffe.«
Das könnte hinkommen, dachte Monti, denn die eingetrocknete Farbe des Bluts auf dem Kruzifix passte schon einmal zu derjenigen auf der Leiche. Er streifte sich Handschuhe über und nahm das Kreuz in die Hand. Es war schwerer, als er gedacht hatte. Womöglich handelte es sich nicht um eine Legierung, sondern es war aus echtem Gold.
Waldvogel wandte sich von ihnen ab und lief in Richtung Altar, als ob er dem Anblick entfliehen wollte.
Monti folgte Waldvogel, der sich nach ihm umdrehte und ihm antwortete, bevor er seine Frage gestellt hatte. »Das Kruzifix gehört uns. Ich verwende es im Gottesdienst, segne damit den Leib Christi und am Schluss der Messe die Leute. Wer missbraucht es für eine so schreckliche Tat?«
Dieselbe Frage stellte sich Monti auch. Und weshalb ein Kruzifix? Es gab geeignetere Tatwaffen, um einen Mord zu begehen. Instrumente, die den Tod mit einer Bewegung herbeiführen konnten, wie ein Messer, eine Pistole, eine Spritze oder ein Hammer. Mit dem Kruzifix musste der Täter mehrmals auf das Opfer eingestochen haben, bis es aus dem Leben schied. So dachte er zumindest. Erfahrung mit Kreuzen als Mordwaffe hatte er keine.
Das Kreuz musste nicht nur einen seelischen Wert aufweisen, sondern auch einen hohen finanziellen, wenn es tatsächlich aus purem Gold bestand, weshalb es Waldvogel sicherlich an einem gut gehüteten Ort aufbewahren musste. »Wo bewahren Sie das Kruzifix auf?«
»Ich lege es immer hier unter die Bibel, so vergesse ich es nie, habe es immer griffbereit.« Waldvogel zeigte auf die Heilige Schrift, die in der Mitte des Altars lag.
Das war fährlässig. Ein Wunder, dass niemand das Kreuz klaute, dachte Monti und bemerkte, wie sich die Miene beim Pfarrer verfinstert hatte.
»Fand der Gottesdienst gestern statt?«
»Ja, wie an jedem Sonntagvormittag.«
Die Messen würden zwar von weniger Leuten besucht als früher, aber er habe ein treues Publikum: Patienten und Mitarbeiter der Klinik, aber auch Außenstehende fänden regelmäßig den Weg in die Kapelle, erzählte der Pfarrer. Das Gleiche sei mit den Beichten. Das Interesse an seinen Sprechstunden, wie der Klinikdirektor und sein Stellvertreter die Beichten der Patienten nannten, habe in all den Jahren nie nachgelassen.
Waldvogel bat Monti, in die Sakristei einzutreten. Dort schenkte sich Waldvogel einen Brandy in einen Zinnbecher ein. Er brauche etwas Starkes, er fühle sich schwach, sagte er und bot auch Monti einen an. Monti lehnte ab, obwohl sein Blutzuckerspiegel eine Krise verzeichnete und nichts gegen eine Stärkung einzuwenden gehabt hätte, aber Brandy konnte er nicht ausstehen.
Während Waldvogel auf dem Stuhl saß und an seinem Drink nippte, ging Monti zurück zu den Kollegen der Spurensicherung. Die Forensiker diskutierten, ob und, falls ja, wie man mit einem Kruzifix mit der Größe einer Handfläche einen Menschen umbringen könnte.
Monti interessierte sich für etwas anderes. »Weshalb gibt es keine Blutstropfen auf dem Boden? Der Täter hatte doch sicherlich auch Blut vom Opfer an den Schuhen, als er aus der Kapelle rauslief.«
»Entweder agierte der Täter mit hoher Sorgfalt …«, sagte Hafner.
Monti unterbrach ihn. »… oder er hat den Boden nach der Tat gereinigt.«
»Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das ist nämlich gar nicht so einfach«, sagte Hafner.
»Weshalb ist Putzen so schwierig?«, fragte Monti.
»Das Blut kriegst du fast nicht aus diesen Steinböden heraus. Schon gar nicht mit herkömmlichen Putzmitteln.«
Monti legte sich auf den Boden und schnupperte. »Es riecht weder nach Putzmittel noch nach Säure.«
Hafner nahm die Kamera in die Hand und knipste ein paar Fotos vom Kruzifix. »Ich bin Atheist, aber du als Katholik kannst mir sicher meine Frage beantworten: Ist die Kapelle immer zugänglich?«
Monti kannte die Antwort darauf ebenfalls nicht. »Fragen wir den Pfarrer.«
Sie gingen zurück in die Sakristei, wo Waldvogel immer noch am Tisch vor seinem Brandy saß.
»Herr Pfarrer, wird die Kapelle nach den Gottesdiensten abgeschlossen?«, fragte Monti.
Waldvogel zuckte zusammen, als ob er sie nicht bemerkt hätte. »Tagsüber ist sie offen für alle. Um zweiundzwanzig Uhr schließe ich die Kapelle mit meinem Schlüssel.«
»Auch gestern Abend?«
»Nein, gestern Abend war ja die Halloween-Party, da habe ich sie erst abgeschlossen, als ich das Fest verließ. Das muss gegen Mitternacht gewesen sein, würde ich schätzen.«
»Halloween-Party?«, fragte Monti überrascht. Jetzt ergab die Lederjacke mit den Nieten von Benz Sinn.
Waldvogel erläuterte ihnen, dass die Klinikleitung auf Anregung eines amerikanischen Patienten für die Suchtkranken diesen Anlass durchführte, um ihnen so eine kleine Freude zu bereiten.
»Und heute Morgen als Sie die Kapelle betraten, war die Tür verschlossen?«
»Nein, zu meinem Erstaunen war sie offen. Ich dachte zuerst, ich hätte sie gestern Abend vergessen zu schließen.«
»Sind Sie der Einzige, der einen Schlüssel für die Kapelle hat?«
Waldvogel zögerte kurz. »Nein, Herr Benz besaß auch einen. Er öffnete und schloss die Kapelle, wenn ich nicht zugegen war.«
Hafner bestätigte, dass Benz diesen Schlüssel in seiner Hosentasche trug.
»Wo bleibt der Staatsanwalt eigentlich?«, fragte Monti, als Hafner und er zurück zur Leiche liefen.
»Keine Ahnung. Der sollte schon längst hier sein. Vielleicht hat der gestern Abend auch Halloween gefeiert.«
Monti nutzte die Pause, um mit Daniela Lüscher zu telefonieren. Die Cyberspezialistin, die sonst die Welt der Daten durchwühlte, musste für einmal in den Außendienst und ihm bei den Vernehmungen assistieren.
In diesem Moment öffnete sich die Pforte, und Staatsanwalt Müller kam im Stechschritt dahermarschiert. Mit seinem schwarzen Anzug und grauer Krawatte hätte er auch als Seelsorger durchgehen können. Er warf einen Blick auf die Leiche in dem Beichtstuhl und sagte: »Wo dreht sich die Welt noch hin? Viel makabrer geht es nicht mehr.«
»Stil haben Mörder selten, Herr Staatsanwalt«, sagte Monti.
»Was haben Sie in Erfahrung gebracht, meine Herren?«
Monti fasste die Erkenntnisse für Müller zusammen, die sie gesammelt hatten.
Der Staatsanwalt schaute die Ermittler an. »Sie denken, er ist mit dem Kruzifix erstochen worden?«
Die beiden hoben die Schultern, bevor sie gemeinsam nickten.
»Das ist nicht die typische Mordwaffe. Kann man mit einem Kreuz jemanden so zurichten?« Müller sprach in seinem üblichen kritischen Ton, in dem er alles stets hinterfragte, was die Ermittler meinten, herausgefunden zu haben.
Hafner deutete auf die Kanten des Kruzifixes, die spitzig genug für eine solche Tat seien, wenn es auch effizientere Tatwaffen gäbe.
»Der Täter muss sich in der Kapelle gut ausgekannt haben. Wem kommt es schon in den Sinn, das Kruzifix unter der Bibel zu finden?«, fragte Müller.
Waldvogel lief an ihnen vorbei, begrüßte Müller mit Handschlag und teilte ihnen mit, er würde kurz an den Empfang der Klinik gehen, um mit Huggenberger, dem stellvertretenden Klinikdirektor, zu sprechen.
Müller fand das keine gute Idee und meinte, es wäre besser, wenn der Pfarrer hier in der Kapelle bleiben würde.
Waldvogel sah ihn verdutzt an, nickte und ging zurück in die Sakristei.
Als dieser sich außer Hörweite befand, wandte sich der Staatsanwalt zu Monti. »Der Priester hat neben dem Hauswart und Sigrist den einzigen Schlüssel, kennt den Ort besser als alle anderen, er weiß, wo sich das Kreuz befindet, und eine Sache, die mich stutzig gemacht hat, haben Sie, meine Herren, übersehen.«
»Was hat Ihr Adlerauge gesehen, was uns Normalsterblichen entgangen ist?«, fragte Monti.
Müller wippte mit dem Kopf in Richtung Ausgang. Sie liefen aus der Kapelle, der Staatsanwalt ein paar Schritte voraus, und als sie draußen waren, zeigte Müller mit dem Zeigefinger auf die Tafel an der Eingangstür. Er schien seinen Erkenntnisvorsprung sichtlich zu genießen und kostete es aus, sie in einer Stimmung der Angespanntheit zu lassen.
Monti zog die Augenbrauen zusammen und schaute Hafner fragend an, der auch baff war.
»Die Kleidung, die der Pfarrer trägt, passt nicht ins Bild. Sie ist Show. Er hat einen Fehler begangen«, sagte Müller.
»Warum? Das ist eine Robe, ein Gewand, das die Pfarrer während des Gottesdienstes tragen. Das ist Brauch in der katholischen Kirche.« Monti vermutete, dass Müller in seiner Kindheit in einer protestantischen Umgebung am Zürichsee aufgewachsen war, mittlerweile sicherlich Atheist war, um ein paar tausend Franken Kirchensteuern zu sparen, und so keine Ahnung von der Kleidung hatte, welche die Geistlichen in den Messen trugen.
»Das weiß ich auch«, sagte Müller eingeschnappt. »Aber heute Vormittag stand keine Messe auf dem Programm, wie unschwer zu erkennen ist.« Er klopfte auf die Tafel mit den Gottesdienstzeiten an der Tür. »Wenn heute keine Messe stattfindet, braucht es auch kein Gewand, wenn ich mich nicht irre. Oder laufen eure Pfarrer vierundzwanzig Stunden mit der Robe umher?«
Punkt für Müller. Der Staatsanwalt mochte ein mühsamer Wadenbeißer sein, aber ein wacher Zeitgenosse war er allemal. Solchen Typen entgingen dann halt auch die kleinsten Ungereimtheiten nicht.
Weder Hafner noch Monti widersprachen ihm. Sie hatten das Offensichtliche, das sich vor ihren Nasen gezeigt hatte, schlichtweg übersehen.
»Und was schließen Sie daraus?«, fragte Monti rhetorisch.
»Der Priester hat seine Kleidung gewechselt. Vielleicht hatten die alten Kleider Blutspuren erhalten, und der Priester musste sie austauschen.«
»Sie denken doch nicht, dass der Pfarrer die Tat verübt hat?«, fragte Hafner.
»Wieso nicht? Er wäre nicht der erste Geistliche, der eine Straftat verübt. Ausschließen lässt sich im Strafrecht gar nichts. Wir gehen mit offenen Augen durchs Leben. Geistliche genießen bei mir keine Immunität. Vor dem Gesetz sind alle gleich.«
Monti stand verdutzt da.
»Wir haben einen Anfangsverdacht. Ich würde Ihnen empfehlen, den Herrn vorläufig –«
Monti unterbrach Müller. »Sie wollen, dass wir ihn festnehmen? Ist das nicht etwas voreilig?«
»Sie überraschen mich jedes Mal wieder aufs Neue, Monti. Sie sind es doch, der sonst immer mit seinen impulsiven, kreativen und hirnrissigen Ideen zu voreiligen Schlüssen gelangt. Und jetzt, wo einmal ein rasches Handeln angebracht und erforderlich ist, vergraben Sie sich in einem Maulwurfsloch.«
»Manchmal sticht man bloß in ein Wespennest.«
»Machen Sie die Sache nicht komplizierter, als sie ist. Die Indizienlast gegen den Priester ist erdrückend. Wir müssen handeln. Ich hoffe, ich muss Ihnen nicht Art. 217, Absatz 2 der Strafprozessordnung in Erinnerung rufen.«
Nein, diesen Artikel kannte er. Er ermöglichte es der Polizei, eine Person vorläufig festzunehmen und auf den Polizeiposten zu bringen, falls diese gestützt auf die Ermittlungen eines Verbrechens verdächtig wurde. Die ersten Anzeichen sprachen gegen den Pfarrer, aber erdrückend waren sie nicht. Na gut, das war Ansichtssache.
»Der Pfarrer mag die Mittel und die Möglichkeit für die Tat haben, aber was wäre sein Motiv?«, fragte Monti und verdrehte die Augen, um Müller mit Nachdruck mitzuteilen, was er von seiner Idee hielt.
»Monti, wie Ihnen bekannt sein sollte, verlangen weder Gesetz noch Gericht ein Motiv zur Verurteilung eines Täters. Das Einzige, was wir brauchen, sind Beweise für die Tat. Und das ist Ihre Aufgabe, die zu finden.«
Müller hatte gesprochen, wie es Monti seit Jahr und Tag erdulden musste. Anweisung und Weisheiten an die Polizisten gab der Herr Doktor allzu gerne, nach ihrer Meinung fragte er sie hingegen nur alle Schaltjahre einmal. »Jetzt führen Sie den Pfarrer ab.«
Monti zögerte.
»Oder haben Sie ein Problem damit, einen Geistlichen Ihres Glaubens zu verhaften? Nehmen Sie ihm die Fingerabdrücke ab, und falls diese nicht mit denjenigen auf dem Kruzifix übereinstimmen, lassen Sie ihn laufen. Dann habe ich mich geirrt.«
»Gott stehe uns bei«, sagte Monti.
»Genug geredet, jetzt machen Sie sich an die Arbeit, meine Herren. Wir brauchen Beweise, Beweise, Beweise.«
»Amen«, sprach Monti.
4
Der schwarze BMW X5 fuhr vom Vorplatz der Klinik weg. So schnell, wie er in der Kapelle erschienen war, so rasch hatte sich Müller wieder aus dem Staub gemacht. Der Mann war kein Freund von einem Kaffeekränzchen, einem Small Talk oder einer Lagebesprechung, ohne vorher eine Traktandenliste erhalten zu haben. Den Kampf an der Front mit Verdächtigen mied der Staatsanwalt, sah er nicht als seine Aufgabe an und überließ ihn dem Fußvolk der Polizisten. Jeder habe seine Rolle und Funktion, und seine als Staatsanwalt lägen im Administrativbereich, hatte er einst zu Monti gesagt.
So gesehen ergänzten sie sich gut, denn ein Büromensch war Monti selbst noch nie gewesen und würde es nie werden. Formal oblag ihm zu diesem Zeitpunkt der Ermittlung die Entscheidung, ob sie den Pfarrer vorläufig festnahmen oder nicht. Der Staatsanwalt hatte es aber vor seiner Abreise nicht unterlassen, ihm noch einmal und mit Nachdruck die Festnahme des Pfarrers nahezulegen. Die Argumente von Müller stachen, gestand sich Monti ein.
In seiner langen Berufskarriere hatte er Verdächtige bereits mit weniger Indizien festgenommen, aber ein Mann Gottes, wie seine Mutter die Pfarrer ehrfurchtsvoll nannte, fehlte bislang in seinem Palmarès. Er hatte in seinem Leben schon vieles erlebt und Personen jeglicher Couleur verhaftet. Sein Portfolio umfasste unter anderem Politiker, Lehrer, Mechaniker, Schachspieler und Hausfrauen. Die meisten wurden später zu langjährigen Gerichtsstrafen verurteilt, bei einigen lag er daneben.
Der Pfarrer kam als Übermittler der traurigen Nachricht vom Tod von Alfred Benz nun in den Genuss, die Räumlichkeiten des neuen Polizei- und Justizzentrums von innen kennenzulernen. An der Güterstraße 33 lebten Polizisten, Staatsanwälte und Gefangene unter einem Dach, als ob sie eine große Wohngemeinschaft bildeten.
Die erste Idee war meist die beste. Das lehrte Monti das Schachspiel. Großmeister fanden in der Regel den besten Zug in einer Stellung innert Sekundenbruchteilen. Danach überprüften sie minutenlang, ob dieser irgendwelche Mängel aufwies, und erst wenn die Kontrolle keinen Fehler an den Tag legte, führten sie den Zug aus. So mussten sie nun auch vorgehen, falls der Pfarrer den Mord tatsächlich verübt hatte.
Monti war eigentlich kein Gegner von voreiligen Entscheidungen, ganz im Gegenteil, vertrat er doch die Ansicht, die Intuition gehöre ins Repertoire eines Ermittlers bei seiner Arbeit wie die Butter aufs Brot. Natürlich setzte das voraus, dass man als Kriminalpolizist mit einem reichlichen Erfahrungsschatz und einer breiten Wissenspalette ausgestattet war. Davon hatten Müller und er mehr als genug. Das Gesetz hingegen kannte den Begriff »Intuition« nicht, es sprach von »begründetem Verdacht«, »hinreichendem Tatverdacht« und verlangte »sachliche Beweismittel«.
Letztere galt es nun zu finden.
Hafner schaute Monti fragend an. »Ich habe ein mulmiges Gefühl. Der Pfarrer kann doch nicht so blöd sein, die Tat mit seinem eigenen Kreuz auszuführen und dann den Mord noch selbst zu melden.«
Monti schwieg. Nein, so dumm war niemand. Plötzlich schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf. Hätten sie auch Zweifel gehabt, wenn es sich beim Verdächtigen nicht um einen Pfarrer, sondern um einen Metzger gehandelt hätte?
Hafner richtete einen fragenden Blick an Monti, bevor er von dannen trottete, während Monti zurück in die Kapelle ging. Als er die Sakristei betrat, saß der Pfarrer am Tisch, las in der Bibel und umklammerte einen Rosenkranz.
Um die Aufmerksamkeit des Geistlichen zu erlangen, tippte ihm Monti zweimal auf die Schulter.
»Herr Pfarrer, Sie müssen mit meinen Kollegen zum Polizeiposten fahren«, sagte Monti. Die Worte »Festnahme« oder »Verhaftung« kamen ihm zwar in den Sinn, wären auch angebracht gewesen, aber sie verließen seinen Mund nicht.
»Verhaften Sie mich?«, fragte Pfarrer Waldvogel, als ob er Montis Gedanken lesen könnte.
Monti schaute ihm kurz in die Augen, bevor er seinen Blick auf den Boden richtete. Er rang nach den richtigen Worten, die er nicht fand. Stattdessen äffte er Müllers juristisches Vokabular nach. »Es handelt sich um einen Anfangsverdacht.«
»Anfangsverdacht?«
»Die Tatwaffe gehört Ihnen.«
Der Pfarrer schüttelte den Kopf. Selbst das tat er bedächtig. »Das Kruzifix gehört dem Heiligen Vater.«
»Tut mir leid. Spirituelle Autoritäten berücksichtigen wir bei der Polizei nicht. Wir sind einzig und allein den irdischen Gesetzen verpflichtet.«
»Ich verstehe, was Sie meinen. Ich stelle mich der Aufgabe, muss Ihnen aber sagen, dass ich nicht der Täter bin, was Gott bestätigen kann. Sie vergeuden Ihre Zeit, aber ich werde Ihnen helfen, den wahren Täter zu finden.« Er versorgte den Rosenkranz in die Tasche seines Gewandes.
Monti konnte gerade noch ein Nicken unterbinden. »Die Kollegen werden Ihre Fingerabdrücke und Ihre DNA abnehmen. Wir werden Ihre Wohnung durchsuchen müssen, und dann werden wir weitersehen. Sie haben das Recht, einen Anwalt für die Vernehmung beizuziehen, Herr Pfarrer.«
Der Pfarrer schlug die Bibel zu und stand auf. »Nein, mein Sohn. Das brauche ich nicht. Der Herr im Himmel ist mein einziger Anwalt und Richter. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Ich habe großes Vertrauen in ihn.«
Die Stimmlage des Geistlichen blieb in all den Gesprächen konstant, aber etwas hatte sich in den Augen nun verändert. Sie hatten sich mit einem Schuss Wasser gefüllt, das Waldvogel mit einem Taschentuch wegwischte, bevor eine weitere Träne die Wangen hinunterrutschen konnte.
»Gott sei mit Ihnen.« Waldvogel stand Monti gegenüber und schaute ihm in die Augen, machte ein Kreuz in die Luft und reichte ihm die Hand.
Monti schritt mit ihm über den Vorplatz zum Dienstwagen und gab ihn in die Obhut von zwei Polizisten, die Monti instruierte, den Verdächtigen auf den Polizeiposten zu führen.
Waldvogel winkte Monti zu, bevor er auf dem Rücksitz im Auto Platz nahm. Ein Novum: So freundlich hatte ihn ein Festgenommener noch nie verabschiedet. Gewöhnlich schrien sie ihm Fluchwörter nach.
Während sich die Polizisten in den Wagen setzten, liefen Monti und Hafner zurück zum Eingang der Klinik. Monti blieb kurz stehen, blickte sich um und sah eine Person im ersten Stock. Ein Mann stand am Fenster hinter Gardinen und beobachtete, wie das Dienstauto der Polizei das Gelände verließ. Als er Montis Blick bemerkte, zog er die Vorhänge zu und lief weg.
5
Um zehn Uhr traf Daniela Lüscher am Tatort ein, und Monti gab ihr einen Überblick über die ersten Erkenntnisse. Es gelte, nun alle Teilnehmer der Halloween-Party zu befragen, da es wahrscheinlich sei, dass der Täter sich darunter befände.
Sie gingen zum Empfangsschalter der Klinik, hinter dem eine ältere Frau stand. Die Dame hatte blondes Haar, war rund ein Meter sechzig groß und trug ein rotes Kleid. Sie hatte ziemlich viel Make-up aufgetragen, und ihr Parfüm roch nach Vanille und Lavendel.
»Fabio Monti, ich leite die Ermittlung der Kriminalpolizei«, stellte er sich vor.
»Frau Blauensteiner, ich bin die Madame du Service. Das ist alles so schrecklich, und dann noch in der Kapelle. Was für ein Mensch muss das gewesen sein?«
»Mörder haben kein Taktgefühl.«
Sie schnaufte. »Wer ist fähig, eine solche Tat zu verüben?«
»Das werden wir herausfinden, das kann ich Ihnen versprechen.«
»Das bleibt zu hoffen. Gott stehe Ihnen bei!«
»Ich würde gerne mit dem zuständigen Chef sprechen.«
Frau Blauensteiner nickte, und während sie voranlief, sagte sie: »Der Direktor ist momentan krankheitshalber abwesend, Herr Dr. Huggenberger ist sein Stellvertreter.« Sie führte Monti die Treppe hoch in den ersten Stock, bevor sie vor einem Zimmer stoppte. Auf der Tafel der Tür stand: »Dr. med. R. Huggenberger«. Sie klopfte an, wartete, bis sie Antwort erhielt, und führte Monti in das Büro.
Hinter dem Pult saß ein Mann mit vollem grauen Haar, das zu einem Scheitel frisiert war, Brille und blauen Augen, der sich erhob, zuerst Lüscher und dann Monti die Hand ausstreckte.
»Dr. Rudolf Huggenberger. Nehmen Sie Platz, bitte.«
Monti stellte sich und Lüscher vor, sprach ihm sein Beileid aus und setzte sich in den Fauteuil. Huggenberger brachte einen Stuhl für Lüscher und nickte Frau Blauensteiner zu, und sie verließ den Raum.