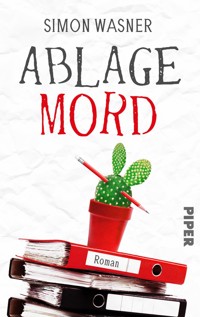4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: between pages by Piper
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Verrückte Alpakas, hohe Berge – und ein Mord. Absurd-schwarzhumorige Krimikomödie in den Schweizer Alpen für Fans von Jörg Maurer und Rita Falk »Und wenn Martin sich ausmalte, dass sein Leben womöglich in den nächsten Momenten enden könnte, weil er zusammen mit dem Tier, das er hasste, in eine Situation, die er hasste, mit einer Verbrecherin, die er zwar nicht hasste, aber fürchtete, geraten war, dann konnte er nur an eine Sache denken: Nie wieder in meinem ganzen Leben fahre ich in den Urlaub!« Trautes Heim, Glück allein – dumm nur, dass dem Ehepaar Martin und Larissa seit Jahren von ihrer Nachbarin Frau Strobl das Leben zur Hölle gemacht wird. Und auch der gewonnene Urlaub in den Schweizer Bergen wird zum Horrortrip, denn nach einer halsbrecherischen Anfahrt entpuppt sich das malerische Chalet als heruntergekommene Jagdhütte und ausgerechnet Frau Strobl ist ebenfalls unter den Gästen. Als ein Erdrutsch die Abreise unmöglich macht und Frau Strobls Leiche im Alpakagehege gefunden wird, ist das Chaos perfekt. Schnell sind sie die Hauptverdächtigen, und so müssen Martin und Larissa wohl oder übel ermitteln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Krimi gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Mord mit Talblick« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© 2025 Piper Verlag GmbH, München
Redaktion: Birgit Förster
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Alexa Kim »A&K Buchcover«
Covermotiv: depositphotos.com (peterwey, happyalex, damedeeso, EsinDeniz), shutterstock.com (Rita_Kochmarjova)
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Zitat
1. Unter den Wolken
2. Das hässlichste Haus in der Straße
3. Älterwerden ist nichts für Feiglinge
4. Die Eigentümerversammlung
5. Nigerianische Prinzen
6. Roadtrip ins Heidiland
7. Serpentinen für Fortgeschrittene
8. Die doppelte Karolina
9. Eine Nacht in den Alpen
10. Morgenstund hat Gold im Mund
11. Alpakafußball
12. Schweizer Käse
13. Ungebetene Gäste
14. Der USB-Stick
15. Das Video
16. Die Kompostierung
17. Der zweite Hinweis
18. Die Flucht
19. Charlène
20. Richie
21. Papa was a Rolling Stone
22. Das Wunder von Mutta
23. Der Sturm auf das Chalet
24. Pablo Escopaka
25. Das Wiedersehen
26. Showdown auf der Mutta
27. Die Gondel
28. Der Showdown des Showdowns
29. Drei Monate später
Danksagung
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Widmung
Für meine Frau, ohne die ich nie auf die Idee für diesen Roman gekommen wäre.
Zitat
»Na ta durmî, pertgè las olmas na chattan mai rua qua.«
(»Schlafe nicht, denn die Seelen finden hier nie Ruhe.«)
1.Unter den Wolken
Das junge Alpaka mit dem gescheckten Fell schaute ein bisschen verzweifelt drein, aber das konnte man ihm ja auch nicht verübeln, in dieser Lage. Der beißende Höhenwind ließ die Gondel bedrohlich hin und her schwanken, und wenn Martin nach unten sah, begannen vor seinen Augen direkt die Sterne zu tanzen. Die Gondel, das verrieten die technischen Daten auf der Plakette neben dem Eingang, hatte ein Fassungsvermögen von zwölf Personen oder neunhundertsechzig Kilogramm und, ach ja, stammte direkt aus der Hölle. Zumindest, wenn man wie Martin eine Mordshöhenangst hatte und gezwungen war, zusammen mit einer flüchtigen Mörderin und einem ausgewachsenen Alpaka seit einer Viertelstunde in der irrsinnig dünnen Gondelkabine auszuharren, die an einem lächerlich dürren Drahtseil über einem gähnenden Abgrund hing. Da konnte der Rhein noch so kristallklar und schön funkeln, und die Berggipfel konnten sich noch so sehr bemühen, wie Toblerone-Pralinen mit Zuckergusshut auszusehen: Retten konnte das die Situation auch nicht mehr. Martin versuchte krampfhaft, weiterhin auf die Informationsplakette zu starren, weil sowohl der Blick durch den Panoramaboden als auch der auf Yvonne ihn vermutlich direkt einem Ohnmachtsanfall nahe gebracht hätten. Und da war noch gar nicht ins Spiel gekommen, dass er sich vor Alpakas ekelte wie andere Leute vor Schlangen oder Spinnen. Und wenn er, der sein ganzes Leben damit zugebracht hatte, aktive Risikovermeidung zu betreiben, sich ausmalte, dass sein Leben womöglich in den nächsten Momenten enden könnte, weil er zusammen mit dem Tier, das er hasste, in eine Situation, die er hasste, mit einer Verbrecherin, die er zwar nicht hasste, aber fürchtete, geraten war, dann konnte er nur an eine Sache denken: »Nie wieder in meinem ganzen Leben fahre ich in Urlaub!«
2.Das hässlichste Haus in der Straße
Zweieinhalb Wochen zuvor.
Wenn Martin neue Leute zu sich nach Hause einlud und die fragten, wo in Karlsruhe er denn wohne, dann beschrieb er immer den Weg nach Neureut-Heide, dann in den Magnolienweg und beendete die Beschreibung stets mit den Worten: »Und dann bitte nicht verunsichern lassen und das Weite suchen, es ist einfach nur das hässlichste, baufälligste und insgesamt wenig vertrauenerweckende Haus am Ende der Straße.«
Die Menschen lachten dann immer etwas verschüchtert, weil sie sich nicht sicher waren, ob Martin einen Scherz gemacht hatte, aber sobald sie in den Magnolienweg einbogen und das Trauerspiel mit eigenen Augen sahen, kam ihnen seine Beschreibung fast schon beschönigend vor. Wenn sie denn überhaupt noch Leute zu sich nach Hause einluden und es vor lauter Scham nicht einfach vorzogen, sich auswärts zum Abendessen zu verabreden. Das war im Grunde genommen ziemlich traurig. Denn eigentlich war die Wohngegend als solche recht hübsch: im Grünen, zwar nahe an der Karlsruher Innenstadt, aber trotzdem sehr ruhig, viele Einfamilienhäuser, ein kleines Naherholungsgebiet und ein See mit Minisandstrand. Gut, der See war ein biologisches Ungetüm und Baden darin absolut verboten, aber das änderte ja nichts daran, dass man abends mit einer Picknickdecke am Strand sitzen und eine Limo trinken konnte. Das taten auch viele, denn die Gegend war seit einigen Jahren ungemein beliebt, vor allem bei jungen Familien. Und gerade der Magnolienweg zeichnete sich dadurch aus, dass viele alte Häuser in den letzten Jahren kernsaniert oder gleich abgerissen und durch neue ersetzt worden waren. Die Hausbesitzer ließen sich natürlich nicht lumpen, und so stand vor jedem Haus eine Wärmepumpe, betrieben von den Solarzellen auf den Dächern, in der Garage ein quietschbunter Elektrosportwagen, und dahinter tuckerten leise die Pools. Das musste man sich leisten können, und durch die Aufwertung des gesamten Viertels war selbst ihre baufällige Wohnung sündhaft teuer gewesen, als sie sie vor zwei Jahren gekauft hatten. Aber ohnehin hatte die Nummer 4 es schwer, gegen ihre Nachbarhäuser zu bestehen: Die anderen Häuser waren ausnahmslos in lebendigen, fröhlichen Farben gestrichen, und ihre Besitzer grüßten immer freundlich, wenn sie morgens vor der Arbeit ihre obligatorische Runde joggen gingen. Die meisten Nachbarn hatten gute Jobs, wohlerzogene Kinder, eventuell eine Haushaltshilfe, und zwei- bis dreimal im Jahr fuhren sie in Urlaub. Laute Partys wurden in der Regel vermieden oder zumindest im Vorfeld angekündigt, der Müll fein säuberlich getrennt, und weil die Straße keine Durchgangsstraße war, gab es, von den vielen Lieferwagen der Post- und Kurierdienste einmal abgesehen, wenig Lärm und Aufregung. Es war wirklich die perfekte Gegend für ein Pärchen wie Martin und Larissa, die die Ruhe liebten und hier womöglich einmal ihre Kinder großziehen würden. Sicher, Martin war weder so dynamisch noch so strahlend gut aussehend wie seine Nachbarn, er verdiente vermutlich auch weniger, und ihr Auto sah nicht aus, als wäre es gerade als Kulisse aus dem neuesten Fast & Furious-Streifen zurückgekehrt. Er hatte außerdem kein Sixpack, sein Haar wurde schon sichtlich dünner, und er ging in seiner Freizeit nicht ohne Sicherungsleine klettern. Alles in allem war er vermutlich einfach jemand, den man als Langweiler bezeichnen würde. Aber rechtfertigte all das schon, dass das Schicksal ihn seit zwei Jahren jeden Morgen in der Hölle aufwachen ließ?
Als sie die Wohnung im Magnolienweg gekauft hatten, hatte der Makler von ihr und ihren unendlichen Möglichkeiten geschwärmt, alles Lügen natürlich, und sie waren sehenden Auges in die Katastrophe geschlittert. Dabei, und das war das Schlimme, hätten sie es ja ahnen können. Das Haus hatte damals schon fürchterlich ausgesehen: Der Außenputz bröckelig, eine Anstrichfarbe nur noch erahnbar, das Treppenhaus voll gesprungener Fliesen in zarten Siebzigerjahre-Brauntönen, das grauenhafte überlebensgroße Ölgemälde zweier Pferde im Treppenhaus, deren starrer Blick ihn bis heute in seinen Albträumen verfolgte. Und damit waren sie noch gar nicht bei dem feuchten Keller, dem Schimmel im Hausflur, dem undichten Dach, der bedrohlich schwankenden Regenrinne, dem sumpfigen Hof und den beiden Wellblechgaragen, die einen Hauch von brasilianischer Favela versprühten, angelangt. Oder, wie der schmierige Makler es damals ausgedrückt hatte: »Eine charmante Immobilie mit Potenzial. Sicher, es gibt einiges zu tun, aber das ist natürlich für Sie auch eine großartige Gelegenheit, der Einheit Ihren eigenen, ganz individuellen Stempel aufzudrücken. Ach, was sage ich. Der Einheit, nein. Ihrem neuen Zuhause! Nicht wahr, Sportsfreund?«
Dabei hatte er versucht, schelmisch zu zwinkern und Martin einen kumpelhaften Knuff zu versetzen, aber zum Glück hatte Larissa ihn rechtzeitig weggezogen, denn wenn es etwas gab, was Martin nicht ausstehen konnte, dann war es eine spontane und ungeplante Berührung unter Fremden.
»Und die Nachbarin?«, fragte Martin den Makler.
»Hach!«, sagte er säuselnd und berührte mit der Hand seine Brust auf Höhe des Herzens, wo er in seiner Anzugweste eine altmodische Taschenuhr verstaut hatte, »Frau Strobl. Ein echter Traum. Eine liebenswerte ältere Dame, leider seit vielen Jahren verwitwet. Ich glaube, sie hat eine erwachsene Tochter, die«, er sprach jetzt betont leise, »sie leider nicht besonders oft besuchen kommt. Ich zumindest habe sie noch nie gesehen. Sie wird sich sicherlich über Ihre kleine Familie freuen, besonders, wenn es da mal Zuwachs geben sollte. Und wissen Sie: Sie wohnt schon ewig in diesem Haus. Ich bin mir sicher, dass sie es kaum erwarten kann, gemeinsam mit Ihnen die Renovierung anzugehen!«
Vielleicht war es der Traum, Eigentum zu besitzen, der sie damals alle Warnzeichen hatte ignorieren lassen. Vielleicht war der Makler auch der Teufel höchstpersönlich, dem es gelungen war, sie mit seinen Lügen und seinen schmierigen, zurückgegelten Haaren um den Finger zu wickeln. Vielleicht auch das Gefühl, ein Zuhause gefunden zu haben, bevor Kinder ins Spiel kamen. Und ganz sicher war es leider auch Martins absurd großes Sicherheitsbedürfnis gewesen, das in ihm schon immer den Wunsch genährt hatte, ihr Geld solide anzulegen, in Betongold, wie man so schön sagte. Auf jeden Fall hatten sie noch am selben Tag einen Termin bei der Bank ausgemacht und die Verträge unterschrieben. Dann hatte Larissa Muffins mit kleinen Schokotropfen darauf gebacken, sie zogen sich etwas Ordentliches an und machten sich auf den Weg, ihren Antrittsbesuch bei Frau Strobl zu absolvieren, der reizenden Dame, die es kaum erwarten konnte, mit ihnen gemeinsam die Renovierung anzugehen.
So konnte man sich irren.
Martin erinnerte sich genau an den Tag ihrer Unterschrift unter den Kaufvertrag. Von Glück beseelt standen sie mit der Muffinbox und einer eilig gekauften Flasche Discountersekt vor Frau Strobls Tür, um sich bei ihr vorzustellen und mit ihr auf die baldige Renovierung ihres gemeinsamen Hauses anzustoßen. Sicher, das alles würde nicht billig werden, aber der enorme Wertgewinn der Immobilie, die Gewissheit, in einem aufstrebenden Viertel zu wohnen, die ideale Lage. Sie dachten wirklich, ein Traum würde in Erfüllung gehen.
Martin konnte die absurde Szene noch immer vor seinem inneren Auge sehen: Wie sie, leicht kichernd, gemeinsam den rostigen Schlüssel in die Hand nahmen und ihn in das ebenso rostige Schloss erst schoben, dann drückten, schließlich hämmerten. Wie sie die Haustür öffneten, ihnen der Muff von fehlender Frischluft und fröhlich sprießendem Schimmel entgegenkroch. Wie sie an den verdammt gruseligen Pferden vorbeiliefen, die ihnen erst jetzt so richtig ins Auge stachen, weil der Makler bei der Besichtigung wahrscheinlich absichtlich die Lampe über ihnen herausgeschraubt hatte. Jetzt glotzten sie Martin aus starren, irren Augen und mit bebenden Nüstern an, und ihm lief es direkt eiskalt den Rücken herunter. Schlangen, Spinnen, Mäuse, Ratten, alles kein Problem für ihn. Aber seit er an seinem zehnten Geburtstag von einem Alpaka, das seine Mutter extra als Überraschung organisiert hatte, in die Hand gebissen worden war und beinahe seinen rechten Zeigefinger verloren hätte, hatte er panische Angst bei gleichzeitigem Ekel vor Alpakas, Eseln und allem, was ihn auch nur indirekt an irgendetwas Pferdeartiges erinnerte. Er hasste ihr Fell, ihre riesigen Augen, ihre noch riesigeren Nasenlöcher und ihre abstrus ungepflegten Zähne. Martin machte jetzt einen kleinen Schreckhopser zur Seite und trat dabei Larissa auf die Füße. Sie stieß einen leisen Schmerzensschrei aus und ließ beinahe die Muffins fallen, legte ihm dann aber die Hand auf die Schulter und sagte ruhig: »Das Bild lassen wir direkt morgen abhängen.«
Deswegen liebe ich diese Frau, dachte er und beruhigte sich tatsächlich ein bisschen. Kaum hatte Larissa das Entfernen des Gemäldes angekündigt, gelang es ihm, von den Augen der Pferde abzulassen, sich umzudrehen und vor Frau Strobls Tür zu treten. Martin suchte nach einer Klingel, fand aber keine und klopfte schließlich an. Nachdem er dreimal geklopft hatte und noch immer niemand reagierte, drehte er probehalber am Türknauf, um herauszufinden, ob sie sich von außen öffnen ließ. Das tat er nicht aus Übergriffigkeit, sondern aus echter Besorgnis, die wahrscheinlich auch berufsbedingt sein ständiger Begleiter war. Schließlich war Frau Strobl nicht mehr die Jüngste und bekam, falls der Makler sie da nicht auch belogen hatte, nicht sehr oft Besuch. Martin war Versicherungsberater, und das mit Leib und Seele. Schon in der Abizeitung stand neben einem Bild mit Seitenscheitel und damals altmodischer, heute aber erstaunlich trendiger Hornbrille, dass sein Berufswunsch Versicherungsmakler sei, während bei seinen Freunden Dinge wie »Biertester« oder »König von Mallorca« zu lesen gewesen waren. Nach einem in Mannheim in Windeseile und mit Bestnoten absolvierten Studium beschäftigte er sich seit mittlerweile zehn Jahren jeden Tag aufs Neue mit vollem Elan und ganzer Hingabe mit dem Risiko. Dabei litt er sehr darunter, dass seine Zunft in letzter Zeit mehr und mehr in Verruf geraten war: Er sei ein Betrüger, ein Halsabschneider, das hörte er nun immer häufiger. Dabei hatte er noch nie einem Kunden eine Versicherung verkauft, die dieser nicht benötigt hätte. Stets war er aufrichtig und erläuterte nach bestem Wissen und Gewissen, welche Risiken existierten und gegen welche sich seine Kunden am besten absichern sollten. Und davon gab es, zumindest seiner Wahrnehmung nach, mehr als genug. Man könnte es also so formulieren: Oft verkaufte er seinen Kunden tatsächlich Versicherungen, die sie noch nicht hatten. Aber, und das war ja das Wichtigste: die sie auf jeden Fall einmal brauchen könnten. Denn Martin rechnete mit allem, und zwar immer. Es überraschte also auch seine Frau nicht, dass er so schnell versuchte, Frau Strobls Fernbleiben auf den Grund zu gehen: Schließlich gab es keinen Moment, in dem er nicht mit einem schrecklichen Unfall oder einem plötzlichen Ableben kalkulierte.
In dem Augenblick, in dem Martin versuchte, den Knauf zu drehen, hörte er von drinnen aber erstaunlich schnell schlurfende Schritte, und keine zwei Sekunden später öffnete sich die Tür. Und da stand sie, in all ihrer nicht vorhandenen Pracht, und starrte die beiden aus funkelnd bösen Augen an: Frau Strobl oder, wie Martin und Larissa sie seit diesem Tag nur noch nannten: der Satan. Martin war überdurchschnittlich groß, und weil er so schlank war, wirkte er noch größer. Larissa hingegen war ziemlich klein, drahtig und braun gebrannt, wie es sich für eine Sportlehrerin vermutlich gehörte. Rein größentechnisch konnte man Frau Strobl zwischen ihnen einsortieren, was aber überhaupt keine Rolle spielte. Denn ihre sehr spezielle Ausstrahlung war alles andere als durchschnittlich. Sie trug eine Art Hauspantoffeln, die aussahen, als hätte man einen pinkfarbenen Igel bei lebendigem Leib gehäutet, eine Leggins mit Leopardenmuster und eine ebensolche Bluse, an der linken Hand prangte eine goldene Armbanduhr, um den Hals eine Diamantkette. Ihre Haare funkelten feuerrot und sahen nach frischer Dauerwelle und einem Hauch von Fegefeuer aus. Ihre Augen waren eisblau und versprühten nicht den leisesten Funken Wärme, was durch die äußerst dünn gezupften, womöglich auch tätowierten Augenbrauen nur noch verstärkt wurde. Natürlich waren auch sie feuerrot.
»Guten Tag, Frau Strobl«, sagte Larissa strahlend und winkte mit der Muffinbox, »wir sind …«
»Wenn Sie nicht sofort aus meinem Haus verschwinden, rufe ich die Geheimpolizei und sorge dafür, dass Sie für immer in einem sibirischen Gulag verschwinden«, sagte ihre neue Nachbarin mit Nachdruck, starkem russischen Akzent und schleppend rollendem R. »Und im Übrigen bin ich russisch-orthodox und habe kein Interesse daran, Zeugin Jehovas zu werden.«
Die beiden lachten kurz auf, weil ihnen das offensichtliche Missverständnis bewusst wurde, dem die alte Frau aufgesessen war. Ein Missverständnis, das ja schnell aus dem Weg zu räumen war. Leider hatten sie zu diesem Zeitpunkt nur noch nicht erkannt, dass Karolina Strobl nicht nur ein Problem mit den Zeugen Jehovas hatte, sondern mit der gesamten Menschheit.
»Liebe Frau Strobl«, sagte Larissa erneut freundlich und hielt wie zur Unterstützung die Box mit den Muffins auf Höhe ihres strohblonden Dutts, »wir sind nicht von den Zeugen Jehovas. Wir sind die neuen Nachbarn und wollten uns nur …«
»Neue Nachbarn?« Zu ihrem Entsetzen sammelte Frau Strobl deutlich hörbar Speichel in ihrer Mundhöhle und spuckte dann auf ihrer eigenen Fußmatte mit dem verschlissenen Wort Willkommen aus. »Brauche ich nicht. Will ich auch nicht. Und wenn Sie versuchen, mir in Ihren verschimmelten Küchlein Drogen unterzujubeln und mich dann auszurauben, dann seien sie gewarnt: Mein Hund ist ein direkter Nachkomme von Genosse Stalins Spaniel. Er ist sehr aggressiv, hat vermutlich Tollwut und beißt!«
»Frau Strobl«, sagte Martin und schob Larissa sanft ein bisschen zur Seite, weil er wusste, dass sie bei solchen Gelegenheiten schnell mal die Diplomatie fallen lassen und sich in einen Streit hineinsteigern konnte, »das ist alles ein großes Missverständnis. Es tut mir sehr leid, falls wir Sie erschreckt haben sollten.«
Martin sprach ruhig und langsam, man wusste ja schließlich nicht, wie gut die alte Dame hörte und wie schnell sie noch Dinge begriff. Auch wenn, das musste er zugeben, sie eigentlich gar nicht so alt, wie von ihrem Makler beschrieben, und außerdem recht rüstig wirkte. Sie mochte sechzig sein, und ihre Dauerwelle sah zwar sehr altmodisch, aber nicht ungepflegt aus. Dazu der Goldschmuck und die für ihr Alter etwas zu große, etwas zu auffällige Perlenkette. Sie versprühte gesunden, leicht mafiös angehauchten Ostblockcharme, war aber vermutlich nicht senil. Man würde also mit ihr reden können. Denn das war es, was Martin aus seinem Alltag als Versicherungsmakler ganz sicher wusste: Man konnte mit jedem reden, wenn man erst mal eine persönliche, vertrauensvolle Basis geschaffen hatte.
»Wie Sie sicherlich wissen«, führte er weiter aus, »stand die Wohnung über Ihnen eine ganze Weile lang leer und ist nun verkauft worden. Und wir, Larissa und Martin Imhoff, sind die neuen Käufer. Und die Muffins, die«, er warf Larissa einen raschen Blick zu, »ganz und gar nicht verschimmelt sind, haben wir mitgebracht, weil wir dachten, wir könnten uns bei einer Tasse Kaffee zusammensetzen, um zu besprechen, wie es mit dem Haus weitergeht.«
»Nicht verschimmelt?«, fragte Frau Strobl und zog eine dünne, rote Augenbraue in die Höhe. »Und was ist das dann für ein widerlich weißes Zeug obendrauf?«
»Das widerlich weiße Zeug«, sagte Larissa, und Martin bemerkte, wie ihre Stimme an Schärfe deutlich zunahm, »nennt man Topping.«
Es war jetzt sehr wichtig, dass es ihm gelang, das Gespräch in ruhigere Bahnen zu lenken. Wenn es ums Backen und Kochen ging, war seine sonst so toughe Frau nämlich sehr empfindlich, weil ihr tatsächlich öfter mal etwas anbrannte oder verschimmelte. Nicht, dass er ihr das jemals ins Gesicht sagen würde. Er war kein besonders konfrontativer Mensch. Einmal hatte er lieber eine Wurmvergiftung riskiert, als ihr zu beichten, dass er einen halbierten Regenwurm in ihrem Zitronenkuchen gefunden hatte. Er hatte schon schönere Geburtstage verbracht.
»Wie dem auch sei«, sagte er und kam nicht umhin, zu bemerken, dass aus Frau Strobls Wohnung ein Geruch irgendwo zwischen vergammelndem Ehemann und Knoblauchfondue strömte, »nachdem wir diesen Irrtum ja jetzt geklärt haben, könnten wir doch bestimmt reinkommen und uns kennenlernen und dann in aller Ruhe gemeinsam überlegen, wie es mit dem Haus weitergehen soll.«
»Dazu muss ich Sie nicht hereinbitten. Das können wir auch direkt hier klären«, sagte Frau Strobl kalt und hakte zur Sicherheit schon einmal die Türkette ein.
»Hier?«, antwortete Martin, der im Gegensatz zu Larissa immer noch nicht verstanden hatte, dass sie auf diplomatischem Wege kaum weiterkommen würden. »Aber es gibt doch so viel anzugehen. Die Fassade, das Treppenhaus. Der Keller. Die Elektrik. Die Garagen. Und dann das Pferdebild«, schloss er seine Ausführung mit einem kleinen Scherz. Der kam natürlich gar nicht gut an.
»Sparen Sie sich die Mühe. Sie sind nicht die Ersten, die versuchen wollen, hier etwas zu verändern. Hier bleibt alles ganz genau so, wie es jetzt ist. Und wenn Sie Hand an mein geliebtes Pferdebild legen«, ihre Augen funkelten jetzt vor purem Hass, »dann bringe ich Sie höchstpersönlich um und verscharre Ihre Leichen in meinem Garten. Dagegen wird dann selbst die Ermordung von Leo Trotzki ein harmloser Streich gewesen sein.«
Damit knallte sie die Tür vor ihren Nasen so heftig zu, dass die Muffins in der Box hin und her hüpften und vermutlich asbesthaltiger Staub von der Decke in die offene Form rieselte. Sie standen noch eine Weile unschlüssig vor der Tür herum, bis Larissa ihren Mann am Arm packte und nach draußen zog. Schwer atmend, weil die frische Luft ihre Lungen überforderte, öffnete Larissa die Biomülltonne vor dem Haus so schwungvoll und aggressiv, dass der Deckel ordentlich gegen die Rückwand der Tonne knallte. Dann kippte sie, ohne zu zögern, die Baustaubmuffins hinein. Sie atmete tief ein und aus, und Martin sah am Zittern ihres Körpers, wie sehr sie mit sich zu kämpfen hatte. Nicht etwa, weil sie Angst hatte oder weil Frau Strobls grobe postkommunistische Art sie so vor den Kopf gestoßen hatte. Nein, so tickte Larissa nicht. Sie entstammte einer uralten badischen Dynastie von Handballspielerinnen und war mit vier älteren Schwestern aufgewachsen. Wer Larissa blöd kam, das hatte Martin schon oft miterleben müssen, der konnte sich auf etwas gefasst machen. Vermutlich hatte sie sich auch deswegen direkt beim ersten Kennenlernen in ihn verliebt: Weil er mit seinem ausgleichenden, defensiven Wesen schon mehr als einmal dafür gesorgt hatte, dass sie nicht aufgrund einer gestohlenen Vorfahrt jemanden krankenhausreif geschlagen hatte. Und umgekehrt war Martin immer froh, dass sie es war, die die vielen kleinen und großen Kämpfe des Alltags ausfocht. Sie waren jetzt seit zehn Jahren zusammen und seit fast vier Jahren verheiratet und nach wie vor, man konnte es nicht anders sagen, ein tolles Team.
Martin ging langsam auf sie zu wie ein Tierpfleger, der ein tollwütiges Raubtier beruhigen musste. Er legte ihr die Hand auf die Schulter, spürte das Schulterpolster ihres Blazers, den sie heute extra angezogen hatte, und sprach langsam und beruhigend auf sie ein. Dass sich schon eine Lösung finden würde. Dass sie jetzt nicht gleich die Flinte ins Korn werfen konnten. Dass auch Frau Strobl, ob sie es wollte oder nicht, auf eine Zusammenarbeit angewiesen war. Dass die Hausverwaltung ja immer mit im Boot und sicherlich auf ihrer Seite wäre. Tatsächlich beruhigte sich Larissa, zumindest ein wenig. Oft waren dafür noch nicht einmal Worte notwendig. Martin und Larissa waren berühmt für ihre stumme Kommunikation, bei der ein Augenrollen oder ein Zucken des Mundwinkels dem anderen direkt mitteilte, was einem gerade durch den Kopf ging. In diesem Fall antwortete Larissa Martin mit einem Augenrollen bei gleichzeitig schmal gezogenen Lippen. Das bedeutete: Es nervt mich, aber du hast ja recht.
Sie ordnete ihren Dutt, ließ den Rest ihrer Aggression am Deckel der Biotonne aus, die sie mit einem kräftigen Kick ihrer Turnschuhe so fest nach oben trat, dass er mit einem ziemlichen Krachen wieder auf den Rahmen knallte. Aber dann hatte sie sich wieder gefangen. Sie fasste Martin an den Händen und sah ihm tief in die Augen. Nur ein kleines Wuttränchen, das ihre linke Wange herunterlief, verriet noch, dass sie bis gerade eben vor Zorn beinahe zum unglaublichen Hulk mutiert wäre. Und Martin, der fast zwei Köpfe größer war und ihren Blick erwiderte, beugte sich zu ihr hinunter und gab ihr einen seiner berühmt tollpatschigen Küsse, wobei sein Hemd immer, wirklich immer, aus der Hose rutschte und er es dann umständlich wieder hineinnesteln musste. Sie lächelten. Das war das Schöne an ihrer Ehe: Ihre Liebe zueinander war fast schon disneyartig groß, und sie wussten, dass sie zusammen alles schaffen konnten. Denn niemand ergänzte sich so gut wie sie. Da konnte sie nichts aufhalten. Nur hatten sie da leider die Rechnung ohne Karolina Strobl gemacht.
3.Älterwerden ist nichts für Feiglinge
Jeden Morgen, wenn Martin geduscht und sich angezogen hatte, beige oder graue Stoffhose, einfarbiges langärmeliges Hemd, bei gutem Wetter Poloshirt, bei schlechtem Wetter Sakko oder Pullunder, trank er seinen Morgenkaffee. Erst danach machte er sich ein kleines Müsli mit Früchten und aß einen Biohonigtoast, und zwar genau so, in exakt derselben Reihenfolge, jeden Morgen. Martin mochte Routinen, denn Routinen bedeuteten Verlässlichkeit, und Verlässlichkeit bedeutete Sicherheit. Nach dem Frühstück putzte er sich die Zähne, zog sich die Schuhe an und betrachtete sich in dem Ganzkörperspiegel mit dem schwarzen Rahmen, den sie direkt neben der Eingangstür aufgehängt hatten. Oft ertappte er sich dabei, wie er seinem eigenen Spiegelbild zunickte, als Bestätigung, dass er okay aussah. Das war ihm zwar dann immer ein kleines bisschen peinlich, aber da Larissa ja nicht zu Hause war, gab es auch niemanden, der das bemerkt hätte. Weil sie Lehrerin war und eine gute Dreiviertelstunde nach Heidelberg pendeln musste, stand sie meistens viel früher als er auf und war nicht selten schon aus dem Haus, wenn er gerade erst aufgestanden war. Aber sie verzichtete nie darauf, ihm direkt bei ihrer Ankunft ein kleines Daumen-hoch-Emoji zu schicken, damit er wusste, dass alles in Ordnung und sie sicher angekommen war.
An jenem Tag betrachtete sich Martin für jemanden, der nicht wirklich selbstverliebt war, erstaunlich lange im Spiegel. An den Schläfen kaum, dafür aber am Hinterkopf, wurden seine dunkelblonden Haare merklich lichter. Ein Kollege hatte ihm den unschönen Spitznamen »Landebahn« verpasst, dabei war der selbst seit mehreren Jahren quasi kahl. Im wie immer penibel glatt rasierten Gesicht fanden sich dafür erstaunlich wenig Falten, zumal wenn man bedachte, dass ihm eine gewisse Nachbarin seit mehr als zwei Jahren den letzten Nerv raubte. Martin strich sein hellblaues Hemd glatt, band sich die weißen Sneaker, durch die er die Lederschuhe ersetzt hatte, denn sein Chef hatte befunden, dass jemand in seinem Alter doch nicht herumlaufen müsse wie ein pensionierter Oberstudienrat, und seufzte noch einmal. Eigentlich hätte er ja gedacht, dass sie in diesem Abschnitt ihres Lebens schon zu dritt sein würden, aber sie hatten beide beschlossen, dass das Thema Kinder erst einmal hintanstehen müsse, bevor das Thema Karolina Strobl nicht endgültig geklärt wäre.
Seit zwei Jahren wohnten sie jetzt im Obergeschoss des Magnolienwegs 4, und seit zwei Jahren hatte sich das Haus nicht verändert. Nein, das stimmte nicht. Es war noch baufälliger geworden. Dafür waren sie jetzt hochverschuldet, der Immobilienmarkt war im Keller, die Wohnung unverkäuflich, und sie hatten viele neue Vokabeln gelernt, auf die sie liebend gerne verzichtet hätten: Eigentümerversammlung zum Beispiel. Die Eigentümerversammlung des Magnolienwegs 4 tagte viermal im Jahr und bestand, da es ja nur zwei Parteien gab, aus dem Ehepaar Imhoff, Frau Strobl aus dem Erdgeschoss und der Hausverwaltung, einem armen Kerl namens Hansi Gruber, der dann immer mit Martin, Larissa und ihrer Erzfeindin in einem neuen Karlsruher Restaurant sitzen und ihnen dabei zuschauen musste, wie sie sich an die Gurgel gingen. Denn wie angekündigt hatte Frau Strobl jeden einzelnen Renovierungs- oder Sanierungsvorschlag abgeschmettert, und weil ja niemand den anderen überstimmen konnte, gab es niemals nur den winzigsten Beschluss, den weiteren Verfall des Hauses abzuwenden. Also mussten Martin und Larissa weiterhin zusehen, wie die Bank sich jeden Monat ein mittleres Vermögen von ihrem Konto holte, während ihre Wohnung vor die Hunde oder, besser gesagt, vor die Pferde ging und Karolina Strobl entgegen allen Prognosen des schmierigen Maklers einfach nicht den Löffel abgeben wollte. Ironischerweise hatte sie besonders Larissa im Laufe der letzten Jahre so viele Nerven gekostet, dass sie an manchen Tagen in den Spiegel sah und nicht umhin kam zu denken: Ich sehe mittlerweile älter aus als sie. Klar, so schlimm war es in Wirklichkeit nicht, sie war immer noch sportlich, schlank und, unbedingt erwähnenswert, nicht unendlich traurig über den Untergang der Sowjetunion. Aber trotzdem: Manchmal kamen sie und Martin sich doch ganz schön alt vor in der asbestverseuchten Ruine, die sie teilweise, kurz bevor die Immobilienpreise wieder gefallen waren, für eine halbe Million Euro gekauft hatten.
Und die Eigentümerversammlungen waren ja nur das Sahnehäubchen der Geschichte. Viel schlimmer war der ganz normale Alltag. Die täglichen Müllkontrollen von Frau Strobl samt ihrer Angewohnheit, Müll, der ihrer Ansicht nach falsch sortiert war, vor ihrer Wohnungstür abzuladen. Das tägliche und eigentlich völlig unnötige Rasenmähen um 4 Uhr morgens. Denn Frau Strobl bewohnte ja die Erdgeschosswohnung und hatte damit auch den Garten mit gepachtet. Der Garten war groß, gemütlich, durch einen recht hohen Zaun sichtgeschützt, und in einem anderen Leben hatten Martin und Larissa doch tatsächlich gedacht, dass sie sich ihn mit der reizenden alten Dame aus dem Erdgeschoss würden teilen können. Stattdessen durften sie jetzt aus ihrer Wohnung voller Dachschrägen, dafür ohne Gaube oder Balkon, jeden Morgen beobachten, wie Frau Strobl einen heiligen Krieg gegen alles, was kreuchte und fleuchte, führte, Rasenmäher, Unkrautvernichter und Vertikutierer schwang und im Prinzip nichts hinterließ außer einem Haufen verbrannter Erde. Der Garten lag wüst, öd und leer, und sie waren sich sicher, dass Frau Strobl ihnen neben der Lärmbelästigung damit außerdem eine unverkennbare Botschaft schicken wollte: Lieber lasse ich hier jeden einzelnen Grashalm verrecken, als dass ich euch ein kleines Quäntchen Glück gönne.
Martin trank jetzt seinen Kaffee in einem Zug aus, räumte die Tasse mit der nur halb ironischen Aufschrift Insurance-Superman in die Spülmaschine und machte sich dann auf zu seinem Kundentermin. Er musste auf jeden Fall pünktlich Feierabend machen, denn heute Abend war Eigentümerversammlung, und das bedeutete in jedem Fall, dass es in irgendeiner Form eskalieren würde. Das stand man nur zu zweit durch. Oder, wenn man Frau Strobl war, indem man einfach den gesamten Hass des Universums für sich gepachtet hatte.
4.Die Eigentümerversammlung
Als der Wecker Martin am nächsten Morgen unsanft aufweckte, fühlte er sich, als wäre er gerade erst vor fünf Minuten eingeschlafen. Mühsam schälte er sich aus dem Bett und hörte dabei jeden einzelnen Knochen knacken. Er war das aber mittlerweile gewöhnt. So ging es ihm immer, wenn am Vorabend Eigentümerversammlung gewesen war.
Gerade gestern war es wieder enorm eskaliert. Larissa, Martin, Frau Strobl und Herr Gruber von der Hausverwaltung hatten sich in einer Neureuter Pizzeria getroffen, im mediterran angehauchten Außenbereich und extra an einem runden Tisch, weil Frau Strobl den anderen beim letzten Mal vorgeworfen hatte, sie würde sich an einem eckigen Tisch so ausgeschlossen und bedroht fühlen wie damals, als die NATO Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert hatte, die Moskau erreichen konnten. In die Richtung gingen nämlich immer ihre Argumente. Zuerst warf sie der Gegenseite, also Martin und Larissa, irgendetwas vor und driftete dann in ihre gruselige Sowjet-Nostalgie ab. Seit gut einem Jahr gesellten sich zu ihrer Totalverweigerung in puncto Haussanierung darüber hinaus noch ziemlich schräge Wahnvorstellungen, die regelmäßig in so absurden Anschuldigungen und Brüllattacken gipfelten, dass die Eigentümerversammlungen ergebnislos abgebrochen werden mussten und die vier aufgrund ihrer Lautstärke und Karolinas gefürchteten Spuckattacken in einer nicht unerheblichen Anzahl Karlsruher Restaurants Hausverbot genossen. Fairerweise musste man aber anmerken, dass auch Larissa bei ihren Treffen dazu neigte, schnell sehr, sehr laut zu werden und überzureagieren. Einmal hatte sie einen Barhocker nach Frau Strobl geworfen, nachdem die ihr vorgeworfen hatte, ihre Haare zu färben und dadurch das Leitungswasser zu vergiften. Welcher Vorwurf sie härter getroffen hatte, war auch von Martin nicht zu ermitteln gewesen, zumal ja auch Frau Strobl ziemlich sicher ihre Haare färbte. Zumindest, wenn sie nicht von einer mittelalterlichen Hexe oder dem Satan abstammte. Aber auch diese Möglichkeit konnte man mittlerweile ja nicht mehr ausschließen.
Sie waren für 19 Uhr verabredet gewesen, aber weil Martin seinen letzten Kundentermin am anderen Ende der Stadt gehabt hatte und es keine Parkplätze gegeben hatte, war er ein paar Minuten zu spät gekommen.
»Na, sieh mal einer an«, bemerkte Frau Strobl direkt scharf und richtete sich den Kragen ihres beigen Lacoste-Trainingsanzugs, um sich für den Kampf zu wappnen, »Ihnen scheinen unsere Treffen aber auch nicht besonders am Herzen zu liegen.«
»Mein Mann«, warf Larissa direkt ein, und die Schärfe in ihrer Stimme sowie die Tatsache, dass sich schon einige Strähnen aus ihrem Dutt gelöst hatten, deuteten darauf hin, dass die letzten fünf Minuten nicht besonders harmonisch verlaufen waren, »hatte einen wichtigen geschäftlichen Termin. Es gibt nämlich Menschen, die in ihrem Leben etwas Produktives tun. Das habe ich Ihnen jetzt aber schon dreimal erklärt.«
»Schön und gut«, giftete Frau Strobl zurück, während der arme Herr Gruber sich mitsamt seiner Halbglatze hinter einer überdimensionierten Weinkarte vergraben hatte, »aber Pünktlichkeit ist in meiner Generation ein hohes Gut. Genauso wie Höflichkeit und Respekt, zumal damals in der Sowjetunion, Gott habe sie selig. Ich kann mir wirklich nicht erklären, warum die jungen Leute keinerlei Interesse mehr an guten Manieren haben.«
»Sie spucken auf Ihre eigene Türmatte, wenn Sie uns sehen!«, entfuhr es Larissa, und sie hieb mit der flachen Hand auf den Tisch, sodass die bereitgelegten Bierdeckel einen kleinen Hopser machten. Leider gelang es ihr immer noch nicht, die Fassung zu wahren, wenn Frau Strobl ihre gut gezielten und akribisch geplanten Spitzen setzte. Das brachte dann leider den Nachteil mit sich, dass in schöner Regelmäßigkeit sie und eben nicht Frau Strobl als Urheberin des Krawalls ausgemacht wurde, wenn ein beflissener Kellner mit unterdrückter Stimme darum bat, sich zu mäßigen oder das Lokal zu verlassen.
»Das ist ein medizinisches Problem«, antwortete Frau Strobl mit fast schon süffisanter unschuldiger Stimme, »wie soll ich denn das bitte kontrollieren?«
»Man könnte zum Beispiel ein Taschentuch benutzen«, zischte Larissa, »ich nehme an, die gab es sogar in der Sowjetunion. Vielleicht sogar mit einer Gratisdosis Manieren.«
Martin legte ihr zur Sicherheit unter dem Tisch die rechte Hand auf den Oberschenkel. Nur falls sie gleich versuchen sollte, Frau Strobl einen ihrer gefürchteten Karatetritte zu verpassen. Ihr ganzes Bein vibrierte vor Wut.
»Manieren sind ein gutes Stichwort«, sagte Frau Strobl, entnahm ihrer Handtasche einen billig wirkenden Fächer mit Chinamotiven und begann, sich Luft zuzufächeln. »Die bräuchte Ihr Mann wirklich dringend. Er brüllt jede Nacht herum wie ein Wahnsinniger! Neulich wäre ich fast aus dem Bett gefallen vor Schreck! Der Bursche ist ja wie vom Teufel besessen!«
Martin musste jetzt gut überlegen, was er darauf antworten sollte. Denn leider hatte sie da tatsächlich einen Punkt, zumindest teilweise: Wenn er nicht schlafen konnte, spielte er gerne im Wohnzimmer Playstation und brüllte zwar nicht, kommentierte seine Spiele jedoch selbst. Aber erstens tat er dies bei Weitem nicht jede Nacht und zweitens: Niemals würden sie Karolina Strobl den Triumph gönnen, ihr auf der Eigentümerversammlung in irgendeinem Punkt recht zu geben.