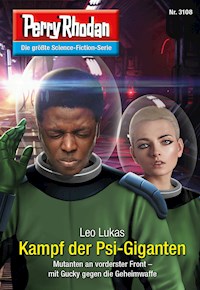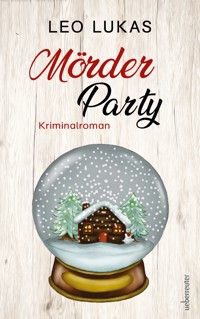
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Ueberreuter Verlag GmbH
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Pistengaudi, Hüttenzauber und eine tiefgefrorene Leiche Weihnachtsferien auf einer urigen Almhütte mitten im schönsten Schigebiet – das klingt nach genau der Erholung, die sich Chefinspektorin Karin Fux redlich verdient hat. Aber ausgerechnet ihr zwielichtiger Informant Peter Szily logiert im selben Haus. Schon bald schlägt das Wetter um. Ominöse Todesfälle ereignen sich und Fux muss all ihre Erfahrung, Scharfsinnigkeit und Karatekünste aufbieten. Denn drinnen in der Hütte, draußen im Schneesturm und bei der großen Silvesterparty treibt sich mehr als nur ein Auftragsmörder herum … Ihr dritter gemeinsamer Fall führt Fux, Pez und den Bravo zu den Schattenseiten der Tourismusindustrie, in eine klirrend kalte, ganz und gar nicht idyllische Bergwelt. Mit feinem Witz und viel schwarzem Humor schildert Bestseller-Autor Leo Lukas das ungewöhnliche Dreiecksverhältnis von Killer, Komiker und Kriminalistin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Danke, dass Sie sich für unser Buch entschieden haben!
Sie wollen mehr über uns & unsere Bücher erfahren, über unser Programm auf dem Laufenden bleiben sowie über Neuigkeiten und Gewinnspiele informiert werden?
Folgen Sie
auch auf Social Media
& abonnieren Sie unseren Newsletter!
Über das Buch
Weihnachtsferien auf einer urigen Almhütte mitten im schönsten Schigebiet – das klingt nach genau der Erholung, die sich Chefinspektorin Karin Fux redlich verdient hat.
Aber ausgerechnet ihr zwielichtiger Informant Peter Szily logiert im selben Haus. Schon bald schlägt das Wetter um. Ominöse Todesfälle ereignen sich und Fux muss all ihre Erfahrung, Scharfsinnigkeit und Karatekünste aufbieten, denn drinnen in der Hütte, draußen im Schneesturm und bei der großen Silvesterparty treibt sich mehr als nur ein Auftragsmörder herum …
Ihr dritter gemeinsamer Fall führt Fux, Pez und den Bravo zu den Schattenseiten der Tourismusindustrie, in eine klirrend kalte, ganz und gar nicht idyllische Bergwelt. Mit feinem Witz und viel schwarzem Humor schildert Bestseller-Autor Leo Lukas das ungewöhnliche Dreiecksverhältnis von Killer, Komiker und Kriminalistin.
Die Rinne lag bereits vollständig im Schatten der Böschung zur linken Hand.
Rechter Hand schützte ein Fangzaun vor dem Abgrund.
Karin Fux schlitterte auf Eisplatten dahin, hielt mit den Stöcken die Balance. Ihr Atem kondensierte zu rasch verwehenden Wölkchen. Es war sehr still, von der Seilbahn nichts mehr zu hören, auch sonst kein Geräusch außer ihrem eigenen Keuchen und dem Knarzen der Schuhe.
Dann ein Schrei.
Links oben.
Fux hielt abrupt an, rutschte weiter, verlor das Gleichgewicht, ruderte mit den Armen, fiel nach hinten, rammte die Stockspitzen in den Untergrund, kam zum Stillstand. Vielleicht zehn Meter vor ihr polterte etwas zwischen Felsblöcken und Legföhren die Böschung herab – eine Gestalt, ein Mensch, der sich überschlug – einmal, zweimal –, von der gegenüberliegenden Wölbung wie in einer Halfpipe hochgeschleudert wurde, über den Zaun hinaus und, zusammen mit zwei einzelnen Skiern, …
Mit freundlicher Unterstützung durch
Danke, dass Sie sich für unser Buch entschieden haben!
Sie wollen über unser Programm auf dem Laufenden bleiben sowie über Neuigkeiten und Gewinnspiele informiert werden? Folgen Sie uns auf Social Media oder abonnieren Sie unseren Newsletter.
1. Auflage 2023
© Carl Ueberreuter Verlag, Wien 2023
ISBN 978-3-8000-9016-7 (print)
ISBN 978-3-8000-9916-0 (e-book)
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Lektorat: MMag. Marie-Therese Pitner
Covergestaltung: Saskia Beck | s-stern.com
Grafiken: Cover, Schneekugel (c) etsy_Deanna M | Innen, Kipferl © iStock
Satz: Lisa Wilfinger | Carl Ueberreuter Verlag
Druck und Bindung: Brüder Glöckler | Wöllersdorf
www.ueberrreuter.at
Inhalt
Prolog: Der Auftrag
22. Dezember
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
23. Dezember
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Zwischenspiel: Der Anflug
26. Dezember
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
27. Dezember
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
28. Dezember
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Zwischenspiel: Der Fehler
29. Dezember
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
30. Dezember
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
31. Dezember
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
1. Januar
Epilog: Der Widerhall
Nachbemerkung
Über den Autor
PrologDer Auftrag
Die Leute sehen durch mich hindurch, als wäre ich nicht vorhanden.
Das war schon immer so. Als Kind habe ich darunter gelitten. Fühlte mich schlecht. Schlimmer: wertlos. Brauchte eine Weile, bis ich erkannte: Nie bemerkt zu werden, ist eine Gabe. Praktisch – vor allem bei gewissen, überall auf der Welt verbotenen Tätigkeiten.
Manchmal bin ich gezwungen, mit jemandem zu reden. Selbst dann vergessen sie mich gleich wieder. Stimme, Geruch, Körpersprache – alles komplett unauffällig. Sie erinnern sich höchstens an meine Verkleidung: Arzt, Nonne, Handwerker, Paketzusteller, was auch immer. Vollbart, Schnurrbart, Backenbart. Weiße, blonde, rote, dunkle Haare, glatt oder lockig, kurz oder lang. Oder Glatze. Tätowierung am Hals, Ring im Ohr. So was bleibt hängen, wenn ich eine falsche Fährte legen will. Sonst nichts.
Nach Möglichkeit vermeide ich Sozialkontakt. Mit Menschen kann ich nicht gut, außer sie vom Leben zum Tod befördern.
Ich bin der Bravo. So lautet mein Deckname, nach einem altitalienischen Ausdruck für Meuchelmörder.
Im Wiener Kunsthistorischen Museum hängt ein Gemälde, das den Titel „Der Bravo“ trägt. Von Tizian. Renaissance. Sehr dunkle Farben. Aber der Name hat mir gefallen.
Bravo. Klingt irgendwie positiv, gell?
Obwohl ich naturgemäß nicht nach Applaus giere. Der beste Mord ist einer, der unentdeckt bleibt. Signaturen hinterlassen nur Spinner. Ich hingegen arbeite seit vielen Jahren als Profikiller, und dass man mich nie erwischt hat, nehme ich als Indiz dafür, dass ich ziemlich klar im Kopf bin. Mir fiele im Leben nicht ein, eine zuordenbare „Handschrift“ zu entwickeln. Da könnte ich ja gleich Interviews für Fernsehdokus geben. Mit verpixeltem Gesicht, Sie wissen schon, und verfremdeter Stimme: „Derzeit leidet unsere Branche unter Fachkräftemangel, wie der gesamte Dienstleistungssektor …“
Nein, danke. Nicht mein Ding.
Bei der Kripo bezweifeln sie sogar, dass ich überhaupt existiere. Vor einigen Jahren behauptete eine Zeitung, die Wiener Kriminalkommissarin Karin Fux jage seit Langem einen Auftragsmörder, der Bravo genannt werde. Zwei Tage später brachte ein etwas seriöseres Blatt ein Dementi der Beamtin. Nicht ohne süffisant zu ergänzen, dass es in Österreich, anders als bei der deutschen Polizei, gar keine „Kommissare“ gibt. Vielmehr bekleidet Frau Fux den Dienstgrad einer Chefinspektorin.
Übrigens glaube ich, dass sie geschwindelt hat und sehr wohl hinter mir her ist. Immer wieder mal zwischendurch nimmt Fux sich die ungeklärten Todesfälle vor und klopft sie auf ähnliche Muster und eventuelle Querverbindungen ab. Wurde mir zugetragen, von einer relativ zuverlässigen Quelle.
Egal. Ich habe meine Sicherheitsvorkehrungen optimiert. Voriges Jahr gelang es ausgerechnet dem Komödianten Peter Szily, mich aufzuspüren und in eine Falle zu locken. Das war mir eine Lehre und darf nie wieder vorkommen.
Jetzt stehen wir vor einer paradoxen Situation. Einerseits will ich unauffindbar sein, perfekt abgeschirmt, andererseits müssen mich potenzielle Kunden erreichen können. Ich gehöre aber keiner kriminellen Organisation an. Bin überzeugter Einzelgänger. Traue niemandem. Scheue Gesellschaft.
Also wie nimmt man mit mir Kontakt auf?
Vergessen Sie schmuddelige Rotlicht-Bars oder das Dunkelnetz! Da wie dort gibt es Spitzel und generell zu viele Maulhelden.
Aber Sie können mir eine Nachricht zukommen lassen. Verschlüsselt natürlich. Beispielsweise zeigt mir ein Bewegungsmelder an, dass letzte Nacht in einen meiner Briefkästen eine alte Zeitung geworfen wurde. Freitagausgabe, daher ist das Sudoku-Rätsel „sehr schwierig“. Während ich es löse, notiere ich nach der Reihe die Zahlen, deren Positionen ich vollständig eruiert habe. Sicherheitshalber vergleiche ich das Ergebnis mit dem eines Sudoku-Rechners. Die Ziffernfolgen stimmen überein: 2-7-3-4-5-6-1-8-9.
Setzen wir Null davor, bekommen wir eine Telefonnummer. 02734 ist die Vorwahl von Langenlois, einer niederösterreichischen Kleinstadt, in der seit tausend Jahren Weinbau betrieben wird. Mit der Fortsetzung 56189 ergibt die Rufnummernsuche keinen Treffer. Aber das muss nichts heißen.
Ich verwende ein Burner-Phone, ein Prepaid-Handy, das ich nie zuvor benutzt habe und danach wegwerfen werde. Das Freizeichen erklingt, dreimal, ein paar Sekunden lang klassische Musik und schließlich eine computergenerierte Frauenstimme: „Künstlervermittlung Schalk International Artists. Unser Büro ist zurzeit nicht besetzt. Bitte besuchen Sie unsere Homepage www.schalk.at. Wir danken für Ihr Interesse.“
Per nicht rückverfolgbarem Internet-Zugang forsche ich nach. Keine einzige hundertprozentige Übereinstimmung. Bloß ein südafrikanischer Maler, eine kleine norddeutsche Spedition und ein oststeirisches Viehhandelsunternehmen. Dass bei „Nutztiere Schalk“ Künstler mitgemeint sind, schließe ich aus.
Sollte eine Agentur, die „International Artists“ im Namen führt, nicht medial präsenter sein?
Sehen wir uns also die Homepage an. Erster Eindruck: billig. Einfach und doch geschmacklos. Hurtig erstellt, indem bei einer handelsüblichen Vorlage Texte und Bilder ausgetauscht wurden. Das Firmenlogo besteht aus SCHALK in Comic Sans-Schrift, mit der übergestülpten Federzeichnung einer Schellenkappe.
Alter Vater. So was traut sich eine professionelle Werbeagentur nicht mal mehr in Langenlois.
Der jüngste Eintrag unter „Aktuell“ trägt dasselbe Datum wie die mir zugespielte rosarote Bobo-Zeitung. Zufall? Unwahrscheinlich. Regenbogenförmig angeordnete und ebenso bunte Lettern verkünden: TOP TIP – JAJA BAND. Das Foto zeigt zwei ältere Herren. Ihre Anzüge, Haarschnitte und Hüte waren schon vor der Ostöffnung aus der Mode. „Úžasný band na oslavy a párty“, steht darunter, „hrají vsechno též španělský nebo německy.“ Sowie die Übersetzung: „Tolle Band für Feiern und Partys, sie spielen auch alles auf Spanisch oder Deutsch.“
Außerdem gibt es auf der Seite einen von Blümchen umrahmten Kasten: „Schüttelreim des Tages:
Letztlich liegt, war noch so groß der Schuft,
Kaiser wie Narr doch im Schoß der Gruft.“
Ich muss nicht lange nachdenken, bis der Groschen fällt.
Sollte jemand unabsichtlich 02734-56189 gewählt oder www.schalk.at eingetippt haben, glaubt er wohl, bei mitleiderregend pimpigen Amateuren gelandet zu sein, und wird keinen weiteren Gedanken darauf verschwenden. Mir jedoch sagt das Arrangement etwas völlig anderes: Wer immer auf diese Weise mit mir in Verbindung treten möchte, weiß beunruhigend viel über mich.
Wenig später fahre ich in einem Bus der Linie 39A durch die Sieveringer Straße. Das ist keine arme Gegend. Schmucke Häuser, Villen, Seniorenresidenzen. Ordinationen, Tierarztpraxis „Pfotenzone“, auch eine „Teppichklinik“. Überhaupt lustige Namen: „Café Nest“, „Restaurant Erbsenbach“, „Blumen Böse“ – ob die Gärtnerfamilie Baudelaires Gedichte kennt? Einige Baustellen, die „Exklusive Eigentumswohnungen“ versprechen … „In Sievering blüht der Flieder“, heißt es schon im Strauß-Walzerlied. Gewisse Blüten gibt es hier das ganze Jahr über und Schwarzgeld ist die beliebteste Währung in Währing wie in Döbling.
Bei der Fröschelgasse steige ich aus und gehe weiter stadtauswärts. Ein Schild kennzeichnet den Einstieg zum „Stadtwanderweg 2“. Das letzte Haus vor der Abzweigung in den Gspöttgraben ist ein moderner dreistöckiger Bau, seine Form erinnert entfernt an die Kuppel eines Observatoriums. Zwei blutrote Stier-Statuen flankieren das Portal. Vom Balkongeländer hängt ein Transparent. Brennende Motorräder sind aufgedruckt und rote fetzige Horror-Schriftzeichen: „Monsters of Stunt“. Den Schaukasten an der Mauer füllt ein Plakat im Stil eines Western-Steckbriefs, vier grobkörnige Porträts, darüber „MoSt Wanted“. Sich als Kapitalverbrecher darzustellen, scheint immer noch schick zu sein.
Ich spaziere bergan. Der Untergrund wandelt sich von Asphalt zu Schotter, durchsetzt mit Matsch. Linker Hand geht es zum Steinbruch. Von dort führt ein steiler Pfad direkt auf die Anhöhe. Ich bleibe aber auf dem breiten Wanderweg, wo etliche Leute unterwegs sind, meist allein, seltener Pärchen oder Familien. Sollte jemand das Gelände überwachen, per Fernrohr oder Kameradrohne, steche ich hier weniger heraus als einsam zwischen Felsen und kahlen Bäumen.
„Am Himmel“, so der Name des Areals, ist ein seit über 200 Jahren beliebtes Ausflugsziel. Mittlerweile gibt es einen Kinderspielplatz, einen „Lebensbaumkreis“ mit Amphitheater und ein achteckiges Café-Restaurant. Die treibende Kraft hinter dem Ganzen, ein ehemaliger Au-Besetzer, hat Biosphären- und Nationalparks verwirklicht, die Privatisierung vieler Wasser- und Waldbestände vereitelt und sich dadurch eher wenige Freunde bei Energiekonzernen gemacht.
Vor der Caritas-Schule biege ich nach links ab. Der Weg mündet in einer kleinen Lichtung. Dort steht ein schlankes weißes Gebäude mit mehreren Türmchen: die Sisi-Kapelle.
Des Rätsels Lösung fiel nicht schwer. Sie steckt im Namen des tschechischen, laut Agentur-Homepage mehrsprachigen Unterhaltungs-Duos „Jaja Band“. Ja heißt auf Spanisch Si, Jaja also Sisi, und das deutsche Wort für Band lautet …? Richtig, Kapelle.
Der Schüttelreim Schuft / Gruft verstärkt den Hinweis, denn das neogotische Bauwerk ist ein Mausoleum.
Errichtet hat es Johann von Sothen, ein Tabaktrafikant, der den Leuten mit Glücksspielen das Geld aus der Tasche zog und so zum Bankdirektor und Millionär aufstieg. Quasi der Monsieur Novomatic des 19. Jahrhunderts. Nachdem ihn sein eigener Förster erschossen hatte, wurde Sothen in der Kaiserin Elisabeth gewidmeten Kapelle beigesetzt. Sisi wiederum kokste nicht nur ganz gern – das Hofburgmuseum stellt ihr Fixer-Besteck aus –, sondern schrieb auch Gedichte: „Schweizer, Ihr Gebirg ist herrlich! / Ihre Uhren gehen gut. / Doch für uns ist höchst gefährlich / Ihre Königsmörderbrut.“ Als hätte sie geahnt, dass man sie am Genfer See erstechen würde. Mit einer Nagelfeile!
Während ich vortäusche, die Kapelle zu fotografieren, umrunde ich sie. Weit und breit niemand. Das Zylinderschloss an der Tür wehrt sich nicht lange. Innen ist es merklich kälter als draußen. Die jeweils sieben an den Längsseiten in die Wände integrierten Flachbildschirme sind dunkel; in Betrieb zeigen sie laut aufliegenden Flyern einen „Kreuzweg der Natur“. Bugholzstühle wurden fein säuberlich in sechs Gruppen zu je fünf gestapelt. Ich steige die vier Stufen zum Altar hinauf. Den Tisch vor den drei Lanzettfenstern bedecken zwei überlappende reinweiße Tücher, auf denen ein Messbuch liegt.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bilden die erwähnten Zahlen tatsächlich einen Countdown? Und falls ja, was passiert bei Null?
Ich habe einen Scanner bei mir. Er registriert keine aktiven elektronischen Geräte. Handschuhe trage ich sowieso, dennoch fahre ich meinen Teleskop-Schlagstock aus, um damit den Buchdeckel zu öffnen. Auf der linken Umschlagseite klebt ein QR-Code. Der Schmutztitel rechts ist nicht paginiert, aber da beginnt gewöhnlich die Zählung bei eins, also entspräche das Innere des Deckels der Null.
Behutsam löse ich das Etikett ab und sichere es in einem Flyer, den ich einstecke. Dann verlasse ich die Sisi-Kapelle. Unbehelligt kehre ich in die Stadt zurück.
Meist verlinken Quick Response Codes ins Internet. Die quadratische schwarz-weiße Matrix aus dem Messbuch entfaltet sich jedoch zu einer Eingabemaske. Violetter Bildschirmhintergrund, sonst nichts außer einem Mikrofonsymbol, einem Violinschlüssel und der Schrift „Akustische Authentifizierung“. Anscheinend wird zusätzlich zur Standard-Dekodierung eine Legitimation via Spracherkennung verlangt, ehe die Pixel das Gespeicherte freigeben.
Hm. Ich habe lange darauf hingearbeitet, dass meine Stimme ebenso uncharakteristisch wirkt wie mein Gesicht. Peter Szily, der sich als Parodist mit so etwas auskennt, meinte einmal, ich klinge zwar nicht monoton, flach oder zu leise, aber „absolut eigenschaftslos“. Davon abgesehen, gibt es meines Wissens keine Tonaufzeichnungen von mir. Zumindest nicht solche, die mit dem Bravo in Verbindung gebracht werden könnten. Außer vielleicht an einem sehr speziellen, in keinem Stadtplan verzeichneten Ort … Ich räuspere mich, weiß nicht, was ich sagen soll. Eloquenz zählt nicht zu meinen Stärken. „Eins, zwei, eins, zwei“, wie bei einem Soundcheck?
Der ominöse Klient kann nicht wollen, dass ich scheitere. Er möchte ja meine Dienste in Anspruch nehmen. Welchen Sinn hätte sonst die umständliche Kontaktaufnahme über Sudoku, Geheimnummer und so weiter?
Es muss einen anderen Weg geben, die Nachricht freizuschalten. Einen anderen Schlüssel.
Die Stimme auf dem Anrufbeantworter der Agentur Schalk? Nein. Sie war synthetisch erzeugt, mit einem Programm, das auf der ganzen Welt millionenfach eingesetzt wird. Aber Moment: Davor erklang kurz Musik! Ein paar Takte, die sogar ich nicht zum ersten Mal gehört habe, obwohl ich beileibe kein Klassik-Experte bin.
Ta-ta-ta-taaa …
Wie ein Anklopfen. Als begehre jemand Einlass.
Ta-ta-ta-taaa …
Oder wie das Morsezeichen für den Buchstaben „V“, lateinisch auch die Ziffer fünf.
Tatata ta, tatata ta, tatata taaa …
Beethoven. Oder? Klar doch. Kennt wirklich fast jeder. Der Anfang der 5. Sinfonie, wie ich rasch herausfinde. „So pocht das Schicksal an die Pforte“, hat der Komponist angeblich seinem Sekretär gesagt. Ich lade das Musikstück hoch.
Tatsächlich sperrt der Noten-Schlüssel. Ich lese die Nachricht. Dann nochmals, ganz langsam, Satz für Satz, Wort für Wort. Wie ich es drehe und wende, sie ist unmissverständlich.
Mein Verdacht hat sich bestätigt. Das bedeutet leider auch, dass ich diesen Auftrag annehmen muss, obwohl er mir sehr zuwider ist. Unter anderen Umständen hätte ich ihn harsch abgewiesen. Aber so … Nicht einmal ich könnte mir das leisten. Es wäre mein Ende, als Bravo und überhaupt. Müßig, darüber zu grübeln. Jammern bringt erst recht nichts.
Einen leisen Fluch gestatte ich mir schon, als ich mich eilig daranmache, die geeignete Ausrüstung zusammenzustellen, herzurichten und einzupacken. Eine Tätigkeit, die mir normalerweise Freude bereitet; diesmal nicht.
Mir missfällt diese Sache. Glauben Sie mir, die ganze Geschichte ist mir äußerst unangenehm.
Um zu verstehen, wie es dazu kam, müssen wir die Zeit einige Tage zurückdrehen.
22. Dezember
Namenstag: Franziska Xaveria
Die erste Heilige der USA, Tochter lombardischer Bauern, gründete Spitäler, Schulen und Heime. Ihre Kongregation, die „Missionarinnen vom Heiligsten Herzen“, kümmerten sich vor allem um Einwanderer, die sich in der neuen Heimat schwer zurechtfanden.
22.12.1808: Die Uraufführung
der „Schicksalssymphonie“ Ludwig van Beethovens im Theater an der Wien stößt auf wenig Begeisterung. Der Saal ist ungeheizt, das Konzert dauert vier Stunden, das Orchester hat unzulänglich geprobt und der Komponist, der selbst als Dirigent und Klaviersolist fungiert, hört und spielt schon sehr schlecht. Hernach ist Beethoven so frustriert, dass er nur mit erheblichen finanziellen Zuwendungen davon abgehalten werden kann, Wien zu verlassen.
22.12.1849: Die Exekution des Schriftstellers
Fjodor M. Dostojewski auf einem Paradeplatz in St. Petersburg stellt sich als Scheinhinrichtung heraus. Dem bereits in einen Leichenkittel gekleideten 28-Jährigen wird ein Erlass des Zaren vorgelesen, der ihn stattdessen zu vier Jahren Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt.
1
„Ich höre, ihr habt ein Geständnis“, sagte Oberst Mirnegg, der Leiter des Ermittlungsdienstes.
Chefinspektorin Karin Fux nickte. „Im Prinzip ja. Und wenn’s dabei bleibt, bald auch offiziell.“
„Gratuliere. Flotte Arbeit.“
„Wir hatten schon kniffligere Fälle. Trotzdem danke.“
„Kaffee?“
„Gern. Daheim ist er mir ausgegangen.“ Wie auch diverse andere Grundnahrungsmittel. Aber diese Woche war sie bisher ohnehin nur zum Schlafen in ihrer Wohnung gewesen.
Mirnegg drückte eine Taste der Gegensprechanlage, die nicht viel jünger war als er, beugte sich vor und sagte, sehr deutlich artikulierend: „Steffi, bitte noch eine Melange für mich und …“ Er sah Fux an und hob fragend die buschigen grauen Augenbrauen.
„Einen Verlängerten. Ohne alles.“
„… einmal verlängert schwarz.“
Aus dem Lautsprecher rauschte es: „Lungo oder Americano? Klein, medium oder X-large?“
Fux schnitt eine Grimasse. „Hauptsache heiß und viel.“
„Großer Lungo“, gab der Oberst weiter. Zu Fux sagte er: „Neue Kaffeemaschine. Verfrühtes Weihnachtsgeschenk vom Generalmajor. Wenn ich’s richtig verstanden habe, wird beim Americano erst hinterher mit heißem Wasser aufgefüllt. Deshalb ist er ein bisschen schwächer und weniger bitter.“
„Wieder was gelernt.“
Mirnegg hatte sie vor dem Lift abgefangen und in sein Büro im ersten Stock des Wiener Landeskriminalamts beordert. Dass er sich nach dem Stand der Ermittlungen erkundigte, kam nicht unerwartet. Der aktuelle Fall, so unkompliziert er sich darstellte, hatte einen pikanten Beigeschmack. Fux war gespannt, ob und wann der Oberst sie darauf ansprechen würde.
Bis der Kaffee gebracht wurde, plauderten sie über die bevorstehenden Weihnachtsferien. Normalerweise ließ Fux sich an Feiertagen zum Journaldienst einteilen, aus Rücksicht auf Kollegen mit Familie. Diesmal hatte sie sich von Stefanitag bis Neujahr freigenommen.
„Du fährst auf Skiurlaub?“, fragte Mirnegg.
„Ja. Eigentlich mag ich den Wirbel an den Liften nicht. Aber heuer nehme ich meinen Neffen mit. Das hat er sich zu seinem vierzehnten Geburtstag gewünscht und ich habe ihm einen Gutschein geschenkt.“
„Den er jetzt tatsächlich einlöst? Bei uns daheim liegen massig verfallene Gutscheine herum. Für alles Mögliche, vom Babysitten bis zum Wellness-Wochenende. Nur dass das Kind inzwischen in der HTL ist und das Thermenhotel in Konkurs.“
Fux lachte. „Fabian vergisst so was nicht, der ist hartnäckig.“
„Das hat er wohl mit seiner Tante gemeinsam.“
„Könnte sein.“
„Ein paar Tage Erholung hast du dir redlich verdient. Nur blöd, dass die Skigebiete derzeit unter Schneemangel leiden.“
„Nicht, wo Fabian und ich hinfahren. Außerdem soll es nächste Woche kräftig schneien.“
„Hoffentlich auch in tieferen Lagen. Diese Saison gab’s schon genug schwere Unfälle von Leuten, die über die Piste hinaus ins Apere gerast sind und sich derstessen haben; auch Tote.“ Es klopfte. „Herein!“ Die Sekretärin stellte ein Tablett mit zwei Tassen, einem Zuckerstreuer und einem Teller Vanillekipferl auf Mirneggs Schreibtisch ab. „Bitte, greif zu!“
Sowohl der Verlängerte, pardon: Lungo, als auch die Kekse schmeckten … naja, eh gut. Nichts daran auszusetzen. „Mm“, machte Fux. „Super.“
„Du wirkst nicht ganz glücklich“, sagte der Oberst. „Mit euren Ergebnissen, meine ich.“
„Doch, doch. Sieht alles gut aus. So gut wie wasserdicht.“
„Trotzdem hast du noch Zweifel.“
„Die habe ich fast immer, wenn wir so schnell abschließen. Ich bin froh darüber, aber … Es geht mir ein bisschen zu glatt.“
„Was ich an dir sehr schätze.“ Mirnegg schlürfte an seiner Melange, dann tupfte er sich mit einem gebügelten Stofftaschentuch die Lippen ab. „Gleichwohl wäre jetzt ein idealer Zeitpunkt, um den Deckel draufzusetzen.“
„Schon klar.“
Grundsätzlich handelte es sich nicht um einen clamorosen Fall. So nannten es die Staatsanwälte, wenn man mit erheblichem Medieninteresse rechnen musste; etwa, weil bekannte Persönlichkeiten involviert waren. Das traf zum Glück nicht zu. Der Fundort des Opfers jedoch …
„Wann ist die Vernehmung angesetzt?“
„Um zehn.“ Fux sah auf die Armbanduhr. „In einer halben Stunde. Wegen des Dolmetschers, er konnte nicht früher.“
„Noch reichlich Zeit. Gib mir eine Kurzzusammenfassung, ja? Gut möglich, dass mich demnächst die Rappold anruft. Nicht, dass die mehr weiß als ich!“
Seine Sorge war berechtigt. Claudia Rappold, die mit allen Wassern gewaschene Lokalreporterin der auflagenstärksten Tageszeitung, hatte mehr als einen Informanten bei der Polizei, und nicht bloß im LKA Wien Berggasse.
„Okay.“ Fux holte ihr Notizbuch aus dem Rucksack und blätterte darin, obwohl sie das meiste aus dem Gedächtnis zitieren konnte. „Am Montagmorgen, zirka zehn Minuten vor sechs Uhr, wurde im Tiefparterre des Hauses Gaullachergasse 13, Bezirk Ottakring, die Leiche eines unbekannten Mannes entdeckt. Diese Kellerräumlichkeiten nutzen mehrere Geschäfte des Brunnenmarkts als Getränkelager. Einer der Standler hat den Toten gefunden und die Polizei verständigt.“
Oberst Mirnegg seufzte. „Kein Syrer, oder?“
„Nein. Österreichischer Staatsbürger, die Großeltern stammen aus der Türkei.“
„Immerhin.“
Der Brunnenmarkt, der längste permanente Straßenmarkt Europas, war kürzlich wieder einmal ins Gerede geraten. Dort herrschten, hatte der Obmann der Wiener Volkspartei in einem Video behauptet, mafiöse Zustände. Die Macht hätten Afghanen, Araber und insbesondere ein Syrer übernommen, dem schon fünf Geschäfte gehörten. Rasch hatte das städtische Marktamt klargestellt, dass es keinen solchen syrischen Paten gab, auch keineswegs eine Monokultur, sondern vielmehr eine bunte Mischung: Insgesamt betätigten sich am Yppenplatz und in der Brunnengasse Unternehmer mit 46 Nationalitäten.
Also unhaltbare Gerüchte, reiner Alarmismus eines um Aufmerksamkeit bettelnden Oppositionspolitikers? Business as usual, nicht der Rede wert – wäre besagter ÖVP-Chef nicht früher Landespolizeipräsident gewesen; ein ziemlich tadelloser sogar. Momentan war deshalb bei allem, was mit dem Brunnenmarkt zusammenhing, Fingerspitzengefühl geboten. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Kriminalfall für Wahlkampfmunition missbraucht wurde.
Als Chefinspektorin leitete Karin Fux eine von drei sechsköpfigen Gruppen der Abteilung „Leib und Leben“, intern die „Gewalt“ genannt, unbestritten Stolz und Aushängeschild der Wiener Kripo. Mit Parteipolitik wollte sie nichts zu tun haben. Freilich war es kein Geheimnis, dass viele Exekutivbeamte eher zu den Rechtspopulisten tendierten. Auf der Schmelz in Ottakring, im hauptsächlich aus einer Polizistenwohnsiedlung bestehenden Sprengel 44, erzielte die FPÖ bei Gemeinderatswahlen regelmäßig ihre besten Ergebnisse. Der Wiener Volksmund hatte dem Häuserblock den Spitznamen „blaues Aquarium“ verliehen.
„Über das Opfer wissen wir leider nicht viel.“ Fux blätterte weiter. „Sehr wahrscheinlich gebürtiger Subsahara-Afrikaner, Mitte zwanzig, 185 Zentimeter groß, gut in Form, vielleicht sogar Leichtathlet. Keine Papiere, in den Taschen der Diskonter-Kleidung nichts außer ein bisschen Kleingeld. Keine Übereinstimmung mit Fahndungsanzeigen oder Vermisstenmeldungen.“
„Ein U-Boot?“
„Darauf deutet einiges hin. Wir haben das Foto des Leichnams am Markt herumgezeigt. Niemand kannte ihn, auch die Leute von den afrikanischen Fleischhauereien nicht.“
„Glaubwürdig?“
„Mein Gruppeninspektor Gallaun wohnt in der Nähe und kauft dort öfter ein. Er meint, die Standler sind zum ganz überwiegenden Teil koscher. Beziehungsweise in diesem Fall halal. Benedikt hat nicht das Gefühl, dass sie mauern, sondern im Gegenteil an einer raschen Aufklärung interessiert sind.“
„Blaulicht mindert den Geschäftsgang.“
„Genau. Bei der Obduktion kam ebenfalls nichts heraus, was darauf hingewiesen hätte, wer der Tote war. Völlig clean in puncto Drogen. Mutmaßlich ist er ins Lager eingebrochen, wurde ertappt und mit einer Glasflasche niedergeschlagen.“
„Von …?“
„Gleich. – Todesursache war jedoch nicht die Platzwunde am Kopf. Sondern der Genickbruch, den er sich beim Sturz über die Treppe zum Kellergeschoß zugezogen hat.“
„Was wird in den Räumen gelagert?“
„Im Tiefparterre, das vom Innenhof aus über eine Rampe für Hubstapler zugänglich ist, palettenweise Softdrinks in Eineinhalbliter-Plastikflaschen sowie Dosenbier. Weiter unten auch Hochalkoholisches, vor allem Raki und Ouzo.“
„Sonst nichts?“
Fux schüttelte den Kopf. „Könnte sein, dass einiges von dem Zeug Schmuggelware oder irgendwo vom Laster gefallen ist. Aber da ginge es um so geringe Summen, dass uns die zuständigen Kollegen fragen würden, ob wir wo ang’rennt sind, sie deswegen zu belästigen.“
„Und womit? – Mit Recht. Würde man die Keller aller Wirte im Land überprüfen, wäre die heimische Gastronomie auf einen Schlag ausgelöscht. – Haben die Hausparteien etwas gehört?“
„Nein. Auf Nummer Dreizehn wohnt keiner. Im Erdgeschoß befindet sich ein Sonnenstudio, darüber ein Grafikbüro, ein Fotoatelier und zwei Anwaltskanzleien. Alle waren Sonntag Nacht geschlossen. Die Pathologie gibt den Todeszeitpunkt unseres Namenlosen mit drei bis fünf Uhr früh an.“
„Klingt nach lauter Sackgassen. Wie seid ihr dann trotzdem auf den Täter gekommen?“
„Die Täterin. Sehr einfach – sie hat sich gestern Nachmittag gestellt. In Begleitung einer Anwältin, die ihre Sprache spricht, jedoch keine gerichtlich beeidete Dolmetscherin ist. Deshalb die Verschiebung auf den heutigen Termin.“
„Zu dem du pünktlich erscheinen solltest. Alles klar, Karin. Falls die Hauptverdächtige tatsächlich niederlegt und das Geständnis allen Überprüfungen standhält …“
„… kriegst du sofort den Akt.“ Und Claudia Rappold eine Exklusivgeschichte, vermutete Fux. Aber das sagte sie nicht laut.
2
Peter Szily hetzte durch die Mariahilferstraße, als wären die Furien hinter ihm her. Oder hießen sie, dings, Erinnyen? Antike Rachegöttinnen jedenfalls. Personifizierte Gewissensbisse, wenn er sich richtig an die Sagen des Altertums erinnerte.
Erinnyerte …? Aua. Wieder eins dieser unbrauchbaren Wortspiele, die an der Fünf-Prozent-Hürde des Durchschnittspublikums zerschellten.
Für so was hatte sein Hirn Kapazitäten! Aber glaubst du, es könnte sich seinen IBAN-Kode merken? Oder wo er sein Handy verschusselt hatte und wo und wann exakt er sich mit, dings, Genevieve treffen sollte? Nicht ums Verrecken.
Die „Mahü“ wurde ihrem Ruf vollauf gerecht. Menschenmassen wogten hin und her, schoben und drängelten, verkeilten sich ineinander und zwängten sich fluchend weiter, die Wintermäntel geöffnet, weil es viel zu warm war für die Jahreszeit, schweißüberströmte Gesichter, panisch flackernde Augen. Die Hölle des vorletzten Einkaufstags. Verdammte dieser Erde, gejagt von den Geistern der Weihnacht.
Gern hätte Pez sich über die traurigen Idioten erhaben gefühlt. Aber er steckte mittendrin, war keinen Deut besser, sondern einer von ihnen.
Wie jedes Jahr hatten die Mitglieder seiner Patchworkfamilie den Schwur abgelegt, sich gegenseitig keinen Stress zu bereiten und „nur ganz was Kleines“ zu schenken. Wie jedes Jahr hatte Pez den anderen vertraut – bis ihn die Schreckensvision überwältigte, er könnte doch am Ende der Einzige sein, der nichts als ein paar Duftseifen unter den Christbaum legte. Worauf er aus dem Haus gestürmt war, ohne Plan und, wie er erst viel später bemerkte, ohne Handy; ergo ohne Möglichkeit, Genevieve zu erreichen. Denn deren Nummer wusste er natürlich ebenfalls nicht auswendig.
Mit Sicherheit jedoch wusste er: Das würde Zores geben.
Sie waren zum Frühstücksbrunch verabredet. Nicht im Café Ritter, so viel stand fest. Pez hatte es vorgeschlagen, aber ihr war dort die vegetarische Auswahl zu bescheiden. Nein, es musste was Schickeres sein; mit bowls betitelte kalte Eintöpfe und in Einmachgläsern servierter biologisch-hydraulischer Haferbrei. Eine dieser aus dem Boden geschossenen ultracoolen Bobo-Quetschen. Bloß, welche?
Pez hatte gehofft, es würde ihm wieder einfallen, wenn er daran vorbeikam. Ja, Schnecken. Fehlanzeige.
Sich darauf zu konzentrieren, fiel aber auch wirklich nicht leicht. Wuselnde Horden von Kaufwütigen verstellten die Sicht. Desgleichen unzählige Punschhütten, die zusätzlich die Luft mit klebrig-süßen Fuseldämpfen in den perversesten Geschmacksrichtungen verpesteten. Hysterisch kreischende Spendenkeiler warfen sich Pez in den Weg, um ihm einen Dauerauftrag zugunsten eines Tierschutzvereins abzuluchsen. Paarweise herumschwärmende Schulkinder, die mit blechernen Sammelbüchsen rasselten, traten ihm auf die Zehen. Eine Form der Schutzgelderpressung: Nach Münzeinwurf bekam man ein Pickerl aufs Revers geklebt, das einem weitere Belästigung ersparte, freilich nur durch Vertreter dieser einen Organisation. An allen Ecken erklang Gebimmel und Gedudel. Dass „Last Christmas“ endgültig von Leonard Cohens „Halleluja“ abgelöst worden war, machte nichts besser. Insgesamt ergab sich ein infernalischer Lärm, von dem sich höchstens noch Artisten abhoben, die mit laufenden Kettensägen jonglierten.
„Besinnung raubend, Herz betörend, schallt der Erinnyen Gesang. Er schallt, des Hörers Mark verzehrend, und duldet nicht der Leier Klang.“
Na bravo! Friedrich Schillers Ballade über den Mord am Sänger Ibykus, die Pez im Gymnasium aufsagen musste, hatte er immer noch präsent. Hingegen Ort und Zeit des Rendezvous mit seiner Freundin … Eine Kirchturmglocke schlug zehn. Nein, zur vollen Stunde war nicht ausgemacht gewesen. Aber Viertel vor, nach oder über? Pez hasste das. Die Kommunikation zwischen Mann und Frau war auch ohne Zeitrechnungsbarriere zwischen Steirer und Salzburgerin schon schwierig genug.
Irgendeine Abkürzung enthielt der Name des Lokals, zermarterte Pez sich das Hirn, während er die Kirchengassen-Kreuzung überquerte, bei roter Ampel, wie alle anderen Fußgänger auch. Und etwas Großkotziges auf Englisch. Essen? Dings, food. Superfood! Das war mächtig angesagt. Könnte man googeln – wenn man ein Handy hätte. Verflixt!
Passanten fragen? Sinnlos, mit Superfood warb jeder zweite Greißler. Praktisch jeder, der sich nicht Feinkostladen schimpfte, sondern … Delicatessen!
„Superfood Deli“. Das war’s. Zugleich ging Pez ein weiteres Licht auf. Nämlich, dass er die Einkaufsmeile noch lange vergeblich hätte rauf und runter hampeln können. Weil das Lokal gar nicht direkt an der Mahü lag, sondern in einer erweiterten Passage zur Windmühlgasse, dem Raimundhof.
Genevieve stand mitten im Durchgang, ein blonder Racheengel mit blausilberner Steppjacke und beiger Paperbag-Hose, der personifizierte Vorwurf. Anstelle einer Begrüßung fauchte sie: „Ich warte seit drei-und-zwan-zig Minuten. Hättest du dich nicht even-tu-ell dazu durchringen können, mir mit-zu-tei-len, auf welchen Namen du reserviert hast?“
„Öhm …“ Pez spähte an ihr vorbei. Das Deli war winzig, alle vier Tischchen dicht besetzt, ebenso wie die Stühle und Bänke im Freien. Kurz erwog er zu flunkern, aber sie hätte ihn durchschaut. Privat war er ein grottenschlechter Lügner. „Ging nicht. Kein Handy. Sorry.“ Dass er außer Atem war, brauchte er nicht zu fingieren.
„Du bist echt das Al-ler-letz-te.“
„Tut mir wirklich leid. Ich habe Weihnachtsgeschenke besorgt.“ Er klopfte auf die Umhängetasche, in der sich nichts befand außer einer sündteuren, angeblich handgefertigten Dose Vanillekipferl. Als ob das eine Entschuldigung wäre.
„Als ob das eine Entschuldigung wäre“, sagte Genevieve prompt.
Getauft war sie auf Jennifer, einen der in ihrem Geburtsjahr beliebtesten Namen. Sie damit anzusprechen, führte zu mindestens einwöchigem Liebesentzug. „Wollen wir vielleicht doch zum Café Ritter …?“
„Nein.“
„Oder wir kaufen eine“, er linste auf die Angebotstafel, „Brazilian Acai Vru Vru Bowl und gehen zu mir nach …“
„Kommt nicht infrage.“
Sie war grantig, da hungrig. Den Gedanken, ihr die Kipferl anzubieten, verwarf Pez dennoch gleich wieder. „Wie kann ich dich dann versöhnen, mein Herz?“
„Ich weiß nicht, ob ich das noch will.“ Melodramatisch warf sie das Haar zurück und schürzte die Lippen.
Beziehungskrisenalarmstufe orange! Pez musste Einfühlsamkeit simulieren. „Ah ja. Wir sollten reden. Ungestört“, sagte er mit der weichen und doch leicht angerauten Baritonstimme, die ihm kürzlich einen Werbespot für Power-Joghurt eingebracht hatte. „Hier ist es zu laut. Drüben im Esterházypark? Es sind nur ein paar Schritte. Wie sagte schon Louis Armstrong: Ein kleiner Schritt für einen Menschen …“
„Halt die Klappe, Pezi.“ Immerhin setzte sie sich Richtung Windmühlgasse in Bewegung.
An den Flakturm mit dem „Haus des Meeres“ hatte Peter Szily nicht die besten Erinnerungen. Der umliegende Park war spärlich besucht, auch am Klettergerüst spielten kaum Kinder.
„Der Astronaut hieß außerdem Neil Amstrong, nicht Louis“, sagte Genevieve.
„Stimmt. Louis war der gedopte Radrennfahrer.“
Sie verdrehte die Augen. „Kannst du ein ein-zi-ges Mal ernst bleiben? Deine Zwangslustigkeit treibt mich zur Weißglut.“
„Sieh auch das Positive: Wenn du mit mir zusammen bist, hast du immer einen Komiker dabei. Ist das nichts?“
„Doch. Strafverschärfend.“
„Man reißt und schleppt sie vor den Richter, die Szene wird zum Tribunal“, meldeten sich abermals Schillers Erinnyen: „Und es gesteh’n die Bösewichter, getroffen von der Rache Strahl.“
Wenn er sich ehrlich war, empfand Pez nicht sonderlich viel für Jenn… Genevieve. Sie hatten sich im Spätsommer auf der Geburtstagsparty eines gemeinsamen Freundes kennengelernt. Es schmeichelte seinem Ego, dass eine blendend aussehende, deutlich jüngere Frau sich gelegentlich mit ihm vergnügte. Seit Beendigung des BWL-Studiums war sie im Consultinginstitut ihres Taufpaten angestellt. Was genau sie dort tat, erschloss sich Pez nicht, nur ein gewisser Rhythmus: Aufwendige Dienstreisen und Arbeitsessen kulminierten in imposanten Präsentationen, deren Conclusio darin bestand, beim Personal zu sparen und dafür noch mehr Consulter zu engagieren.
„Du machst auf locker“, setzte Genevieve anklagend fort. „In Wahrheit bist du der ärgste Spießer. Welcher Mensch unter Achtzig hat am Klo ein Klemmbrett für das ZEIT-Kreuzworträtsel? Aber gegen die defekte Lüftung unternimmst du nichts!“
„Ganz bewusst! Weil das meine Heimwerkerfalle ist. Entsprechend talentierte Gäste basteln am kaputten Ventilator rum, scheitern kläglich – und reparieren dann aus Schamgefühl etwas anderes. Schalter mit Wackelkontakt, tropfender Siphon, stotternde Heizung … Auf professionelle Elektriker oder Installateure wartet man ja monatelang.“
„Deshalb nutzt du schamlos deine Besucher aus.“
„Und Besucherinnen“, ergänzte Pez. „Die sind sogar oft technisch versierter und ehrgeiziger.“ Er zwinkerte. Sie verzog keine Miene. „Dir liegt etwas am Herzen. Lass es raus.“
„Ach, Pezi …“ Sie sah ihn an, nicht länger wütend, sondern traurig, was ihn ungleich mehr beunruhigte. „So geht es nicht weiter mit uns. Du bist lieb, aber mir fehlt … der Tiefgang.“
Das hörte er nicht zum ersten Mal. „Containerschiffe haben mächtig viel Tiefgang“, sagte er ärgerlich. „Luxusdampfer. Und Flugzeugträger. Ich bin ein Jetboot, ich fühle mich auch im flachen Wasser wohl.“
„Nicht lustig.“
„Doch. Und umweltfreundlicher.“
„Ich fahre nicht mit auf die Alm.“
„Was?“
„Hörst du schlecht? Ich. Fahre. Nicht. Mit.“
„A-aber … wieso?“
„Selbst du solltest das inzwischen begriffen haben.“
„Kein Grund zur Eile. Überleg es dir nochmal in Ruhe. Okay? Du hast einen Zuckerschock. Brauchst dringend Kohlehydrate.“
„Pezi, es ist aus. Ich trenne mich von dir.“
„Nein!“
„Das bestimmst nicht du.“
Er war perplex. Mit einem Streit hatte er gerechnet. Schreien, Tränen, ein Tritt gegen das Schienbein. Sie war sehr temperamentvoll, auch beim Versöhnungssex. Den er sich, ahnte Pez, aufzeichnen konnte. Stattdessen wurde er eiskalt abserviert. Ihn beschlich ein Verdacht. „Du hast einen anderen.“
„Äh … nein.“
„Es ist eine Frau.“
„Wer hat dir das verraten?“
„Dein Zögern.“ Er winkte ab. „Schon gut. Wurst, ob Männchen oder Weiblein. Nehme an, du bist verliebt?“
„Unsterblich“, schluchzte sie.
„Ah ja. Dann wünsche ich dir viel Glück. Und Tiefgang.“
„Danke. Dir auch, Pezi.“
Als er sich umdrehte und davonstapfte, den schmatzend feuchten Weg entlang, spielte sein dummes Hirn Filmmusik ein. Zum langsam abblendenden Schlussbild passend schnulzige Streicher, im Vordergrund aber Klavier, Kontrabass, Beserlschlagzeug und die bittersüß schmelzende Stimme des Barpianisten Sam: „As Time Goes By“, was sonst. Pez verbat es sich, zu kichern, obwohl er sich sehr lächerlich vorkam.
Ihm blieben immer noch die Vanillekipferln.