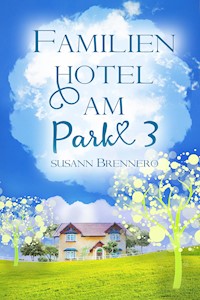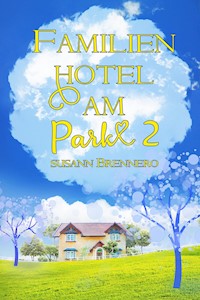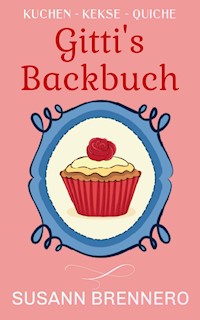Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Matteo Richterswil und Ullrich Neusiedl
- Sprache: Deutsch
In den Umbruchswirren des Jahres 1991 wird ein ehemaliger Stasi-Oberst in Weimar erschossen. Matteo Richterswil aus der Schweiz und Ullrich Neusiedl aus Österreich fahnden nach dem Mörder. Ihre Ermittlungen führen sie quer durch den neu gegründeten losen Staatenbund von Schweiz, Österreich und Deutschland - SÖD. Unter Verdacht stehen alle Opfer des Toten, der an Bespitzelungen, Festnahmen, Verhören, Folterungen und an Hinrichtungen beteiligt war. Wer hat seinem Hass freien Lauf gelassen und ihn ermordet?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Susann Brennero
Mordsakten
Kriminalroman
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © ullstein bild – Thierlein
ISBN 978-3-8392-5296-3
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Kapitel 1
»Kein Wesen kann zu nichts zerfallen«
Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) aus Vermächtnis 1829
»Eine Leiche!«, schrie eine Frauenstimme hysterisch.
»Ausgerechnet jetzt!«, erklang ein tiefer Bariton. »Schrecklich!«
Nora Attendorn nahm das aufgeregte Stimmengewirr der anderen Reisenden im Luxus-Reisebus erst nach und nach wahr. In Gedanken war sie noch hinter dem Weimarer Stadtschloss im Park an der Ilm unter dem dichten Blätterdach der schönen alten Bäume unterwegs. Gerade einmal fünf Minuten saß sie wieder in ihrem gemütlich gepolsterten dunkelblauen Reisesessel im voll klimatisierten Bus der Reisegesellschaft Dörgemann und Söhne, die ihren Sitz in Wien hatte. Neben ihr auf dem leeren Sitzplatz am Gang lag das Hochglanz-Reiseprospekt der Drei-Länder-Tour »Highlights deutschsprachiger Kultur – von Erfurt über Wien nach Zürich«. Die Kühle im Bus war angenehm. Sie öffnete ihre rote Haarspange und schüttelte ihren Kopf. Ihre halblangen braunen Haare verteilten sich auf ihren bloßen Schultern über dem pinkfarbenen Sonnentop.
Mit Blaulicht und lautem Sirenengeheul fuhren mehrere der modernen schwarz-grau gestreiften Einsatzfahrzeuge der Sonderkommission SAO am Reisebus von Dörgemann und Söhne vorbei. Die Soko »Stasi als Opfer« war derzeit im gesamten Staatenbund in aller Munde. Nora sah zum ersten Mal mit eigenen Augen diese gefürchteten Dienstfahrzeuge der SAO, und das auch noch mit Blaulicht, im Einsatz. Dieser Anblick und der schrille hohe Ton des Martinshorns machten ihr Angst. Doch sie verscheuchte den blitzartig aufkommenden Gedanken, dass das ein böses Omen sein könnte. Hätte sie aus Weimar wegbleiben sollen?
Nora Attendorn hatte im vergangenen Sommer den ersten Preis beim Rätselwettbewerb einer überregionalen Tageszeitung im Rheinland gewonnen. Von 750.000 Teilnehmern war sie die glückliche Siegerin, die sich über zwei Wochen Studienreise mit Vollpension und einem exklusiven Freizeitprogramm freuen durfte.
Doch jetzt schien ein unvorhergesehenes Ereignis gleich auf der zweiten Station der Tour in Weimar den Reiseplan durcheinander zu bringen. Hatte sie wirklich das Wort Leiche verstanden?
Dabei hatte der gestrige Auftakt der Reise in Erfurt Nora gerade erst in eine schöne Traumwelt entführt. Der Erfurter Dom, die Krämerbrücke und die schönen historischen Fachwerkhäuser, die in den kommenden Monaten endgültig dank großzügiger Investoren und Spenden aus aller Welt vor dem Zerfall gerettet werden würden – diese charmanten Seiten des erwachenden Ostens hatten sie beeindruckt. Über die Plattenbauten, an denen sie auf der Stadtrundfahrt in Erfurt vorbeigekommen waren, hatte sie bestens gelaunt hinweggeschaut. Die Politiker und Wirtschaftsweisen hatten doch alle noch vor wenigen Monaten in den Tagen der Vereinigung versprochen, dass es hier bald blühende Kulturlandschaften geben würde – Ende mit dem sozialistischen Einheitsbrei. Der 3. Oktober 1990, der Tag, an dem die Schweiz, Österreich und die beiden deutschen Staaten gemeinsam mit den Alliierten den 4+4-Vertrag zur Gründung des losen Staatenbundes SÖD in ihren Parlamenten ratifiziert hatten, war Nora noch in allen Details lebhaft im Gedächtnis. Sie hatte diesen Tag in Berlin mit Freunden am Brandenburger Tor verbracht. Nora hatte wildfremde Menschen aus aller Welt umarmt und mit ihnen hautnah ein Stück Geschichte erlebt. Keine Macht der Welt konnte den 9. November 1989 mehr rückgängig machen. Die Menschen hatten, ohne ihre Regierungen zu fragen, historische Fakten geschaffen. Ost und West hatten sich in einer einzigen schicksalshaften Nacht inmitten eines fast undurchdringlichen weltpolitischen Nebels wiedergefunden. Das erste Loch in der Mauer hatte den Menschen einen Blick in die Welt der anderen ermöglicht. Die Mauer war für immer gefallen. Genauso würden hier schon bald die restlichen Überbleibsel des real existierenden Sozialismus fallen.
»Abreißen, neu bauen«, flüsterte Nora leise vor sich hin, als sie an die hohen Leichtbauhäuser zurückdachte. Die Bilder dieser schäbigen Plattenbauten und der maroden, aber schönen historischen Gebäude in der Erfurter Innenstadt, die mit Sicherheit seit den 50er-Jahren keine Sanierung mehr erlebt hatten, vermischten sich vor ihrem inneren Auge zu einer einzigen sagenhaften Baulandschaft. Was für eine Aufgabe für sie als angehende Architektin im Osten wartete, wenn sie erst ihr Studium absolviert hatte – ein Traum.
Nora schaute aus dem Busfenster auf die Ausfahrt des Parkplatzes, die zur Innenstadt hin gelegen war. Auch hier blickte sie wie in Erfurt auf bröckelnde Häuserfassaden und abgefahrene Katzenkopfpflaster, auf schief getretene Bürgersteige und Schlaglöcher, auf wild wucherndes Unkraut in den Straßen: sozialistisches staubiges Einheitsgrau – immerhin ohne Fahnen und ohne die mit Botschaften des Kommunismus bedruckten roten Banner. Sie hatte keine Lust, sich aus ihrer surreal wirkenden Traumwelt im neuen Land Thüringen wieder heraus reißen zu lassen. Doch allmählich begannen die wirren Sprachfetzen, die aus allen Richtungen an ihre Ohren drangen, einen grauenhaften Sinn zu machen. Gänsehaut überzog blitzartig ihre leicht gebräunten Unterarme.
»Die Polizei ist schon vor Ort!«, erklang die sympathische Stimme des charmanten Reiseleiters Leon Hofer durch den Lautsprecher. »Bitte bleibt alle auf euren Plätzen sitzen. Die Fahrt geht gleich weiter zum Hotel ›Schlossgarten‹.« Er nieste ins Mikro. »Dort werden wir auch, wie vorgesehen, pünktlich zu Mittag essen.« Leon Hofers Wiener Akzent klang in Noras Ohren im Vergleich zum rheinischen Dialekt ihrer Professoren an der Uni daheim trotz der unerquicklichen Botschaft wie eine Melodie.
Die ältere weißhaarige Dame in dem hellgrünen eleganten Seidenkostüm auf dem Sitz vor Nora wendete sich um und schaute mit blitzenden blauen Augen durch den Zwischenraum der beiden breiten Reisesessel hindurch.
»Nie und nimmer werden wir rechtzeitig zum Mittagessen kommen«, erklärte Gabriele Karenhall. Sie seufzte enttäuscht. »Mit Sicherheit wird die Polizei erst einmal alle unsere Daten aufnehmen. Und dann wird der leckere Entenbraten kalt sein.«
Nora spürte ein leichtes Knurren in ihrem Magen, obwohl ihr Frühstück im 5-Sterne-Hotel in Erfurt aus zwei Croissants mit Honig und Blutorangenkonfitüre bestanden hatte.
»Was ist denn passiert?«, fragte sie. Bei dem Wort Braten war sie endlich in der Realität angekommen. »Gibt es wirklich eine Leiche?«
*
»Der ist noch warm, oder?«, fragte Kriminaloberstleutnant Matteo Richterswil Dr. Kevin Beerbaum, den diensthabenden Gerichtsmediziner der Spurensicherung Weimar. Richterswil, wie immer im Einsatz mit schwarzer Leinenhose, weißem Shirt und schwarzen Sportsneakers bekleidet, stand direkt neben der Arzttasche.
Dr. Beerbaum nickte und gab trotz seiner Leibesfülle erstaunlich schnell den Blick auf den Toten für die Polizeifotografin frei. Der gemütliche Mediziner deutete auf eine unübersichtliche Anzahl von kleinen und größeren Hämatomen und Spuren von fast abgeheilten Kratzern an den Armen der Leiche oberhalb der Handgelenke. Das blütenweiße gestärkte Hemd des Toten war bis über die Ellenbogen ordentlich hochgekrempelt. Nur das Einschussloch in Höhe des Herzens, umgeben von einem kleinen rötlichen Kranz aus Blut, störte den perfekten Anblick des Oberhemdes, das aussah wie aus einer klassischen westdeutschen Werbung für Waschmittel aus den 70er-Jahren. Das Gesicht der Leiche unter den grauen Haaren schien blankes Entsetzen und Furcht auszudrücken. Seine blaugrauen Augen waren weit aufgerissen. Der starr in die Luft gerichtete Blick wirkte auf Richterswil gebrochen. Blut trat in einem dünnen Rinnsal aus dem linken Mundwinkel des Toten.
Die Fotografin machte zahlreiche Nahaufnahmen von allen Gliedern, dem Korpus und dem Gesicht der Leiche. Immer wieder zuckte der automatische Blitz des Fotoapparates auf, obwohl die Mittagssonne grell am hellblauen Himmel stand. Aber das Blätterdach der über 100 Jahre alten Kastanie warf sanft verspielte Schatten auf das Opfer, das seine vorerst letzte Ruhe im Park an der Ilm gefunden hatte. Für das forensische Gutachten brauchte Dr. Beerbaum beste Fotoqualität. »Ohne Blitzlicht sind Tatortfotos nicht brauchbar«, lautete seine Standarderklärung.
Richterswil wandte sich seinem Assistenten Kriminalmajor Ullrich Neusiedl zu.
Der gebürtige Wiener mit der gepflegt polierten Glatze kritzelte wie gewohnt in winzigen Buchstaben wichtige Notizen in einen mit weichem blauem Kalbsleder eingebundenen Kalender. »Schwarz, Peter, Jahrgang 1945. Bis 1989 Oberst der Staatssicherheit der DDR«, fasste Neusiedl im Telegrammstil zusammen.
»Gibt es Zeugen, die in der Nähe waren?«, fragte Richterswil.
»Ja, einen ganzen Reisebus voll Touristen.«
»Hä?«, hakte der Oberstleutnant jetzt deutlich mit seinem für die Region ungewöhnlichen Schweizer Akzent nach. »Geht’s noch? Was soll das heißen?«
Neusiedl wies mit der linken Hand auf den Luxus-Reisebus, aus dem die Reisenden neugierig mit ihren großen und kleinen Nasen an den Fenstern hingen. »Als die Schüsse fielen, waren diese Damen und Herren im Park.«
»Wiener Kennzeichen«, sagte Richterswil. »Kleiner Gruß aus der Heimat, Ulli!« Er schaute in alle Himmelsrichtungen. Sein Blick blieb am Weg zu Goethes Gartenhaus hängen. »Der Täter hat das Risiko, gesehen zu werden, nicht gescheut.«
»Mein Wien!«, seufzte Neusiedl. »Ewig werden wir nicht hier eingesetzt sein. Und dann geht es wieder nach Hause.«
»Ohne uns würden die hier doch alles irgendwo im alten Filz vertuschen«, sagte Richterswil mit leisem Spott in der Stimme.
»Vielleicht hat er die Gunst der Stunde genutzt, weil er sonst keine Chance gesehen hat?«, schlug Neusiedl vor.
»Oder Affekt gepaart mit sehr gutem Fluchtinstinkt«, überlegte Richterswil. »Außerdem ist der SÖD trotz Abschaffung unserer Armeeverbände noch lange kein rechtsfreier Raum«, fügte er leise hinzu.
»Jaja! Ohne uns hätten sich die Wessis und Ossis längst die Köpfe eingeschlagen.«
»Eben! Wir Schweizer und Österreicher sind hier mit den SAO Teams unersetzlich, oder?« Richterswil beugte sich über die Arme des Toten. »Aber nicht jeder ermordete ehemalige Mitarbeiter der Staatssicherheit ist auch Opfer eines Racheaktes.« Er steckte die Hände in die Taschen seiner Leinenhose. »Kratzer vom Liebesspiel mit der Geliebten. Eifersuchtsdrama …«
»Das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn dieser Mord nicht ein Fall für uns ist. Das passt alles ins Schema«, bekräftigte Neusiedl seine Ansicht von den »Piefkes mit Wild West Manieren«, wie er sie ausnahmslos in Ost und West alle so gerne nannte. »Nie und nimmer ein Eifersuchtsdrama.«
»Mal sehen! Wir brauchen die komplette Namensliste der Reisegruppe in diesem Wiener Reisebus.« Richterswil zog ein Päckchen Kaugummi mit Pfefferminzgeschmack aus der Hosentasche. »Die Reisenden können sich im Hotel zu unserer Verfügung halten.«
»Die Liste übernehme ich persönlich«, sagte Neusiedl. »Nicht, dass der Täter im Bus sitzt und unter dem Deckmäntelchen der Kulturreise spurlos verschwindet.«
»Wenn der Bus noch lange hier steht, ist das ein gefundenes Fressen für die Presse. Ich sehe schon die Schlagzeile vor mir ›30 Reisende unschuldig verdächtigt: neuer Polizei-Skandal‹. Der übliche Quatsch.«
»Schade, dass wir keine Fingerabdrücke nehmen dürfen – so ohne Tatverdacht.«
»Die reisen in unsere Heimat, Ulli.« Richterswil seufzte leise. »Als Nächstes werfen wir im Büro einen Blick in die Personalakte des Toten. Ich rufe gleich im Ministerium an. Die sollen die Akte per Express schicken. Wer weiß, wie viele Leichen dieser Schwarz im Keller hat.« Richterswil strich sich unwirsch ein gefallenes Blatt aus seinen dichten blonden Locken. »Hier gibt es nichts mehr zu entdecken. Überlassen wir Leiche und Tatort der Spusi.«
»Das übliche Prozedere. Wir statten seinen Opfern einen Besuch ab«, dachte Neusiedl laut. »Hoffentlich verteilen die sich nicht wieder wie beim letzten Fall auf alle ehemaligen angrenzenden Bruderstaaten.«
»Wie üblich! Aber in diesem Fall kommt uns vermutlich Kommissar Zufall in Gestalt dieser Reisegruppe zu Hilfe. Dann können wir uns vielleicht sogar den Besuch in diesem lächerlichen Kellerprovisorium von Gerichtsmedizin sparen.« Richterswil verzog gequält das Gesicht. »Manches Mal habe ich den Eindruck, im Notstandsgebiet zu leben.«
»Noch ein, zwei Jahre, dann sieht es hier genauso aus wie bei uns.«
»Einer der 30 Reisenden wird den Täter gesehen haben.« Richterswil grinste zufrieden und dachte an ein paar Tage Urlaub.
»Ein Fall, den wir morgen Abend schon zu den Akten legen können. Leiwand!«, frohlockte auch Neusiedl.
»Mal sehen, was wir gleich in der Akte Schönes finden.«
»Oder doch ein Drogendelikt.« Neusiedl massierte seine Glatze. »Mit der Freiheit kam das Verbrechen«, spottete er. »Die internationale Mafia hat zugeschlagen. Ein Fall für die hiesige Kripo in Weimar.«
»Genug der Spekulationen. Wenn Italiener, Russen oder Kolumbianer Schwarz hätten ausschalten wollen, hätten sie es nicht am helllichten Tag im Park unter den Augen von 30 neugierigen Touristen gemacht«, fasste der erfahrene Kriminaloberstleutnant aus Zürich zusammen. »Ich bin mir sicher, wir finden die Lösung in seiner Personalakte. Da ist wieder ein Opfer zum Täter geworden.« Richterswil steckte seine Hände in die Hosentaschen. »Bin gespannt, was Beerbaum uns zu den Kratzspuren sagen wird. Die stören das Bild.«
»Seltsame Neigung beim Liebesspiel?«
»Kann gut sein!«
»Bin gespannt auf die Angehörigen«, sagte Neusiedl. »Wie er da so liegt … Als wenn er gerade auf dem Weg zum Mittagessen nach Hause wäre.«
»Die Familie müssen wir noch informieren«, nickte Richterswil unwillig. Er hasste diese Besuche bei den Angehörigen. Entweder sie brachen hysterisch zusammen. Oder sie waren froh über den Tod eines nach 1989 unliebsam gewordenen Verwandten. In dieser obskuren Atmosphäre der Vereinigung seit der Gründung des losen Staatenbundes der deutschsprachigen Länder in der Mitte Europas lebten die meisten Menschen, die vor dem Mauerfall in irgendeiner Weise mit der Stasi zu tun hatten, in einem fantasievollen Lügengebäude. Sie schützten sich selbst und ihre alten Seilschaften mit allen erdenklichen Methoden. Trotzdem hatte Richterswil bislang ausnahmslos jeden Fall auf seinem Schreibtisch gelöst. Dass ihm die ehemaligen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit charakterlich nie sonderlich sympathisch waren, war für seine Arbeit nicht von Belang. Selbst wenn sie vor der Ratifizierung des 4+4-Vertrages Handlanger eines Unrechtsstaates gewesen waren, so unterlagen sie alle ausnahmslos der Amnestie vom 3. Oktober 1990. Sie waren heute fester Bestandteil der Neuen Grenzschutztruppe, der NG SÖD. Sie erfüllten an den Außengrenzen des Staatenbundes SÖD nach Auflösung von NVA, Bundeswehr, Heer und Armee eine wertvolle Aufgabe für diese Gesellschaft. Ein moralisches Urteil stand Richterswil nicht zu. Er war für Gerechtigkeit nach dem Gesetz zuständig, und das sah vor, dass der Staat und nicht die Bürger Straftaten und anderes Unrecht ahndeten. Selbst wenn dieser Peter Schwarz Mitglied einer konspirativen Henkertruppe in der DDR gewesen sein sollte, hatte heute niemand das Recht, ihn zu töten. Richterswil konnte es der neuen Staatsführung des SÖD nicht verdenken, auf die ehemaligen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR für den Grenzschutz zurückgegriffen zu haben. Weder die Schweiz noch Österreich noch die Bundesrepublik Deutschland hatten am Tag der Ratifizierung des 4+4-Vertrages über ein annähernd perfekt funktionierendes Sicherheitssystem verfügt.
»Wie ist es nur zum Mauerfall gekommen?«, sagte er leise und schaute auf den Rücken des Toten, den Dr. Beerbaum gerade untersuchte. »Das wird mir ein ewiges Rätsel bleiben.«
»Durchschuss, großer Austritt«, erklärte der Gerichtsmediziner. »So wie es aussieht, hat die Patrone das Herz zerfetzt. Das könnt ihr morgen Früh in meinem Bericht nachlesen.«
*
Der Reisebus stand immer noch mit verschlossenen Türen auf dem großen Parkplatz in der Nähe des Parks an der Ilm. Der Busfahrer hatte den Motor wieder abgestellt. Das brummende Motorengeräusch war verstummt. Die Klimaanlage lief nicht mehr.
»Was für ein Glück, dass es keinen von uns getroffen hat!«
»Hier ist es ja richtig gefährlich! Wie im Wilden Westen!«
»Das ist halt der Wilde Osten!«
»Das kann ja heiter werden.«
»40 Jahre Unrechtsstaat«, kommentierte Gabriele Karenhall die Ausrufe der Mitreisenden in einem blasiert lehrerhaften Tonfall. »Was haben Sie alle denn hier erwartet?«
Nora schaute aus dem Fenster. Außer der sich am strahlend blauen Himmel von weiter Ferne nähernden dichten dunkelgrauen Wolkenpakete konnte sie nichts Interessantes entdecken. Da war weit und breit keine Leiche zu sehen. Für heute Nachmittag hatte der Wetterdienst im Frühstücksradio in Erfurt heftige Hitzegewitter angesagt. Sie hatte nichts gegen eine leichte Erfrischung. Das Thermometer ihres kleinen schwarzen Chronometers am Handgelenk hatte im Park 30 Grad angezeigt. Sie verscheuchte ihre aufkommenden Gedanken an diese heißen, unerbittlichen Sonnenstrahlen im Osten. Ihre verblassten Kindheitserinnerungen hatten nichts mit dieser Reise zu tun. Sie wollte ihre »Tour de Kultur«, ihren 1. Preis, in vollen Zügen genießen. Daran würde auch diese dubiose Leiche im Park nichts ändern. Nora lachte leise bei dem Gedanken an die Mischung der Einrichtungsgegenstände aus Ost und West in ihrem Hotelzimmer der gestrigen Nacht in dem riesigen Erfurter Hotelkomplex, der ihr eine Sicht über die ganze Stadt und ein neues innerdeutsches Lebensgefühl beschert hatte. Was für ein Chaos. Immerhin waren Matratze und Frühstück eines internationalen 5-Sterne-Hotels würdig gewesen.
»Jetzt erleben wir auch noch ein Verbrechen mit!«
»Hoffentlich wird es nicht gefährlich!«
Die Sätze der Mitreisenden schwirrten immer aufgeregter und lauter durcheinander. Die Gerüchteküche war kurz davor, einen Haufen überkochenden sinnlosen Brei zu produzieren. Es hatte keinen Sinn mehr, die Ohren zu verschließen, denn der anschwellende Geräuschpegel im Bus drang in jeden Winkel.
»Es muss wohl ein Mord geschehen sein, während wir noch im Park spazieren gegangen sind«, erklärte Gabriele Karenhall. »Ich bin seit dem Mauerbau nicht mehr in Europa gewesen. Und nun erlebe ich gleich am zweiten Tag meiner Reise einen Mord.«
»Ein Mord?« Nora Attendorns Gesichtszüge hatten sich zu einer entsetzten Grimasse verzogen. Erst eine Leiche, jetzt schon ein Mord, dachte sie.
»Und wir waren zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes!«, bekräftigte Gabriele Karenhall ihre Ansicht. »Ich bin mir sicher, vorhin ein paar Schüsse gehört zu haben.«
»Das wird unseren Reiseplan durcheinander werfen.« Nora suchte in ihrer hellen Canvas-Tasche nach einem Päckchen Kaugummi mit Brombeergeschmack. »Ich hatte mich so auf den Besuch im alten Nationaltheater heute Abend gefreut.« Sie konnte an der Existenz der Leiche nichts ändern. Vielleicht löste sich das Problem von alleine, wenn sie es ignorierte, und der Tote würde in ihrem Leben morgen Früh nur noch eine Schlagzeile sein – wie in den Tageszeitungen daheim im Rheinland.
»Naja, bis heute Abend werden die uns wohl nicht hier festhalten dürfen!«
»Die Räuber«, hauchte Nora hoffnungsvoll. Nur noch zwei leere Filme lagen in ihrer Tasche.
Leon Hofer und der Busfahrer begannen, Erfrischungsgetränke und kleine Schokoriegel an die Reisenden zu verteilen, um den Unmut über die unfreiwillige Pause in der Mittagszeit klein zu halten.
Nora griff gierig nach einer Flasche Wasser ohne Kohlensäure.
»Haben Sie auch für beide Abende in Weimar eine Karte?«, fragte Gabriele. »Ich bin Gabi!«
Nora nickte. »Faust. Der Tragödie zweiter Teil.«
*
Starr vor Schreck schaute Manfred Günther auf die Masse an Menschen, die sich ihren Weg durch die Innenstadt von Jena bahnte. Hatten diese Leute den Verstand verloren? Für was demonstrierte dieser Haufen Irrer? So würde das nie etwas mit dem Aufbau des Sozialismus werden. Nur weil es nachts momentan keinen Strom gab, weil die Arbeitsnormen bei gleichzeitigen Lohnkürzungen erhöht worden waren, weil die Versorgung mit Lebensmitteln nicht perfekt funktionierte hatten diese undankbaren Bürger der jungen hoffnungsvollen DDR noch lange kein Recht, unangemeldet zu demonstrieren. Heute war nicht der 1. Mai, heute war der 17. Juni. Mit Entsetzen beobachtete Manfred Günther, dass die Gebäude des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes und der Untersuchungshaftanstalt angegriffen wurden. Diese Wahnsinnigen wollten doch nicht etwa die Gefangenen befreien? Günther sah, wie die Menschen ihre Ausweise der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft zerrissen und vor dem FDGB-Haus auf die Straße warfen. Er überlegte kurz, ob er einige von diesen Papierfetzen zu Beweiszwecken aufheben sollte. Doch es war besser, er blieb in seiner Tarnung als Schaulustiger des Geschehens.
»Reih dich ein!«, rief ihm ein Demonstrant zu. »Wir wehren uns gegen die neuen Arbeitsnormen. Wir sind freie Menschen und keine Sklaven der Oberschicht der Partei.«
»Die halten sich wohl für die neuen Herren?«, rief eine junge Frau.
Der Holzmarkt war schwarz von Menschen. Wo blieben die Waffen gegen diese Aufständischen, die den Sozialismus gar nicht verdient hatten? Manfred Günther schaute auf seine neue Armbanduhr, Modell »Moskau«. Wenn nicht bald Hilfe nahte, würde auch noch das Gebäude der Staatssicherheit gestürmt werden. Er sah, wie die Menge einem Polizisten die Uniform vom Leib riss. Sie trieben ihn in Unterhosen vor sich her.
Endlich! Manfred Günther atmete auf. Die Russen wollten aus den Kasernen ausrücken. Ein Kollege hatte ihm inmitten der Menge die Nachricht zukommen lassen, dass in Berlin bereits die Panzer auffuhren. Mit Erleichterung sah er wenige Minuten später sowjetische Lkws kommen, auf deren Ladeflächen Soldaten saßen. Gleich war Schluss mit diesem Spuk. Laute russische Befehle waren zu hören. Günther konnte sich einer Festnahme entziehen. Er zeigte seinen MfS-Ausweis vor. Er sah, wie die ersten Menschen auf den Lkws verschwanden. Die würden Jena so schnell nicht wiedersehen. Das waren Fälle für das Kriegsgericht: Aufstand gegen den Staat, Konterrevolution, Standgericht.
Die Nacht verbrachte Manfred Günther im Innendienst der MfS-Zentrale in Leipzig. Ein riesiger Haufen an Ausweispapierfetzen musste ausgewertet werden. Für Festnahmen waren heute Nacht die Sowjets zuständig. Kriegsrecht. Vier Tage Ausgangssperre ab 22 Uhr abends waren angeordnet. Die Bürgermeister der Gemeinden hatten die Bevölkerung aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben – es werde nichts geschehen. Die Straßen waren wie leer gefegt.
Bis zum Morgengrauen des 18. Juni waren die Aufständischen bereits aus ihren Wohnungen und Häusern abgeholt. Weg mit diesem Abschaum. Wegsperren. Sibirien. Manfred Günther war stolz auf diesen wehrhaften Sozialismus, den er hier in der Mitte Europas mit aufbaute. Auch in Berlin hatten die Panzer den Aufstand der Bauarbeiter auf der Stalinallee niedergeschlagen. Jetzt waren die Verhältnisse geklärt. Es herrschte Ruhe. Ein paar abschreckende Hinrichtungen, und niemand würde mehr wagen, die Hand gegen einen Polizisten oder einen Volksarmisten zu erheben. Manfred Günther frohlockte. Der Westen hatte stillgehalten, nicht eingegriffen. Die DDR hatte als ein souveräner Staat ihre Probleme ohne fremde Bevormundung gelöst. Auch die Mitarbeiter der Staatssicherheit würden zur Sicherung des friedlichen Lebens jetzt mehr Macht erhalten. Er dachte an seine Karriere, die in diesem jungen Staat gerade erst begonnen hatte. Für Sekunden blitzte der Gedanke an den Posten eines Ministers in ihm auf. Er war tief in seinem Herzen davon überzeugt, dass die DDR einen Platz in der Gemeinschaft der friedliebenden Sowjetvölker finden würde. Dann dachte er an den Jungen seiner neuen Nachbarn, die Familie Schwarz. Peter war ihm sympathisch. Keine West-Verwandten, kein Aufmucken gegen Erwachsene, immer hilfsbereit. Manfred Günther hatte keine eigenen Kinder. Ein Ziehsohn wie der junge Schwarz war das, was ihm in seinem Leben fehlte. Peters Eltern hatten sicherlich nichts dagegen, wenn er sich in diesen unruhigen Zeiten ein wenig um ihn kümmerte.
*
Richterswil und Neusiedl saßen in ihrem mobilen, großzügig ausgestatteten Einsatzbüro auf dem Parkplatz der Weimarer Polizeiinspektion. Die kleine Kommandozentrale der Soko SAO III war mit modernster Technik eingerichtet. Selbst die Wohnwagen der Spusi, die im Gefolge der Soko SAO fuhren, waren komplett mit neuesten Geräten für die kriminaltechnischen Untersuchungen besser ausgestattet als viele Stationen der umliegenden Krankenhäuser, in denen es an Einwegspritzen und Einweghandschuhen fehlte. Das Ministerium für Innere Sicherheit und Grenzschutz hatte an nichts gespart.
»Katastrophal ist eine Beschönigung für die Zustände in den Krankenhäusern«, hatte Dr. Beerbaum Richterswil an einem Abend bei einem Glas Bier anvertraut.
Doch die Arbeit der Sonderkommissionen SAO hatte zur Befriedung der Gesellschaft oberste Priorität. Die Menschen mussten die Vergangenheit vergessen lernen, sie mussten wieder auf die Zukunft, auf Recht und Justiz vertrauen können.
»Sich gegenseitig zerfleischen, hat keinen Sinn«, hatte Dr. Beerbaum gesagt. Er hatte schon in der DDR als Gerichtsmediziner gearbeitet. »Diese sinnlosen Racheakte binden wertvolle Ressourcen, die wir zum Aufbau der Infrastruktur im Osten brauchen.«
Zum Glück gab es genug erfreuliche Hoffnungsschimmer, wie die ausgebuchten Reisen in die Regionen rund um Weimar, Erfurt, Dresden und Leipzig bewiesen. Die blühenden Kulturlandschaften, die so viele Politiker vor den letzten Wahlen der vier Länder gepriesen hatten, lagen greifbar nahe. Jetzt mussten nur noch die Menschen lernen, sich entsprechend ihrer einzigartigen Kultur zivilisiert zu benehmen.
Manches Mal kamen Richterswil beim Anblick von zerbrochenen Fensterscheiben und Schmierereien mit Farbe an den Wänden Zweifel, ob alle Menschen in diesem Staatenbund so viel Freiheit vertrugen. »Was geht in einem Menschen vor, der seinem Nachbarn ›Stasi-Schwein‹ oder ›Spitzel-Sau‹ an die Häuserwand sprayt?«, dachte Richterswil laut.
»Herein!«, rief Neusiedl beim Klopfzeichen an der Tür des Einsatzwagens bestens gelaunt statt, seinem Vorgesetzten auf dessen zum gefühlten 100. Mal gestellte Frage zu antworten. Auch Neusiedl hoffte, dass der Fall »Peter Schwarz« schon bald zu den Akten gelegt werden konnte. Ein einfacher Fall. Der Täter war unter Garantie in der Personalakte von Schwarz zu finden. Eines der Opfer hatte ausreichend Hassgefühle über sein verkorkstes Leben entwickelt und zur Waffe gegriffen. »Nächste Woche bin ich auf Urlaub in Wien, und du kannst endlich die Sächsische Schweiz erkunden.«
Der Aktenbote Robert Matze steckte den Kopf zur Türe herein.
»Hallo, Matze!«, begrüßten ihn die beiden Ermittler im Chor.
»Hier ist das Ding, aber leider nicht komplett.«
Entsetzt schaute Richterswil auf den Sperrvermerk der Akte. »Was soll das?«, fauchte er wütend. »Wie sollen wir so ermitteln? Geht’s noch?«
»Schwarz war bei geheimen Hinrichtungskommandos in der DDR eingesetzt. Der Teil der Akte fehlt wie immer«, erklärte der lange hagere Matze, der sich beugen musste, um durch die Tür des Einsatzmobils zu schauen.
»Natürlich! Die Herren vom Staatsschutz meinen, Hinterbliebene von zum Tode Verurteilten sind keine potenziellen Täter. Für wie blöd halten die diese Welt?« Richterswil kochte vor Wut und wählte die Kurzwahl des ehemaligen Bereichs Personal des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. »Ja genau, Richterswil mein Name. Wollen sie uns verarschen? Ich bin nicht mit Ihnen im Sandkasten gesessen. Lassen Sie diese Spiele endlich. Ich will in einer halben Stunde die komplette Akte hier haben oder ich beschwere mich wegen vorsätzlicher Behinderung unserer Arbeit, oder?« Nach diesen mehr gebrüllt als gesprochenen Sätzen war die Wut des Kriminaloberstleutnants erst einmal verraucht. Er wusste, dass der Rest der Akte in einer halben Stunde auf seinem Tisch liegen würde. Es war ein reines Machtspiel irgendwelcher im Dunkeln agierenden alten Seilschaften der ehemaligen DDR, das diese regelmäßig gegen ihn, den Oberstleutnant aus der Schweiz, verloren. Richterswil würde sich nie in die Seele und die Gedankenwelt dieser Menschen einfinden. Wie oft sollte er den deutschen Kollegen aus den neuen und den alten Ländern noch klar machen, dass er hier die Macht hatte? Es war eine Sisyphusarbeit. Vielleicht sollte er sich doch besser nach Zürich zurückversetzen lassen und die Arbeit einem jüngeren Kollegen mit Nerven wie Drahtseilen überlassen?
Genau 28 Minuten später klopfte Matze erneut an die Türe. Er hielt den Rest der fehlenden Akte mit einem triumphierenden Lächeln in der Hand.
»Der war als ›Berater Interessensgruppe Akteneinsicht‹ der noch erhaltenen Stasi-Dokumente eingesetzt«, grinste Richterswil. »Der hat sich nach der Wende für die Schreibtischarbeit statt für den Einsatz an unseren Grenzen entschieden.
»Die Hände dürfen sich die anderen schmutzig machen?«
»Mal sehen, wen er auch nach der Wende noch in die Pfanne gehauen hat.«
»Den Bock zum Gärtner machen«, kommentierte Neusiedl. »Da bin ich glatt angefressen. Wir sollen ihr Leben durch unsere Ermittlungen schützen, und die machen freudig weiter mit dem alten Shit.«
»Einschlägige Erfahrung«, grinste Richterswil. »Der hat selbst vor vielen Jahren die Grenzen der DDR mit der Waffe in der Hand geschützt. Grenzschutz durch Abknallen.« Er zuckte mit den Schultern. »Wer sich selbst in Gefahr begibt, liebt das Risiko oder ist ein fanatisch idealistischer Idiot.«
»Sollen wir seine Familie heute noch informieren?«
»Das kann ich alleine machen. Er hat mit seiner Frau gelebt. Barbara Schwarz, Heirat in den 60ern. Gute Adresse, unter Garantie eine alte Villa, die er sich im Rahmen des 4+4-Vertrages unter den Nagel gerissen hat.«
»Und sonst?« Neusiedl schaute neidisch auf die Akte vor Richterswil.
»Das Übliche. Die gesamte Palette der Stasi-Mitarbeit von der Pike auf. Sogar im Westen war er als Gigolo einsamer weiblicher West-Herzen auf den internationalen Messen eingesetzt.« Richterswil klappte die Akte zu.
»Nur als Spitzel?«
»Mauerschütze, Kontaktmann, Spitzel im Westen, Jugendarbeit und last but not least die Teilnahme an Hinrichtungen unliebsamer zu Verrätern gewordener Genossen, die versucht haben, in den Westen zu fliehen.« Er lehnte sich im Stuhl zurück.
»Ein ganzer Blumenstrauß an Opfern? Dann sind wir ein paar Tage länger beschäftigt, als gedacht.«
»Es sei denn, die Reisegruppe hat ein brauchbares Phantombild für uns«, hoffte Richterswil.
»Ich brauche jetzt einen Kaiserschmarrn und eine Melange. Sonst geht gar nichts mehr. Gerade hat die zweite Überstunde begonnen«, erklärte Neusiedl. Zur Bekräftigung seiner Aussage gähnte er herzhaft. »Außerdem hat diese Reisegruppe mit Sicherheit mehr als ein Phantombild für uns. Vermutlich eines mit und eines ohne Bart, eines mit blonden und eines mit grauen Haaren.« Er stöhnte genervt auf.
»Hau schon ab zu deiner Freundin. Aber lass dich von ihr nicht komplett um den Finger wickeln. Nicht, dass wir Doreen eines Tages als Verdächtige auf dem Tisch haben, und dann muss ich wegen Befangenheit auf dich verzichten.«
»Ich weiß, keine Kontakte zur Bevölkerung!«, amüsierte sich Ullrich Neusiedl über die offizielle Belehrung seines disziplinarischen Vorgesetzten. Er griff nach seinem Halfter und zog seine dunkelgraue Dienstweste über sein schwarzes Shirt.
»Morgen Früh um sieben im Speisesaal des Hotels. 20 Reisende à fünf Minuten. Das ist für jeden von uns beiden knapp eine Stunde.«
»Du willst die Witwe wirklich alleine besuchen?«
Richterswil nickte. »Schließlich wartet auf mich keine Herzdame«, sagte er spöttisch. »Außerdem bin ich gespannt, wen sie in Verdacht hat. Da geht es nach unserem Besuch im Hotel morgen Früh als Erstes hin.«
Kapitel 2
»Willst du dir ein hübsch Leben zimmern,Musst dich ums Vergangne nicht bekümmern«
Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) aus Zahme Xenien VIII
Mit dreistündiger Verspätung stieg Nora hinter Gabriele Karenhall aus der hinteren Türe des Luxusreisebusses aus. Sie warf einen Blick auf ihr neues Reisegepäck in der Farbe Pink, das wie ein UFO in diesem halb grau tristen, halb frisch in Sienagelb gemalerten Innenhof des Hotels »Schlossgarten« neben den Koffern und Taschen der anderen Reisenden stand. 20 völlig unterschiedliche Charaktere und ein Ziel: Burgen, Theater, Wohnhäuser der Dichter und Denker.
Die Fassade des Hotels war zu zwei Dritteln saniert. Hier hatten Investoren rasch reagiert. Nora sah viele internationale Kennzeichen auf dem Parkplatz im hinteren Teil des Innenhofs. Leise stöhnte sie auf. Auch Japaner und Amerikaner hatten Weimar bereits entdeckt. Aber was hatte sie erwartet? Sie befand sich in einem der kulturellen Zentren der deutschen Sprache, das zudem unzählige historische Gebäude als Sehenswürdigkeiten zu bieten hatte. Der Zustand der Bausubstanz war hier im Moment nicht von Belang. Ein neues Schild mit dem Hinweis, dass Goethe, Schiller, Cranach, Bach oder eine andere Berühmtheit auch nur eine Nacht in einem der Gebäude verbracht hatte, reichte aus, um die Reisenden aus aller Welt in verzückte Ah- und Oh-Rufe ausbrechen zu lassen. Die Möglichkeit, an Orte zu reisen, die noch vor zwei Jahren nur mit einem Visum der DDR zu erreichen waren – an Orte, die zum ungeschriebenen Weltkulturerbe der Menschheit gehörten – an Orte, die dank Schicksalsironie fast unberührt an die Zeit nach dem Krieg 1945 erinnerten, war eine Verlockung, der nur wenige Menschen widerstehen konnten. Kein Wunder, dass Städte wie Weimar bereits ein Gäste-Kontingent eingeführt hatten. Nora musste lachen. Früher hatten die Behörden der DDR über eine Genehmigung, das Land zu bereisen, entschieden. Heute entschied der Reiseveranstalter und damit das Portemonnaie über die Chance, Erfurt, Weimar und Jena erleben zu dürfen. Was war sie doch für ein Glückspilz, den 1. Preis in diesem Rätselwettbewerb gewonnen zu haben. Es war ein Privileg, hier in Weimar sein zu dürfen, und sie genoss jede Sekunde – daran änderte auch dieser Leichenfund nichts. Ihre Freunde daheim würden vor Neid platzen über ihr Reisetagebuch mit den vielen Fotos. Am besten ließ sie die ersten Filme schon hier in Weimar entwickeln. Dann konnte sie unterwegs entscheiden, welche Abzüge für das Tagebuch geeignet waren, und welche Motive ihr noch fehlten. Und auf den letzten Stationen der Reise, in Wien und Zürich, würde sie nach diesem Ausflug in die geheimnisvolle, fast schon verwirrende Welt des Ostens, der so tief in der Vergangenheit zwischen 45 und 89 verhaftet zu sein schien, rasch wieder in ihr normales westliches Alltagsleben zurückfinden. Für die nächsten Tage war ein Abenteuer pur angesagt, auf das sie sich voll und ganz einlassen wollte – hoffentlich ohne weitere Leiche! In der Empfangshalle des noblen »Schlosshotels«, in das irgendein internationaler Investor Unsummen investiert hatte, entdeckte Nora einen Prospektständer mit Hochglanzflyern.
»Porzellanstraße Thüringen, Floßfahrt Saale, Rundgang Buchenwald, Tagestour Sächsische Schweiz, Nachtwächter-Tour Weimar«, war in bunten Lettern zu lesen.
»Ihre Ausweispapiere bitte!«, forderte sie ein junger Mann mit feuerroten Haaren in leicht singendem Thüringer Akzent auf.
Nora schob dem jungen Mann, dessen strahlend blaue Augen sie faszinierten, ihren Ausweis über die Theke der Rezeption.
»Zimmer 511, die ›Fürstenruh‹, 5. Etage«, erklärte Kevin Loser. Nora hatte das Namensschild auf der schwarz-dunkelblauen Livree des Portiers entdeckt. »Ich begrüße Sie herzlich im Namen unseres Hauses. Wenn Sie Wünsche haben, bin ich ihr persönlicher Ansprechpartner. Sie erreichen mich und meine Kollegen über die Telefonanlage.«
»Danke!«
»Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Ihr Gepäck befindet sich bereits auf Ihrem Zimmer. Und da vorne ist der Lift in die 5. Etage.«
»Haben Sie einen Pool?« Nora brauchte nach diesem Wechselbad der Gefühle zwischen kulturellen Highlights und Leiche eine kleine Auszeit im Wasser.
»Sternzeichen Fische werden den Stress im Wasser wieder los«, hatte ihre mit einem Inder verheiratete Yoga-Lehrerin Jasmin Deriwari ihr erklärt.
Nora hatte es ausprobiert und festgestellt, dass Jasmin recht hatte. Unter Duschen und in Pools fand Nora innerhalb von Minuten zu ihrem inneren Gleichgewicht zurück. Das wäre doch gelacht, wenn dieser Tote aus dem Park sie noch post mortem nerven würde.
Erstaunt schaute der Portier Nora an. »Im Keller. Der Pool ist rund um die Uhr geöffnet mit Ausnahme der Geisterstunde.« Er zwinkerte mit den Augen. »Dann wird er von den guten Hotelgeistern gereinigt. Auf dem Dachgarten finden Sie Liegestühle und eine Bar.«
»Danke!« Nora nickte ihm zu. Sie spürte eine leichte Müdigkeit. Die Geschichte mit der Leiche und das elende Warten im Bus, bis alle Daten von dem Mitarbeiter der Soko SAO mit der lustigen glänzenden Glatze aufgenommen worden waren, waren anstrengend gewesen. Aber eine halbe Stunde Schlaf, eine Runde im Pool und das Fünf-Gang-Menü mit dem Hauptgericht Ente würden ihre sieben Sinne vor dem Besuch im Nationaltheater wieder wecken.
Nachdem Nora ihr großes mit dunklen Kirschholzmöbeln im Biedermeierstil gediegen eingerichtetes Zimmer mit dem Namen »Fürstenruh« ausgiebig inspiziert hatte, fiel ihr der Film in ihrer Kamera ein. Noch zwei Fotos, die sie verknipsen konnte. Vom Fenster mit dem einzigartigen Ausblick in die historische Innenstadt aus hatte sie einen Foto-Express-Laden entdeckt, der mit Übernachtentwicklung und Express-Abzügen in grell bunten Farben auf Plakaten im Schaufenster warb. Das farbliche Zusammenspiel dieser grauen Hausfassade, gestützt von einem alten rostigen Gerüst mit den Neonfarben der Werbung, begeisterte Nora. Sie fühlte sich als Zeitzeugin des Wiederaufbaus nach der Wende. In ein oder zwei Jahren würden die grauen bröckelnden Fassaden verschwunden sind. Nichts würde mehr an den untergegangenen real existierenden Sozialismus erinnern. Nichts! Und dann konnte sie mit einem Stapel Fotos der Welt zeigen, wie es hier ausgesehen hatte – im Sommer 1991. Sie öffnete eines der schönen alten Holzfenster mit den Butzenscheiben in der »Fürstenruh« und fotografiert die gegenüberliegende Fassade. Ob dieser Foto-Laden jetzt geöffnet hatte?
*
»Irgendwo müssen wir anfangen«, hatte Neusiedl sich verabschiedet. »Denkst du morgen Früh an eine Kopie deiner Liste mit den Verdächtigen für mich?«, hatte er über die Schulter blickend gerufen.
Nachdem Richterswil die lange Liste auf der kleinen Copy-Maus kopiert hatte, verließ auch er mit der kompletten Akte »Schwarz« unter dem Arm den mobilen Einsatzwagen auf dem Parkplatz der Polizeiinspektion in Weimar. Er brauchte frische Luft für ein paar klare Gedanken. Da waren wieder einmal unzählige Verdächtige mit starken Motiven. Er ließ den schwarz-grauen Dienstwagen stehen. Von hier aus konnte er zu Fuß in seine Unterkunft am Frauenplan gehen. Dort hatte ihr oberster Dienstherr, das im Rahmen des 4+4-Vertrages gegründete Ministerium für Innere Sicherheit und Grenzschutz, schon vor der Ratifizierung ein in Windeseile saniertes Haus für die Teams der Soko SAO angemietet. Kontakte zur Bevölkerung waren bis auf die Ermittlungstätigkeit nicht erwünscht. Richterswil bewohnte einen Teil des Erdgeschosses mit Gartenzugang. So hatte er dann trotz aller Sicherheitsvorkehrungen des Ministeriums auch die ersten Kontakte zur normalen Bevölkerung gefunden. Hin und wieder luden ihn seine Nachbarn, die von Thuns, die ihren Adelstitel seit dem 3. Oktober des vergangenen Jahres wieder voller Stolz trugen, zum Grillen ein. Interessante Einsichten ins Leben hüben und drüben, die für die tägliche Arbeit wichtig waren, hatten sich für Richterswil ergeben. Mittlerweile hatte er ein vages Gefühl für die Menschen und ihr Leben im Osten entwickelt, die sich selbst erst noch neu orientieren mussten. Doch so spannend er die Geschichten der Familie von Thun von der Flucht aus Pommern bis zur Teilnahme des ältesten Sohnes an der Olympiade 1988 in Seoul fand, lange würde er dieses Leben aus dem Koffer, das ihn und Neusiedl oft quer durch die neuen Länder bis in die Tiefen der angrenzenden ehemaligen sozialistischen Bruderstaaten der DDR führte, nicht mehr mitmachen. Die beiden Tage in Moskau, der Plattensee, Prag und Budapest und die Woche in Bukarest, der Abstecher nach St. Petersburg waren interessant gewesen. Aber er war nicht mehr so jung wie Neusiedl, dem es offensichtlich Spaß machte, hie und da eine Affäre im Einsatzgebiet zu haben. Nur selten nutzte sein Wiener Kollege sein kleines Appartement unter dem Dach am Frauenplan. Bei jedem größeren Fall in den letzten Monaten hatte Richterswil bislang gedacht: Das ist die letzte Leiche. Vielleicht sollte er mit diesem Henker Peter Schwarz einen triumphalen Abgang machen, bevor es für ihn zu spät war, sich dieser obstruktiven Atmosphäre in den neuen Ländern im Osten zu entziehen. Wehmütig dachte er an den Zürichsee und ein gutes Glas Wein.
*
»Lass es zurück! Was willst du mit Erinnerungen?«
»Aber wir können ihnen doch nicht alles überlassen«, begehrte Gabriele Karenhall leise auf.
Im Lichtschein einer flackernden Kerze packten die ehemaligen Eigentümer auf dem Rittergut Karenhall die letzten Wertsachen in ein paar alte abgewetzte Feldrucksäcke aus dem Zweiten Weltkrieg. Gabriele, ihre jüngere Schwester Sophie und ihre Mutter Amalia teilten sich den kleinen Salon des Hauses. Alle anderen Räume hatte der Rat der Gemeinde Flüchtlingen aus den Ostgebieten zugeteilt. Die Umsiedler, wie sie offiziell im Ostjargon hießen, hatten vom Dienstboten bis zum Grafen selbst alles verloren. Einige waren froh, mit dem Leben davongekommen zu sein. Andere wurden mit ihrem Schicksal schlechter fertig. Sie schimpften auf die Russen und den Rest der Welt, nahmen sich aus Verzweiflung das Leben oder hatten es bereits bei Nacht und Nebel über die Grüne Grenze geschafft.
Heute Nacht war es auch für die drei Karenhall-Damen soweit. Es war Neumond. In der Dunkelheit war die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Flucht in den Westen am größten.
»Lass die Fotos liegen«, mahnte Amalia Karenhall erneut. »Dafür können wir uns nichts kaufen.«
Sophie hob vorsichtig ein Brett der Bodendielen hoch. Sie steckte die silbernen Löffel und ein paar alte Orden aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg in ein Handtuch gewickelt in ihren Rucksack. »Bloß keinen Lärm. Fehlt noch, dass sie uns erwischen. Ist doch Ausgangssperre.«
Gabriele holte tief Luft. Ihr Blick ging durch den Raum wie in einem bösen Traum. Das war der Rest ihres Rittergutes, und nicht einmal dieser Raum gehörte ihnen mehr nach der Bodenreform. Sie schaute Sophie und ihrer Mutter in die Augen. Ein Ruck ging durch ihren Körper. Es war Zeit, für immer Abschied zu nehmen. Nichts auf der anderen Seite der Grenze konnte auch nur annähernd so schlimm sein wie dieses Leben hier.
Auf der Straße war ein herannahendes Auto zu hören, das jetzt in den Hof des Gebäudes einfuhr.
»Ins Bett«, flüsterte Amalia Karenhall. »Schnell!«
Gabriele und Sophie hatten die Rucksäcke unter das Bett geschoben. Sie zogen die Federbetten bis zum Kinn hoch. Amalia Karenhall setzte sich in den einzigen zerschlissenen Sessel des Zimmers. Sie lauschten. Russische Sprachfetzen drangen vom Hof herauf durch das angelehnte Fenster an ihre Ohren.
»Die Suchen einen Soldaten«, flüsterte Sophie, die als Einzige der Karenhalls in den letzten Monaten Russisch gelernt hatte. »Ein Verhältnis mit einem deutschen Liebchen«, übersetzte sie. »Verräter.«
»Still!«, fauchte Amalia Karenhall ihre Tochter an.
Die Schritte der schweren Stiefel im Hof gingen in Richtung des Stalls. Ein paar russische Befehle waren zu hören.
»Der ist nicht hier«, übersetzte Sophie. »Die fahren weiter in Richtung Dorf.«
Das Motorengeräusch heulte auf, das russische Militärauto fuhr davon.
»Jetzt schnell und leise!«, flüsterte Amalia Karenhall. »Durch den Vorratskeller in den Gemüsegarten. Wir gehen direkt zum Waldweg.«
Die drei Frauen schlichen auf Zehenspitzen mit ihren Schnürschuhen in der Hand durch das stille Haus. Jeden Moment konnte sich eine der Türen öffnen, hinter der einer der neuen Genosse wohnte, der noch vor wenigen Jahren ein braunes Parteibuch hatte. Ihre Flucht durfte nicht entdeckt werden.
Eine halbe Stunde später schützte sie der dichte Wald. Gabriele lauschte auf das Knacken der kleinen Zweige unter ihren Schuhen, auf das Rufen des Kauzes und das leise Heulen des Windes. Sie schickte ein Stoßgebet zum Himmel. Bald konnten sie im Goldenen Westen sein, im Land der Freiheit und der Zukunft. Ein Fluchthelfer, der im Wald auf sie gewartet hatte, fuhr sie auf der Ladefläche eines Lasters versteckt unter einer Plane, unter der normalerweise Kartoffeln lagen, in die Nähe der Grenze. Wieder durchschritten sie schweigend und raschen Schrittes einen Waldabschnitt bis zu einem kleinen Fluss. Endlich fanden sie das Ruderboot, das ein Fluchthelfer aus dem Westen unter Brettern und Zweigen versteckt hatte.
Als Gabriele nach ihrer Schwester und ihrer Mutter aus dem Boot ans Ufer auf der anderen Seite stieg, standen ihr die Tränen in den Augen. Sie drehte sich um. Mehrere Taschenlampen blitzten weit hinter ihnen im Osten auf.
»Schnell jetzt!«, rief sie.
»Sie dürfen uns von hier aus nicht mehr zurückholen«, erklärte Sophie.
»Unser Rittergut hätten sie uns auch nicht wegnehmen dürfen«, sagte Gabriele trotzig.
*
Nora hatte eines der Zimmerfenster in der »Fürstenruh« geöffnet. Zehn Minuten später stand sie mit einem Abholcoupon »Foto Fröhlich und Söhne« in der Hand in der Weimarer Innenstadt. Hinter ihr schloss der Ladeninhaber persönlich die Tür.
Dicke Wolken zogen sich am Himmel zu einer einzigen grauen Decke zusammen. Das laute Geknatter von Zweitaktmotoren wurde von Donnergrollen begleitet. Neben den Trabis und Wartburgs, deren Produktion in Erfurt seit April Geschichte war, fuhren unzählige westdeutsche Fabrikate, zum Teil älter als zehn Jahre mit sichtbar überlackierten Roststellen und Beulen durch die Straßen. Irgendjemand verdiente sich an dem Wunsch nach den so lange begehrten Westwaren eine goldene Nase. Lange würde das nicht gut gehen. Diese abstrusen Sonderkommissionen, die aus dem Nichts aus österreichischen und schweizerischen Kriminalbeamten zusammengestellt worden waren, hatten jetzt schon alle Hände voll mit diesen schrecklichen Stasi-Racheakten zu tun. Nicht auszudenken, wie das Leben bald aussehen würde, wenn die Menschen sich auch noch wegen Betrügereien, Fehlspekulationen und anderen Gaunereien die Schädel einschlugen. Im gesamten SÖD verging keine Wochen ohne Schlagzeile in den Tageszeitungen über einen Mord an einem der ehemaligen Mitarbeiter der Staatssicherheit. Die Diskussion über die Amnestie nahm kein Ende. Zu viele Details über das wahre Ausmaß der Stasi-Tätigkeiten sickerten mehr und mehr an die Öffentlichkeit. Die Stimmen, die im 4+4-Vertrag einen großen historischen Irrtum sahen, wurden immer lauter. Dabei machte diese Spitzeltruppe sich doch jetzt nach der Generalamnestie in der Neuen Grenzschutztruppe zwischen Nordsee und Alpen nützlich. Ein Blick auf die Uhr verriet Nora, dass sie noch knapp zwei Stunden Zeit zum Duschen und Umziehen hatte. Nach dem Abendessen standen gegen 20:00 Uhr die »Räuber« im Nationaltheater auf dem Programm. »Des Menschen Wille, das ist sein Glück«, deklamierte Nora Schiller amüsiert. Dann fiel ihr ein, dass dieser Satz aus Wallenstein und nicht aus den Räubern war. Staunend schaute sie unter dem Vordach des Hotels auf die Hagelkörner, die aus dem schönen englischen Rasen eine weiße Landschaft zauberten. Hagel im Sommer, ein seltsames Gefühl lief über Noras Nacken. Wann hatte sie dieses Wetterphänomen zuletzt erlebt?
Gegen Mitternacht freute sich Nora über das Betthupferl, das die Geschäftsführung des Hotels ihr als Siegerin des Preisausschreibens mit einer Grußkarte auf den Nachttisch gestellt hatte.
Als sie nach dem Piccolo und vier kleinen Kuchenstücken im weichen Kingsize Bett der »Fürstenruh« versank, hatte sie das Bild des Goethe- und Schillerdenkmals am Nationaltheater vor Augen.
»Halt mich fest, sonst fall ich runter!« Das war ein uralter Witz über die beiden Dichterfürsten und ihre Position auf dem Podest. Ein Wunder, dass die beiden nie jemand gegen Marx und Engels oder gegen Lenin und Trotzki ausgetauscht hatte. Hoffentlich blieb der unbekannte Tote die letzte Leiche, die ihre Rundreise störte. Wie lästig Leichen doch sein konnten. Nora schlief mit einem Lächeln auf den Lippen ein. In der Nacht träumte sie wirre Szenen von Räubern im Park und einer Leiche auf der Bühne des Nationaltheaters, die wie das Sandmännchen aussah.
*
Oberstleutnant Richterswil verließ die Villa Schwarz mit einem Karton voller Fotos und persönlicher Notizbücher kurz nach Mitternacht.
Bei der Überbringung der Nachricht vom Tod ihres Mannes hatte er die Gesichtszüge der in seinen Augen attraktiven Witwe genau beobachtet. Mit Mitte 40 hatte Barbara Schwarz nur wenige Falten. Ihr ungeschminktes Gesicht hatte eine jugendliche Ausstrahlung. Ihre langen blonden Haare trug sie zu einem lässigen Dutt hochgesteckt, aus dem die eine oder andere Strähne hing. Richterswil hatte im Gesicht der Witwe das übliche erschreckte Zucken gesehen, das alle Gesichter zeigten, die gerade vom Tod eines nahen Angehörigen erfahren hatten. Ein Polizeipsychologe hatte ihm erklärt, dass sich diese Sätze wie ein harter Schlag in den Magen anfühlten. Dennoch waren kurze informative Sätze besser als langes Herumgerede. Oft versuchten die Betroffenen zu schreien, blieben aber stumm.
»Wir leben – lebten getrennt. Seit fünf Monaten«, begann Barbara Schwarz zu erklären, nachdem sie Richterswil in die Villa gebeten hatte. »Ich lebe in Berlin. Ich bin zufällig hier, heute, um ein paar persönliche Dinge abzuholen.« Dann hatte sie sich in einen hohen weißen Ledersessel fallen lassen, die Knie angezogen und den Kopf darauf gelegt.
Richterswil nahm unaufgefordert Platz. Er schaute sich im Raum um. Schlecht war es Peter Schwarz nicht gegangen. Vermutlich hatte der Stasi-Oberst vor der Wende nicht gewusst, was eine Defizitware war, unter der Otto Normalverbraucher Ost so gelitten hatte.
Barbara Schwarz sah mit Tränen in den Augen auf. »In Berlin, da pulsiert das Leben, da findet jetzt schon die Zukunft statt. Wissen Sie, ohne Mauer, da hatte unsere sozialistische Ehe keine Bedeutung mehr gehabt. Die Liebe – wir sind ja keine kleinen Kinder mehr. Aber das ist sicherlich nicht das, was Sie von mir hören wollen?«
»Hatte er eine Affäre?«
Richterswil hatte die kleine Hausbar in der Schrankwand im sozialistischen Stil mit der dunklen Lackfront gefunden. Scheinbar hatten diese Wohnzimmermöbel Ost alle denselben Einheitsaufbau.
Barbara Schwarz zog die Augenbrauen kraus, eine Steilfalte bildete sich zwischen ihren Augen auf der Stirn. »Affäre?«
»Haben Sie Haustiere? Katzen?«
Sie schüttelte den Kopf.
Er schenkte Barbara Schwarz und sich einen exklusiven französischen Cognac ein. Peter Schwarz war es auch nach der Wende gut gegangen. Sack, dachte Richterswil.
»Silberne Hochzeit, 25 Jahre Höhen und Tiefen, die lassen sich mit einer Trennung nicht wie ein Mantel ablegen.« Sie schniefte jetzt ohne Tränen in den Augen. »Ich kann es noch nicht fassen, dass er nicht mehr da sein soll. Er wird mir fehlen, so oder so.«
Richterswil reichte der Witwe den gut gefüllten Cognacschwenker. »Besser so, oder?«
»Nein, aber gut tut’s trotzdem. Sie wollen alles über ihn wissen?«
»In erster Linie müssen wir wissen, wo Sie heute Vormittag waren.«
»Ich war es nicht.«
»Und?«
»Ich hatte einen Friseurtermin. Ansätze färben.«
»Die Adresse des Frisiersalons? Wir müssen das überprüfen, routinemäßig.«
»Ich habe das privat machen lassen, von einer Freundin. Mozartstraße 20, Marga Frenzel.«
Richterswil notierte Namen und Adresse. »Sie bleiben bitte vorerst in Weimar zu unserer Verfügung.«
»Sie gehen ernsthaft davon aus, dass ich etwas mit dem Mord an meinem Mann zu tun habe?«
»Genauso gut könnten Sie das nächste Opfer sein, oder?«, erklärte Richterswil leise. »Oder wollen Sie etwa behaupten, in all den Jahren nichts von der Arbeit Ihres Mannes gewusst zu haben?«
Barbara Schwarz zuckte mit den Schultern. »Nur weil wir hier ein sozialistisches Leben geführt haben, haben wir noch lange nicht alles voneinander gewusst«, sagte sie verärgert. »Wir haben nicht unter ständiger Kontrolle gelebt. Oder haben Sie hier irgendwo Kameras gesehen, als die Mauer gefallen ist?«
»Aber richtig verheiratet waren Sie schon, oder? Ich meine, Sie haben mit Ihrem Mann zusammen in einer Wohnung gelebt?« Richterswil zögerte mit einer erneuten Fragen nach einer Affäre. War die Trennung nur eine Schutzbehauptung?
»Wir haben über 20 Jahren hier in dieser Villa gewohnt. Aber wissen Sie, wir Frauen in der DDR hatten unser eigenes Berufsleben, unsere Karriere und unser Kollektiv. Wie waren stolz auf unsere Selbstständigkeit, auf die Unabhängigkeit von unseren Ehemännern.«
Richterswil grinste. Hoffentlich kam jetzt nicht noch irgendein alter auswendig gelernter Parteiquatsch. Zu dieser vorgerückten Stunde hätte er kaum noch die Geduld aufgebracht, eine böse Bemerkung zu unterdrücken. »Haben Sie einen Verdacht? Ein ehemaliger Kollege? Ein Widersacher?« Richterswil holte tief Luft. »Ein Opfer, das sich rächen wollte? Eine Geliebte, mit der er Streit hatte?«