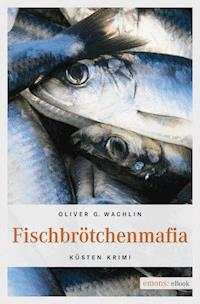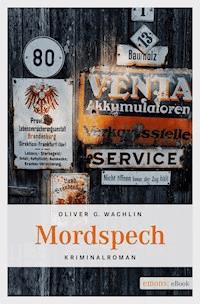
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im heißen Sommer 1997 zeiht ein Auftragskiller eine blutige Spur durch Berlin. Er tötet präzise, eiskalt und gnadenlos. Ein Phantom. Niemand kennt seine wahre Identität. Nur seinen Decknamen. Es geht um Giftgas, geheime Kriegsgeschäfte und das ganz große Geld. Die Kommissare Hünerbein und Knoop kommen einem veritablen Skandal auf die Spur. Wer sind die Hintermänner?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oliver G. Wachlin, Jahrgang 1966, lebt und arbeitet seit über zwanzig Jahren hauptberuflich als freier Autor und Dramaturg in Berlin. Er schrieb zahllose Texte, Konzepte und Drehbücher für Film und Fernsehen sowie diverse Image- und Werbekampagnen. »Mordspech« ist sein fünfter Kriminalroman für den Emons-Verlag.
www.petkovic-und-schwartz.de
www.wunderlandkrimi.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Am Ende des Buchs finden sich Übersetzungen und inhaltliche Erläuterungen.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literaturagentur Michaela Behrens&
© 2013 Hermann-Josef Emons Verlag Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: © mauritius images/ib/Karl F. Schöfmann Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch eBook-Erstellung: CPI – Clausen & Bosse, LeckISBN 978-3-86358-313-2 Originalausgabe
Prolog
Abstand ist wichtig. Größtmöglicher Abstand. Man hinterlässt keine Spuren, wenn man Abstand hält. Eine Kugel und ein Loch im Kopf des Toten. Mehr gibt es nicht. Und auch die Kugel wird man sich bald sparen können. In Amerika experimentieren sie schon mit Laserwaffen.
Tante Tilly schraubte ihr Arctic Warfare zusammen. Eine Sonderanfertigung extra für die Bundeswehr. Im Bosnienkrieg hatten sich die Soldaten der internationalen Schutztruppe mit dem G3-Sturmgewehr den serbischen Snipern stark unterlegen gefühlt. Das Heer veranlasste daher die Ausschreibung einer Neuentwicklung, an der sich alle führenden westeuropäischen Waffenfirmen beteiligten. Die Engländer bekamen den Zuschlag. Wegen des Sofortbedarfs lieferten sie umgehend achtundfünfzig Präzisionsgewehre der Marke Arctic Warfare Magnum. Sie kamen nie bei der Bundeswehr an.
Tante Tilly lächelte. Zu den Modifizierungen ihrer Waffe gehörten Dreibein, Schall- und Rückstoßdämpfer sowie ein wegklappbarer Hinterschaft. Nahm man dazu noch den Lauf ab, passte die Waffe in jeden Sportrucksack. Einen sogenannten City Bag, wie die Dinger heute Neudeutsch hießen. Millionen von Touristen und Praktikanten liefen in dieser Stadt damit herum. Unauffälliger ging es nicht.
Sie öffnete das schmale Dachfenster und richtete das Gewehr aus. Die Erstschusstrefferwahrscheinlichkeit auf tausendfünfhundert Meter lag bei offiziell achtzig Prozent. Mit etwas Übung und bei guter Sicht waren es mehr. Tante Tilly war Profi. Sie traf mit dem Arctic Warfare auf tausend Meter jede Ratte.
Heute lag das Zielobjekt, so zeigte es der Entfernungsmesser im Visier, in exakt 357,82 Metern Distanz. Die Sicht war gut, obwohl es regnete und sich viele der Menschen auf den Straßen unter großen, nass glänzenden Schirmen versteckten. Mitunter verdeckten sie das Ziel. Ein größeres Problem war der Verkehr auf der viel befahrenen Kreuzung am John-F.-Kennedy-Platz. Immer wieder kreuzten Lkws und Doppeldeckerbusse die Schussbahn, und etwaige Kollateralschäden konnte sich Tante Tilly nicht leisten.
Sie sah auf die Uhr und wartete. Wenn man in dem Job Erfolg haben will, muss man Geduld haben. Ausdauer und das Gespür für den richtigen Augenblick unter Einbeziehung aller äußeren Faktoren.
Eine Grünphase auf der Martin-Luther-Straße dauerte zwei Minuten und sechsundvierzig Sekunden. Dann schalteten die Ampeln auf Gelb, um kurz darauf den Verkehr von der Belziger Straße anderthalb Minuten lang auf die Kreuzung zu lassen. Tante Tilly hatte die Umschaltphasen präzise ausgemessen und herausgefunden, dass vor jedem Wechsel sechs Sekunden lang alle Ampeln auf Rot standen. Ein Zeitfenster, mit dem die Planer sicherstellen wollten, dass die Kreuzung wirklich frei von Fahrzeugen war, bevor der Verkehr aus der anderen Richtung freigegeben wurde. Zwischen jeder Ampelphase also standen die Autos auf dem John-F.-Kennedy-Platz ganze sechs Sekunden lang still. Und genau diesen Umstand galt es zu nutzen.
Tante Tilly visierte ihr Ziel konzentriert an. Fünfzehn Sekunden bevor die Ampeln auf Gelb schalteten, drückte sie die Wähltaste ihres Handys. Irgendwo da drüben klingelte jetzt ein Telefon. Sie hatte es genau im Fadenkreuz. Jemand nahm ab. Die Ampeln schalteten auf Rot, die Kreuzung war frei. Kein Laster verdeckte das Schussfeld und kein Doppeldeckerbus. Freie Sicht für sechs Sekunden, es war einfach perfekt.
Eins. Zwo. Tante Tilly drückte den Abzug ihres Präzisionsgewehrs durch. Drei Sekunden. – Schuss!
Und knapp sechshundertachtundfünfzig Meter entfernt löste sich ein aufgeschreckter Vogelschwarm aus den Bäumen am Straßenrand und verlor sich im verregneten Berliner Sommerhimmel.
1 EINE DER JÜNGSTEN GEISSELN unserer Zeit ist die stete Erreichbarkeit. Noch vor ein paar Jahren haben wir uns über auf der Straße telefonierende Italienerinnen und permanent in ihr Mobilephone plärrende Businessmen lustig gemacht. Das Funktelefon, so schien es, war wie das Karmann-Cabriolet oder der mit Zahlenschloss gesicherte Aktenkoffer nur ein weiteres neumodisches Accessoire profilneurotischer Wichtigtuer. Ein kurzlebiges Spielzeug für Anzugträger und Dolce-&-Gabbana-Frauen, eine Modeerscheinung wie einst Walkman oder Zauberwürfel. Beide sind, wie der Aktenkoffer, fast völlig aus dem Straßenbild verschwunden, und das Karmann-Cabrio musste bulligen, als SUV oder Sports Utility Vehicles bezeichneten Geländewagen weichen. Einzig das Mobiltelefon ist geblieben. Als Handy hat es heute Alltagsstatus, überall piept und dudelt der Nokia Tune genannte Gran Vals des spanischen Komponisten Francisco Tárrega, es wird gesimst und gequasselt, dass der Äther rauscht.
Schon gibt es Gerüchte, die Welt sei eine einzige Mikrowelle, wir würden uns die Hirne verbrutzeln mit all der Telefoniererei. Erste Bürgerinitiativen haben sich gegründet, um gegen den Bau weiterer Mobilfunkmasten zu demonstrieren, und selbstverständlich verabredet man sich per Handy zum Protest. Entrinnen unmöglich. Das Telefon im Taschenformat hat jede Kommunikation pervertiert, es sind kaum noch zwischenmenschliche Gespräche möglich, ohne dass es dazwischen piepst. Es nervt beim Autofahren, stört beim Essen, beim Sex und das getragene Adagio des »Notturno« von Franz Schubert bei einem Konzert der Berliner Philharmoniker.
Natürlich kann man es einfach ausschalten. Aber dann muss man sich hinterher rechtfertigen, die Mailbox ist voll mit wütenden Nachrichten: Warum war man nicht erreichbar, wozu hat man schließlich ein Handy, wenn man es nicht anmacht? Es könnte ja wichtig sein, sicher, aber meistens ist es das nicht.
Mit anderen Worten: Ich hasse diese Dinger!
Dass ich dennoch ein Mobiltelefon bei mir trage, ist einzig und allein meinem Beruf geschuldet. Seit Jahren schon scheitert die Berliner Polizei an der Aufgabe, ein abhörsicheres Funknetz aufzubauen. Es fehlt an Geld und Technikern, die neuen Geräte sind nicht kompatibel, alles funktioniert nur noch sporadisch. Über die Jahre ist der Berliner Polizeifunk sozusagen kaputt modernisiert worden. Die Presse schürt Häme, die Verbrecher lachen sich einen Ast, und wir Kriminalbeamten haben die Anweisung bekommen, bis auf Weiteres übers private Handy zu kommunizieren. Wer keines hat, soll sich eines anschaffen und genau Buch darüber führen, welche Gespräche denn nun dienstlich waren und welche nicht. Sobald entsprechende Formulare existieren – noch wird über die genaue Ausgestaltung derselben in einer externen, also outgesourcten, Arbeitsgruppe verhandelt –, kann man seine Dienstgespräche finanziell rückwirkend geltend machen. Allerdings wird das noch etwas dauern, wir sind hier schließlich in Berlin, der Hauptstadt der Improvisation. Die ewige Baustelle grüßt ihre Gäste, unsere größte Stärke ist die Unfertigkeit.
Improvisiert wird auch bei der Kinderbetreuung. Vor fünf Jahren bin ich noch mal doppelter Vater geworden, ein Nesthäkchen wurde erwartet – es kamen zwei. Unsere Zwillinge heißen Liam und Zoé, ganz süße Kinder, dunkle Locken und grünäugig wie ihre Mama, aber sie fordern den ganzen Mann. Und so stehe ich im Kinderladen »Stoppelhopser«, einer von berufstätigen Eltern auf eigene Initiative gegründeten Tagesbetreuungsstätte, zwischen lärmenden Kleinkindern, als das Handy in meiner Jackentasche lospiept. Um mich herum ein Chaos, das jeder Beschreibung spottet. Bauklötze fliegen durch die Gegend, ein halbes Dutzend quietschender Gören hängt an meinen Beinen, weil sie mich – hurra! – »gefangen« haben, zwei, Anna-Chiara und Tabea-Luise genannte, Mädchen zerren sich brüllend gegenseitig an den Haaren, und die enervierend schrille Stimme der Erzieherin gellt durch den Raum.
Melanie ist dran, aber nicht zu verstehen.
»WAS?«, rufe ich in den Hörer, mich nach einem stillen Eckchen umsehend, denn meine älteste Tochter ruft mich normalerweise nie an. Ich bin ihr völlig egal. Es sei denn, sie will etwas. Die Frage ist, was?
»Brauchst du Geld?« Studentinnen sind immer klamm, das weiß ich aus meiner eigenen Unizeit. Eine zweite Möglichkeit wäre die alte Schrottkiste, die sie sich kürzlich angeschafft hat, um »mobil« zu sein. Allerdings habe ich sie mit der Karre noch nie fahren sehen.
»Ist was mit deinem Wagen?« Ich halte mir das linke Ohr zu, ans rechte presse ich das Handy: »Kannst du etwas lauter sprechen? Hier ist ein Lärm, der …«
Melanie stammelt irgendwas, und meine väterliche Intuition sagt mir sofort, dass sie in Schwierigkeiten steckt. Weint sie etwa? Es gibt mir einen Stich ins Herz. Ich kann es nicht ertragen, wenn meine Kinder leiden. Was ist da los? Melanie ist nicht der Typ, der gleich in Tränen ausbricht, wenn es ein Problem gibt. Es muss also was Ernstes sein, und deshalb erspare ich mir weitere Fragen zum Grund ihres Anrufes und erkundige mich lediglich, wo sie gerade ist.
»Zu Hause«, höre ich es schluchzen.
»Bleib wo du bist, ich bin in zehn Minuten da.«
Melanie wohnt in meiner alten Bude, das schaffe ich zu Fuß. Ich muss nur erst die Zwillinge loswerden. Normalerweise gibt es da ein fest verabredetes Abschiedsritual mit viel Hutziwutz und Bussibussi – aber heute muss ein kurzer Schmatz auf die Stirn der Kinder reichen. Die sind immerhin schon im Vorschulalter und sollten verstehen, dass es auch mal schneller gehen kann, wenn Papa dringend weg muss.
Sie verstehen es aber nicht. Sie fangen an zu plärren wie Dreijährige. Sie hängen sich an meine Jacke, wollen mich nicht ziehen lassen. Dabei sind sie fast die ältesten Kinder hier.
Seid doch vernünftig, ihr seid doch schon soo grooß, Herrgott noch mal!
Aber alle Appelle gehen ins Leere. Liam und Zoé wollen nicht groß sein. Sie wollen Bussibussitrallala wie immer. Also hocke ich mich hin, mache unser Abschiedsspielchen, ein Kuss links, ein Kuss rechts, noch ein Kuss links und noch einer rechts, dann Nasereiben wie bei den Eskimos und das Versprechen, nachher beim Abholen ein Eis zu kaufen. Schokoeis für Zoé und Himbeere für Liam. Je eine Kugel. Jawohl, mit bunten Streuseln drauf. Ganz großes Indianerehrenwort.
Dann darf ich endlich gehen und nehme mir fest vor, meine Erziehungsmethoden altersgemäß anzupassen. Sonst wird das im nächsten Jahr nichts mit der Einschulung.
Es regnet, die Straßen sind nass. Ich spanne meinen Schirm auf und biege, aus der Merseburger kommend, rechts in die Belziger ein. Am alten Postfuhramt vorbei laufe ich zügig auf die Eisenacher Straße zu und quere sie am wilhelminischen Backsteingebäude der Gustav-Langenscheidt-Schule. Sie gilt als Baudenkmal, ähnlich wie die meisten der um die Jahrhundertwende gebauten Mietshäuser hier. Hochparterre, vier Etagen, dazu viel Stuck und Pomp. Typische Berliner Gründerzeitarchitektur. Vermutlich war man nach den Krieg froh um jedes Haus, das noch stand, und stellte es rasch unter besonderen Schutz. Das ehemalige Straßenbahndepot links gilt ebenfalls als denkwürdig. Jetzt ist eine Polizeidienststelle drin. Gegenüber liegt der Heinrich-Lassen-Park und dahinter der Friedhof der Evangelischen Gemeinde mit der Schöneberger Dorfkirche. Sie stammt aus dem achtzehnten Jahrhundert und ist natürlich auch denkmalgeschützt.
Die Hausnummer 75 dagegen, ganz am Ende der Belziger Straße, an der Kreuzung Dominicus- und Martin-Luther-Straße, ist ein schmuckloser, in den fünfziger Jahren im Stile Le Corbusiers errichteter grauer Kasten. Fast sechzehn Jahre lang habe ich dort in jener kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt, die jetzt Melanie bewohnt. Schräg gegenüber steht das Schöneberger Rathaus natürlich unter Denkmalschutz, denn hier hatte sich kurz nach dem Mauerbau ein amerikanischer Präsident dazu bekannt, Berliner zu sein, weshalb die Kreuzung heute seinen Namen trägt. Die Frage ist, was die vielen Blaulichter auf dem John-F.-Kennedy-Platz zu bedeuten haben und die Menschenmenge vor meinem Haus.
Nervös verfalle ich in schnellen Trab. Was ist da los? Polizisten drängen Schaulustige zurück und ziehen Absperrbänder. Eine Ambulanz orgelt mit Sirenengeheul an mir vorbei und stoppt. Zwei Sanitäter springen heraus und kümmern sich um eine blutüberströmte Gestalt auf dem Gehweg. Es ist Melanie. Meine Tochter!
»Spatz«, brülle ich fassungslos und renne drauflos. »Oh mein Gott!« Ich ignoriere den Polizisten, der mich aufhalten will, und schiebe mich hektisch zwischen gaffenden Leuten hindurch.
Platz da, verdammt noch mal! Was ist hier geschehen? Was, um Himmels willen, ist mit Melanie passiert?!
»Der Radfahrer …«, stammelt sie schluchzend, während sie von den Sanitätern in eine Wärmedecke gehüllt wird, »Scheiße, der Radfahrer …«
»Sind Sie der Vater?« Die Sanitäter bringen Melanie zu einem Krankenwagen.
Ich kann nur nicken und sehe besorgt auf meine Tochter. »Ist sie schwer verletzt?«
»Das sieht schlimmer aus, als es ist. Das meiste Blut stammt von dem da.«
Ich folge dem Blick des Sanitäters zu einem Toten auf dem Trottoir vor dem Haus. Er liegt eigenartig verdreht in einer dunklen Blutlache und hat einen kaputten Fahrradhelm auf dem Kopf.
»… der ist mir direkt in die Arme gefallen.« Melanie wischt sich mit ihrem blutverschmierten Ärmel über das Gesicht und schnieft. »Ich kam gerade aus dem Haus, und plötzlich …«
»Sie steht natürlich unter Schock.« Die Sanitäter setzen Melanie in den Krankenwagen. »Wir bringen sie erst mal weg hier. Wollen Sie mit?«
Natürlich will ich mit, aber einer der Polizisten hält mich zurück. »Ich nehme an, Sie sind Hauptkommissar Knoop?«
»Derselbe.« Ich zücke meinen Dienstausweis.
»Dachte ich’s mir doch. Ihre Tochter sagte uns, dass sie Sie angerufen hat.«
»Und? Was ist hier los?«
»Ja, schwer zu sagen. Bei dem Getöteten handelt es sich offenbar um einen Fahrradboten.«
Eine gelb-blaue Kuriertasche und ein Rennrad neben der Leiche scheinen die Vermutungen des Polizisten zu bestätigen.
»Ein Unfall?«
»Dafür fehlt ein Unfallgegner.« Der Polizist hebt ratlos die Schultern. »Und das Rad scheint auch in Ordnung. Irgendwas muss ihn in voller Fahrt da runtergeholt haben. – Mensch, schickt doch mal die Fotografen in die Wüste«, brüllt er seine Uniformierten an. »Hier gibt’s nichts zu knipsen!«
»Ja, ick werd wohl noch erfahren dürfen, wat vor meiner Haustür los is«, protestiert ein älterer Herr, den ich als Kawelka identifiziere. Fritz Kawelka, ein Lokalreporter, der seit Jahren die kleine Ladenwohnung unten im Parterre nutzt und immer von der ganz großen Story träumt. Jetzt passiert endlich mal was. Und zwar direkt vor seinem Büro. Mensch, bequemer geht’s nicht, und natürlich will er die Leiche des toten Fahrradkuriers mit einer Sofortbildkamera ablichten, doch zwei Polizisten stellen sich ihm, »Hauen Sie ab, Mann!«, in den Weg.
Kawelka protestiert heftig und pocht wild gestikulierend auf das verfassungsrechtlich verbriefte Recht der Pressefreiheit. Es entsteht ein kleiner Tumult, bis eine resolute ältere Dame dazwischengeht. Vermutlich die Polizeipsychologin oder so jemand. Auf jeden Fall scheint sie für solche Fälle ausgebildet zu sein, denn sie weist Kawelka freundlich, aber bestimmt darauf hin, dass er sich gerne an die Pressestelle des Landeskriminalamtes wenden könne, und drängt ihn zurück in seine Ladenwohnung.
»Haben Sie die Spurensicherung verständigt«, wende ich mich wieder dem Polizisten zu, »und die Rechtsmedizin?«
»Ja«, er sieht auf seine Uhr, »die sollten längst hier sein.«
Wie auch immer, ich muss mich erst mal um meine Tochter kümmern. »Halten Sie die Augen offen«, ermahne ich die Uniformierten. »Ich komme später wieder dazu.« Schon sitze ich neben Melanie, die Türen klappen, und der Krankenwagen setzt sich mit Blaulicht in Bewegung. Behutsam tupfe ich ihr das Blut aus dem Gesicht. »Tut’s weh?«
»Nicht wirklich.« Melanie schüttelt den Kopf. »Mir fehlt nichts. Das ist wirklich alles Radfahrerblut …«
»Und der ist dir einfach so in die Arme gefallen?«
»Voll auf mich drauf«, nickt Melanie. »Ich wollte eigentlich in die Uni. Ich komme aus dem Haus, und plötzlich hebt’s den vom Rad. Baff! Wir liegen auf dem Boden, und aus seinem Kopf strömt total viel Blut. Ich hab echt Panik bekommen …« Sie fängt wieder an zu weinen.
»Schon gut, Spatz. Schon gut«, beruhige ich sie. »Da kümmern wir uns drum. Wichtig ist nur, dass du wieder auf die Beine kommst.«
»Ich sage doch, mir fehlt nichts.«
»Das lassen wir mal besser die Fachleute entscheiden.«
Draußen fliegt die Stadt vorbei. Die Sirene tönt.
»Wir müssen Mutti anrufen«, sagt Melanie.
Da hat sie sicher recht. Ich ziehe mein Handy hervor und wähle eine Nummer.
2 SIE KÄMPFTEN gegen einen übermächtigen Feind. Wie riesige Libellen schwebten schwere Bell-, Sea-King- und Sikorsky-Helikopter der Bundeswehr über den aufgeweichten Deichen und warfen Sandsäcke ab. Tausende Soldaten, Bundesgrenzschützer, Kameraden des Technischen Hilfswerkes und freiwillige Helfer waren mit Pionier- und Räumpanzern, Lastkraftwagen und Booten im Einsatz und versuchten verzweifelt, die Dämme zu stabilisieren. Vergebens. Im Südosten Brandenburgs, bei Brieskow-Finkenheerd und Aurith, waren die Deiche bereits auf siebzig und zweihundert Metern Länge gebrochen und hatten die dahinter liegende Ziltendorfer Niederung unter Wasser gesetzt. Über zweihundertfünfzig Häuser wurden von den Fluten weggerissen, die Ernte eines ganzen Jahres war vernichtet, auf dem Wasser trieben aufgeblähte Tierkadaver.
Und mittendrin in dieser apokalyptischen Katastrophe steckte Monika. Eigentlich sollte sie für den Berliner Tagesspiegel vom Kampf gegen die Jahrhundertflut berichten. Doch es war unmöglich. Hier wurden keine fragenden Journalisten mit Diktafonen gebraucht, sondern Hände, die mit anpackten. Inzwischen wurde auch Frankfurt von der Oder bedroht, da kämpften allein sechzigtausend Einwohner um ihre Stadt, und im nördlicher gelegenen Oderbruch liefen Evakuierungsmaßnahmen für weitere zwanzigtausend Menschen.
Mit einem Trupp freiwilliger Helfer vom Roten Kreuz, dem Arbeiter-Samariter-Bund und der Johanniter-Unfall-Hilfe stand Monika in Gummistiefeln bis zu den Knien im Wasser. Bei Hohenwutzen rutschten die aufgeweichten Schutzdeiche auf einer Länge von fast zweihundert Metern weg und mussten dringend gestützt werden. Hastig wurden Faschinen gebunden und Sandsäcke aufgetürmt. Auf der Wasserseite versuchten Kampftaucher der Bundeswehr unter Lebensgefahr, die Deiche mit Folien abzudichten. Immer wieder donnerten Tornado-Kampfflugzeuge der optischen Luftaufklärung über den reißenden Fluss hinweg. Sirenen gaben Daueralarm, sämtliche Kirchenglocken läuteten. Lautsprecherwagen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft fuhren durch die Dörfer und forderten die Bewohner auf, ihre Gehöfte unverzüglich zu verlassen. Aus dem Altreetzer Zoo wurden alle Tiere in Sicherheit gebracht.
»Gruppe drei: kurze Pause!«
Es waren jeweils fünfzehn Männer und Frauen in sogenannte freiwillige Gruppen eingeteilt. Im Gegensatz zu den Soldaten im Dienst wurden den zumeist untrainierten Freiwilligen des Zivilschutzes regelmäßig kurze Pausen zugestanden, damit sie nicht zusammenbrachen. Monika gehörte zur Gruppe drei. Neben Kaffee gab es auch Bier, Wasser und Tee. Irgendwer verteilte Zigaretten und Schnaps aus dem Flachmann. Anders war das hier nicht auszuhalten.
Monikas Hände bluteten und waren voller Schwielen. Sie konnte den Kaffeebecher kaum halten und sank erschöpft auf eine alte Obstkiste. Zum ersten Mal fielen ihr die jungen Apfelbäume auf. Sie standen auf der Wiese gleich hinter dem Deich, zarte, von Stöcken gestützte Bäumchen mit kleinen grünen Äpfeln an jedem Zweig.
»Wenn der Deich hält«, sagte jemand, »sind sie nächsten Monat reif. Obwohl der Sommer dieses Jahr ja nicht so doll war. Augustäpfel brauchen Feuchtigkeit; na, davon gab’s genug; aber eben auch Wärme. Sonst bleiben sie grün.«
Dann kann man sie immer noch für Apfelaromen verwenden, dachte Monika. So wie in den Achtzigern, da war das Mode: Grüne-Apfel-Seife, Grünes-Apfel-Shampoo, Weichspüler mit Grünem-Apfel-Duft. In der DDR hatte man damals offenkundig zu viel von dem Zeug produziert, da gab’s wegen absurder Planübererfüllung am Ende sogar Cola mit Grünem-Apfel-Aroma. Igitt! Es schüttelte Monika noch heute, wenn sie daran dachte.
»Gruppe drei: Es geht weiter!«
Von einem Laster wurden neue Sandsäcke abgeladen. Monika stand auf und packte wieder mit an. Über eine Menschenkette wurden die Säcke weitergereicht und am Deich aufgeschichtet. Eine stupide Arbeit. Und doch besser als zuschauen. Kindheitserinnerungen wurden in Monika wach. Denn ein bisschen war das hier wie der Bau einer Sandburg am Ostseestrand. War der Sand pulvrig und trocken, zerrann er in den Händen. Erst Nässe gab ihm Festigkeit. Dann konnte man ihn zu Mauern kneten, Tore bauen, Türmchen. Zu nass durfte der Sand aber auch nicht werden, dann wurde er pampig und verlor jeden Halt. Wie oft hatte Monika fassungslos zusehen müssen, wie ihr in mühsamer Arbeit errichtetes Sandschloss plötzlich in sich zusammenfiel, weil ihm eine Ostseewelle zu nah gekommen war.
Deshalb die Säcke. Sie hielten den Sand zusammen, selbst wenn er pampig war. Und deshalb waren die Deiche mit Gras und Buschwerk bepflanzt. Das Wurzelwerk minderte die Erosion des Erdwalls bei Hochwasser und starker Strömung. Bis zu einem gewissen Grad jedenfalls, denn über Monika brachen plötzlich ganze Grasnarben aus dem Deich. Ihnen folgte erst schwarze Pampe, dann bräunliche Brühe, die sich zu einem immer stärkeren Wasserstrahl entwickelte.
Jemand schrie mit sich überschlagender Stimme nach einer Pumpe. Aber die waren schon alle im Einsatz. An zu vielen Stellen schon sogen sie das Wasser aus dem Deich. Und trotzdem war er nur noch ein einziger Berg aus teigigem Brei, der jeden Moment in sich zusammenbrechen konnte.
»Alle zivilen Helfer zurück!« Plötzlich wimmelte es von Soldaten. In der Nähe heulte schrill ein Signalhorn auf. Auch das hatte Monika schon mal gehört. Bei der Eisenbahn benutzten es die Gleisbauarbeiter, um sich vor herannahenden Zügen zu warnen.
»Runter von der Deichkrone«, schepperte eine Lautsprecherstimme, »alles sofort runter von der Deichkrone!«
Eine militärisch-grün lackierte Planierraupe der Bundeswehr kletterte brüllend heran. Vorn hatte sie eine riesige Schaufel wie ein Schneeflug. Damit schob sie das pampige Erdreich zusammen und drückte es mit durchdrehenden, im Schlamm versinkenden Ketten gegen den Deich.
»Weg hier!« Irgendwer packte Monika am Arm, zerrte sie mit sich fort. »Kommen Sie schnell! Das kann jeden Moment alles zusammenbrechen. Dann heißt’s: Land unter.«
Monika fand sich mit anderen Helfern auf der überfüllten Pritsche eines Lastwagens wieder, der über regennasse Straßen raste. Flucht ins Landesinnere. Weg von in sich zusammenfallenden Deichen, weg von der alles verschlingenden Flut. Die Menschen um sie herum sahen grau aus und erschöpft. Alles Freiwillige. Zuversichtlich waren sie vor einigen Tagen hier eingetroffen, voller Optimismus, dass der Mensch es schaffen würde. Mit vereinter Kraft, ein Bezwinger der Natur. Jetzt waren die Blicke leer und trostlos. Ihre Bemühungen waren umsonst.
»Das war’s jetzt mit den Augustäpfeln«, sagte jemand, »alles im Eimer.«
Der Laster stoppte vor einem Gasthaus. »Absitzen! Zwanzig Minuten Mittagspause.«
Auch in der Katastrophe gab es Mahlzeiten. Und dann?
»Wir warten auf weitere Einsatzbefehle. Wer nicht mehr kann, soll sich beim Roten Kreuz melden.«
Monika löffelte an ihrer Soljanka und sah aus dem Fenster.
Draußen stoppten mehrere Radpanzer und Kastenwagen der Bundeswehr. Soldaten mit grauer ABC-Schutzkleidung saßen ab, holten sich ebenfalls Soljanka.
Monika reckte den Hals. Seltsam. Was hatte ein Hochwasser mit der Abwehr von A wie Atomwaffen, B wie biologische Waffen und C wie Chemiewaffen zu tun? Was wollte die ABC-Truppe hier?
Eigentlich fühlte sich Monika viel zu kaputt, um noch Fragen zu stellen, doch dann siegte wieder die journalistische Neugier. Sie raffte sich auf und trat an einen der ABC-Soldaten heran.
»Gibt es Probleme? Einen Chemieunfall? Wo ist Ihr Einsatzgebiet?«
»Altgrieben«, antwortete ein junger Soldat unbekümmert, »soweit ich das mitbekommen habe, sollen wir irgendeinen unterirdischen Bunker sichern helfen.«
»Altgrieben?« Monika überlegte. »Aber das ist …«
»… reine Routine«, mischte sich ein älterer Offizier der Truppe ein. »Wo es Überschwemmungen gibt, gibt’s auch Giftstoffe. Denken Sie nur an all die Reinigungsmittel, die sich in Ihrem eigenen Haushalt befinden. Spülmittel, Kalklöser, WC-Reiniger. Da kommt einiges zusammen. Dann die Heizöltanks der Leute im Garten. Das Benzin in den Autos. In Garagen wird Unkrautvernichter gelagert, Insektizide, Schmierstoffe. Und das wird jetzt alles mit der Flut unkontrolliert durch die Gegend gespült, kein Zuckerschlecken für die Umwelt, sage ich Ihnen. Deshalb sind wir hier, wir werden das in Grenzen halten.« Er klopfte Monika beruhigend auf die Schulter und empfahl dann dem jungen Soldaten, die Gespräche mit der Bevölkerung lieber den Offizieren zu überlassen.
Eigenartig. Monika wandte sich wieder ihrer Soljanka zu. Aber vielleicht wäre das ein neuer Ansatzpunkt für das Thema. Bislang wurde über die Oderflut ja eher reißerisch im Stile von Kriegsberichterstattern geschrieben. Welche Deiche mussten aufgegeben werden, wo gab es Siege im Kampf gegen das Wasser? Da wurden Mannschaftsstärken aufgelistet, das eingesetzte Material gezählt und die Anzahl der benötigten Sandsäcke. Zwischendurch die neuesten Pegelstände. Und immer wieder heroische Berichte über den größten zivilen Einsatz der Bundeswehr seit ihrem Bestehen. Die Folgen der Flut für die Umwelt dagegen wurden bislang noch nicht journalistisch aufgearbeitet. Das wäre mal was Neues, da könnte man ansetzen. »Mit dem Wasser kam das Gift« oder so ähnlich könnte der Artikel heißen. Nicht schlecht.
Monika zog ihr Handy aus der Hosentasche und schaltete es an, um die Redaktion in Berlin anzurufen. Es piepste mehrmals. Offenbar waren Nachrichten auf der Mailbox.
Dieter hatte gleich mehrmals draufgesprochen: Melanie sei mit einen Fahrradkurier zusammengestoßen. Der Kurier sei gestorben, aber Melanie gehe es den Umständen entsprechend gut. Zur Sicherheit habe man sie jetzt ins Krankenhaus gebracht …
Melanie! Unfall! Krankenhaus! Und ein Toter! Wahnsinn. Besorgt tippte Monika auf ihrem Handy herum. Die nächste Nachricht brachte Entwarnung. Das Mädel habe wohl nur einen Schock. Äußerlich gebe es keine Verletzungen.
Na, der war gut. Hastig gab Monika Dieters Nummer ein. Ohne Erfolg, denn sein Handy war abgeschaltet.
Mist!
Unruhig sprach sie ihm die Mailbox voll. Sie wolle versuchen, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen – und warum er sein Handy ausgemacht habe? Ihm sollte doch klar sein, dass sie ihn nach solchen Nachrichten zurückrufen will. – Blödmann!
»Halte mich auf dem Laufenden, okay? Ich komme so schnell wie möglich nach Berlin.« Sie schmatzte ihm einen Kuss auf die Mailbox und steckte das Telefon wieder ein.
Seufzend sah sie sich um. Wo war noch mal das Rote Kreuz?
3 IN DER NOTAUFNAHME des Auguste-Victoria-Krankenhauses herrscht das komplette Chaos. Hilflos versuchen mehrere Sanitäter und eine überforderte Polizistin, zwei betrunkene Kampfhähne auseinanderzubringen, die hier zwar ihre selbst beigebrachten Blessuren behandeln lassen wollen, aber nicht voneinander loskommen. Immer wieder versuchen sie, sich gegenseitig die ohnehin schon völlig demolierten Gesichter einzuschlagen, und decken sich dabei mit wüsten Beschimpfungen ein. Als das Gerangel überhandzunehmen droht, weil sich auch zwei ältere Herren mit Krücken in das Geschehen stürzen wollen, greife ich mit der Dienstpistole ein.
»Schluss jetzt! Wenn ihr Vollidioten euch nicht augenblicklich beruhigt, knallt’s!«
Meine Güte, ist Berlin ein hartes Pflaster geworden. Früher, in gemütlichen alten Vormauerfallzeiten, konnte man es sich als Kriminalbeamter noch leisten, unbewaffnet seine Fälle zu lösen. Heute muss man schon mit der Knarre drohen, wenn man nur seine Tochter in die Notaufnahme bringt.
Apropos Tochter? – Wo ist sie hin?
»Melanie?« Hektisch sehe ich mich um. »Melanie!« Sie ist weg! Das gibt’s doch nicht!
»Machen Sie sich keine Sorgen.« Eine Schwester kümmert sich um eine verletzte Kickboarderin. »Wir arbeiten hier nach dem Ar, ar, ar.«
»Ar, ar, ar«, wiederhole ich verständnislos und mache einem humpelnden Kleingärtner Platz, der sich mit einem Luftgewehr versehentlich in den Fuß geschossen hat, als er die Stare aus seinem Kirschbaum verjagen wollte. »Und was heißt das?«
»ESI.« Die Schwester spricht es englisch aus wie »Ih Es Ei«. »Eine Form der Triage nach dem Emergency Severity Index. Oder anders ausgedrückt«, sie lächelt mich an und rollt das R wie eine Amerikanerin: »Der richtige Patient zur rechten Zeit am richtigen Ort. Ar, ar, ar.«
Na prima. Und wo ist der richtige Ort für meine Tochter?
»Was für eine Verletzung hat sie denn?«
»Einen Schock«, antworte ich. »Das blutüberströmte Mädchen, das hier gerade eingeliefert wurde.«
»Stabil?«
»Das hoffe ich«, aber ich bin ja kein Arzt.
»Ich schau mal nach.« Die Schwester erhebt sich. »Wie war noch mal Ihr Name?
»Knoop«, antworte ich und zeige ihr meinen Dienstausweis, »Kriminalhauptkommissar Hans Dieter Knoop. Das Mädchen ist meine Tochter.«
»Melanie Knoop?«
»Melanie Droyßig«, verbessere ich. »Sie trägt den Nachnamen der Mutter.«
»Haben Sie eine Geburtsurkunde dabei?«
»Nee. Wieso?«
»Um zu belegen, dass es Ihre Tochter ist.« Die Schwester sieht mich vorwurfsvoll an. »Sonst könnte ja jeder kommen.«
»Schwester«, versuche ich ruhig zu bleiben, »ich bin zwar stolzer Vater, trage aber nicht täglich die Geburtsurkunden meiner Kinder mit mir herum. Sie müssen mir schon glauben.«
»Haben Sie wenigstens die Krankenversicherungskarte Ihrer Tochter dabei?«
»Nein. Auch nicht, leider.«
»Krankenversicherungskarten sind aber unerlässlich für eine kassenärztliche Behandlung.« Sie hebt genervt die Hände. »Es ist immer dasselbe! Ständig sagen wir den Patienten, dass sie ihre Karten bei sich tragen sollen. Immer! Zu jeder Zeit! Falls mal was passiert, Sie sehen ja. Wer soll denn sonst die Kosten tragen?« Die Schwester runzelt nachdenklich die Stirn. »Was machen wir denn jetzt?«
»Kann ich die Karte nicht nachreichen?«
»Na gut«, sagt sie schließlich ergeben. »Aber nur weil Sie bei der Kripo sind.«
»Danke.« Ich trete etwas beiseite, weil in einem Pulk aufgeregt durcheinanderschreiender und besorgter Menschen eine Trage hereingeschoben wird. Den Verletzten kann ich inmitten der Leute nicht sehen. Ihm wird geholfen werden, denke ich, denn ich weiß ja jetzt, dass sie hier nach dem Emergency Severity Index arbeiten. Wie im »Emergency Room« bei ProSieben. Helden der Notaufnahme. Doctor Ross, bitte kommen! Ar, Ar, Ar.
»Herr Knoop, bitte zur Anmeldung«, scheppert es kurz darauf aus den Lautsprechern, als wäre ich tatsächlich George Clooney: »Herr Knopp, bitte melden Sie sich umgehend bei der Anmeldung!«
Hat sich Melanies Zustand verschlechtert? Besorgt stürme ich durch Gänge an geschäftigen Ärzten und Krankentragen vorbei zum Glaskasten der Anmeldung. Dort wird mir ein Telefon entgegengehalten: »Herr Knoop? Dringender Anruf für Sie!«
Am anderen Ende der Leitung ist Hünerbein. Mein übergewichtiger Kollege von der Mordkommission.
»Du hast sie doch nicht mehr alle«, nölt er drauflos: »Wieso verlässte denn den Tatort, bevor die Spusi da ist?«
»Melanie wurde verletzt«, verteidige ich mich, denn es ist ja wohl ganz normal, dass ich mich zuerst um meine Tochter kümmere.
»Und warum machste dein Handy nicht an?«
»Weil man im Krankenhaus mobil nicht telefonieren darf«, erkläre ich ihm, »von wegen Funkwellen und so. Die stören die Instrumente. Wie im Flugzeug. – Und was heißt überhaupt Tatort?«
»Na, ein harmloser Unfall ist das hier nicht«, Hünerbein klingt ziemlich aufgeregt: »Oder was glaubst du, was den Fahrradkurier vom Drahtesel geholt hat?«
»Keine Ahnung.«
»Eine Patrone. Der Mann wurde mit einem gezielten Kopfschuss getötet. Und nun komm in die Puschen, wir brauchen dich hier.«
Was denn noch alles, denke ich genervt. Monika kämpft unerreichbar an der Oderflut, und Melanie liegt hier mit schwerem Schock, weil vor ihrer Haustür ein Fahrradkurier ermordet wurde. Erschossen am helllichten Tag, es ist echt nicht zu fassen!
»Ihre Tochter befindet sich im Schockraum.« Die Schwester ist zurück. »Wollen Sie sie sehen?«
»Natürlich. Und was bitte ist ein Schockraum?«
»Halb so wild«, die Schwester lächelt beruhigend, »da hat sie ihre Ruhe. Kommen Sie!« Sie läuft vor mir her den Gang hinunter und öffnet eine Tür. »Bitte!«
»Danke.« Ich trete in den Raum. Es ist sehr hell hier und alles weiß; die Wände, die Zimmerdecke, die Vorhänge an den Fenstern. Man fühlt sich wie in einer Schneelandschaft. Der einzige Farbfleck ist Melanies Gesicht. Es ruht mit friedlich geschlossenen Augen auf einem weißen, frisch gestärkten Kopfkissen in einem weiß bezogenen Bett. Daneben hängt in einem Ständer eine Flasche, aus der beständig Flüssigkeit in einen Plastikschlauch tropft. Er ist über eine Nadel mit dem Arm meines Kindes verbunden … Fragend sehe ich die Schwester an.
»Eine Injektion«, erklärt sie mir. »Damit stabilisieren wir den Kreislauf. Außerdem haben wir ihr ein Beruhigungsmittel gegeben. Schlaf ist die beste Medizin.«
Mein armer, kleiner Spatz. Melanie schläft wie ein Kleinkind, so zart und zerbrechlich. Liebevoll streiche ich ihr das dunkle Haar aus der Stirn.
»Wir werden sie die Nacht über zur Beobachtung hierbehalten.« Die Schwester drückt mir eine Plastiktüte mit Melanies blutverschmierten Kleidern in die Hand. »Wenn Sie sie morgen abholen, bringen Sie ihr bitte frische Wäsche mit.«
»Ja, natürlich.« Ich sehe bekümmert auf Melanie. Der Tropf macht mich nervös. So was kenne ich nur aus Filmen, und da haben das immer die ganz schwer Verletzten. Ich dagegen darf Melanie morgen abholen. Dann wird es wohl wirklich nicht so schlimm sein. Ich gebe ihr einen Kuss auf die Stirn und verabschiede mich: »Bis morgen, Spatz!«
4MITEINEMTAXI geht es zurück in die Belziger Straße. Inzwischen ist der gesamte Fußweg vor dem Haus abgesperrt und die Menschenmenge drum herum größer geworden. Auf Leitern, Klappstühlen und Bäumen drängeln sich die üblichen Freiberufler und versuchen, mit Fotoapparaten und Kameras ein paar Bilder zu machen. Sogenannte freie Fotoreporter, Paparazzi, die Tag und Nacht den Polizeifunk abhören in der Hoffnung auf eine Sensation, auf einen Unfall, ein Verbrechen. Und wenn irgendwo etwas passiert, fahren sie los, rasen, sämtliche Verkehrsregeln ignorierend, durch die Stadt und sind oft noch vor den Einsatzkräften vor Ort. Der Schnellste gewinnt. Die Konkurrenz schläft nicht, und nur wer als Erster ein spektakuläres Foto, eine erste sensationelle Filmaufnahme vom blutigen Geschehen an die Presse liefert, kann den Preis dafür bestimmen. Es ist ein harter, ein unbarmherziger und skrupelloser Job.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!