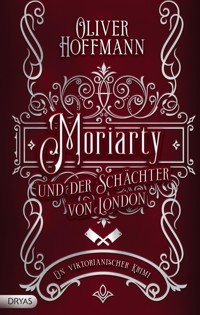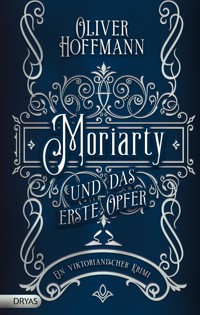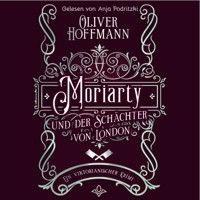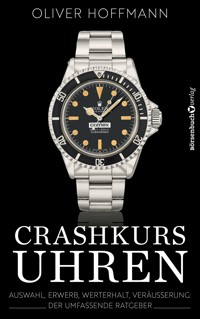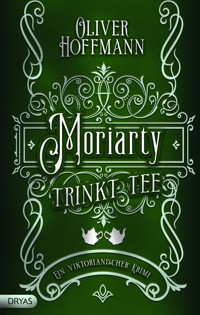
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Moriarty ermittelt
- Sprache: Deutsch
London 1895. Auf Bitten seiner früheren Nemesis Sherlock Holmes, mit dem ihn aktuell ein angespannter Waffenstillstand verbindet, wird Professor Moriarty erneut detektivisch tätig. Der Grund ist ebenso simpel wie bestürzend: Ein beruflicher Konkurrent Holmes' wurde überfallen und schwer verletzt, und Dr. Watson ist dringend tatverdächtig. Bei ihren Recherchen stoßen Moriarty und Molly Miller schon bald auf die Familie Cavendish-Smythe, Teemagnaten mit politischen Ambitionen und einigen dunklen Geheimnissen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oliver Hoffmann
Moriarty
trinkt Tee
Ein viktorianischer Krimi
Prolog
Kanpur, Indien, 25. Juni 1857
Brigadegeneral Hugh Wheeler, Oberbefehlshaber der britischen Garnison von Kanpur, trank einen Schluck von seinem nur noch lauwarmen Kaffee – er konnte trotz all der Jahre in Indien dem hier allgegenwärtigen Tee nichts abgewinnen – und warf einen Blick auf seine versammelten Offiziere. Dann wandte er sich an seinen Stellvertreter, Colonel Peter Wallace, der im Laufe der Ereignisse der zurückliegenden Wochen nicht nur seine rechte Hand, sondern so etwas wie ein Freund geworden war. Dabei versuchte er, sich seine Unsicherheit, ja Angst nicht anmerken zu lassen, da dies eindeutig ein falsches Signal an seine Männer gesendet hätte. »Und, was meinen Sie, Colonel?«, fragte er, so forsch er eben konnte. »Ist das wirklich der richtige Weg – Kapitulation?«
Während der baumlange Offizier mit dem schütteren Haar, ein Soldat von altem Schrot und Korn, der schon fast so lange in Uniform Dienst tat wie der Brigadegeneral selbst, noch überlegte, wie er die Frage beantworten sollte, meldete sich Lieutenant Colonel Swanson zu Wort. Der dürre junge Mann aus Cornwall war wie viele der jüngeren Offiziere erst vor wenigen Wochen als Verstärkung in der Garnison stationiert worden, zu einer Zeit also, als der Sepoy-Aufstand und die Gefahr, die er für das gesamte Empire darstellte, in der Heimat endlich Widerhall gefunden hatte. Obgleich er sich Mühe gab, die Offiziersrolle auszufüllen, war Swanson ein Mensch, dem es nach Wheelers Auffassung besser zu Gesicht gestanden hätte, daheim auf seinem Landsitz auszuharren, bis sich der Pulverdampf gelegt hatte. »Ich denke, wir sollten das Angebot der Aufständischen annehmen, Sir.«
Gemurmel erhob sich unter den versammelten Uniformierten, teils zustimmend, teils verhalten ablehnend. Neun weitere britische Offiziere waren neben Wheeler, Wallace und Swanson in der schwül-heißen Offiziersmesse versammelt. Ein Dutzend Männer, darunter nach Wheelers Einschätzung außer ihm nur fünf erfahrene Militärs, die eine Schlacht schon einmal aus erster Hand erlebt hatten, dazu drei Sesselfurzer und drei mehr oder minder wohlmeinende Grünschnäbel, die ihr Ehrgeiz oder der Einfluss ihrer Familien ausgerechnet in diesem schwülheißen Juni nach Kanpur geführt hatte – oder die schlicht das Pech hatten, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein.
Während die Offiziere untereinander mit zunehmend erhitzten Gemütern Swansons Einlassung diskutierten, dachte Brigadegeneral Wheeler an die turbulenten Tage und Wochen zurück, die hinter ihm lagen. Ein schwächerer Mann als Wheeler hätte sie als lebensbedrohlich apostrophiert, der schwer zu erschütternde Ire empfand sie eher als ereignisreich. Er diente seit seinem sechzehnten Lebensjahr bei den Truppen der Britischen Ostindien-Kompanie und zählte mittlerweile zu deren angesehensten Kommandooffizieren. Seit seinem Eintritt ins Militär hatte er fast ausschließlich in Indien gelebt, war seit mehreren Jahrzehnten mit einer Inderin verheiratet und mit den kulturellen Gepflogenheiten seiner Wahlheimat vertraut. Das unterschied ihn grundlegend von den zivilen Vertretern der Ostindien-Kompanie, die sich meist hauptsächlich durch ihre Verachtung für die indische Lebensweise auszeichneten.
Mit seinen nahezu siebzig Jahren hätte Wheeler längst den wohlverdienten Ruhestand genießen können, doch er liebte das Land seiner Gemahlin so sehr, dass eine Rückkehr nach Großbritannien für ihn niemals infrage gekommen war. Dasselbe galt für das Militärleben –Wheeler konnte sich eine zivile Existenz überhaupt nicht mehr vorstellen. Ausgerechnet in dieser Phase, wo seine nur wenige Jahre jüngere Frau und seine drei Töchter, allen voran die jüngste, Eliza, ihn zum Rückzug ins Private drängten und er sich ohnedies mit zahlreichen existenziellen Fragen herumschlug, hatten die indischen Sepoy ihre Meuterei angezettelt. So lautete zumindest die offizielle Bezeichnung der Generalität und der Politiker in der Heimat für das, was um sie herum geschah, doch Wheeler war genau wie viele Briten, die wie er Jahrzehnte auf dem indischen Subkontinent verbracht hatten, klar, dass es sich um viel mehr handelte, nämlich um eine nationale Revolte gegen die Kolonialmacht. Aber natürlich konnte das Empire, wenn es verharmlosend nur von einer Meuterei statt von einem regelrechten Volksaufstand sprach, leichter so tun, als sei in Indien alles in Ordnung und musste sich nicht in seinem Selbstverständnis vom integren Weltreich erschüttern lassen.
Doch es ging um nicht mehr und nicht weniger als einen Unabhängigkeitskrieg. Brigadegeneral Hugh Wheeler sah schlimme Zeiten auf das Empire zukommen.
Aktuell waren drei Armeen der Ostindien-Kompanie in Indien stationiert, eine in Bombay, eine in Madras und eine in Bengalen. Eine Viertelmillion Soldaten, von denen nur etwa vierzehntausend Europäer waren. Gleichzeitig waren allerdings verschiedene Regimenter der britischen Armee mit einer Mannstärke von etwas über dreißigtausend britischen Soldaten auf dem indischen Subkontinent stationiert. Die meisten von ihnen taten in der Region Punjab Dienst, die das Empire vor kurzem erobert hatte.
Die indischen Soldaten hatten schon mehrfach tatsächlich gemeutert, wenn Befehle ihrer britischen Offiziere dazu geführt hatten, dass sie gegen ihre religiösen Verpflichtungen hatten verstoßen müssen. Das erste Mal war es zu so etwas vor über fünfzig Jahren gekommen, als britische Offiziere indischen Soldaten das Anlegen einer Uniform befohlen hatten, bei der Teile aus Leder bestanden, obgleich das Tragen von Rindsleder für Hindus ein Sakrileg war. Außerdem hätten sie im Dienst auf das Tilaka verzichten sollen, jenen gemalten Stirnpunkt, den die Hindus als Segenszeichen genau zwischen den Augen über der Nasenwurzel trugen. Die Niederschlagung jener ersten Meuterei hatte über hundert britische Soldaten gekostet, rund dreihundertfünfzig indische Leben gefordert, und weitere neunzehn Meuterer hatte man nach der Niederschlagung des Aufstandes wegen Befehlsverweigerung hingerichtet.
Der Auslöser der aktuellen Krise, die sich von einer tatsächlichen Meuterei zu einem Flächenbrand ausgebreitet hatte, stand irrsinnigerweise ausgerechnet im Zusammenhang mit der Einführung einer neuen, modernen Waffe für die indischen Truppen, des Enfield-Gewehrs. Die mit Schwarzpulver gefüllten Papierpatronen dieses Vorderladers mussten zum Schutz gegen die hohe Luftfeuchtigkeit mit Fett imprägniert werden. Seit Januar gerüchtete sich durch die britisch-indischen Streitkräfte, das dafür verwendete Mittel sei eine Mischung aus Rindertalg und Schweineschmalz. Dies nun war ein schwerer Affront für Hindus wie Moslems, also Anhänger beider Religionen, denen die einheimischen Truppen des Subkontinents angehörten. Alle vertrauensbildenden Maßnahmen, mit denen die Kommandoebene versucht hatte, das Gerücht aus der Welt zu schaffen, waren ohne Wirkung geblieben, weil die befehlsverweigernden indischen Soldaten auch dem Schimmer der papiernen Patronenummantelung misstrauten, deren Glanz sie ebenfalls auf eine Behandlung mit Fett zurückführten.
Aufgrund dessen war es seit Januar in mehreren Garnisonen Ost- und Nordindiens zu Brandstiftungen in britischen Einrichtungen gekommen. Der erste Gewaltausbruch ereignete sich im März in Barrackpur: Ein Sepoy hatte zwei britische Offiziere angegriffen und schwer verletzt. Er wurde von einem Kriegsgericht zum Tod durch den Strang verurteilt.
Als im vergangenen Monat fast hundert Sepoys der Garnison in Merath eine Schießübung mit den inkriminierten Gewehren verweigert hatten, hatte der befehlshabende Offizier harsch reagiert: Wheelers Pendant hatte die Befehlsverweigerer zu zehn Jahren Zwangsarbeit verurteilt und öffentlich degradiert, indem er sie auf dem Paradefeld der Garnison in Anwesenheit aller dort Stationierten hatte antreten, ihrer Uniform entledigen und in Fußfesseln legen lassen. Die Reaktion war ein offener Aufstand, bei dem die Einheimischen über fünfzig europäische Militärs, Zivilbeamte, Frauen und Kinder massakriert und die Verurteilten befreit hatten.
Innerhalb weniger Tage hatte dieser Aufstand auf Delhi übergegriffen, wo der letzte Großmogul, der über achtzigjährige Bahadur Shah Zafar II., im sogenannten Roten Fort seinen Palast hatte. Beim Einmarsch eines britischen Regiments erschossen aufständische einheimische Kavalleristen vier britische Offiziere. Als die überlebenden Offiziere den ihnen unterstellten indischen Soldaten befahlen, das Feuer zu erwidern, schossen diese lediglich in die Luft und attackierten dann stattdessen ihre britischen Vorgesetzten. Der Großmogul persönlich stellte sich an die Spitze des Aufstands. Noch am selben Tag war Delhi vollständig in den Händen der Rebellen.
Von dort aus hatte sich der Aufstand auf weite Teile Nord- und Zentralindiens ausgebreitet, unter anderem auch auf Kanpur, wo Brigadegeneral Wheeler die britische Garnison befehligte. Er hatte als Kenner des Landes und seiner Bewohner die Woge des einheimischen Widerstandes kommen sehen und sich mit den britischen Militärs, Beamten und in der Stadt ansässigen Zivilpersonen schon vor Wochen, unmittelbar nach den Geschehnissen in Delhi, in der Garnison verschanzt. Kurz nachdem er die Tore hatte schließen lassen, hatte die Belagerung der Garnison durch die aufständischen Sepoy-Soldaten von Kanpur unter dem Oberbefehl Nana Sahibs, des Sohns eines Brahmanen vom Dekkan und Adoptivsohn des letzten Peshwa der Marathen, wie dieses Volk aus der Gegend um Goa seine Herrscher nannte. Als der Peshwa, ein Mann namens Baji Rao II., sechs Jahre zuvor gestorben war, hatte die Ostindien-Kompanie sich geweigert, Nana Sahib zu alimentieren, weil er zwar der rechtmäßige Erbe des verstorbenen Peshwas, aber eben nur adoptiert sei. Nana Sahib hatte sich empört an die britische Regierung gewandt, gar einen Botschafter nach London geschickt, aber bei den Knausern in Whitehall auf Granit gebissen. Es war zwar zu einem Prozess gekommen, aber die Anwälte der Krone hatten den jungen Mann, für sie nur ein brauner Emporkömmling aus einer Kolonie, finanziell nach Strich und Faden ausgezogen.
Mit den Resten seines Vermögens hatte er sich in seine Residenz Bithur ganz in der Nähe der Stadt Kanpur zurückgezogen und dort illegitim wie der Fürst gelebt, der er im Grunde war – und nun, über drei Jahre nach Prozessende, hatten seine Rachegelüste endlich ein Ventil gefunden. Er stand an der Spitze der Belagerungsarmee, die die Garnison eingekesselt hatte. Sein Jugendfreund und Adjutant Tantya Tope koordinierte die Truppen für ihn.
Anfangs waren in der Garnison knapp tausend Menschen versammelt gewesen – neben den knapp 300 britischen Soldaten etwa hundert Zivilisten, achtzig loyale Sepoys, vierhundert Frauen und Kinder sowie indisches Personal. Doch die Garnison lag seit Tagen praktisch von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang unter dem Artilleriebeschuss der Aufständischen, was sehr schnell zu hohen Verlusten geführt hatte. Die Gebäude waren nicht stabil genug, um diesem Dauerfeuer standzuhalten, und es gab nirgends ausreichend Schutz für die Belagerten. Wheeler warf sich insgeheim vor, zu wenig Wasser- und Nahrungsmittelvorräte eingelagert zu haben, denn seit dem gestrigen Tag wurde beides knapp. Außerdem waren die Beschädigungen der Gebäude inzwischen so massiv, dass die Eingeschlossenen der gnadenlosen indischen Sommersonne nahezu schutzlos ausgeliefert waren.
Eine Stimme riss Wheeler aus seinen Gedanken. Sie gehörte Lieutenant Colonel Daniel Cavendish-Smythe, dem jüngsten Neuzugang in der Offiziersriege der Garnison. Cavendish-Smythe war ein junger Grünschnabel, Erbe einer britischen Teehandels-Dynastie, der sich zur wahrlich ungünstigsten Zeit ein Offizierspatent gekauft hatte, um sich in den Kolonien einen Namen zu machen.
»Ich bringe die Verlustmeldungen, die Sie wollten, Sir.«
»Heraus damit«, sagte der Brigadegeneral müde.
»Etwa ein Drittel der Insassen der Garnison sind tot, Sir. Wir haben wie angeordnet die bestattet, für die Platz war. Darüber hinaus haben die Männer heute Nacht 350 Leichen in den trocken gefallenen Brunnenschacht geworfen.«
»Wie steht es um die Überlebenden?«
»Beklagenswert, Sir«, meldete Cavendish-Smythe mit so viel Schneidigkeit, wie er angesichts der Situation aufbringen konnte. »Die meisten von ihnen sind verletzt oder krank. Viele der Frauen und auch einige der Männer sind einem Nervenzusammenbruch nahe. Wir haben die Wasserrationierung verschärft und das Waschen ganz untersagt – was das für die hygienischen Verhältnisse in der Garnison bedeutet, muss ich ihnen nicht erklären.«
Der Brigadegeneral nickte. Er war einiges gewohnt, doch die Mischung aus Schweißausdünstungen und Leichengestank, die über der gesamten Anlage hing, machte auch ihm schwer zu schaffen. Fliegenschwärme surrten wie ein dichter schwarzer Teppich überall am sonnengleißenden Himmel.
Irgendwo schlug mit einem Pfeifen, dem rasch eine dumpfe Detonation folgte, ein Artilleriegeschoss ein, sodass der junge Offizier zunächst nicht weitersprechen konnte.
Als wieder Stille einkehrte, fuhr Cavendish-Smythe fort: »Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Sir, ich glaube, Swanson hat recht. Die Garnison ist nicht zu halten, zumal jetzt jeden Tag die Regenzeit einsetzen dürfte.«
Am gestrigen Abend war ein junger Sepoy unter weißer Parlamentärsflagge ans Tor der Garnison gekommen und hatte einen Brief an Brigadegeneral Wheeler überbracht, von Nana Sahib eigenhändig in fließendem Englisch und geübter, schwungvoller Handschrift verfasst. Er bot dem Brigadegeneral freien Abzug mit allen in der Garnison befindlichen britischen Militärs und Zivilpersonen an, wenn er kapitulierte.
Brigadegeneral Hugh Wheeler gab sich einen Ruck. Er ließ Colonel Peter Wallace eine Parlamentärsflagge geben, und diesem gelang es tatsächlich, mit einem Unterhändler Nana Sahibs bessere Bedingungen für den Abzug der Briten auszumachen. Die Überlebenden sollten sich zum Gangeshafen Sati Chowra begeben, wo der Rebellenführer Boote für ihren Abzug den Fluss hinunter nach Allahabad bereitstellen wollte. Für den Weg dorthin offerierte Nana Sahib für Kinder, Frauen und Verletzte Karren und Elefanten. Er bestand nicht einmal auf einer Entwaffnung der britischen Militärs.
Am nächsten Tag, am 26. Juni 1857, gab Brigadegeneral Hugh Wheeler in den frühen Morgenstunden den Befehl zum Abmarsch. Die Briten räumten die Garnison in Kanpur. Wheeler selbst, seine Familie und seine Offiziere führten den Zug an, gefolgt von den Soldaten und Zivilisten unter seinem Befehl.
»Nimm meine Hand, Eliza, und trag den Kopf schön hoch«, hörte Wheeler seine Frau zu seiner ältesten Tochter sagen. »Wir dürfen sie nicht sehen lassen, dass wir Angst haben. Das ist wie bei der Begegnung mit einem Tiger.« Wheeler lächelte grimmig in sich hinein und blickte selbst stur geradeaus. Seine Frau hatte recht – es tat selten gut, andere sehen zu lassen, was man fühlte. Er selbst hielt mit eisernen Zügeln seine Angst im Zaum.
Die Nachhut bildeten Lieutenant Colonel Daniel Cavendish-Smythe, sein treuer Offiziersbursche, den er aus England mitgebracht hatte und der auf den prosaischen Namen Thomas Smith hörte, und eine Handvoll Infanteristen, der traurige Rest von einem ganzen Regiment. »Bald ist es vorbei, Tom«, sagte Cavendish-Smythe halblaut zu seinem treuen Burschen, als sie die zerschossenen Tore der Garnison hinter sich ließen und Richtung Fluss marschierten.
Der Zug erreichte ohne Zwischenfälle die Anlegestelle am Ganges.
Während die Briten die Boote bestiegen, eröffneten die am Ufer aufmarschierten indischen Truppen das Feuer.
Kapitel 1
London, 10. März 1895
Der Winter hatte London immer noch fest in seinen kalten Krallen, und an dem Tag, als mein zweites großes Abenteuer mit dem Professor (und, wie sich später herausstellen sollte, mit dem größten Detektiv der Welt) begann, bedeckten Eisblumen von innen die Fensterscheiben meines Zimmers. Es war ein nebliger Sonntagmorgen, und ich lag gemütlich eingemummelt in meinem Bett, als die dröhnenden Glocken der katholischen St Patrick’s Church die Gläubigen zur vierten morgendlichen Messfeier riefen. An diesem Morgen schickte der Mann, der ein knappes Jahr zuvor mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hatte und von dem ich Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, auf den folgenden Seiten dieses bescheidenen Pamphlets Neues zu berichten gedenke, wieder einmal nach mir.
Ja, mir ist natürlich vollkommen klar, wie das klingt und was Sie jetzt denken müssen, von mir und von dem Verhältnis zwischen mir und ihm. Aber weit gefehlt – ich bin keineswegs auch nur annähernd so etwas wie die Mätresse dieses Mannes, wie die feinen Herren der gehobenen Londoner Gesellschaft ihre Flittchen auf Abruf gern euphemistisch nennen.
Euphemistisch, ja, genau! Auch so ein Wort, das erst zu meinem aktiven Sprachschatz zählt, seit ich mit dem Professor Umgang pflege. Aber ich tue es schon wieder – ich greife vor, nicht wahr? Ehe ich Sie mit diesem Bericht über meine Abenteuer an der Seite des James Moriarty, ehemaliger ordentlicher Professor für Mathematik an der Universität London und nun Privatgelehrter, überfalle, scheint es nur geziemend, mich Ihnen vorzustellen. Das ist nicht mehr und nicht weniger als ein Gebot der Höflichkeit – so sagt man doch, oder?
Also dann: Mein Name ist Molly Miller, und geboren bin ich im Jahre des Herrn 1878 in London in einem Elternhaus, das man wohl mit Fug und Recht als zerrüttet bezeichnen darf. Mein Vater hieß William und war ein einfacher Fleischhauer auf dem Smithfield Market, meine Mutter war Näherin. Ich habe eine zehn Jahre ältere Schwester namens Mary, und mein Vater hätte meiner Mutter bestimmt noch viele kleine irisch-katholische Bälger gemacht, hätte er sie nicht leider eines Tages volltrunken die Treppe hinuntergeprügelt. Er ist dann einfach zur Arbeit gegangen und hat es mir überlassen, Hilfe für meine Mutter zu suchen. Da war ich sechs Jahre alt. Zwei Tage danach ist sie trotz der Bemühungen der dortigen Ärzte im Armenspital in der Kingsland Road ihren inneren Verletzungen erlegen.
Ein paar Monate später ist Mary dann ins Kloster gegangen und hat die Gelübde abgelegt, weil unser Vater ihr aus Ermangelung einer Ehefrau an die Wäsche wollte – ein Mann hat eben Bedürfnisse. Ich dagegen habe es noch fast sieben Jahre unter demselben Dach mit ihm ausgehalten, habe versucht, so wenig wie möglich zu Hause zu sein, wenn er es war, erst heimzukommen und einzuschlafen, wenn er volltrunken ins Bett gefallen war und mich davonzustehlen, ehe er aus seinem Stupor wieder aufwachte.
Als ich dreizehn war, hat mein Vater dann das erste Mal versucht, mir Gewalt anzutun. Tja, ich sage mal so: Es ist bei dem einen Mal geblieben. Nicht, weil er zur Vernunft gekommen wäre, nein – danach bin ich von zu Hause weggelaufen und habe mich auf mich allein gestellt auf den Straßen Londons durchgeschlagen, während er sich von der Prellung in seinen Kronjuwelen erholt hat. In den Jahren darauf gab es in meinem Leben viele Höhen und Tiefen, das können Sie mir glauben, aber letztere haben überwogen.
Zumindest bis ich letztes Jahr aus beruflichen Gründen – ein mir gut bekannter indischer Hehler hatte mich angeheuert, ein bestimmtes kostbares Schreibgerät für ihn zu entwenden, das er weiter zu veräußern gedachte – in die Stadtvilla eines älteren Herrn, des Mathematikprofessors James Moriarty, einstieg. Das besagte Haus steht in der Dunraven Street im Londoner Distrikt Mayfair, einem noblen Viertel im Londoner West End am östlichen Rand des Hyde Parks, und man muss gut situiert sein, um sich ein Leben dort leisten zu können.
Nun, der Professor ertappte mich auf frischer Tat und stellte mich zur Rede, eins kam zum anderen, und am Ende half ich ihm und seinem kuriosen »Hofstaat«, wie er in sanftem Spott über die von mir nicht uneingeschränkt geteilte britische Begeisterung für unsere Monarchie die kleine Gruppe von Bediensteten und andern helfenden Händen und Köpfen nennt, mit denen er sich umgibt, Ende Mai letzten Jahres einem Serienmörder das Handwerk zu legen, einem Anwalt namens Nelson Fairchild. Der hatte versucht, die braven weißen angelsächsischen Londoner gegen unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger anderen Glaubens oder anderer religiöser Vorlieben aufzubringen. Der Professor hatte ihn mit ein wenig Schützenhilfe des selbsternannten »größten Detektivs der Welt« zur Strecke gebracht. Er tat das auf eine sehr … endgültige Weise, mit der sicher der eine oder die andere von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, nicht einverstanden gewesen wäre, aber die Vorstellung von Selbstjustiz passte sehr gut zu des Professors sehr klarer, von Grautönen ungetrübter Weltsicht. Die Revolverblätter hatten Fairchild posthum ebenso vollmundig wie blutrünstig den Beinamen »Der Schächter von London« gegeben.
Doch ich schweife ab – das war zum Zeitpunkt der Ereignisse, die ich zu schildern gedenke, auch schon wieder eine ganze Weile her. Kehren wir zurück zu den Ereignissen Anfang März.
Die Geschichte, die ich Ihnen zu erzählen beabsichtige, beginnt an jenem bereits erwähnten kalten, nebligen Sonntagmorgen (wobei man, wie Sie im Laufe Ihrer Lektüre feststellen werden, auch mit Fug und Recht behaupten könnte, dass sie Dekaden zuvor beginnt). Ich hatte mich noch nicht an die laut läutenden Glocken von St Patrick’s drüben an der Green Bank gewöhnt, obwohl ich mittlerweile ein gutes dreiviertel Jahr in unmittelbarer Nähe der Kirche wohnte, und folgte deren Ruf nicht, sondern drehte mich noch einmal um und zog mir das weiche Federbett, das ich mir aufgrund der großzügigen Zuwendung der Krone in Gestalt von Mycroft Holmes hatte leisten können, über die Ohren. Doch ein erholsamer Schlaf wollte sich kein weiteres Mal einstellen, und so erhob ich mich und tappte im grauen Morgenlicht hinüber zu meiner Kommode, wo ein Waschlavoir stand. Ich hatte gerade den schlichten Porzellankrug ergriffen, um an der Pumpe auf dem Hof Wasser für meine Morgentoilette zu holen, da hämmerte es an der Tür.
»Falsche Tür!«, rief ich mit der für mich um diese nachtschlafende Tageszeit leider typischen Kombination aus Morgenmuffeligkeit und Restmüdigkeit. Ich ging davon aus, dass dort draußen der unsympathische, übereifrige Eintreiber stand, der im Namen des Inhabers des Hauses die am Ultimo jedes Monats für den nächsten fällige Miete kassieren wollte. »Ich habe die Miete für diesen Monat pünktlich bezahlt, Mr Haynes, wie immer, und ansonsten gibt es keinerlei Grund, mich um diese unchristliche Morgenstunde zu stören, also gehen Sie weg!«
Als es erneut hämmerte, noch drängender diesmal, seufzte ich auf und sah irritiert zur Tür. Alte, instinktive Vorsicht, erlernt in Jahren auf der Straße, übernahm mein Handeln, und ich bewegte mich in Richtung des Stuhls, der am Fußende meines Bettes stand, und legte mir eine gehäkelte Wollstola um, um gegen die Kälte des Morgens besser gewappnet zu sein und der Person, die mich da so unbedingt aufzusuchen gedachte, weniger unbekleidet entgegenzutreten. Aus der Schublade des Tisches, der mir in Dreifachfunktion als Ess-, Arbeits- und Schreibtisch diente, schnappte ich mir einen ziemlich spitzen Brieföffner, nahm all meinen Mut zusammen und riss die Tür auf.
Zu meiner Überraschung stand dort Wiggins, ein schlaksiger Junge, der ein paar Jährchen jünger war als ich und außerdem der Anführer einer Gruppe von Londoner Straßenjungen, der sogenannten Baker-Street-Spezialeinheit. Bill »Billy« Wiggins war so etwas wie der Sprecher und aufgrund seines Alters auch der Kommandant dieser zusammengewürfelten Gruppierung minderjähriger Straßenbettler. Kinder und Jugendliche wie sie gab es in der britischen Hauptstadt, in der die Armut in den unteren Schichten ebenso grassierte wie der Snobismus in den oberen, in jenen Jahren zuhauf. Sie kauerten oft tagein, tagaus mit traurigen, rotz- und rußverschmierten Gesichtern an Straßenecken, abgeschabte Mützen umgekehrt vor sich und auf die eine oder andere Münze von Passanten hoffend. Andere, kühnere gingen die Sache anders an: Sie bettelten die betucht aussehenden Londoner Bürgerinnen und Bürger, die auf den geschäftigen Straßen der Hauptstadt unterwegs waren, aggressiv und mit frechen Sprüchen an, und die allerkecksten unter ihnen hielten sich mit Taschendiebstählen über Wasser. Das Besondere an Wiggins und seinen mit allen Wassern der Welt ungewaschenen Gefolgsleuten – ich vermutete übrigens, dass er gar nicht wirklich so hieß, sondern dass es sich dabei um eine Art Straßennamen handelte, weil er seinen echten hütete und geheim halten wollte – war, dass sie schon vor vier Jahren Sherlock Holmes kennengelernt hatten, der sie sehr zum Missvergnügen seines Freundes und Chronisten Dr. Watson als eine Art inoffizielle Hilfstruppe rekrutiert hatte. Er setzte die Burschen ein, wenn es darum ging, sich tiefer in den Schmutz der Stadt zu wühlen, als dies die beiden vornehmen Verbrecherjäger mit eigenen Händen tun wollten, oder an einen Ort vorzudringen, wo die beiden auffallen würden wie die bunten Hunde, ein paar dreckige Straßenbengel aber gewissermaßen mit dem Hintergrund verschmolzen. Da der große Detektiv jedoch eine ganze Weile gar nicht in der Stadt gewesen war und sich auch jetzt nur sporadisch in London aufhielt, hatte Professor Moriarty die Baker-Street-Spezialeinheit quasi geerbt, setzte sie aber nur selten ein. Ich hatte manchmal den Verdacht, dass ich für ihn in gewisser Weise so etwas war wie diese Jungen für Holmes.
»Kann ich reinkommen?«, fragte er mit einer seltsam kindlich klingenden, quengeligen Stimme, die nicht zu seinem schlaksigen Äußeren passen wollte. Der Professor hatte mir einmal erzählt, Holmes habe zu ihm gesagt, Wiggins habe bei seiner ersten Begegnung mit ihm im Zusammenhang mit der Untersuchung eines Doppelmordes kurz vor dem zwölften Geburtstag gestanden. Demnach musste er meiner Rechnung nach inzwischen vierzehn sein. Er befand sich mitten im Stimmbruch und sprach manchmal wacklig kieksend wie ein Bursche, dem sich die neue, männliche Stimme noch nicht recht fügen wollte. Dazu passte auch seine ungelenke, an eine Marionette gemahnende Art, sich zu bewegen – er war sich seines sich verändernden Körpers alles andere als sicher. Obgleich er seit unserer ersten (und letzten) Begegnung deutlich gewachsen war, war Wiggins nach wie vor von unscheinbarer Gestalt und mit seinen schlechten Zähnen, dem schmutzigen Gesicht und den Aknenarben eher unappetitlich anzusehen.
Wortlos öffnete ich dem Straßenjungen die Tür. »Was gibt es?«, erkundigte ich mich kühl, aber nicht unfreundlich, als er nach dem Eintreten kein Wort sagte, sondern nur seine Mütze an die schmutzige Hemdbrust presste und sich neugierig umsah.
Wiggins zog einen Lappen aus der Tasche des viel zu großen Jacketts, das er trug, und wischet sich damit die Hände ab – ein angesichts des Zustandes sowohl des Lappens als auch seiner Hände fruchtloses Unterfangen. »Der Herr Professor schickt mich«, antwortete er halblaut.
»Was du nicht sagst «, meinte ich höhnisch. Er roch schlecht, und ich wollte Wiggins so schnell wie möglich wieder aus meinem bescheidenen Heim komplimentieren – von dieser Art von Gerüchen hatte ich bis an mein Lebensende genug. »Das dachte ich mir schon ... warum sonst sollst du hier auftauchen? «
»Klar hast du dir das gedacht. Bist wohl auch schon eine halbe Detektivin geworden«, höhnte er.
»Sei nicht so frech! Was will Professor Moriarty von mir?«
»Er lässt fragen, ob du Lust und Zeit für ein Sonntagsfrühstück mit ihm im Hyde Park hast. Er hätte was mit dir zu besprechen, lässt er ausrichten.«
»Natürlich habe ich Zeit. Wann denn?«
»Wenn du ja sagst, sollst du dir eine Mietdroschke nehmen und so schnell wie möglich aufbrechen – das war die Anweisung, die er mir aufgetragen hat.«
»Tja, dann lass mich mal bitte allein, damit ich rasch meine Morgentoilette erledigen kann.«
»Hast wohl ein Buch mit schönen, schweren Worten auswendig gelernt, um den feinen Herrn Professor zu beeindrucken«, grinste Wiggins mit höhnischem Unterton und hielt eine rußverschmierte Hand auf.
»Ist das dein Ernst?«, fragte ich, und meine pikierte Stimme ließ ihn sofort erkennen, dass ich ihn durchschaut hatte (und dass er von mir kein Geld bekommen würde). Instinktiv wich er fast ängstlich einen Schritt zurück wie jemand, der in seinem Leben einmal zu oft geschlagen worden ist. »Wir wissen doch beide, dass du von Professor Moriarty für diesen Botengang bereits in vollem Umfang entlohnt worden bist. Ebenso wissen wir beide, dass der Professor sich stets großzügig zeigt, wenn man ihm auf diese Weise zur Hand geht. Also schaff dich zurück auf die Straße und versuch hier nicht, mich abzuzocken. Du vergisst wohl, dass ich vor gar nicht allzu langer Zeit in derselben Lebenslage war wie du, Billy?«
Sofort änderte sich Wiggins’ gesamtes Gebaren; er warf mir aus seinen blauen Augen einen großen Blick zu, der zum Steinerweichen war. »Ja, tut mir leid, Molly. Alte Gewohnheiten und so, du weißt ja.«
»Ja, ich weiß«, antwortete ich mit versöhnlichem Grinsen und deutete auf die Tür. »Jetzt hau ab, ich muss mich für mein Treffen mit dem Professor fertig machen.«
Ohne ein weiteres Wort ließ mich der Straßenjunge allein.
***
Eine Dreiviertelstunde später setzte mich eine Mietdroschke am nordwestlichen Rand des Parks ab. Der riesige Hyde Park zählte zu den größten Stadtparks der Welt. Moriarty, von dessen Wohnung er nur einen Steinwurf entfernt war, weswegen der Professor auch praktisch jeden Tag hier spazieren ging, um seinen Gedanken freien Lauf zu lassen, hatte mir im letzten Herbst, als ich ihn einmal auf einem dieser täglichen, ausgedehnten Spaziergänge begleitet hatte, erzählt, er bedecke eine Fläche von über hundertvierzig Hektar, und hier stünden weit über viertausend Bäume. Auch ich liebte den Park mit seinem großen See und den prachtvollen Blumengärten, doch lagen die dortigen Cafés ein wenig über meinem Budget.
Das galt auch und besonders für The Lodge, ein Kaffeehaus, das in einem weiß getünchten neoklassizistischen Gebäude mit Säulenportikus untergebracht war. The Lodge war Professor Moriartys Stammcafé; er nahm seinen Nachmittagstee beinahe ebenso häufig hier ein wie in seinen eigenen Räumlichkeiten in der Dunraven Street, lag es doch zu Fuß nur eine Viertelstunde entfernt – weniger, wenn man sich im strammen Schritt des Professors fortbewegte. In wärmeren Monaten konnte man auf der Terrasse den Ausblick auf den Park und den Marble Arch zu seinen Sandwiches und dem leckeren Gebäck als Begleitung zum obligatorischen Tee genießen, doch dafür war es aktuell noch zu kalt. Der Professor erwartete mich an einem niedrigen Tisch in der Nähe des Kamins, um den gepolsterte Sessel standen und auf dem ein üppiges Frühstück für zwei Personen aufgetragen war. Er stand hinter dem Sessel, auf dem er offensichtlich demnächst Platz zu nehmen gedachte, einen Ellbogen auf den Kaminsims gestützt, auf dem bereits eine Tasse Tee dampfte, mit der er wohl die Wartezeit überbrückt hatte, und sah mir erwartungsvoll entgegen.
Professor Moriarty war hager, von seinem Haupthaar war nur ein grau melierter schwarzer Kranz übrig. Mächtige, buschige Augenbrauen unter einer riesig vorgewölbten Stirn dominierten sein Gesicht, die Augen selbst waren so dunkelbraun, dass sie fast schwarz wirkten, lagen tief in den Höhlen und waren eher klein. Der Professor trug einen altmodischen, aber teuren dreiteiligen Anzug aus schwarzem Stoff. Die Weste unter seinem Rock hatte ein Schalrevers, was in Großbritannien zum letzten Mal vor zehn Jahren in Mode gewesen war. Zu diesem in die Jahre gekommenen, aber sorgsam gepflegten Aufzug kombinierte er ein weißes Hemd samt Vorbinder, und auf seiner Weste blitzte wie immer eine Kette, die das Vorhandensein seines geliebten, kostbaren Taschenchronometers im Uhrentäschchen des graugestreiften Kleidungsstücks signalisierte.
»Hey, Professor!«, begrüßte ich ihn und steuerte den Sessel gegenüber dem an, hinter dem er stand. »Was verschafft mir die Ehre dieser Einladung?«
»Warten Sie, Molly, ich helfe Ihnen aus dem Mantel. Sie sollten doch wissen, dass mir als Gentleman gar nichts anderes übrig bleibt, wo doch beklagenswerterweise Toby nicht da ist, um diesen Dienst zu verrichten«, erwiderte er. Schalk blitzte bei dieser Bemerkung in den tief liegenden, dunklen Mäuseaugen auf. Toby war Tobias Oliver, des Professors treuer Butler und Kammerdiener in einer Person.
Ich ließ mir also aus dem Mantel helfen, ein Kellner zog meinen Sessel zurück, ich nahm in gezierter, für mich eher untypischer Weise Platz und wartete, bis der Cafébedienstete dem Professor und mir – beziehungsweise natürlich mir und dem Professor, Ladies first – wohlriechenden, goldbraunen Tee eingegossen hatte. Kaum hatte sich der ältere Mann wieder von unserem Tisch entfernt, wiederholte ich gespannt: »Was liegt an? Sie hätten es nicht so dringend gemacht und diesen schmuddeligen Wiggins den ganzen Weg zu mir zu Fuß zurücklegen lassen, wenn dies einfach nur eine gesellschaftliche Einladung zu einem gemeinsamen späten Frühstück wäre. Oh, und danke, dass ich mir einen Wagen nehmen durfte – das war sehr aufmerksam von Ihnen.«
»Gern geschehen und vollkommen korrekt beobachtet«, antwortete der Professor und nippte an seinem Tee. Ich hatte schon häufig mit ihm dieses Getränk konsumiert und wusste, dass er ein echter Connaisseur war, auch wenn er als erstes am Morgen und manchmal auch spät in der Nacht, wenn Ermittlungsarbeiten wichtiger waren als seine persönliche Müdigkeit, gelegentlich auch Kaffee trank. »Ich möchte mit Ihnen über ein kleines Problem sprechen, das möglicherweise eine neuerliche gemeinsame Ermittlung erfordert. Da war es ja wohl das Mindeste, dass ich Ihnen einen Wagen spendiere, um den Weg hierher so rasch und so angenehm wie möglich zu gestalten.«
»Eine Ermittlung!«, rief ich entzückt. Ich hatte ungeheure Freude daran gehabt, mit ihm gemeinsam unseren Scharfsinn mit dem des Schächters von London zu messen, auch wenn ich dabei zwischendurch selbst in Gefahr geraten war.
Der Professor zeigte sich weniger begeistert – es war einfach nicht seine Art, seine Gefühle offen zur Schau zu tragen. Da war er ganz Brite der alten Schule.
»Brauchen Sie wieder Informationen aus Kreisen, in denen ich mich besser bewegen kann als Sie?«, erkundigte ich mich begierig. »Erzählen Sie schon und spannen Sie mich nicht länger auf die Folter!«
»Nun, ich habe Ihre Hilfe, Ihre Beiträge und Ihren scharfen Verstand letztes Jahr bei den Ermittlungen gegen Fairchild insgesamt sehr genossen«, entgegnete er. »Und ich bedauere es noch immer zutiefst, dass Sie kurz vor der Lösung des Falles von diesem Schurken entführt wurden, nur weil er mir drohen wollte.« Die Stimme des Professors war grabestief, viel volltönender, als es seine schmale, knorrige Erscheinung vermuten ließ, wirkte aber auch immer ein wenig versnobt und angestaubt. Er erhob sich und ging ein paar Schritte zum Kamin, wo seine mir ebenfalls bereits bekannte lederne Aktenmappe lehnte. Ihr entnahmen die langen, spinnendünnen Finger des Professors einen großen, cremefarbenen Briefumschlag, den er mir reichte, ehe er wieder Platz nahm und sich ein weiteres Spiegelei und etwas gebratenen Speck von der Silberplatte mit der Cloche nahm, die der Kellner auf einem Teewagen neben unserem niedrigen Tisch abgestellt hatte. Ich spürte, dass der Blick des gebildeten Mannes mir gegenüber auf mir ruhte – die Prüfung hatte begonnen, nun war es an mir, mich würdig zu erweisen, an seiner Seite ermittlerisch tätig zu werden.
Wie immer in schwierigen Situationen wurde ich vollkommen ruhig. Ich begann mit der Examination des Umschlags. Ein schneller Blick verriet mir, dass er in eleganter, schwungvoller Handschrift, die fast schon an Kalligrafie erinnerte, an den Professor adressiert war. Am oberen Rand hatte er das Kuvert sorgfältig mit einem Brieföffner aufgeschlitzt, wie es seine Art war. Ich hielt den Umschlag ans Licht und erkannte das eingeprägte Siegel des Schatzamtes, und prompt war mir klar, wer hier schrieb, auch wenn unüblicherweise auf der Rückseite des Kuverts entlang des oberen Randes kein Absender vermerkt war. Ich war mir recht sicher, dass ich schon zwei Begegnungen mit dem Absender dieses Briefes hinter mir hatte – Mycroft Holmes, der ältere Bruder des großen Detektivs, der offiziell leitender Beamter im Schatzamt der britischen Krone war, inoffiziell aber, wie ich seit dem vergangenen Jahr wusste, damit betraut war, komplexe Kriminalfälle, die das gesamte Empire betrafen, diskret zu untersuchen. Er und seine Abteilung für besondere Aufgaben, die von der Krone mit einem großzügigen Budget ausgestattet war und nicht viele Fragen von offizieller Seite beantworten musste, solange sie sich erfolgreich zeigte, hatten früher häufig seinen Bruder konsultiert und zur Unterstützung herangezogen und im vergangenen Jahr in Ermangelung dessen auf den Professor und seine unbestechliche Intelligenz zurückgegriffen. So war auch ich ins Blickfeld des älteren Holmes-Bruders geraten.
Professor Moriarty entnahm der Innentasche seines Rocks einen weiteren Brief in einem deutlich kleineren Kuvert und hielt ihn mir hin. »Der Umschlag, den ich Ihnen zuerst gegeben habe, enthielt zwei Dinge«, erläuterte er. »Eine Visitenkarte von Mycroft Holmes, auf deren Rückseite handschriftlich die Worte ›Vielen Dank‹ notiert waren, und diesen zweiten Umschlag.«
Ich nahm das zweite Kuvert entgegen, auf das jemand mit flüchtigen, kaum leserlichen Schriftzeichen »Bitte an Prof. M. weiterleiten« notiert hatte. Dann drehte ich es in der ausgestreckten Hand, konnte allerdings außer der Tatsache, dass es ebenfalls geöffnet worden war – offenbar hatte der Professor den Inhalt bereits zur Kenntnis genommen – und dass es weder einen Absender trug noch frankiert war, nichts Auffälliges daran feststellen. Ich hielt es einen Augenblick in Händen und versuchte, mich zu erinnern, wo ich diese charakteristische, krakelige, aber doch ausdrucksstarke Schrift, die wirkte wie in höchster Eile hingeworfen, schon einmal gesehen hatte. Dann fiel es mir jäh ein. Ich hatte diese Schriftzeichen auf einem anderen an meinen Gönner gerichteten Brief gesehen.
»Der ist von Holmes«, stellte ich erstaunt fest.
»Das trifft auf beide Briefe zu«, antwortete der Professor leicht amüsiert. »Das große Kuvert wurde mir heute Morgen per persönlichem Boten vom Schatzamt zugestellt. Kommentarlos, wie Sie sehen. Zweifellos auf Veranlassung Mycrofts. Der innere Brief hingegen stammt von Sherlock, der es wohl nicht über sich gebracht hat, sich direkt um Hilfe an mich zu wenden. Deshalb hat er seinen Bruder als Mittelsmann benutzt.« Ein selbstzufriedenes Lächeln huschte über sein blasses, makellos rasiertes Gesicht.
Ich musste daran denken, in welchem traurigen, heruntergekommenen Zustand der selbst ernannte größte Detektiv der Welt gewesen war, als wir ihn ein knappes Jahr zuvor in seinem Versteck an der Kanalküste aufgespürt hatten. Er hatte ausgesehen wie jemand, den die Sucht schleichend aufzehrt und der zwischen Selbstaufgabe und verzweifeltem Lebenswillen pendelt – ausgelaugt und doch von einer Art manischem Betätigungsdrang erfüllt. Als ich ihn kurz vor Weihnachten auf der London Bridge wiedergesehen hatte, hatte er etwas stabiler gewirkt, aber bei weitem nicht wie ein gesunder Mann im Vollbesitz seiner geistigen und körperlichen Kräfte.
Mit dem Fingernagel meines rechten Zeigefingers fuhr ich gedankenverloren den aufgeschlitzten oberen Rand des zweiten Briefes nach und fragte dann: »Darf ich ihn lesen?«
Des Professors selbstgefälliges Lächeln verschwand, war wie weggewischt. »Oh, ich bitte darum. Das ist schließlich der Grund Ihres Hierseins«, antwortete er.
Ich sah mich im Café um. Um diese Jahreszeit war der Park noch nicht besonders gut besucht, schon gar nicht am Vormittag. Ohne selbst zu wissen warum, hatte ich instinktiv Angst, beobachtet zu werden, wenn ich einen Brief las, der wichtig genug war, dass der Professor mich hatte hierherholen lassen. Ich zog das eine Blatt Papier aus dem Kuvert, aus dem das Schreiben bestand, hielt es zwischen spitzen Fingern und las die mit einer billigen schwarzen Tinte hingeworfenen Zeilen in der schwer leserlichen Handschrift Sherlock Holmes’:
Verehrter Professor,
ich bräuchte Ihre Hilfe. Dieser unfähige Trottel Baxter hat den guten alten Watson wegen eines Tötungsdeliktes eingebuchtet. Wie ich aus zurückliegenden Gesprächen mit Ihnen weiß, liegen wir beide in unseren Einschätzungen ähnlich, was den Chief Inspector und seine ermittlerischen Fähigkeiten angeht.
Ich bin sicher, der gute John würde niemals einen Mord begehen – das ist einfach nicht seine Art. Bitte hauen Sie ihn da raus. Vielleicht können Sie sich ja wieder der Unterstützung der entzückenden jungen Dame versichern, in deren Begleitung Sie im vergangenen Frühsommer die Reise zu mir an den Kanal angetreten haben.
Mein Bruder wird dafür sorgen, dass Ihre Bemühungen angemessen vergolten werden.
Ich bedanke mich herzlich und verbleibe in tiefer Verbundenheit der Ihre,
S.
Nachdenklich richtete ich den Blick zum Fenster hinaus, wo der eisige Märzwind die kahlen, schwarzen, von Efeu überwucherten Baumgerippe sich unwirklich im Londoner Winternebel wiegen ließ. Dann schaute ich den Professor an.
»Dr. Watson soll ein Mörder sein?«, fragte ich ungläubig.
»Ja. Vollkommen absurd.«