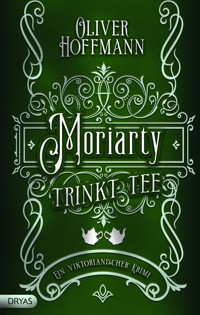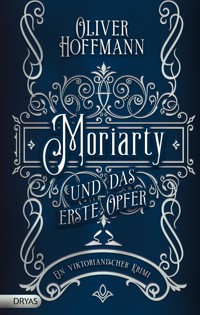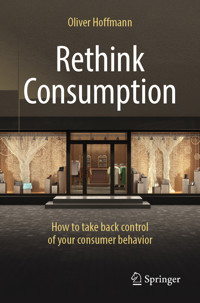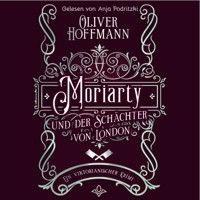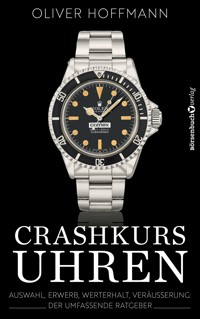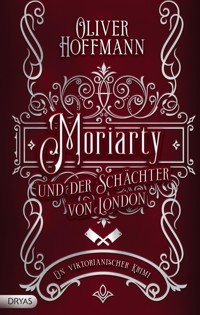
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Dryas Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Moriarty ermittelt
- Sprache: Deutsch
London, 1894. Eine Serie bizarrer Morde an prominenten Mitgliedern der Gesellschaft stürzt die Stadt in Angst. Der Täter tötet seine Opfer auf eine Weise, die auf religiöse Bräuche der nicht christlichen Einwohner der Themse-Metropole hindeuten. James Moriarty, Professor für Mathematik am renommierten King's College, muss wider Willen eine Allianz mit seiner Nemesis, einem kokainsüchtigen, selbsternannten Meisterdetektiv namens Holmes, eingehen, um dem Serienmörder das Handwerk zu legen. Denn hinter den Hassverbrechen steckt ein noch viel perfiderer Plan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Oliver Hoffmann
Moriarty
und der Schächtervon London
Ein viktorianischer Krimi
Inhalt
Prolog
Kapitel 1 London, 4. Mai 1894
Kapitel 2 London, 4. Mai 1894
Kapitel 3 London, 4. Mai 1894
Kapitel 4 London, 4. Mai 1894
Interludium 1: Dunkelmänner Beechwood House, 10. März 1894
Kapitel 5 London, 4./5. Mai 1894
Kapitel 6 London, 5. Mai 1894
Kapitel 7 London, 5. Mai 1894
Kapitel 8 London, 5. Mai 1894
Kapitel 9 London, 6. Mai 1894
Kapitel 10 London, 6. Mai 1894
Kapitel 11 London, 6. Mai 1894
Interludium 2: Debakel London, 9. Dezember 1886
Kapitel 12 London, 7. Mai 1894
Kapitel 13 London, 7. Mai 1894
Interludium 3: Opferlamm London, 5. Mai 1894
Kapitel 14 London, 8. Mai 1894
Kapitel 15 London, 8. Mai 1894
Kapitel 16 London, 9. Mai 1894
Kapitel 17 London, 11. Mai 1894
Kapitel 18 London, 12. Mai 1894
Kapitel 19 London, 12. Mai 1894
Kapitel 20 London, 13. Mai 1894
Epilog 1 London, 9. Dezember 1894
Epilog 2 London, 23. Dezember 1894
Danksagung
Der hagere, irischstämmige Mathematiker hatte das Schweizer Dorf Meiringen im Berner Oberland am 3. Mai des Jahres 1891 erreicht. Er war im Englischen Hof abgestiegen, dem besten Haus am Platze, und gedachte, dort in der Abgeschiedenheit des Haslitals Abstand zu gewinnen von den verworrenen Geschehnissen im »Old Smoke« und vor allem zu seiner Nemesis, dem bleichen Irren mit dem Deerstalker. Der Wirt, ein Mann namens Peter Steiler der Ältere, war ein verständiger Bursche, der auch vortrefflich Englisch sprach. Auf seinen Rat hin brach der Mathematikprofessor bereits am Tage darauf zu einer Wanderung auf, um über die Höhen die kleine Ortschaft Rosenlaui zu besuchen. Dort beabsichtigte er im gleichnamigen Hotel zu übernachten, ehe er am nächsten Tag nach Meiringen zurückkehren wollte. Der Wirt hatte seinem Gast strengstens eingeschärft, hierbei den erforderlichen kleinen Umweg nicht zu scheuen, um die auf halber Höhe liegenden Fälle zu besichtigen. Dabei handelte es sich um eine 300 Meter hohe Kaskade von sieben Wasserfällen im Verlauf des Reichenbachs.
Der irische Professor beherzigte seinen Rat. Von Meiringen brauchte er zügig ausschreitend und auf seinen knotigen Wanderstab aus englischer Eiche gestützt etwas über eine Stunde. Beim Erreichen des Rychenbachfalls, wie die Einheimischen ihn nannten, stellte er alsbald fest, dass dieser zusammen mit seiner Umgebung einen wirklich grauenerregenden Eindruck auf ihn machte. Der Reichenbach war durch die schmelzenden Schneemassen geschwellt. Er stürzte in einen furchtbaren Abgrund, aus dem weißer Schaum emporwirbelte wie der Rauch aus einem brennenden Hause. Die ungeheuerliche, von glänzenden, kohlschwarzen Felsen umsäumte Kluft, in die die Wasser hinabrauschten, verengte sich schließlich zu einem brodelnden Kessel von gänzlich unberechenbarer Tiefe. Über dessen gezackten Rand schoss der Strom dann weiter zu Tale. Dem irischen Professor wurde schwindelig von dem unablässigen Donnergetöse der riesigen weißen Wassersäule und von der ewigen Wirbelbewegung der aufspritzenden, flackernden Gischt, die sich gleich einem dichten Vorhang aus der Tiefe emporhob. Ganz außen am Rande stehend sah er den tosenden Wassern zu, wie sie sich in sprühendem Glanze tief unten an den schwarzen Felsen brachen, lauschte den Tönen, die einem menschlichen Jubellaut vergleichbar mit der aufspritzenden Gischt aus der Schlucht heraufschallten.
Auf der einen Seite war um den Fall herum ein schmaler Pfad gehauen, um eine vollständige Besichtigung des Naturschauspieles zu ermöglichen. Der irische Professor schlug ihn ein, doch der Steig endete plötzlich, sodass er umkehren und auf demselben Wege zurückgehen musste. In dem Augenblick, in dem er sich umwandte, erblickte er ein gutes Stück vor sich den Schattenriss einer hochgewachsenen Gestalt. Sie schaute ihm entgegen und versperrte den Weg. Der Mann da vor ihm war auf einen Alpenstock gestützt, einen langen Holzpfahl mit eiserner Spitze, wie ihn die Hirten in den Alpen seit dem Mittelalter für die Überquerung von Schneefeldern und Gletschern verwendeten. Auf dem hageren Kopf trug er die unverkennbare karierte Jagdmütze des selbst ernannten größten Detektives der Welt. Dem Professor war augenblicklich klar, dass sein albtraumhafter Schatten ihn selbst hier, in dieser abgelegenen Felsschlucht in den Schweizer Bergen, gefunden hatte. Er musste wenige Minuten nach des irischen Professors Weggang aus Meiringen denselben Bergsteig eingeschlagen haben wie er. Die schwarze Gestalt hob sich deutlich von dem Grün der Bäume hinter ihr ab.
Des irischen Mathematikers ehemaliger Schüler stand einen Augenblick lang ganz und gar reglos unter einer überhängenden Felsnase. Von deren Moosbewuchs troff Spritzwasser der Fälle auf seine Mütze. Dann lehnte er gemächlich seinen Alpenstock an die Felswand.
»So endet es denn, Professor«, rief er und kam seinem einstigen Lehrer in so eiligem Laufe, wie es der schmale Bergsteig eben zuließ, entgegen. Ein Ausdruck des Erstaunens überflog des irischen Professors Züge. Beim Blick in die Augen seiner Nemesis legte sich eine eiskalte Hand um sein Herz.
»Soll ich also wirklich ausgerechnet hier, auf einem gottverlassenen Bergpfad in den Schweizer Alpen, von Ihrer Hand sterben, Holmes?«, fragte er. Dabei zog er die Schusswaffe aus der Tasche, ohne die er seit einem Angriff des auf ihn Losstürmenden daheim in London nirgends mehr hinging. »Hätten Sie nicht wenigstens den Anstand besitzen können zu warten, bis ich wieder daheim in England bin?«
»Nein, keinen Tag mehr konnte ich warten!«, rief sein Angreifer emphatisch aus. »Jetzt habe ich Sie – Sie sitzen in der Falle! Nirgends geht’s zurück für Sie! Ha! Hier und heute findet der Napoleon des Verbrechens sein Ende. Ich werde Sie …«
Doch der irische Professor ließ den jüngeren Mann seinen Satz nicht beenden. Er riss die rechte Hand hoch, um zu schießen. Doch am Ende brachte er es nicht über sich und floh bebend vor Angst weiter auf dem Wege, der sich schmal, trügerisch, nass und glitschig vom Spritzwasser am Felsen entlangdrückte. So sehr er sich aber auch anstrengte, sein jüngerer und offenbar deutlich trainierterer, in einen Tweed-Paletot gekleideter Verfolger holte auf. Vor ihm schäumte bedrohlich der Wasserfall.
Die Flucht des irischen Professors nahm ein abruptes Ende, als der Körper seines einstigen Schülers von hinten gegen ihn prallte. Sein Angreifer war hager, fast asketisch und doch mit sehniger Muskulatur ausgestattet. Beide Männer verloren augenblicklich den Halt und stürzten taumelnd in die gischtschäumende Wut der Reichenbachfälle. Umweht von ihren nassen Paletots rasten sie dem herabschäumenden Weißwasser entgegen wie zwei riesige, groteske Fledermäuse, zum Fliegen zu schwer, der Schwerkraft anheimgefallen, dem Tode geweiht. Einen grausigen, zweistimmigen Schrei riss der eisige Wind von den Lippen der so ungleichen und einander doch so ähnlichen Männer. Dann schlug das Wasser der Fälle über ihnen zusammen, sie sanken, sanken, sanken, unerbittlich ineinander verkeilt, verkrallt, wütend mit den Füßen tretend. Lungen füllten sich mit eiskaltem, schäumendem Wasser. Dann war es vorbei.
Sherlock Holmes’ Alpenstock lehnte weit oben an dem Felsen, an dem dieser ihn zuvor abgestellt hatte. Aber von den beiden verfeindeten Wanderern war nirgends eine Spur. Kurze Zeit darauf und doch viel zu spät traf dann der getreue Doktor ebendort ein, der Sancho Pansa zum Don Quixote des selbst ernannten Meisterdetektivs. Kaltes Grauen packte ihn. Er schrie entsetzt nach seinem Freund. Doch des Doktors Rufen blieb vergeblich; nur von den Felswänden ringsum tönte in hundertfältigem Widerhall der Klang seiner eigenen Stimme zurück.
Old Smoke.
So hat meine Mutter das Kronjuwel des Empires immer genannt, weil man in vielen Stadtteilen Londons auch tagsüber die Hand nicht vor Augen sieht, so verrußt ist die Luft vom Auswurf der vielen improvisierten Herde und Öfen, in denen Dung, Dreck und Abfall verbrannt wird. Ständig ist es feucht, und wenn der Himmel über der Stadt nicht von Regenwolken verdunkelt ist, aus denen ständiger Niesel fällt, dann legen sich von der Themse her Nebelschwaden über die alten, grauen Häuser Londons. Es riecht nach kokelndem Unrat, nach ungewaschenen Leibern, nach sauer eingelegtem Kohl, nach Krankheit und Armut.
Sicher, in den gehobenen Stadtvierteln, in denen der Mann, von dem ich Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, auf den folgenden Seiten dieses bescheidenen Pamphlets zu berichten gedenke, ein- und ausgeht, bekam man davon nicht zu viel mit, aber in den Gedärmen der Stadt, in ihren Eingeweiden, im fauligen, stinkenden Gekröse der Themsemetropole, wo ich und meinesgleichen unser Dasein fristen, da spürt man dieses übelriechende Halbdunkel bei Tag am eigenen Leibe, und bei Nacht weicht es einer im wahrsten Wortsinne lebensbedrohlichen Finsternis.
Da, wo ich herkomme, in den Vierteln, wo ich mich bewege, in Whitechapel und Brixton, Tower Hamlets, Limehouse und Shoreditch, da wohnt nicht nur das Laster, da sitzen auch die Klingen locker. Nacht für Nacht wechselt Hehlerware den Besitzer, werden böse Taten besprochen, gibt es Streit und Händel – und ja, jede Nacht gibt es Tote in den Vierteln, die ich mein Zuhause nenne. Jede Nacht fordert dort ihren Blutzoll. Das ist so, es handelt sich um eine unumstößliche Tatsache des Lebens, und jeder weiß es, und doch kann ich mich einfach nicht daran gewöhnen. Ich habe im Laufe meines noch jungen Lebens viel gesehen, und die unappetitlichen Details möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, gerne ersparen, doch nach wie vor trifft mich der Anblick von Toten tief, und selbst der Gedanke an den Tod schmerzt mich jedes Mal aufs Neue in der Seele.
Aber ich greife vor. Ich habe mich Ihnen ja noch gar nicht richtig vorgestellt!
Nun ja, auch wenn ich wohl nie so genau erfahren werde, welche feinen Damen und welche Gentlemen sich die Ehre geben, meine Zeilen zu lesen, dürfen Sie zumindest meinen Namen gern wissen. Das ist nicht mehr und nicht weniger als ein Gebot der Höflichkeit, oder wie das heißt.
Ich bin Molly Miller, und geboren bin ich im Jahre des Herrn – so sagt man doch, nicht wahr? – 1878 in jener großen Stadt an der Themse, die ich auch heute noch mein Zuhause nenne und mit der mich eine glühende Hassliebe verbindet. London.
Dort stand mein Elternhaus, das ich mit Fug und Recht als zerrüttet bezeichnen darf. Nicht, dass es im Wortsinne meinen Eltern gehört hätte – wir wohnten zur Miete, wie alle in unserem Viertel, in unserem Fall zu viert in einem Zimmer, was gerade für eine irische Familie geradezu luxuriös geräumig war. Mit schöner Regelmäßigkeit durften am Monatsende Wetten abgeschlossen werden, ob dieses Mal genug Geld da sein würde, um die gierige Handfläche des Mieteintreibers zu schmieren, der jeden letzten Donnerstag im Monat pünktlich wie die Uhr vor unserer Tür erschien, um für den Besitzer der Mietskaserne abzukassieren.
Mein Vater Bartholomew Miller war Fleischhauer auf dem Smithfield Market, meine Mutter Tanya, eine geborene O’Brien, war Näherin. Beide gläubige Katholiken, auf ihre Weise. Ich habe eine Schwester namens Mary. Meine Eltern haben uns auf die Schule geschickt und uns eingebläut, wir müssten es mal weiter bringen als sie. Na ja. Jedenfalls hab ich da lesen gelernt, meine große Leidenschaft, nein, meine kleine Flucht. Schon mit sieben, acht habe ich alles gelesen, was mir in die Finger kam. Alte Zeitungen, die ich auf der Straße fand, Groschenhefte und bald eben auch schon Dickens. Ich hab früh kapiert, was Bücher in Wirklichkeit sind: Notausgänge für ’n kluges Kind, das ansonsten nicht raus kann aus seiner engen, dreckigen, fiesen Welt.
Tja, mein Vater hätte meiner Mutter bestimmt noch viele kleine irisch-katholische Bälger gemacht, hätte er sie nicht eines Tages volltrunken die Treppe hinuntergeprügelt. Er ist dann zur Arbeit gegangen und hat es mir überlassen, Hilfe für sie zu suchen. Da war ich sechs Jahre alt.
Zwei Tage danach ist sie im Armenspital in der Kingsland Road ihren inneren Verletzungen erlegen.
Ein paar Monate später ist Mary ins Kloster gegangen und hat die Gelübde abgelegt, weil unser Vater ihr aus Ermangelung einer Ehefrau an die Wäsche wollte. Ich habe es noch fast sieben Jahre unter demselben Dach mit ihm ausgehalten, habe versucht, so wenig wie möglich zu Hause zu sein, wenn er es war, heimzukommen und einzuschlafen, wenn er volltrunken ins Bett gefallen war, und mich davonzustehlen, ehe er aus seinem Stupor wieder aufwachte.
Als ich dreizehn war, hat er das erste Mal versucht, mir Gewalt anzutun. Es ist bei dem einen Mal geblieben.
Danach bin ich von zu Hause weggelaufen und habe mich auf den Straßen Londons durchgeschlagen. Ich will Sie, werte Leserinnen und Leser, nicht mit den Details meines unappetitlichen Lebens langweilen, will Ihnen Mundraub und Arbeitshaus, das Leben auf der Straße und die großen und kleinen Grobheiten des sogenannten starken Geschlechts, die man offenbar auszuhalten hat, wenn man als Mädchen allein zurechtkommen muss, ersparen. Schließlich dienen diese Zeilen dazu, von meiner Begegnung mit einem überaus außergewöhnlichen Mann zu erzählen und von dem Wirbelwind von Ereignissen, den ich an seiner Seite erlebt habe. Deshalb mag es genügen, wenn ich sage, es gab viele Höhen und Tiefen, aber die Tiefen haben überwogen.
Andererseits sind die tiefsten Tiefen schon eine ganze Weile her.
Die Geschichte, die ich Ihnen zu erzählen beabsichtige, beginnt ziemlich genau drei Jahre, nachdem ich meinem Elternhaus endgültig den Rücken gekehrt hatte. In jener Zeit lebte ich ganz gut von kleineren und größeren Einbruchdiebstählen in den reicheren Vierteln der Stadt wie Mayfair, Westminster und Kensington. Mein Quartier war ein Verschlag im Hof eines Wirtshauses in Whitechapel, in dem einstmals wohl ein Wagen oder eine Kutsche untergestellt gewesen war, der dem Koch aber heute als Vorratslager diente. Für ein paar kleine Münzen im Monat ließ er mich hier nächtigen, und die Stricher und Huren, die Kartenhaie und Hehler der Gegend versorgten mich gegen erschwingliche Beteiligungen mit Tipps, wo es sich einzusteigen lohnte. Ab und an stieg ich für Letztere auch gezielt in Herrenhäuser und Villen ein und besorgte bestimmte Beutestücke – Geld bar auf die Hand und keine Fragen.
Um Zuneigungsbezeugungen der unerwünschten Art, von Kniffen in den Hintern über geraubte Küsse und Tatschereien bis hin zu dem, wovor wohl jedes Mädchen und jede Frau in London am meisten Angst hatte, zu entgehen, nannte ich mich seit einigen Monaten Tom, trug enganliegende Männerkleidung und umwickelte jeden Morgen meine ohnedies nicht üppige Oberweite mit mehreren Schichten Leinenverbänden. Das presste meine Brüste – die im Vergleich zu dem, was die Freudenmädchen aus den Hurenhäusern der Umgebung in ihren weit ausgeschnittenen Korsagen zur Schau trugen, geradezu nicht der Rede wert waren – eng an meinen Körper. Überdies war ich immer schon gut darin gewesen, Gangart, Bewegung und Sprechweise anderer zu imitieren, und so hatte ich mir die Persönlichkeit eines ziemlich kleinen, schlanken, aber wendigen Straßenjungen zugelegt.
In der Nacht Anfang Mai 1894, die mein Leben für immer verändern sollte (auch wenn ich das zu Beginn jenes Abends noch in keinster Weise ahnte), huschte ich wendig und lautlos über die Dächer der Dunraven Street im Londoner Distrikt Mayfair, einem Viertel im Londoner West End am östlichen Rand des Hyde Parks. Hier, zwischen Oxford Street, Regent Street, Piccadilly und Park Lane, lebten wohlhabende, gebildete und kultivierte Londoner unter sich. Kurzum, Mayfair war eines der teuersten Pflaster der Hauptstadt. Der Nachtwind zauste meine roten Locken, doch ich ließ mich nicht beirren. Dunraven Street 1, das Eckhaus zur Park Lane, das laut den Auskünften des Hehlers, in dessen Auftrag ich unterwegs war, irgendein Schnösel mit mehr Bildung und Geld, als ihm guttat, bewohnte, war mein Ziel.
Wie immer trug ich bei der Arbeit enganliegende, lederne Männerkleidung. Meine schlanken, muskulösen Beine trugen mich raschen Schrittes über die Bohlen der Flachdächer. Manchmal, wenn unten eine Fußstreife vorbeikam, verbarg ich mich im Schatten eines der zahllosen Kamine. Schließlich setzte ich mit einem kühnen Sprung über eine Lücke zwischen zwei Wohnhäusern und prallte hart auf dem Dach des Gebäudes auf, das mein Ziel war. Sofort rollte ich mich ab, blieb flach auf dem Bauch liegen und robbte in Richtung des kugelförmigen Oberlichts. Es war erfreulicherweise offen. Mächtig und Ehrfurcht gebietend ragte das Messingrohr eines Teleskops daraus himmelwärts, dessen beträchtliche Ausmaße zeigten, dass es sich dabei nicht um das Spielzeug eines Hobbysternguckers handelte, sondern um das Arbeitsgerät eines Mannes, der sich professionell mit dem Himmel und seinen Gestirnen befasste.
Hier war ich richtig.
Ich löste von meinem breiten, derben, braunen Rindsledergürtel ein dünnes, aber stabiles Hanfseil, an dessen Ende eine dreifingrige Wurfkralle befestigt war. Meine zarten, aber kräftigen Hände befestigten die Stahlspitzen der Wurfkralle fest an einem Dachbalken, und ich machte mich daran, meinen schmalen, sehnigen Körper an der Hausmauer entlang abzuseilen. Mein eigentliches Ziel lag hinter einem Fenster im ersten Obergeschoss, doch dann sah ich, dass aus einem Fenster drunten im Parterre für diese späte Stunde noch sehr helles Licht auf die Straße fiel. Meine Neugier, die, wie das Sprichwort so schön besagte, schon so manche Katze getötet hatte, gewann die Oberhand. Mit einem nachdenklichen Blick nach oben seilte ich mich nach kurzem Zögern geschickt Hand über Hand weiter ab.
Schon bald hing ich kopfunter wie eine in Leder gekleidete Spinne an die Backsteinmauer geschmiegt über dem betreffenden Fenster und spähte vorsichtig nach drinnen. Eine aus meiner Sicht überaus ungewöhnliche Ansammlung von Personen war um einen Esstisch versammelt und debattierte lebhaft.
Als außergewöhnlich empfand ich, wie ich da auf meinem Beobachtungsposten an der Wand hing, nicht nur, dass die Personen, wie an ihrer Kleidung unschwer zu erkennen war, offensichtlich unterschiedlichen gesellschaftlichen Standes waren. Unter ihnen saß auch noch eine Hausangestellte mit Köchinnenschürze, die einen recht dunklen Teint und rabenschwarz glänzendes Haar hatte, sich aber lebhaft an dem Gespräch der vier Herren um sie herum beteiligte.
Einer davon war der größte Mann, den ich je gesehen hatte, ein Riese in Kutscherlivree mit pechschwarzer Haut. Sein breitflächiges, nicht mehr ganz junges Gesicht mit den wulstigen Lippen zierte ein komplexes Geflecht von Narben, die offensichtlich bewusst herbeigeführt waren und ein seltsames Punktemuster von ineinander verschlungenen Spiralen über seine gesamten Wangen bildeten.
Der zweite männliche Teilnehmer dieser obskuren Tafelrunde war hoch aufgeschossen, hatte eine Stirnglatze, ein langes Gesicht mit eingefallenen Wangenknochen, graues Haar und ebensolche Augen und trug eine Butler-Livree.
Das Fußende des Tisches nahm ein Mann mittleren Alters mit wettergegerbten Zügen und mehr Falten, als er aufgrund seiner Jahre hätte haben müssen, ein. Er trug einen dreiteiligen braunen Anzug mit Fischgrätmuster, darunter ein weißes Vatermörder-Hemd mit einem schwarzen Binder, hatte das braune Haar sorgfältig gescheitelt und den braunen Vollbart ebenso sorgfältig gestutzt. Sein Blick war stechend, und das Fehlen einer Uhrkette auf der Weste des Mannes verriet meinem Blick, dass dieser Mann einen kultivierteren und distinguierteren Anschein erwecken wollte, als den Tatsachen seiner Lebensumstände entsprach.
Vielleicht am bemerkenswertesten aber war der Mann am Kopfende des Tisches, der vor einer Schiefertafel saß, die eher in den Klassenraum einer höheren Knabenschule gepasst hätte als in ein solch hochherrschaftliches Speisezimmer. Bei ihm musste es sich um den Hausherrn handeln – den Mann, den zu bestehlen ich im Begriff war. Er war hager, hatte nur noch einen grau melierten, schwarzen Haarkranz, mächtige Augenbrauen unter einer riesig vorgewölbten Stirn und trug einen altmodischen, aber teuren dreiteiligen Anzug aus schwarzem Stoff. Die Weste unter seinem Rock hatte ein Schalrevers, wie es sicher vor zehn Jahren einmal Mode in der Hauptstadt des britischen Empires gewesen war. Auch er kombinierte zu seiner in die Jahre gekommenen, aber sorgsam gepflegten Kleidung ein weißes Hemd und Vorbinder, doch im Gegensatz zu seinem Gegenüber blitzte auf seiner Weste eine Kette, die meinem kundigen Blick das Vorhandensein eines teuren Taschenchronometers im Uhrentäschchen seiner Weste signalisierte. Das Fenster war gekippt, und deshalb drangen zumindest Teile des Gesprächs der fünfköpfigen Tafelrunde klar nach draußen.
»Wenn morgen früh in der Times die Meldung von diesem Geschehen erscheint, so wird sich die Berichterstattung auf die dürren Fakten beschränken und sich nicht in den merkwürdigen Randerscheinungen dieses Tötungsdeliktes suhlen, wie es die jüngeren Reporter bedauerlicherweise zu tun pflegen«, sagte der hagere Mann gerade. »Zumindest habe ich in einem persönlichen Gespräch mit dem Leiter der Redaktion für Lokales darum gebeten. Sonst überschlagen sich die Wirrköpfe und Verschwörungsgläubigen dieser Stadt wieder darin, Briefe an den Herausgeber zu schreiben und irgendwelche absurden Theorien zum Tathergang zu schildern, die selbstverständlich ausschließlich ihrer überregen Fantasie entspringen.«
»Sind Sie denn am Tatort einem Reporter begegnet, Professor?«, fragte der nach Militär aussehende Mann mit dem kurz gestutzten braunen Vollbart.
»Ja, als ich gerade im Weggehen begriffen war, tauchte so ein Jungspund auf und begann, den beiden Ermittlern von Scotland Yard überaus aufdringliche Fragen zu stellen.«
Der Bärtige spitzte interessiert die Ohren. »Hat dieser Reporter seinen Namen genannt?«
»Ja, aber ich habe nicht so genau hingehört«, gestand der Hagere, den sein Gegenüber Professor genannt hatte und von dem ich inzwischen mehr als sicher war, dass es sich um den Hausherrn handelte. »Warten Sie, Colonel … der Name lautete Reginald soundso … Nopper, kann das sein?«
»Napier«, verbesserte der Bärtige und verzog angewidert das Gesicht. »Das ist ganz schlecht.«
»Oh, warum?«
»Weil dieser Napier ein richtiger Sensationsjournalist ist. Keine Ahnung, wie ein Mann wie er es überhaupt in die Redaktion der Times geschafft hat. Auf jeden Fall kann man sich bei ihm ganz und gar nicht darauf verlassen, dass er irgendwelche Diskretionszusagen einhält.«
Der Hagere seufzte tief. Dann sagte er: »Nun denn, bis der Bericht dieses Mr Napier erscheint, wüsste ich gern mehr über unsere Leiche, als in diesem überaus obskuren Bericht steht.« Er tippte mit langen, dünnen Spinnenfingern auf einen schmalen, hellbraunen Aktendeckel, der vor ihm auf dem Esstisch lag.
Bei dem Wort »Leiche« erschrak ich so, dass ich beinahe mein Seil losgelassen und den Halt verloren hätte. In letzter Sekunde und mit einem schmerzhaften Ruck an dem an meinem Gürtel befestigten Seil gelang es mir, mich abzufangen.
»Aber ich bin nicht bereit, mich dabei auf die fragwürdige Expertise dieses Pathologen von Scotland Yard, dieses Dr. Roberts, zu verlassen«, sagte der Hagere, der offenbar noch immer ein wenig verstimmt über die Informationen dieses Colonels über den Times-Journalisten war. »Wir brauchen eine zweite Meinung, und ich weiß auch schon ganz genau, wen wir danach fragen werden.«
Ich beschloss, nicht abzuwarten, bis ich erfuhr, was er vorhatte. Alle Bewohner des Hauses hatten sich offenbar zu so was wie einem Kriegsrat getroffen, und dies bot mir die ideale Gelegenheit, meinen Raubzug zu vollenden und unbemerkt wieder in der Nacht zu verschwinden. Ich hangelte mich Hand über Hand so lautlos wie möglich wieder ein Stockwerk höher und schwang mich aufs Sims des Fensters im ersten Obergeschoss, hinter dem mein Ziel lag: das Arbeitszimmer des Hausherrn. Dort kauernd zog ich vorsichtshalber das dunkelgrüne Tuch hoch, das ich um den Hals trug und das bei den seltenen Anlässen, wo ich Molly und als junge Frau in den Straßen Londons unterwegs war, so schön mit meinem kupferroten Haar kontrastierte. In dieser Nacht diente es dazu, im Falle einer zufälligen Begegnung mit einem Augenzeugen meine Züge zusätzlich unkenntlich zu machen.
Als ich mich gerade daran machen wollte, den Zustand des Fensters vor mir zu untersuchen, öffnete sich um die Ecke die Hintertür des Anwesens, was sich mir dadurch erschloss, dass Licht in den Hof fiel. Vorsichtig schob ich mich auf dem im ersten Obergeschoss auf voller Länge das Haus umlaufenden Sims bis zur Ecke vor. Ich hörte drunten im Erdgeschoss im Inneren des Gebäudes die schneidende, leicht nasale Stimme des Hausherrn einen Befehl bellen, den ich leider nicht verstand, dann trat der schwarze Hüne ins Freie und machte sich auf den Weg zu Anbauten im rückwärtigen Bereich des Hofs, bei denen es sich vermutlich um Stallungen und eine Remise handelte. Wenn ich die vergoldete, mit Diamanten besetzte Feder aus der Federschale vom Schreibtisch des Hausherrn stehlen wollte, musste ich mich beeilen, denn der Kriegsrat war offenbar beendet.
Ich legte die Hände an das mit einem Schieberahmen gefasste Fenster und stellte zu meiner Freude fest, dass es nicht verriegelt war. Ohne viel Federlesens schob ich es nach oben und duckte mich, sobald die entstandene Öffnung hoch genug war, nach drinnen. Dabei hatte ich nicht bedacht, dass das Fenstersims innen nur aus einem schmalen, weiß lackierten Holzbrett bestand. Mein Fuß rutschte ab, und ich plumpste unsanft und leider auch recht geräuschvoll auf einen kostbaren orientalischen Teppich.
Zwar gelang es mir, einen Aufschrei, gemischt aus Schmerz und Überraschung, zu unterdrücken, doch hörte ich prompt Schritte auf der Treppe. Wie immer in solchen Situationen analysierte mein Gehirn blitzschnell die Lage. Wenn ich Glück hatte, handelte es sich um die vermutlich indische Haushälterin, wenn ich Pech hatte, um den Hausherrn selbst oder gar den vollbärtigen Ex-Militär. Ich hatte zwar Glück im Unglück, und das schwarze Gebirge hatte das Haus verlassen, aber eines stand mit unumstößlicher Klarheit fest: Diese Mission war gescheitert. Jetzt galt es, Leib und Leben zu retten. Ich sprang auf und rannte wie ein geölter Blitz zur Zimmertür, bereit, auf die Belohnung für diesen Raubzug zu pfeifen, wenn ich nur heil aus diesem Haus herauskam.
Das zweite, was mir einen Strich durch die Rechnung machte, war die wahrlich außergewöhnliche Größe dieses Arbeitszimmers. Obwohl ich nach dem Hochrappeln aus Leibeskräften sprintete, hatte ich gerade die Hand nach der Klinke ausgestreckt, als die Tür mit Schwung von außen geöffnet wurde und mir gegen die gespreizten Finger der rechten Hand prallte. Erneut unterdrückte ich einen Schmerzensschrei und taumelte zwei, drei Schritte zurück.
Umrahmt von den Gaslaternen des Treppenhauses stand da die hagere Silhouette des Hausherrn, der mich um höchstens eine Handbreit überragte.
»Was in drei Teufels Namen …«, fing er an.
Weiter kam er nicht.
Den Schmerz in meinen Fingern ignorierend hatte ich den linken Arm angezogen, die Schulter vorgeschoben und rannte in ihn hinein wie eine Kugel beim Rasenbowling. Mit einem Aufkeuchen ließ er alle Luft auf einmal aus seiner Lunge entweichen und ging zu Boden. Ich setzte mit einem weiteren Sprung über ihn hinweg, erreichte noch halb geduckt das Treppenhaus und spielte für einen Sekundenbruchteil mit dem Gedanken, über das ebenfalls weiß gestrichene Treppengeländer zu setzen und so ein halbes Stockwerk Vorsprung zu erreichen. Doch für ein derart akrobatisches Manöver schmerzte meine rechte Hand einfach zu sehr. Also umrundete ich das Geländer und stürmte die Treppe hinunter – nur um auf halber Höhe jäh zu verharren, als hätte mich ein Schwall Eiswasser getroffen. Am Fuß der Treppe stand der Mann mit dem militärischen Gebaren und dem braunen Vollbart, eine Art Schwert oder Säbel, jedenfalls aber eine Waffe, die keineswegs britisch anmutete, in der Rechten.
Erschrocken machte ich zwei Schritte rückwärts, erklomm die zwei Treppenstufen wieder, ohne mich umzudrehen. Die Anwesenheit des Hausherrn in meinem Rücken spürte ich mehr, als dass ich sie sah. Braunbart kam die Treppe hoch, ganz Entschlossenheit und Tatkraft, und es sah aus, als wäre über kurz oder lang ich diejenige, die in dieser Nacht den Blutzoll an die grausamen Götter der Londoner Unterwelt zu entrichten hatte. Es gab kein Entrinnen.
»Hab ich dich, Bürschchen!«, rief er triumphierend. »Dass du es wagst, von allen Häusern Mayfairs ausgerechnet hier einzusteigen! Nun, jetzt mache ich dich einen Kopf kürzer, und dann wirst du sehen, was du von deiner Tollkühnheit hast!«
»Übertreiben Sie es nicht, Colonel«, hörte ich die im Vergleich zu meinem Angreifer viel dünnere Stimme des Hausherrn hinter mir. »Ich bin überzeugt davon, dass ich unseren Gast auf frischer Tat ertappt habe und mir noch nichts abhandengekommen ist. Außerdem finde ich die Frage, warum jemand ausgerechnet bei mir einbricht, wo es doch links und rechts in Mayfair wesentlich lohnendere Ziele für Beutezüge gibt, ebenfalls überaus interessant. Ich denke, eine eingehende Befragung wäre angebracht.«
Inzwischen war der Braunbärtige direkt vor mir. Sein Blick verriet mir deutlich, dass er viel lieber kurzen Prozess mit mir gemacht hätte, aber nicht vorhatte, sich den Wünschen des hageren Hausherrn zu widersetzen. Er zuckte die Achseln.
»Wie Sie meinen, Professor. Dann eben so.«
Er hob die seltsame Klingenwaffe und knallte mir den massiven Knauf ansatzlos gegen die Schläfe. Vor meinen Augen breitete sich in Windeseile Schwärze aus, und für eine ganze Weile sah und hörte ich gar nichts mehr.
Es tat schrecklich weh, die Augen wieder zu öffnen, und ich war nicht sicher, ob das Licht in dem Zimmer, in das meine Häscher mich gebracht hatten, wirklich so grell war oder ob mit meinem Kopf etwas nicht stimmte. Auf jeden Fall empfand ich ein unangenehmes Pochen hinter der linken Schläfe.
»Er beginnt langsam, zu sich zu kommen, Professor«, sagte eine Frauenstimme mit einem Akzent, der auf die indischen Kolonien des Empires verwies – zweifellos die Haushälterin, die ich zuvor durchs Fenster gesehen hatte.
Direkt vor meinen Augen tauchte eine weibliche Hand mit brauner Haut und gepflegten Fingernägeln auf, die ein in warmem Wasser getränktes Baumwolltuch hielt und behutsam meine Schläfe betupfte. Meine Sicht war noch sehr verschwommen, und auch mein Sichtbereich schien ein wenig eingeschränkt, doch als sie die Hand zurückzog, sah ich Blut auf dem Tuch und hörte, wie sie einen besorgten Laut von sich gab.
»Ich verstehe nicht, warum du dir solche Mühe mit dem Burschen gibst, Sophie«, hörte ich die knappe, militärische Stimme des Mannes mit dem braunen Bart, der mich niedergeknüppelt hatte. »Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich den Bengel aufgeschlitzt – der Tod von solchen Lumpen macht die Stadt ein bisschen sauberer, denn es gibt wahrlich genug von seiner Sorte in London.«
Es gelang mir gerade noch rechtzeitig, die verquollenen Augen wieder ganz zu öffnen, um den vernichtenden Blick zu sehen, den die indische Haushälterin dem groben Kerl mit dem braunen Bart zuwarf.
»Was denn?« Erstaunlicherweise war dem Mann deutlich anzumerken, dass die Missbilligung der vielen kleineren, viel zarter gebauten, aber nichtsdestoweniger resolut wirkenden Frau ihn in die Defensive gedrängt hatte. »Auf den Straßen von Limehouse und Whitechapel wimmelt es nur so von Burschen wie ihm, die sich scheuen, mit ehrlicher Arbeit ihr täglich Brot zu verdienen und sich einmal die Hände schmutzig zu machen und stattdessen den Weg des Verbrechens einschlagen.«
»Ich bin sicher, dass die nächtlichen Eskapaden unseres jungen Gastes wesentlich vielschichtiger sind, als Sie ahnen, Colonel«, fiel ihm plötzlich eine sanfte, aber sehr klare Stimme spöttisch ins Wort. Sie musste dem Hausherrn gehören.
Es war das erste Mal, dass ich diesen ganz speziellen Moriarty-Tonfall hörte, der in Zukunft zahllose unserer Konversationen durchziehen sollte und der immer ein wenig klang, als erzähle der Professor sich selbst einen Witz, den nur er und der Weltgeist selbst verstehen konnten und der auch nur diesem sehr kleinen, privaten Kreis vorbehalten war. »Toldo, du kannst dich auch entspannen. Unser Gast geht vorerst nirgendwohin.«
Ich hatte gar nicht gemerkt, dass der hünenhafte Schwarze, den ich zuvor beim Verlassen des Hauses beobachtet hatte, hinter meinem Stuhl Aufstellung genommen hatte, bereit, mich jederzeit an der Flucht zu hindern. Jetzt aber trat er seitlich in mein Sichtfeld; seine Körperhaltung war tatsächlich entspannt, aber sein Argwohn war keineswegs verflogen, und er behielt mich misstrauisch im Auge.
Na wundervoll. Von dem steifen, grauen Butler einmal abgesehen, war der gesamte Haushalt hier versammelt. Ich hatte keinerlei Chance zu entkommen, obgleich man mich zu meiner Verwunderung nicht an den gepolsterten Lehnstuhl gefesselt hatte, in dem ich saß, womit ich durchaus gerechnet hatte. Nun gut, dann musste ich mich von jetzt an eben durchimprovisieren.
Der Raum, in dem ich mich befand, war, wie ich feststellte, als ich beide Augen endlich wieder ganz öffnete, ein großer, elegant, aber eher spartanisch eingerichteter Salon. Schräg rechts vor mir saß der Mann mit dem braunen Bart, zweifellos ein früheres Mitglied des britischen Militärs, und direkt mir gegenüber, die Hände auf dem Rücken gefaltet, stand der Hausherr. Die Haushälterin war aus meinem Blickfeld verschwunden, der schwarze Riese schwebte bedrohlich direkt rechts von mir.
»Also«, begann der Hausherr. »Mein Name ist Professor James Moriarty, und dies ist mein langjähriger Weggefährte und, nun, sagen wir, Berater in mancherlei Belangen, Colonel Sebastian Moran. Meine Haushälterin hört auf den schönen Namen Amravati, aber wir nennen sie der Einfachheit halber Sophie, und mein Kutscher heißt Toldo – aber das haben Sie ja bereits mitbekommen. Ich bitte um Entschuldigung für die etwas grobe Behandlung durch den Colonel – er ist eher ein Mann der Tat als einer der Subtilität.«
Der Angesprochene schickte sich an, den Professor zu unterbrechen, doch der warf ihm einen blitzschnellen, warnenden Blick aus dem Augenwinkel zu, und der Kerl mit dem braunen Bart beließ es bei einem mürrischen Brummen.
»Ich fürchte, Sie werden«, nahm der Professor seinen kleinen Vortrag wieder auf, als sei nichts gewesen, »da an der Schläfe eine hübsche Beule zurückbehalten – sie ist jetzt fast schon so groß wie ein Taubenei. Ein Hämatom dürfte im Laufe der nächsten Stunden noch dazukommen. Aber zumindest Letzteres können Sie sicher trefflich überschminken – ich vermute mal, das stellt für Sie kein Problem dar.«
Jetzt konnte sich Colonel Moran nicht mehr zurückhalten. »Das wird ja immer schöner. Sie glauben, dass er einer von diesen effeminierten Burschen ist, die sich schminken? Vielleicht dann auch noch in Mädchenkleidern ihren Körper feilbieten?«
»Lassen Sie es gut sein, Colonel, oder schauen Sie genauer hin – gerade bei der Affäre, mit der wir es gegenwärtig zu tun haben, eine Fertigkeit, in der sich zu üben Ihnen gut anstünde. Sehen Sie nicht, dass es sich bei unserem unerwünschten nächtlichen Gast um eine junge Frau handelt?«
Ich war verblüfft – nicht nur über seine scharfe Beobachtungsgabe, sondern auch darüber, wer er zu sein behauptete. Schließlich las ich Zeitung, und vor ziemlich genau drei Jahren hatte die Times in mehreren aufeinanderfolgenden Ausgaben um Pfingsten herum von seinem Ableben in der Schweiz berichtet.
»Professor Moriarty?«, brachte ich krächzend hervor. Meine Stimme funktionierte noch nicht wieder richtig. »Ich dachte, Sie wären tot.«
»Nun, meine Liebe«, antwortete er mit dem unernsten und zugleich weltmüden Lächeln, von dem ich in den kommenden Wochen und Monaten erfahren sollte, dass es so etwas wie sein Markenzeichen war, »einigen wir uns einfach darauf, dass die Berichte über mein Hinscheiden enorm übertrieben waren.«
Eine Stunde später saßen wir einander gegenüber. Wir waren in sein Arbeitszimmer umgezogen. Zuvor hatte Sophie sich um meine Schläfe gekümmert und mich mit einem viel zu weiten Herrenhemd versorgt, nachdem ich im Badezimmer des Hauses des Professors die Wicklung um meine Brust entfernt hatte, um etwas freier atmen zu können. Jetzt saß ich mit offenem Haar in einem bequemen Besuchersessel gegenüber dem Schreibtisch des Professors, neben mir auf einem Beistelltischchen, das der weitgehend stumme, graue Butler dort hingestellt hatte, eine Tasse duftenden Tees und ein Glas mit nicht minder duftendem Portwein. Die schweren, genagelten Stiefel hatte ich abgestreift.
Der Professor hatte es sich hinter seinem Schreibtisch bequem gemacht und dieselben beiden Getränke, eine Kombination, die er scherzhalber als »Londoner Clubgedeck« bezeichnete, vor sich.
Er hatte mir berichtet, dass seine Nemesis, der mir ebenfalls aus zahllosen Berichten in der Times bekannte selbst ernannte größte Detektiv der Welt, in der Schweiz versucht hatte, ihn umzubringen, zweifellos unter Drogeneinfluss. Doch der Professor hatte überlebt, auch wenn ihn die Folgen des Attentats zu einem etwas über vier Monate währenden Aufenthalt in verschiedenen Schweizer Kliniken und Sanatorien gezwungen hatten. Des Weiteren erzählte er mir, dass er aktuell nicht ganz freiwillig in den Diensten der Mordkommission von Scotland Yard stehe, um diese in einem besonders kniffligen Fall zu unterstützen. Er befürchte, so sagte er, dass ihn die Ermittlungstätigkeiten an Orte führen würden, wo ein Mann seines Standes auffallen würde wie, und ich zitiere wörtlich, »eine Butterblume in einem Kuhfladen«, und hier, so meinte er, käme ich ins Spiel.
»Zunächst einmal danke ich Ihnen, dass Sie mir Ihren wahren Namen anvertraut haben, Miss Miller.«
»Nein, ich danke Ihnen, Professor, dass Sie verhindert haben, dass dieser Grobian von Moran mich mit seinem Schwertdings aufgeschlitzt hat.«
»Dieses Schwertdings, wie Sie es ebenso treffend wie ungenau nennen, ist ein Tegha, eine traditionelle indische Klingenwaffe, die der Colonel sich von seinem Einsatz in den Kolonien als Souvenir mitgebracht hat. Und ich finde doch, eine sozusagen standrechtliche Hinrichtung ist eine etwas hoch gegriffene Reaktion auf einen Einbruchdiebstahl, noch dazu auf einen letztlich misslungenen. Was wollten Sie eigentlich stehlen?«