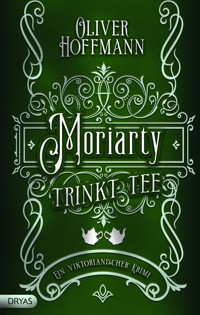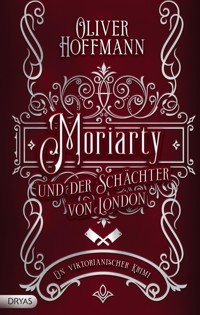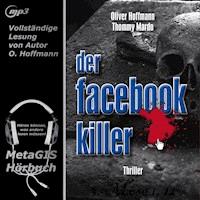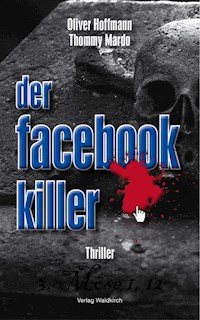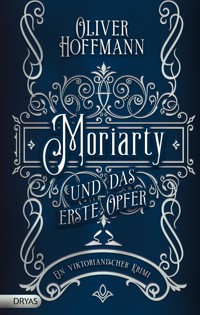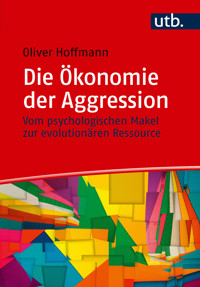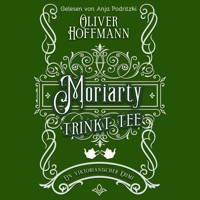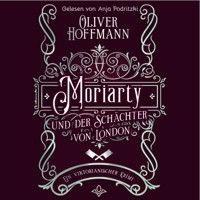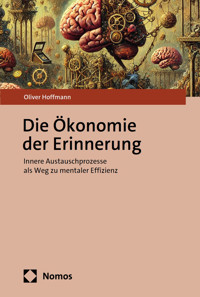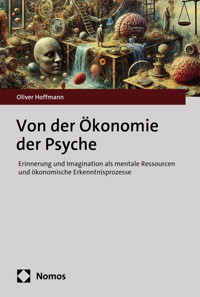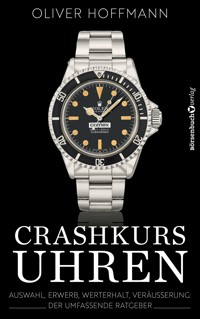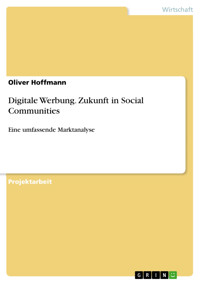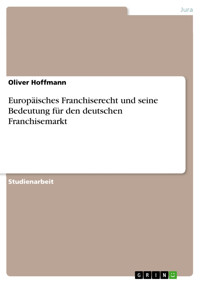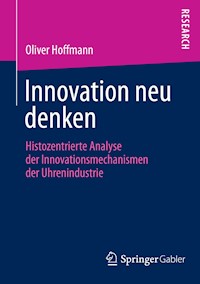Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: oekom verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was bedeutet Wohlstand in einer Welt, die im Überfluss lebt und doch nie satt wird? Dieses Buch bietet eine prägnante Analyse der modernen Gesellschaft und legt die psychologischen, wirtschaftlichen und sozialen Mechanismen offen, die unser Verständnis von Wohlstand prägen. Es beleuchtet, wie Kapitalismus und Konsumismus unsere Werte formen, und hinterfragt die Rolle des Luxus als Statussymbol. Mit einem scharfsinnigen Blick auf die Krise der Moderne lädt es dazu ein, die Grenzen des Wohlstands zu erkennen und neue Wege für ein nachhaltiges, sinnerfülltes Leben zu beschreiten. Denn wahrer Reichtum beginnt dort, wo Besitz aufhört – bei Sinn, Zufriedenheit und sozialer Verantwortung. Eine tiefgründige Reflexion über die Herausforderungen und Chancen unserer Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oliver Hoffmann
Die Grenzen des Wohlstands
Untertitel: Über Luxus, Konsum, Kapitalismus und die Krise der Moderne
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2025 oekom verlag, München oekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH, Goethestraße 28, 80336 München +49 89 544184 – 200
www.oekom.de
Layout und Satz: oekom verlag
Umschlaggestaltung: oekom verlag
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9783987264337
DOI: https://doi.org/10.14512/9783987264320
Menü
Cover
fulltitle
Inhaltsverzeichnis
Hauptteil
Inhaltsverzeichnis
Ein kurzes Vorwort
Kapitel Eins:
Wohlstand, Konsum, Luxus – das Triumvirat des Kapitalismus
Kapitel Zwei:
Luxus – der Begriff der Postmoderne
Kapitel Drei:
Die Religion des Konsumismus
Kapitel Vier:
Wie Luxus die Ökonomie antreibt
Kapitel Fünf:
Was Wohlstand heute noch bedeutet
Kapitel Sechs:
Konsum zwischen Ritual und Ekstase
Kapitel Sieben:
Die Idee des Betrugs als Grundpfeiler des Kapitalismus
Kapitel Acht:
Kapitalismus als neofeudales Konstrukt
Kapitel Neun:
Über die innere Ordnung von Konsum
Kapitel Zehn:
Der Fluch der Verfeinerung
Kapitel Elf:
Konsum und Ohnmacht
Kapitel Zwölf:
Wohlstand als Krankheit
Kapitel Dreizehn:
Die verlockende Illusion von Nachhaltigkeit durch Konsum
Kapitel Vierzehn:
Die Metamorphose des Wohlstands
Kapitel Fünfzehn:
Das Paradox von kapitalistischer Freiheit
Ein offenes Nachwort
Literatur
Anmerkungen
Ein kurzes Vorwort
In einer Welt, die sich immer stärker an der Oberfläche der Dinge orientiert (und orientieren muss), an ihrer scheinbaren Bedeutung und dem Versprechen eines erfüllten Lebens durch Konsum, scheint der Begriff des Wohlstands gleichzeitig universell und doch flüchtig geworden zu sein. Wohlstand, Konsum, Luxus – diese Begriffe sind längst zu einer Art Dreieinigkeit moderner Gesellschaften herangewachsen, eine Trias, die sich tief in das kollektive Bewusstsein gefressen hat. Sie prägen unsere Werte, unser individuelles Streben und oft sogar das, was wir nur allzu oft für den Sinn im Leben halten.
Aber wie fest sind diese Werte verankert? Welche Rolle spielt Wohlstand in einer Gesellschaft, in der alles – von Kleidung bis hin zu digitalen Dienstleistungen – zum Objekt von Status und Sehnsucht gemacht wird? Und warum hat der Luxus, einst Symbol für Überfluss und Dekadenz, seine Stellung in der Gesellschaft als ultimatives Streben erhalten? Es scheint, als hätte sich der Kapitalismus des Begriffs »Luxus« bemächtigt und ihn in eine bloße Rechtfertigung für Konsum und Identitätsfindung umgewandelt.
Dieses Buch möchte nicht nur ein Spiegel unserer Zeit sein, sondern einen Schritt tiefer gehen, um die inneren Mechanismen und psychologischen Auswirkungen dieser Dynamik zu erkunden. Luxus und Konsum sind mehr als nur ökonomische Begriffe – sie sind zu Glaubenssätzen geworden, zu einem modernen Ritual, das unser Verständnis von Wohlstand prägt und gleichzeitig die Grenzen zwischen Notwendigkeit und Überfluss verwischt. Der Versuch, diesen Phänomenen auf den Grund zu gehen, führt uns daher nicht nur in die Ökonomie der Dinge, sondern auch in die Psychologie der menschlichen Bedürfnisse und Werte.
In den folgenden fünfzehn Kapiteln lade ich Sie ein, diese Fragen mit mir zu durchleuchten, den Facettenreichtum des kapitalistischen Konsumismus zu verstehen und sich kritisch mit der Rolle auseinanderzusetzen, die Luxus, Wohlstand und Kapitalismus in unserem Leben eingenommen haben. Dies ist eine Einladung, nicht nur den äußeren Schein zu betrachten, sondern auch die dahinterliegenden Strukturen und Motive zu hinterfragen, die unsere Gesellschaft formen – und, vielleicht, einen Weg zu finden, uns von der scheinbaren Allmacht dieser Konzepte zu lösen.
Mit den besten WünschenProf. Dr. Dr. Oliver Hoffmann
Im Januar 2025
Kapitel EinsWohlstand, Konsum, Luxus – das Triumvirat des Kapitalismus
»Der heutige, zur Herrschaft im Wirtschaftsleben gelangte Kapitalismus also erzieht und schafft sich im Wege der ökonomischen Auslese die Wirtschaftssubjekte – Unternehmer und Arbeiter – deren er bedarf. Allein gerade hier kann man die Schranken des ›Auslese‹‐Begriffes als Mittel der Erklärung historischer Erscheinungen mit Händen greifen. Damit jene der Eigenart des Kapitalismus angepaßte Art der Lebensführung und Berufsauffassung ›ausgelesen‹ werden, d.h.: über andere den Sieg davontragen konnte, mußte sie offenbar zunächst entstanden sein, und zwar nicht in einzelnen isolierten Individuen, sondern als eine Anschauungsweise, die von Menschengruppen getragen wurde.«
Max Weber (1905): [36]
In einer nicht‐kapitalistischen Gesellschaft – wie auch immer sie aussehen mag – hätten Wohlstand und seine Folgen möglicherweise eine völlig andere Bedeutung. Anders als im Kapitalismus, der Wohlstand als zentrales Ziel betrachtet und ihn zum Maßstab individuellen und kollektiven Erfolgs macht, könnte in einem alternativen System Wohlstand mehr als Nebeneffekt oder gar Nebenprodukt des sozialen und gemeinschaftlichen Zusammenlebens gesehen werden. Die Prinzipien des Wirtschaftens – Ressourcennutzung, Produktion und Verteilung – blieben erhalten, doch die Art und Weise, wie wir über Wohlstand, Konsum und Luxus denken, könnte sich radikal wandeln. Diese Begriffe wären in einer nicht‐kapitalistischen Gesellschaft nicht die dominierenden Werte oder Ziele, sondern könnten ihren Status als Primärwerte verlieren und zu bloßen funktionalen Aspekten werden.
Beispiele für alternative Gesellschaftsmodelle gibt es in der Realität selten. Die meisten bekannten Ansätze scheiterten oder existierten nur kurzzeitig – wie etwa die utopischen Sozialisten des 19. Jahrhunderts (z. B. in Robert Owens »New Lanark« oder Charles Fouriers »Phalanstère«)1. Auch indigene Gemeinschaften und andere nicht‐industrielle Gesellschaften zeigen Elemente einer alternativen Wertschätzung von Wohlstand, wo Besitz und Reichtum oft geteilt und als kollektives Gut verstanden werden. Hier zeigt sich ein anderes Verständnis: Reichtum und Wohlstand werden nicht als individuelle Errungenschaft betrachtet, sondern als gemeinschaftliches Kapital, das dem Wohl der Gemeinschaft dient.
Diese alternativen Systeme sind jedoch rar, was an mehreren Gründen liegt. Ein Grund ist dabei stets in der Stärke und Widerstandskraft des kapitalistischen Systems zu finden, das es vermag, fast alle ökonomischen und sozialen Prozesse in seine Logik zu integrieren. Der Kapitalismus nutzt einem Schwamm gleich die menschlichen Bedürfnisse nach Verbesserung und Status und bindet diese an materielle Errungenschaften und Luxusgüter. Ein anderer Grund ist die globale Dominanz des Kapitalismus, die alternative Systeme wirtschaftlich und politisch unter Druck setzt. Gesellschaften, die eine andere Wirtschaftsform ausprobieren, werden oft isoliert oder sind nicht wettbewerbsfähig auf dem Weltmarkt, was den Erfolg dieser Experimente von vornherein erschwert.2
Die Begriffe Wohlstand, Konsum und Luxus prägen unser soziales und politisches Handeln spätestens seit dem Niedergang der Religion – und genau hier liegt der kritische Punkt. Sie wirken wie ein unsichtbares, quasi‐göttliches Netz, das gesellschaftliche Wertvorstellungen und Handlungsweisen bestimmt. Wohlstand bedeutet nicht nur das Vorhandensein von Reichtum, sondern die soziale Anerkennung dessen, was als Wohlstand gilt. Konsum wird in kapitalistischen Gesellschaften zum Selbstzweck und verleiht dem Individuum soziale Identität, während Luxus den Status einer Person unterstreicht und den sozialen Rang festigt. Alle drei Begriffe sind auf den ersten Blick positiv besetzt, aber sie kontrollieren uns in subtiler Weise, indem sie Werte vermitteln, die wir nur selten hinterfragen. Dieses Netz, das sich aus Wohlstand, Konsum und Luxus spinnt, verstrickt unsere Gesellschaft und lenkt sie in eine Richtung, die letztlich den sozialen Zusammenhalt und die individuelle wie kollektive Existenz gefährdet. In einer nicht‐kapitalistischen Gesellschaft wäre dieses Netz weniger dicht und weniger bindend, und die Menschen könnten sich stärker auf die intrinsischen Werte des Lebens konzentrieren – Kooperation, soziale Nähe und Nachhaltigkeit. Hier könnten Wohlstand, Konsum und Luxus auf neue Weise definiert werden, ohne die zerstörerischen Effekte, die in kapitalistischen Systemen damit einhergehen.3
In einem alternativen Modell ginge es nicht um den Status durch Besitz, sondern um die gemeinsame Nutzung und den Zweck der Dinge im alltäglichen Leben. Ein solches Denken mag heute mehr denn je radikal erscheinen, ist aber angesichts der gesellschaftlichen und ökologischen Krisen unserer Zeit notwendiger denn je. Wir brauchen Alternativen zu dem, was wir haben. Es ist an der Zeit für eine Bestandsaufnahme, um über das nachzudenken, was uns das große Experiment des Kapitalismus gebracht hat und wohin er uns führt. Und welche Entwicklungsmöglichkeiten sich daraus ergeben – im Außen wie im Innen.
Beginnen wir mit drei nackten Definitionen:
Wohlstand beschreibt den Zustand, in dem ein Individuum oder eine Gesellschaft über ausreichend materielle und immaterielle Ressourcen verfügt, um ein gutes, sicheres und erfülltes Leben zu führen. Dabei geht es nicht nur um die Verfügbarkeit von Geld und Besitztümern, sondern auch um den Zugang zu Bildung, Gesundheit, sozialen Beziehungen und kultureller Teilhabe. Wohlstand wird oft anhand von Indikatoren wie Einkommen, Vermögen, Lebensqualität und sozialem Schutz gemessen.4 In der Wirtschaft wird Wohlstand oft im Zusammenhang mit Volkswohlstand betrachtet und bezieht sich auf das Wohlstandsniveau eines Landes oder einer Gesellschaft als Ganzes. Dies schließt Infrastruktur, wirtschaftliche Stabilität und soziale Sicherheit ein. Ein zentrales Merkmal des Wohlstandes ist seine Verteilung innerhalb der Gesellschaft – zumindest in der Theorie führt eine gerechte Verteilung zu sozialem Zusammenhalt, während eine ungleiche Verteilung Konflikte und soziale Spannungen verursachen kann.
Konsum bezeichnet den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Befriedigung von Bedürfnissen und Wünschen. Konsum umfasst alles, was Individuen oder Gesellschaften erwerben und verwenden, um Lebensnotwendigkeiten zu decken, Bequemlichkeit zu steigern oder Vergnügen zu finden. Konsum ist der grundlegende Bestandteil der kapitalistischen Wirtschaft, da er die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen antreibt. In kapitalistischen Systemen spielt Konsum eine zentrale Rolle und ist stark mit dem Wirtschaftswachstum verbunden. Konsum kann jedoch auch negative Folgen haben, etwa Umweltverschmutzung, Ressourcenverschwendung und soziale Ungleichheiten, wenn die Verteilung der Konsummöglichkeiten ungleich ist.Der Begriff wird sinnvollerweise in zwei Kategorien unterteilt:
Basiskonsum: Dies umfasst notwendige Ausgaben für grundlegende Bedürfnisse wie Nahrung, Kleidung, Wohnen und Gesundheit.
Luxuskonsum: Dies bezieht sich auf Ausgaben für nicht lebensnotwendige Güter, die oft dem Statussymbol oder der Selbstdarstellung dienen.
Luxus bezieht sich auf den Besitz und die Nutzung von Gütern und Dienstleistungen, die über das Notwendige hinausgehen und oft mit einem hohen finanziellen oder symbolischen Wert verbunden sind. Luxusgüter und ‑dienstleistungen gelten in der Regel als selten, exklusiv und qualitativ hochwertig und dienen häufig als Statussymbole. Luxus kann sowohl materiell (wie exklusive Mode, Schmuck, teure Autos) als auch immateriell sein (z. B. luxuriöse Erlebnisse wie Reisen, kulinarische Erlebnisse oder Freizeitgestaltung). In einem weiteren Sinne steht Luxus auch für eine Lebensweise, die sich durch freien Zugang zu Ressourcen, Zeit und soziale Gestaltungsmöglichkeiten auszeichnet. Historisch gesehen war Luxus häufig mit gesellschaftlichen Eliten verbunden, während er in modernen Gesellschaften oft als Teil der Konsumkultur erscheint und für eine breitere Schicht zugänglich geworden ist. Luxus spielt eine Rolle in der Selbstdarstellung und signalisiert oft Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht oder einen individuellen Lebensstil.5
Wieso diese drei Begriffe? Weil sie aufeinander aufbauen und gemeinsam unsere kapitalistische Welt konstituieren – und damit unser gesamtes Leben. Der Mensch ist in der Moderne zuallererst ein ökonomisches Wesen, der Homo oeconomicus.6 Diese Ausrichtung und Sichtweise bestimmt unser individuelles Denken und hat längst fast alle Bereiche unserer Realität infiltriert und praktisch ohne ernst zu nehmenden Widerstand erobert. Diese ökonomische Logik hat sich schleichend, aber wirkungsvoll in unsere Wahrnehmung, unsere Werte und unsere Entscheidungen eingeschlichen – und das so weitreichend, dass wir kaum noch Alternativen sehen. Die Verführungskraft des Kapitalismus liegt zunächst in seiner Fähigkeit, sich scheinbar als einzig logische Ordnung der Welt zu präsentieren, die auf den (vermeintlichen) Prinzipien von Knappheit und Konkurrenz basiert. Er passt zu unserem Verständnis einer Welt, in der Ressourcen begrenzt sind und daher umkämpft werden müssen. Doch diese Vorstellung, die so natürlich erscheint, ist ein Paradox, das die Wurzeln unseres Daseins ins Wanken bringt.
Kapitalismus macht uns glauben, dass wir in einer feindseligen Welt leben, in der alles knapp und jeder Vorteil hart erkämpft werden muss. Diese Denkweise – dass Ressourcen endlich sind und immer umverteilt oder gesichert werden müssen – lässt uns glauben, dass unablässiges Streben, Besitzen und Verteidigen essenziell sind, um im »Spiel des Lebens« zu bestehen. Aber diese Knappheit ist nicht nur eine physische Realität, sondern ein psychologisches Konstrukt, das der Kapitalismus geschickt genutzt hat, um eine ewige Abhängigkeit zu schaffen.7
Unsere psychologische Verfassung wurde dadurch in der Moderne so geformt, dass wir uns in einem permanenten Zustand des Mangels sehen, selbst wenn objektiv genug vorhanden ist. Dieses Paradox zeigt sich besonders in wohlhabenden Gesellschaften: Trotz des Überflusses fühlen sich viele Menschen getrieben, immer mehr anzusammeln und ständig nach »mehr« zu streben – sei es mehr Besitz, mehr Erfolg oder mehr Anerkennung. Der Kapitalismus hat uns eingetrichtert, dass jeder Mangel als ganz persönlicher Makel empfunden werden muss, der durch Konsum und Leistung behoben werden kann. So streben wir unermüdlich nach Wohlstand und Status und bleiben doch immer in einem Mangeldenken gefangen. Die Macht des Kapitalismus liegt auch darin, dass er unser Bedürfnis nach Kontrolle über eine unsichere und unvorhersehbare Welt anspricht. Wir glauben, indem wir Kapital anhäufen und unser Einkommen maximieren, könnten wir Unsicherheiten neutralisieren und unser Schicksal kontrollieren. Doch der Widerspruch ist offensichtlich: Das Streben nach Kapital bringt uns in eine Spirale, die mehr Unsicherheit schafft, als sie löst. Diese Dynamik hält uns im Kreislauf des Konsumierens und Arbeitens gefangen, während wahre Freiheit und Sicherheit immer außerhalb unseres greifbaren Horizonts bleiben.
So ist der Kapitalismus nicht nur eine ökonomische Struktur, sondern eine mentale Falle. Er verkauft uns die Illusion, dass alles – selbst unsere Identität, unsere Beziehungen und unsere Träume – durch Kapital bemessen und bewertet werden kann. Und weil wir in einem System leben, das uns von Geburt an diese Spielregeln vermittelt, erscheinen sie uns als universell und unverrückbar. Es wird uns eingetrichtert, dass wir ohne diese Logik der Knappheit und des Wettbewerbs nichts erreichen können, dass jede Alternative entweder naiv oder unrealistisch ist.
Doch warum akzeptieren wir diese Knappheit so widerstandslos? Weil wir kaum je hinterfragt haben, ob die Prämisse überhaupt wahr ist. Die Natur zeigt uns unzählige Beispiele von Fülle und Selbstregulation.8 Doch der Kapitalismus ignoriert diese natürliche Balance und zwingt uns, in einer von uns selbst konstruierten Wüste des Mangels zu leben. Dieses Universum der Knappheit ist ein Konstrukt, das wir selbst geschaffen haben – und das nur besteht, weil wir daran glauben und uns daran binden.
Die Verführungskraft des Kapitalismus liegt darin, dass er unsere tiefsten Ängste und Hoffnungen anspricht, uns jedoch eine Antwort auf Fragen verspricht, die er selbst in uns erzeugt hat. Wir werden in ein Hamsterrad aus Konsum und Wettbewerb gesperrt und überzeugt, dass dies der einzige Weg zu einem »guten Leben« ist. Solange wir diese Regeln nicht infrage stellen, wird der Kapitalismus seine Vorherrschaft behalten – nicht weil er der Natur entspricht, sondern weil wir in uns selbst kollektiv ein Universum aus Knappheit und Wettbewerb geschaffen haben, das sich selbst immer weiter verstärkt.
Alle drei Begriffe – Wohlstand, Konsum und Luxus – sind Konsequenzen aus diesem Denken und den Grundprinzipien des Kapitalismus: Im Kern spiegeln sie die Prinzipien des Kapitalismus wider, der auf unaufhörlicher Akkumulation und dem Streben nach abstraktem Einfluss aufbaut. Wohlstand bedeutet hier nicht nur die Ansammlung von Ressourcen für ein besseres Leben, sondern die abstrakte Kontrolle über die Welt durch die schiere Macht des Eigentums – also nicht einmal mehr die Macht des physischen Besitzes, da heute die Rechte an den Objekten des Wohlstandes weit mehr bedeutend sind als die Objekte selbst (was viel über den Zustand der Gesellschaft schon für sich genommen aussagt).9 Konsum ist nicht nur die Befriedigung von Bedürfnissen, sondern ein ständiger Zyklus der Erfüllung und des Mangels, der den Markt antreibt und das Individuum in einen ewigen Kreislauf des Kaufens und Begehrens versetzt. Luxus schließlich ist das Symbol der Überwindung der bloßen Notwendigkeit – das Streben nach dem, was überflüssig und dennoch begehrenswert ist, weil es Status und Einfluss repräsentiert.
Akkumulation, das Anhäufen von Kapital und Besitz, ist im Kapitalismus zu einer Art »anthropomorpher Konstante« geworden – ein scheinbar universelles Streben, das den modernen Menschen definiert und dominiert. Dieses Streben wirkt so fundamental, dass es heute fast die biologischen Grundbedürfnisse wie Fortpflanzung oder Selbsterhaltung in den Hintergrund drängt. Es scheint, als sei das menschliche Bestreben nach Besitz und Einfluss wichtiger geworden als das bloße Überleben. Unsere moderne Gesellschaft ist inzwischen weit weniger auf das Weitergeben von Genen ausgerichtet als auf das Hinterlassen von Besitztümern und Vermögen. Statt sich um die Sicherung des Lebens zu kümmern, richtet sich der Fokus auf das Streben nach immer mehr, auf das Horten, Sammeln und Vermehren – nicht um zu leben, sondern um in den Augen anderer Bedeutung und Macht zu gewinnen.
Dieses Denken schafft eine paradoxe Welt, in der das menschliche Glück und die Erfüllung nicht mehr an das reale Leben gebunden sind, sondern an die Symbolik des Besitzes. Die Werte von Wohlstand, Konsum und Luxus transformieren sich in Abstraktionen, die uns das Gefühl geben, über das Leben hinaus wirken zu können, indem wir Macht in der Form von Kapital und Gütern hinterlassen. Diese Güter sind nicht einfach Dinge – sie sind Signale und Symbole, die anzeigen, wer wir sind oder wer wir sein wollen. Wir kaufen nicht nur, um zu haben, sondern um uns selbst und anderen etwas zu beweisen. So wird das Streben nach Wohlstand zum endlosen Wettlauf um Einfluss und Macht, der das Individuum in eine Spirale der Bedeutungslosigkeit stürzt, da der Markt stets nach mehr verlangt und kein Besitz je endgültig ist. In einer Gesellschaft, die auf Akkumulation ausgerichtet ist, werden alle Aspekte des Lebens von diesem Streben absorbiert. Wohlstand ist nicht mehr das Ziel eines guten Lebens, sondern das Maß, an dem der Wert eines Menschen bemessen wird. Konsum ist kein Mittel mehr zur Bedürfnisbefriedigung, sondern ein Akt der Selbstdarstellung und der sozialen Positionierung. Luxus schließlich ist nicht mehr die Belohnung für harte Arbeit, sondern das ultimative Ziel, das die Einzigartigkeit und Überlegenheit des individuellen Egos demonstrieren soll.
Der Kapitalismus verwandelt den Menschen in einen Akkumulator, dessen Selbstwert sich daran bemisst, wie viel er besitzt und wie viel Einfluss sein Besitz ihm verschafft. In diesem Sinne ist Akkumulation zur neuen Form des Überlebens geworden – ein Überleben, das nicht durch biologische Notwendigkeiten, sondern durch soziale Mechanismen und das Bedürfnis nach Anerkennung definiert ist. Die kapitalistische Gesellschaft verleiht der Akkumulation eine existenzielle Bedeutung und verwandelt sie in eine Art Lebenszweck, der das menschliche Dasein und seine Werte dominiert. Der Kapitalismus hat es geschafft, das Streben nach Wohlstand, Konsum und Luxus als zentrale Triebkräfte des menschlichen Lebens darzustellen. Die Frage ist jedoch, ob der Mensch dabei nicht mehr verliert, als er gewinnt: Eine Gesellschaft, die ihre Grundwerte in Akkumulation und Besitz verankert, könnte am Ende das Leben selbst entwerten. Wohlstand, Konsum und Luxus – einst Mittel zum Zweck – sind zu Zielen geworden, die das Individuum zwingen, in einer Endlosschleife zu existieren, die ihm nie wirkliche Erfüllung bringt.
Wohlstand ist die erste Konsequenz aus diesem menschlichen Streben. Die Umverteilung von Gütern sowie deren Veredelung zu immer komplexeren Produkten führt unweigerlich zu einer ungleichmäßigen Verteilung von Kapital; es sammelt sich in den Ecken und Eckpfeilern der Gesellschaft an.10 Über Wohlstand wurde viel geschrieben; er ist zum Selbstzweck des Kapitalismus geworden. Im kapitalistischen Narrativ wird Wohlstand zum höchsten Ideal, zum Maßstab aller Dinge, der zugleich eine Art unsichtbares Gefängnis ist. Er macht die Menschen zu Sklaven eines immer entfernteren Ziels, treibt sie in die endlose Jagd nach Besitz und Anerkennung. Wohlstand ist nicht mehr das Ziel eines erfüllten Lebens, sondern eine Fata Morgana, die die Gesellschaft ins Endlose treibt und Menschen als Teilnehmer in einem Wettbewerb instrumentalisiert, der nie ein Ende findet und kaum Gewinner kennt.
Konsum hingegen ist eine Konsequenz der Funktionsweise des Kapitalismus selbst; er ist sehr viel mehr anthropologische Konstante, ja Notwendigkeit als Akkumulation oder Wohlstand. Seit dem frühesten Einsetzen von Spezialisierung und Arbeitsteilung muss der Mensch konsumieren und daher Güter und Produkte erwerben, um sie nutzend zu verbrauchen. Erst in der Neuzeit wurde Konsum zunehmend mit sozialer, ja transzendenter Bedeutung aufgeladen und entkoppelte sich dadurch zunehmend vom Utilitaritätsprinzip vergangener Zeiten.11 Dadurch driftete Konsum zunehmend in die Richtung des Luxus ab; Luxusgüter erlebten eine enorme Bedeutungsaufwertung seit Mitte des 20. Jahrhunderts.
Luxus – dieser dritte Begriff im Dreiklang von Wohlstand und Konsum – ist mehr als bloßer Überfluss. Er ist, auf eine paradoxe Weise, ein Stück weit menschliche Notwendigkeit. Seit den Anfängen der Zivilisation existieren Luxusgüter; sie sind Ausdrucksmittel und Repräsentation, Spiegel unserer innersten Sehnsüchte und Verlangen. Luxus ist der Stoff, aus dem wir uns Identität und Status weben, und in seinem Glanz erkennt der Mensch sein Bedürfnis, über das Notwendige hinauszugehen, die Grenzen des rein Funktionalen zu überschreiten und sich selbst in einem größeren, außergewöhnlicheren Licht zu sehen. In der Geschichte waren es luxuriöse Gewänder, kunstvoll gefertigte Schmuckstücke, exotische Gewürze und seltene Stoffe, die Reichtum und Macht symbolisierten. Der ägyptische Pharao, der römische Senator, der chinesische Kaiser – alle verstanden sie die Sprache des Luxus. Sie wussten, dass Luxus nicht nur eine Frage von Besitz ist, sondern ein Werkzeug, um etwas Höheres darzustellen: die Fähigkeit, über die Grundbedürfnisse hinauszugehen, das Leben zu feiern und etwas von einem Unsterblichen in das eigene Dasein zu tragen. Luxusgüter sind die »Träger« dieser Zivilisation, sie sind die Objekte, an denen sich Kultur verdichtet, durch die sich Geschichte erzählt und die uns eine Art magischen Zugangs zum Erhabenen und Außergewöhnlichen bieten.
Doch Luxus ist kein Zufall. Er ist das Spiel der Ästhetik und der Sinnlichkeit, die Perfektion der Details, die Kunst des Überflüssigen, die Kunst der Verführung. Er erfüllt ein menschliches Bedürfnis, das tief in unserer Psyche verwurzelt ist: das Verlangen nach Schönheit und transzendentaler Bedeutung, das Gefühl, ein Teil von etwas Außergewöhnlichem zu sein, das eigene Leben aus dem Alltäglichen in das Sagenhafte zu heben. Luxus ist das, was uns innehalten lässt und uns daran erinnert, dass es jenseits des Nutzens, jenseits der simplen Funktion, etwas gibt, das nur um seiner selbst willen existiert – eine Art gelebter Mythos. In unserer modernen Zeit hat sich Luxus in alle Ecken unseres Lebens geschlichen und wurde zu einer Art unentbehrlichem Accessoire. Es ist nicht mehr der Thron des Königs, sondern eben das Designerkleid, der exotische Urlaub, das extravagante Dinner. Der moderne Mensch braucht Luxus, um zu beweisen, dass sein Leben Bedeutung hat – dass er es »geschafft« hat, dass er mehr ist als nur ein Rädchen im Getriebe. Luxus wird zum täglichen Ritual, zum Zeichen dafür, dass das Leben noch das Versprechen von Fülle und Schönheit in sich trägt.
Doch dieser Luxus ist auch verführerisch und betrügerisch. Während er uns das Außergewöhnliche verspricht, zieht er uns immer tiefer in die Logik des Konsums hinein. Der wahre Luxus des Lebens – Zeit, Muße, Sinn – geht dabei verloren. Luxus wird zur Karikatur seiner selbst, eine Art Maskerade, hinter der die tiefe, authentische Sehnsucht nach Erfüllung oft verborgen bleibt. Denn Luxus hat die Fähigkeit, das Beste in uns hervorzubringen, unsere Fantasie zu entzünden und unsere Wertschätzung für das Schöne zu schärfen. Doch in einem System, das ihn zur Ware degradiert, verliert Luxus seine Magie, wird zum bloßen Statussymbol, das uns trennt, anstatt uns zu erheben. Luxus, dieser ewige Begleiter der Menschheit, ist deshalb weit mehr als ein Zeichen von Reichtum. Er ist ein Symbol unserer kulturellen Reise, unserer Fähigkeit, Schönheit zu schaffen und zu genießen. Und in dieser Fähigkeit liegt vielleicht die größte menschliche Notwendigkeit verborgen: das unstillbare Verlangen nach einem Leben, das über das Alltägliche hinausgeht – ein Leben, das dem Überfluss eine tiefere, fast spirituelle Bedeutung verleiht. Der Luxusgedanke hat bis heute ein wenig den Glauben an das Göttliche, Schöne, Transzendente eingefangen und in Symbole von Herrschaft und Wohlergehen verwandelt. Luxus war – vom Ursprung her gedacht – viel mehr religiös‐ästhetische Notwendigkeit als ein Gebrauchsgut; erst die moderne Deutung hat ihn in die Niederungen des alltäglichen Konsumerlebens hinabgezwungen.
Wie man also sieht, bedingen die Begriffe sich gegenseitig und bauen ebenso aufeinander auf: Aus der unbegrenzten Akkumulation von Kapital12 entsteht das moderne Konzept des Wohlstands, welcher Konsum als sozioökonomisches Ventil benötigt; der Konsum wiederum benötigt für sein Wachstum die Adaption des Luxusgedankens, was zu mehr (echten oder unechten Luxusprodukten führt. Gleichzeitig beeinflusst und verändert die Auffassung und Zuschreibung von Luxus die Gesellschaft und das Individuum gleichermaßen, was das Konsumverhalten und dadurch die Wahrnehmung und Bedeutung von Konsum und Wohlstand in eine Richtung vorantreibt, die den luxusorientierten Konsum immer weiter befeuert. Das, was vor 50 Jahren als absoluter Wohlstand im praktischen Leben gegolten hätte, wird heute vielfach überboten – wenn auch nicht in allen Dimensionen; Luxus ist ein vielköpfiges Phänomen.
In diesem begrifflichen Spannungsfeld werden sich die folgenden 14 Kapitel dieses Buches bewegen – die innere Gegensätzlichkeit dieser zentralen Elemente unserer von Ökonomie dominierten Lebensrealität ist enorm.
Die Konzepte von Wohlstand, Konsum und Luxus beherrschen das Leben und Streben der Moderne wie kaum andere komplexe Geisteskonstrukte – und haben eine mitunter bedrohliche Form und Macht angenommen. In einer Zeit, die mehr hat als jede andere Periode zuvor, ist der Ruf nach mehr zu einem kaum hinterfragten Selbstläufer geworden; ganze Gesellschaften stehen an der Schwelle zum Hyperkonsumismus der westlichen Welt und sind drauf und dran, diesen mehr oder weniger ungefragt zu übernehmen, ja weiter zu intensivieren.13 So sind die meisten Formen von Konsum längst zu Luxuskonsum geworden, auch wenn dies oft nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist.
Dieses Phänomen erschreckt deswegen so sehr, weil es oft als alternativlos begriffen und mit positiven Gedankenkonzepten wie Freiheit oder Gleichheit verknüpft wird; mit Zivilisation und Fortschritt. Unsere aktuelle kollektive Vorstellung von Wohlstand ist nicht nur ein Ziel, das wir verfolgen – sie ist zu einem gefährlichen Selbstläufer geworden, einer Art suizidaler Vision, die auf globalem Level unser eigenes Fundament bedroht. Der blinde Glaube an den Wohlstand, wie er heute verstanden wird, hat sich in eine Spirale des ungezügelten Wachstums und der maßlosen Ausbeutung verwandelt. Dieser Wohlstandsidealismus, der ständig nach »mehr« strebt, egal um welchen Preis, stellt die Welt und ihre Ressourcen auf eine Zerreißprobe. Er bewegt sich an der Schwelle zur Selbstzerstörung, indem er das Leben auf dem Planeten selbst gefährdet und die soziale Balance ins Chaos stürzt. Auch vor diesem recht bedrohlichen Hintergrund sollte die Beschäftigung mit dem Themenkomplex ein wichtiges individuelles Anliegen sein. Es reicht an das Gesellschaftssystem selbst heran – die Frage, wie wir warum leben, drängt sich auf. Und ebenso die Frage nach dem individuellen Wozu.
Diese globalen Phänomene, die wie überdimensionierte Kräfte des Kapitalismus und Konsumismus auf uns wirken, sind in Wahrheit zutiefst persönliche Fragen. Es ist eine radikale Herausforderung unserer Zeit, sich dieser persönlichen Ebene zu nähern und zu erkennen, dass Wohlstand, Konsum und Luxus nicht nur abstrakte Konzepte sind, sondern Symbole, die unser inneres und äußeres Leben formen. In jedem Einzelnen liegt das Potenzial, diesen Konzepten einen neuen Impuls zu verleihen und so eine Metamorphose in Gang zu setzen, die der ungezügelten Akkumulation Einhalt gebietet. Es geht darum, Luxus neu zu erfinden, ihn zu einer Qualität des Seins statt des Habens zu machen – eine Rückkehr zur Essenz, die jenseits von Überfluss und Exzess liegt.
Denn Wohlstand ist viel mehr als die bloße Anhäufung von Dingen. Er ist eine gelebte Philosophie, die unser kollektives Unbewusstes prägt, ein Konstrukt, das sowohl unsere innersten Bedürfnisse als auch unsere größten Illusionen reflektiert. Wohlstand ist eine Idee, die in uns lebt und wächst, ein Spiegel unserer Träume und Ängste. Doch ein »Weiter‐wie‐bisher« ist nicht mehr möglich, weil die Welt, wie wir sie kennen, an ihre Grenzen stößt. Der Wohlstand – und mit ihm der Kapitalismus und der Konsumismus – wird neu gedacht werden müssen. Es ist Zeit für ein neues Verständnis, das nachhaltige Lebensfreude über temporäre Befriedigung stellt, das die Balance mit der Umwelt und den sozialen Frieden über das unstillbare Verlangen nach mehr stellt. Die Neudefinition von Wohlstand könnte letztlich bedeuten, die äußere Fülle in eine innere Qualität zu transformieren – eine Weisheit des Genug, die das Leben reicher macht als jeder noch so prall gefüllte Besitz.
Diesem sich stets verwandelnden Konzept möchten die folgenden Kapitel eine gedankliche Grundlage bieten – bis hin zu einer zukünftig weiteren Metamorphose.
Kapitel ZweiLuxus – der Begriff der Postmoderne
»Der Hang zum Luxus geht in die Tiefe eines Menschen: er verrät, daß das Überflüssige und Unmäßige das Wasser ist, in dem seine Seele am liebsten schwimmt.«
Friedrich Nietzsche (1954): [405].
Die Idee von Luxus hat in den letzten Jahrzehnten einen bemerkenswerten Wandel durchlaufen und sich von einem schamhaft gemiedenen Begriff zu einem erstrebenswerten Symbol für ein gelungenes Leben entwickelt. Einst war Luxus fast wie ein Schimpfwort, ein Synonym für Verschwendung, Exzess und moralische Dekadenz. Der Duden spricht von Luxus als »nicht notwendigem, nur zum Vergnügen betriebenen Aufwand an Verschwendung und Prunk« – eine Definition, die durchdrungen ist von einem Hauch moralischer Verwerflichkeit. Diese negative Konnotation hat ihren Ursprung in einer jahrhundertelangen religiös und moralisch geprägten Ablehnung des Luxus, die in der westlichen Gesellschaft tief verwurzelt ist.
Die protestantische Ethik, wie Max Weber sie in Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus analysiert hat14, förderte eine Haltung, die Luxus nicht nur als überflüssig, sondern als moralisch verwerflich betrachtete. Reichtum, so die Lehre, sollte in den Dienst Gottes und der Gemeinschaft gestellt werden, nicht in persönliche Exzesse oder gar luxuriöse Verschwendung. Arbeiten, Sparen und die Zurückhaltung weltlicher Genüsse galten als Tugenden, die nicht nur religiöse, sondern auch ökonomische Wurzeln hatten. Das Gefühl, dass Luxus eine Art »Sünde« ist, wurzelt in diesem protestantischen Ethos, das Genuss und Überfluss mit Verdammung verknüpft. Sparsamkeit und Verzicht waren nicht nur persönliche Ideale, sondern gesellschaftliche Normen, die den Lebensstil der westlichen Welt für Jahrhunderte prägten.
Erstaunlich ist, wie lange diese Auffassung vom Luxus Bestand hatte. Noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war Konsum etwas, das dem »normalen« Leben nachgeordnet war, eine Art Beigabe, nicht das Herzstück des modernen Lebensstils. Die Mehrheit der Menschen lebte mit dem Anspruch, Genügsamkeit und Bescheidenheit als Ideal zu sehen – nicht nur aus wirtschaftlicher Notwendigkeit, sondern mehr als gesellschaftliche Tugend. Auch das Wirtschaftssystem selbst unterstützte diese Denkweise, indem es auf Produktivität, Sparsamkeit und Stabilität setzte, anstatt auf ständige Kaufanreize und Konsumexzesse. Der Konsum war eine Randerscheinung des Alltags, nicht dessen zentraler Zweck.
Doch mit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann eine Transformation, die das Bild des Luxus und des Konsums radikal veränderte. Plötzlich wurde Luxus nicht mehr nur geduldet, sondern zelebriert und gefeiert. Ein schleichender Wandel in der kollektiven Wahrnehmung vollzog sich: Luxus wurde zu einem Symbol der Freiheit, der Individualität und des Lebensgenusses. Luxus wurde zu einem Ziel, einem erstrebenswerten Zustand, einem Lebensstil, der die Grenzen des Notwendigen überschritt und das Unmögliche erreichbar erscheinen ließ. Die Werbung, die Medien und schließlich die soziale Marktwirtschaft selbst förderten diese Umdeutung, indem sie Luxus und Konsum zum Herzstück des modernen Kapitalismus machten.
Was früher als Sünde galt, wurde zur Tugend der modernen Gesellschaft, in der Konsum nicht mehr nur ein Mittel zum Zweck ist, sondern ultimative Pforte zur individuellen Identität. Heute ist Luxus ein Ausdruck der Selbstverwirklichung, ein Symbol dafür, dass man es »geschafft« hat. Der Übergang vom Verbotenen zum Begehrten ist vollständig vollzogen: Luxus ist nicht mehr das Stigma der moralischen Verfehlung, sondern der Maßstab des gelungenen Lebens. Die alte protestantische Haltung, die Luxus als eine Bedrohung der Tugend sah, ist zu einer historischen Fußnote geworden. In einer Welt, die durch Konsum und Erreichbarkeit definiert ist, wurde Luxus neu erfunden – und mit ihm die moderne Idee davon, was ein erfülltes Leben ausmacht.15
Zu verstehen, dass Kapitalismus und Konsumismus nicht identisch sind, ist essenziell, denn während Kapitalismus als Wirtschaftsform auf dem Prinzip der Kapitalakkumulation beruht, treibt der Konsumismus die ständige Erzeugung von Bedürfnissen und Wünschen an, die durch Konsum erfüllt werden sollen. Der Konsumismus evoziert dabei eine fast dominante Funktion von Luxusgütern, die in der Geschichte beispiellos ist. Noch nie zuvor waren Luxusgüter so zentral für die Selbstwahrnehmung des Einzelnen und das soziale Gefüge der Gesellschaft. Luxus ist im Konsumismus nicht mehr nur ein Nebenprodukt des Wohlstands weniger, sondern ein allgegenwärtiges Versprechen, das für viele zum Lebensziel geworden ist. Der Konsumismus schafft eine Kultur, in der Luxusgüter Status und Identität prägen und den sozialen Aufstieg symbolisieren.
Die industrielle Revolution brachte eine neue Ära der Produktion und des Kapitals hervor, die den Kapitalismus maßgeblich geformt hat. Diese Epoche und der Kapitalismus bedingten sich gegenseitig, da das Kapital plötzlich zu einer dynamischen Größe wurde, die nicht mehr nur gehortet, sondern produktiv eingesetzt werden konnte. Vor dieser Zeit war Kapital eher statisch – es wurde bewahrt und nicht reinvestiert. Wohlstand war für die meisten eine Konstante, die sich kaum veränderte und für die soziale Struktur wenig Bedeutung hatte. Für die Mehrheit der Bevölkerung, die in agrarischen Verhältnissen lebte, spielten Kapital und Vermögen nur eine untergeordnete Rolle, und auch der Wohlstand der Eliten manifestierte sich weniger in dynamischen Investitionen als in statischen Besitztümern wie Ländereien und Burgen. Wie Thomas Piketty in Das Kapital im 21. Jahrhundert betont, war Kapital in vormodernen Gesellschaften weitgehend immobil und konzentriert, es erfüllte eine Repräsentations‐ und Machtfunktion, aber keine produktive Rolle im heutigen Sinne.16
In dieser Zeit gab es praktisch keinen Luxus in dem Sinne, wie wir ihn heute verstehen. Es existierten zwar wertvolle, oft kostbare Güter, doch sie erfüllten keine aktive Funktion für die Gesellschaft als Ganzes. Luxusgüter dienten der »Herrschaftsrepräsentation«, einem pseudo‐magischen Symbol für Macht und göttliche Legitimation. Solche Güter, wie prächtiger Schmuck und kostbare Kunstwerke, waren primär auf die herrschenden Schichten begrenzt und symbolisierten eine Distanz zum gewöhnlichen Leben. Dies umfasste sakrale Kunst und aufwendige Repräsentationsmöbel, die die Macht und den Status des Adels und der Priesterschaft visualisierten. Diese Güter hatten eine Bedeutung, die weit über ihren materiellen Wert hinausging – sie waren Symbole für eine Ordnung, die als unveränderlich und von göttlicher Gnade gewollt galt.
Doch die industrielle Revolution und der Kapitalismus haben das Fundament dieser statischen sozialen und ökonomischen Strukturen erschüttert. Kapital wurde nicht länger gehortet, sondern investiert und vermehrt, was eine neue Dynamik des Wachstums ermöglichte und die soziale Hierarchie in Bewegung brachte. Mit der Entstehung des Konsumismus wurden Luxusgüter nicht mehr nur Symbole des Adels, sondern greifbare Versprechen für alle, die an das Märchen des sozialen Aufstiegs glaubten. Luxus wurde ein Teil des Alltags, ein Symbol für persönliche Leistung und individuelle Bedeutung. In einer Kultur, die auf dem endlosen Kreislauf von Konsum und Verlangen basiert, wird Luxus zu einem zentralen Mechanismus, der das Rad des Konsumismus am Laufen hält und die Erzählung vom »guten Leben« ins Unendliche treibt.
In vorkapitalistischen Gesellschaften existierten Luxus und Luxusgüter zwar, doch ihre Bedeutung war auf eine kleine, elitäre Schicht beschränkt. Diese Objekte, die wir heute als »Luxus« bezeichnen, erfüllten keine praktische Funktion für die Gesellschaft als Ganzes, sondern waren vielmehr eine Art symbolischer Schatz, der die Macht und den Status der herrschenden Klasse repräsentierte. Sie besaßen eine pseudo‐magische Anziehungskraft und galten als Symbole der Herrschaft, unzugänglich für die breite Bevölkerung und oft mit einer rituellen oder quasi‐religiösen Bedeutung behaftet. Luxusgüter wie kunstvolle Schmuckstücke, exquisite Kunstwerke und beeindruckende Möbelstücke waren Manifestationen der Macht, Ausdruck des Übernatürlichen und Göttlichen, die die Position des Adels und der Priesterschaft festigten. Sie waren die Verballhornung religiöser und priesterlicher Symbole, die nicht nur den Prunk, sondern auch die Distanz zu den Massen betonten.17 Die Möbel und Einrichtungsgegenstände, die wir heute selbstverständlich in jedem Wohnraum finden, dienten damals primär der Machtrepräsentation und weniger dem Komfort. Teppiche, verzierte Lampen und luxuriöse Textilien waren Zeichen von Reichtum und Bedeutung und standen für eine Art symbolischen Überflusses, der keinen Platz in der Alltagswelt der gewöhnlichen Menschen hatte. Diese Güter waren nicht dazu gedacht, das Leben der Masse zu verschönern oder zu erleichtern; sie waren vielmehr Ausdruck eines direkten Herrschaftsanspruchs, fast ein sakrales Arrangement, das an die göttliche Gegebenheit der Eliten erinnerte. Der Gedanke, dass ein gewöhnlicher Bürger einen edlen Teppich oder eine kunstvoll geschnitzte Truhe besitzen könnte, war so unrealistisch wie die Vorstellung, überirdische Kräfte zu erlangen. Für die breite Bevölkerung spielten diese Luxusgüter keine Rolle, da sie außerhalb ihres wirtschaftlichen und sozialen Horizonts lagen.18 Natürlich weckten sie Neid und Begehrlichkeit, vielleicht sogar eine Art verborgene Sehnsucht – doch diese Begehrlichkeiten waren von vornherein erstickt in der Realität der sozialen Unmöglichkeit. Die soziale Struktur war so gestaltet, dass der Zugang zu diesen Objekten fast eine Parodie war, eine Art Vorführung von etwas Unerreichbarem, das für den normalen Bürger ohne Bedeutung blieb. Nur in Ausnahmefällen, wie in Zeiten des Krieges oder Aufstandes, konnten die Massen diesen Schatz in ihre Hände bekommen – und dann meist als Trophäen, die sofort geplündert und nicht zur langfristigen Nutzung bestimmt waren.
Das Leben des einfachen Menschen in vorkapitalistischen Gesellschaften war von Notwendigkeiten und praktischen Bedürfnissen geprägt. Der Gedanke, Luxusgüter zu erwerben oder auch nur zu konsumieren, lag jenseits der Vorstellungskraft, weil die soziale und wirtschaftliche Realität dies schlicht nicht zuließ. Es gab eine so klare Trennung zwischen dem Besitzenden und dem Nicht‐Besitzenden, dass der Begriff »Konsum« im heutigen Sinne bedeutungslos war. Luxus war ein Symbol, ein Mythos, der für die herrschende Elite Bedeutung hatte, aber in der Lebenswelt der breiten Masse keinen Platz fand.
Die industrielle Revolution – dieser Triumphzug der Technik und Mechanisierung – war schließlich in erster Linie eine Umwälzung der Produktion, eine Revolution der Maschinen und der Produktionsmethoden, kein Aufbruch in eine neue Gesellschaftsordnung. Sie führte zu einer tiefgreifenden Veränderung in der Art und Weise, wie Güter hergestellt wurden, und schuf eine neue Arbeitswelt, die das Leben der Menschen in Fabriken und Fertigungslinien verankerte. Doch während die Produktionsprozesse in einem Tempo voranschritten, das die Welt in ihren Grundfesten erschütterte, blieben die gesellschaftlichen Strukturen weitgehend unverändert. Menschen wurden zu Rädchen im Getriebe einer gigantischen Maschinerie, aber sie waren noch immer in den alten Hierarchien und wirtschaftlichen Abhängigkeiten gefangen. Die soziale (und erst recht eine innere) Revolution ließ auf sich warten.
Erst nach der Entfaltung des Innovationspotenzials der industriellen Fertigung, die mit den beiden Weltkriegen einen ungeahnten Höhepunkt erlebte, begann sich das wirtschaftliche und soziale Gefüge zu verschieben. Die Kriege schufen nicht nur ein Arsenal an Produktionstechnologien und einen riesigen industriellen Komplex, sie machten auch deutlich, in welchem Ausmaß die industrielle Maschinerie Menschen, Ressourcen und Märkte mobilisieren konnte. Nach 1945 lagen die industriellen Strukturen bereit, um nicht nur Kriegsgerät, sondern Konsumgüter in Massen zu produzieren und zu verteilen.19 In den 1950er Jahren erlebte der Kapitalismus eine grundlegende Transformation, die bis heute nachhallt: Er wandte sich vom bloßen Fokus auf die Produktion von Gütern hin zu einer Ideologie, die das Konsumieren an sich als höchste Form des gesellschaftlichen Wertes und des individuellen Glücks betrachtete. Dies war die Geburtsstunde des Konsumismus, der die kapitalistische Logik revolutionierte.
Mit diesem Wandel wurde der Konsum nicht nur in seiner Menge und Frequenz gesteigert, sondern auch in seiner Bedeutung überhöht. Der Konsumismus verlieh dem individuellen und kollektiven Konsum eine Bedeutung, die ihn zur neuen sozialen Währung machte. Besitz und Konsum wurden zum Maßstab für sozialen Status und persönlichen Erfolg, und die industrielle Produktion konzentrierte sich zunehmend darauf, Bedürfnisse zu schaffen und zu bedienen, die das Wirtschaftssystem am Laufen hielten. Der Kapitalismus, der einst auf der Akkumulation von Kapital durch Produktionssteigerung basierte, verlagerte seinen Fokus hin zur Schaffung von Märkten für immer neue Konsumprodukte. Damit veränderte sich die Mechanik des Kapitals fundamental: Es ging nicht mehr allein darum, Güter herzustellen, sondern darum, eine unstillbare Nachfrage zu erzeugen, die den Motor der Wirtschaft am Laufen hält.20
Konsumismus wurde zur neuen gesellschaftlichen Grundordnung (wenn auch zunächst hinter den samtenen Vorhängen des Liberalismus verborgen), in der es nicht mehr darum ging, Bedürfnisse zu befriedigen, sondern das Verlangen nach immer neuen Dingen zu wecken – Metabedürfnisse lösten echte Bedürfnisse ab. Die Werbung, das Marketing und die Medien schufen eine Welt, in der Konsum als Weg zum Glück und zur Selbstverwirklichung dargestellt wurde. Dabei wandelte sich der Kapitalismus endgültig in ein System, das nicht nur die Arbeitskraft und die Rohstoffe der Menschen in sich aufsaugte, sondern auch ihre Sehnsüchte und Wünsche inkorporierte und verwandelte – die Traummaschine der Moderne. In dieser neuen Ordnung wurde das Kapital zur treibenden Kraft des Konsums und der Konsum zur treibenden Kraft des Kapitals – eine perfekte Symbiose, die bis heute das Bild unserer Gesellschaft prägt und die Menschen als Konsumenten formt.
Die Herzkammer des Kapitalismus, die sich um die unendliche Akkumulation dreht, wurde entstaubt und weit geöffnet – weit über die Sphären immateriellen Kapitals hinaus, hinein in die Welt der physischen Dinge. Damit wurde nicht nur das Streben nach Reichtum, sondern auch das nach grenzenlosem Konsum zu einem Fundament des modernen, nahezu pseudoreligiösen Gesellschaftssystems. Der Kapitalismus hat seinen Wirkungsbereich ausgeweitet, und was früher das Feld der Finanzmärkte und Vermögensvermehrung war, ist heute eine allumfassende, durch und durch materialistische Ideologie: die unersättliche Sehnsucht nach immer mehr Besitz.
Mit dem Aufstieg des Kapitalismus nach dem Fall der Sowjetunion und Chinas Hinwendung zum Turbokapitalismus verblassten die einstigen Werte der Zurückhaltung und Skepsis gegenüber Luxus. Der Hyperkonsumismus, der sich im 21. Jahrhundert ausbreitete, hat nicht nur den Luxus an sich entgrenzt, sondern ihn auch entwertet – Luxus ist heute allgegenwärtig, unpersönlich und hohl geworden.21 Wo früher exklusive Güter einen klaren sozialen Unterschied und damit Status symbolisierten, sind sie heute für viele (oder sogar die meisten) verfügbar. Der einst kostbare Luxus, der Jahrhunderte lang den Adel oder die Elite kennzeichnete, ist heute ein inflationäres Statussymbol, das seine Exklusivität verloren hat.
Diese Entwicklung war unausweichlich. Der rationale, am praktischen, individuellen Nutzen orientierte Konsum kennt Grenzen – er ist gebunden an die realen Bedürfnisse, die sich in der Hauswirtschaft, im »Haushalten« manifestieren. Das Haushalten selbst ist ein Konzept, das tief in der menschlichen Zivilisation verankert ist und die Keimzelle allen Wirtschaftens darstellt. Die Hauswirtschaft diente stets dazu, Ressourcen zu verwalten, Vorräte sinnvoll zu nutzen und das Überleben der Gemeinschaft zu sichern. Konsum und Haushalten waren an die Funktionalität von Gütern gebunden – an Verbrauchsgüter, die den Alltag stützen, und Gebrauchsgüter, die langlebig und universell einsetzbar sein sollten. Hier stand der funktionale Nutzen im Vordergrund, und ökonomische Abwägungen entschieden über die Anschaffung und Verwendung dieser Güter. Das Ziel war es, langlebige, vielseitige und qualitativ hochwertige Dinge zu besitzen, die den Haushalt effektiv unterstützen.22 Luxusgüter hingegen waren stets eine Ausnahme in dieser pragmatischen Welt des Haushaltens – eine Art »Ökonomie des Überschusses« und Privileg für einige wenige, mit starker sozialer Symbolkraft, die bis ins 20. Jahrhundert hinein ökonomisch kaum ins Gewicht fiel. Luxus erfüllte eine andere Funktion als Gebrauchsgüter: Er sollte beeindrucken, darstellen und symbolisieren, weniger als konsumieren und zu gebrauchen. Diese Güter waren geprägt von einer Ästhetik der Knappheit und des Unverfügbaren.
Mit dem Aufkommen des modernen Konsumismus änderte sich diese Rolle des Luxus grundlegend. Wo die Hauswirtschaft eine Kultur der Begrenzung und der Zweckmäßigkeit repräsentierte, tritt der Konsumismus als eine Kultur der Entgrenzung auf, in der die Begrenztheit der Ressourcen durch den Drang nach immer mehr in den Hintergrund tritt. In den wohlhabenden, modernen Gesellschaften Nordamerikas, Europas und Teilen Asiens sind Gebrauchsgüter in einem Maße verfügbar, das jede Sättigung übersteigt. Die Flut an standardisierten, universellen Gütern hat die Haushalte überschwemmt, und der Konsum folgt einem effizienzgetriebenen Wettbewerb, der Standardgüter für jedermann zugänglich macht. Der Konsumismus hat hier die ursprüngliche Logik der Hauswirtschaft ersetzt und Güter zu einem »notwendigen Überfluss« gemacht.
Um das endlose Wachstum des Konsums zu sichern, musste eine neue Kategorie von Gütern gefunden werden – Güter, die sich wie Kapital endlos anhäufen lassen, ohne einer funktionalen Begrenzung zu unterliegen. Diese entgrenzten Konsumgüter brechen mit der Logik des klassischen Haushalts, weil sie nicht mehr an praktische Bedürfnisse oder langfristigen Nutzen gebunden sind. Der moderne Konsumismus fördert stattdessen eine unstillbare Akkumulation von Dingen, die den Menschen von der Logik des praktischen Bedarfs entfernt. Der Konsum wurde daher eng an den Verbrauch und tatsächlich vorhandene und entstandene Bedürfnisse einer Hausgemeinschaft verknüpft; es war ein Konsum der Verbrauchs‐ und Gebrauchsgüter.
Die Konsumgesellschaft hat sich auf ein unendliches Streben eingelassen, das Luxusgüter als unendlich verfügbare Objekte präsentiert, die nur durch das Verlangen des Menschen nach mehr definiert werden. Die Notwendigkeit für diese endlose Anhäufung liegt im Wesen des modernen Menschen, des Homo consumens, der durch die kulturelle Überladung und die soziale Symbolkraft dieser Güter angetrieben wird.
Um das Wachstum des Konsums potenziell unbegrenzt zu gestalten, war es unerlässlich, eine neue Kategorie von »entgrenzten« Gütern zu erschaffen – eine Art von Ware, die sich wie Kapital endlos anhäufen lässt, ohne dass je ein Sättigungspunkt erreicht wird. Grundsätzlich könnte dies auf fast jedes Gut zutreffen, sofern es platzsparend genug ist, doch allein die physische Akkumulation würde nicht ausreichen, um den modernen Homo oeconomicus zu motivieren. Ihm musste eine Erzählung, ein Anreiz, ein Sinn vermittelt werden. Der Konsumismus brauchte mehr als nur Waren; er brauchte eine Konstitution, ein Konzept, das über die Funktion hinaus Bedeutung stiftet. Und hier fand er den perfekten Kandidaten: den Luxus.
Die Idee des Luxus ist so alt wie die Zivilisation selbst. Schon im alten Ägypten trugen Pharaonen Schmuck aus Gold und Lapislazuli, um sich über das Volk zu erheben und ihre Göttlichkeit zu demonstrieren. In Rom symbolisierten exotische Gewürze, edle Stoffe und feinster Wein die Macht und den Wohlstand der Elite. Luxus war stets ein Instrument der Distinktion, ein Mittel, das Überleben und das Notwendige weit hinter sich zu lassen und sich der Verwirklichung eines scheinbar grenzenlosen Lebensideals hinzugeben. Doch der Konsumismus hat diesen alten, erhabenen Luxusgedanken geschickt neu interpretiert und ihm einen zeitgemäßen Anstrich verpasst.
Luxus wurde in der Moderne zu einem Symbol für das ewige Streben nach dem »Mehr«. Der Konsumismus nutzt diese Idee als treibende Kraft, indem er Luxus nicht nur als exklusives Gut, sondern als erreichbares Ideal für alle darstellt. Aus dem distanzierten Ideal für wenige wurde ein allgegenwärtiges Versprechen an die Massen. Luxus ist nun nicht mehr der exklusive Palast eines Königs, sondern das Auto, das Schmuckstück, das Designerstück, das jedem offensteht – vorausgesetzt, er ist bereit, für den nächsten Schritt in Richtung des »besseren Lebens« zu bezahlen. Luxus hat den Weg von der Notwendigkeit zur Sehnsucht beschritten, und der Konsumismus hat ihm eine Allgegenwärtigkeit verliehen, die aus einer jahrtausendealten Faszination nun ein kollektives Streben gemacht hat.
Luxus ist heute mehr als nur ein Symbol für Reichtum. Er ist die Projektion des unendlichen Konsumtraums, ein Versprechen, das niemals ganz erfüllt werden kann und doch immer wieder neu erweckt wird. Der Konsumismus hat Luxus als grenzenloses Gut inszeniert, das, anders als Lebensmittel oder Gebrauchsgüter, nie vollständig befriedigt werden kann. Luxus ist die Erfüllung und das Verlangen zugleich – ein Paradoxon, das die Akkumulation endlos antreibt. Der Wunsch nach Luxus ist nicht stillbar, denn er baut auf einem permanenten Streben nach Distinktion und Selbstüberhöhung auf. Es ist die ultimative Falle, in die der Konsumismus den modernen Menschen gelockt hat: die Idee, dass durch Konsum von Luxus nicht nur Status, sondern auch Erfüllung erreicht werden kann.
So ist Luxus zur Konstitution des Konsumismus geworden, sein Herzschlag und sein Grund, sich unendlich fortzuschreiben. Er hat der Menschheit einen zeitgemäßen Sinn gegeben, der unstillbar ist und dennoch den tiefen Antrieb zur Akkumulation kultiviert. Luxus ist heute kein Ziel mehr, sondern ein Prozess, ein fortwährender Status, der keine Befriedigung kennt und den modernen Homo oeconomicus an die Kette legt, mit der Aussicht, das Unerreichbare doch irgendwie zu besitzen. Der Konsumismus hat Luxus nicht nur neu verpackt – er hat ihn zur ewigen Illusion gemacht, die den modernen Menschen in der Spirale des »Mehr« gefangen hält und ihm stets vorgaukelt, dass der nächste Kauf die endgültige Erfüllung bringen wird. Doch diese bleibt ein Versprechen ohne Ende, denn im Luxus des Konsumismus gibt es kein Ankommen – nur das »Mehr« ist eine Konstante.
Zunächst wurde Luxus entgrenzt. Kein Objekt, keine Produktkategorie war mehr vor dem Luxusgedanken sicher; alles konnte potenziell »luxusfähig« gemacht werden. Die Produktwelt wurde zu einer Leinwand, auf der sich jedes noch so banale Alltagsobjekt in einen Luxusgegenstand verwandeln ließ. Durch das Einflechten technischer Innovationen, ästhetischer Aufwertung und die Anpassung an die Träume und Wünsche einer wohlhabenden Kundschaft erlangte jedes Produkt die Möglichkeit, über seinen ursprünglichen Nutzen hinausgehoben zu werden. Die Produkte wurden ausdifferenziert, in immer spezifischere Formen und Funktionen aufgesplittet – eine Zahncreme, eine Wasserflasche, eine Matratze: Alles wurde in die Sphäre des Luxus integriert. Die einst »universellen« Dinge, die für jeden zugänglich und brauchbar waren, wurden zu distinktiven Einzelstücken transformiert, deren schiere Existenz nun eine Aussage über Status und Einzigartigkeit vermittelte.
Doch dann geschah eine noch tiefere Entfremdung: Der monetäre Wert eines Luxusguts wurde von seinem realen Nutzen getrennt. Die Idee, Luxusgüter als Investitionen zu betrachten, wurde geboren, eine Perspektive, die eigentlich im Widerspruch zur Produktlogik stand. Dinge, die zuvor als pure Ausdrucksform von Stil und Exklusivität existierten, wurden zu Werten mit spekulativem Potenzial. Eine Handtasche, ein Kunstwerk, ein Oldtimer – all das wurde plötzlich nicht mehr nur gekauft, um den eigenen Lebensstil zu betonen, sondern um Kapital zu sichern, um Gewinne zu realisieren. Der Luxus verlor seine intime, sinnliche Dimension und wurde zum Träger ökonomischer Versprechen. Der Investitionsgedanke infiltrierte die Sphäre des Luxus und erhob sie zu einem Spielplatz des Spätkapitalismus, in dem Statussymbole nicht nur Macht, sondern auch Rendite versprachen.
Als sich der Konsum weiterentwickelte und in die Sphäre des Hyperkonsumismus eintauchte, wurde Luxus ein weiteres Mal entgrenzt. Luxus transzendierte die Welt des Materiellen: Es war nun nicht mehr notwendig, ein physisches Objekt zu besitzen, um den Luxusgedanken zu erleben. Er manifestierte sich auch in Dienstleistungen und digitalen Angeboten, die in alle erdenklichen Richtungen ausgeweitet wurden. Ein einfaches Abendessen konnte zu einer luxuriösen Erfahrung stilisiert werden, die durch Zubereitungstechniken und Zutaten zu einem hochpreisigen Event mutierte. Digitale Güter wie NFTs, virtuelle Kunstwerke und exklusive Abonnementsysteme kamen hinzu und eröffneten eine weitere neue Dimension des Luxus. Der Luxusgedanke wurde von der physischen Welt losgelöst und existierte nun in digitalen Räumen, in temporären Erfahrungen und in immateriellen Transaktionen, die die klassischen Statussymbole der Vergangenheit nahezu irrelevant machten.
Das Resultat war eine radikale Neuinterpretation des Luxus, in der jede Erfahrung, jedes Gefühl, jede noch so kleine Facette des Lebens in eine exklusive, hochpreisige Version ihrer selbst transformiert wurde. Luxus wurde zur Idee ohne Grenzen, zu einer Möglichkeit, sich im immerwährenden Streben nach Exklusivität und Individualität zu verlieren – bis das Objekt selbst überflüssig wurde und nur der Gedanke, der Status und das Erlebnis verblieben.
Die Konsequenz aus all jenen Entwicklungen ist zum einen eine ganz neue Form des Massenluxus und des Pseudoluxus23, welche beide zusammen den Konsumismus befeuern, zum anderen eine ungemeine Aufwertung des Luxusbegriffs selbst.
Luxus ist vom »nicht notwendigen Aufwand«, von der »Verschwendung« und dem »den normalen Rahmen übersteigenden« zum Mittelpunkt des Konsumverhaltens, zum Sinn und Zweck des eigenen ökonomischen Lebens und Tuns, zum Stifter von Identität und Spiritualismus geworden; »Ich kaufe, also bin ich« ist in mannigfaltiger Weise zum Credo der Postmoderne aufgestiegen. Luxus ist nicht mehr das Außergewöhnliche, das uns an unsere Werte, an Kunst, an Ästhetik erinnert. Stattdessen ist er zu einem Akt der Selbstbeschwichtigung geworden, eine kleine Beruhigung, ein rascher Trost im Hamsterrad des Alltags. Man »gönnt« sich eben mal ein neues Handy, ein Designerstück in der Farbe des Jahres oder eine angeblich besondere Edition eines Alltagsgegenstands – Accessoires, die in Wirklichkeit kaum Funktion oder Wert besitzen, außer der, den Konsum zu feiern.
Allein wenn man dies aufschreibt, spürt man die Absurdität, die sich dahinter verbirgt. Die digitale Parzelle, die als »Eigentum« in virtuellen Welten verkauft wird, das limitierte Designobjekt, das sofort in Millionenauflage produziert wird, das modische Accessoire in zehn Farben – all das hat nichts mehr mit Luxus zu tun, wie man ihn konzeptionell versteht. Luxus war das Ergebnis bewusster Auswahl, das Eintauchen in etwas Echtes, Seltenes, Kostbares. Doch der heutige »Luxus« ist bloß eine Hülle, eine oberflächliche Spielerei, die nichts Echtes repräsentiert. Er ist zum Pseudobegriff verkommen, ein Abziehbild des Wahren, das dem Konsumismus eine schillernde Rechtfertigung bietet.
So wurde Luxus zum Schlachtruf des Hyperkonsumismus. Er ist ein Begriff, den die Werbung mit glänzenden Bildern auflädt, ein Schlagwort, das suggeriert, man investiere in sich selbst, wenn man sich das »Beste« gönnt. Doch in Wahrheit ist dies eine clevere Maschinerie, die den Konsum bis zur letzten Möglichkeit auszureizen versucht, ohne Rücksicht auf den eigentlichen Nutzen für den Käufer. Luxus ist die Entschuldigung geworden, die jeder für sich selbst akzeptiert, um das System des Konsumrausches weiter zu unterstützen. Denn worin liegt der Wert von zehn teuren Handtaschen, von überteuertem Digitalbesitz oder der hundertsten Sonderedition eines Konsumartikels? Die Antwort ist: Es gibt keinen. Doch indem wir uns selbst vorgaukeln, es handle sich um »Luxus«, entschuldigen wir den inzwischen absurden Drang nach mehr.
In der Moderne ist Luxus damit zum Feigenblatt für eine Art des Konsums geworden, die primär das eigene Leeregefühl kaschiert. Der Konsumismus hat es geschafft, uns glauben zu lassen, dass unser Wert als Menschen in unserer Kaufkraft liegt – dass wir nur dann wertvoll sind, wenn wir konsumieren. Doch worin liegt die Essenz des Menschen, wenn man ihm diese Rolle wegnimmt? Der Konsumismus hat auf diese Frage keine Antwort. Und so verteidigt sich das System durch den Begriff »Luxus«, der uns suggeriert, dass im Konsum das Versprechen auf das »gute Leben« liegt, das wir uns angeblich selbst schulden. Luxus ist damit die letzte Bastion, hinter der sich die Sinnlosigkeit des Konsums versteckt – und die gleichzeitig das ultimative Mittel ist, uns zu immer neuen Käufen zu treiben. Es ist die perfekte Strategie, das sinnlose Spiel des Hyperkonsumismus am Leben zu halten.
Darüber wird zu reden sein, und es wird keine einfache Unterhaltung. Das Thema Hyperkonsumismus, der unaufhörliche Drang nach »mehr« in einer Welt, die längst überfüllt ist, hat etwas von Verfall, von Verwesung. Vielleicht ist der Hyperkonsumismus tatsächlich die letzte, tödliche Ausprägung des Kapitalismus, die ultimative Endstation eines Systems, das ohne Grenzen wuchert und in immer extremeren Formen der Selbsterfüllung nachhallt. Dieser Gedanke ist für den modernen Menschen so beängstigend, dass er fast lieber über das physische Ende der Welt nachdenkt, über apokalyptische Katastrophen und das Verschwinden allen Lebens, als sich einer möglichen »Apokalypse« des Kapitalismus zu stellen. Denn was bleibt, wenn dieses System, das uns Identität, Sinn und Struktur gibt, zerbricht? Den Kapitalismus abzuschaffen, ihn gar enden zu lassen – was könnte absurder, ja geradezu undenkbarer sein? Es wäre, als würde man den Rahmen verlieren, in dem das moderne Leben stattfindet.24
Denn was bliebe dann? Was wäre der Sinn des Lebens, wenn das Sammeln, Horten und Akkumulieren an Bedeutung verlöre? Jahrzehnte, ja Jahrhunderte menschlichen Strebens nach immer mehr, das Anhäufen unzähliger Dinge, die uns das Glück versprechen – all das würde plötzlich entwertet und hohl erscheinen. Dieses »Mehr«, das so tief in das moderne Selbst eingebrannt ist, würde sinnlos, und diese Leere scheint so undenkbar, dass wir lieber weiterkonsumieren und den Abgrund ignorieren, als uns der fundamentalen Sinnkrise zu stellen, die jenseits des Kapitalismus auf uns wartet. Auch der Luxus, dieser ehemals elitäre Ausdruck besonderer Erfüllung, ist mittlerweile ein Symbol für den Überfluss und die Übersättigung geworden. Luxus ist kein seltenes Privileg mehr, sondern ein breit verfügbarer Status, ein Zeichen dafür, dass man es »geschafft« hat, dass man zum »glücklichen Konsumenten« geworden ist. Der Bedeutungswandel des Luxusbegriffs zeigt einen tiefgreifenden Wandel, eine soziale Aufladung und ein Überfluten dessen, was einst die Grenze zwischen Notwendigem und Überflüssigem markierte. Luxus ist heute nicht mehr nur ein Zeichen von Status, sondern Ausdruck eines kulturellen Systems, das den Wert des Lebens am Besitz misst.
Dieser Wandel des Luxusbegriffs ist wie ein stummes Signal, ein Fanal für die Umstrukturierung unserer Gesellschaft. Es ist ein Symbol für die Veränderung in der postmodernen Gesellschaft, die sich über die ersten Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts ausgebreitet hat. Man kann den Finger nicht direkt auf das legen, was geschehen ist, doch etwas ist anders geworden, in einer Art, die gleichzeitig subtil und zutiefst beunruhigend ist. Vielleicht ist es diese unausgesprochene Leere, die sich durch das ständige Streben nach mehr in unser kollektives Bewusstsein frisst. Vielleicht ist es das Wissen, dass all diese Dinge, die wir anhäufen, nicht die versprochene Erfüllung bringen, sondern eine immer tiefere Entfremdung. Diese subtile Verschiebung ist beunruhigend, weil sie uns an den Rand unserer eigenen Lebensweise führt, an die Grenze des kapitalistischen Paradigmas, in dem wir verhaftet sind. Es ist ein leises, aber durchdringendes Gefühl, dass etwas nicht mehr passt, dass das Streben nach Konsum uns weiter entfremdet und isoliert. Wir alle spüren, dass die Dinge nicht mehr so sind wie früher, dass wir das selbst geschaffene Labyrinth aus Konsum, Status und Überfluss immer weiter befeuern und gleichzeitig erkennen, dass es letztlich nirgendwo hinführt.
Die Aufwertung des Luxusbegriffes, dessen obsessive und obstinate Zurschaustellung im Mittelpunkt des menschlichen Lebens der Moderne hat etwas Nagendes, Zersetzendes; Luxus ist heute nicht mehr bloß ein Ausdruck für Exklusivität oder feinen Geschmack, sondern er ist zum Lebensinhalt geworden, zur Obsession, die uns treibt. Es ist, als wäre Luxus unser eigener Nidhöggr.25 Nur dass unser Luxus die Fundamente der sozialen und ökologischen Ordnung unterminiert und gleichzeitig den Geist der Menschen erodiert.