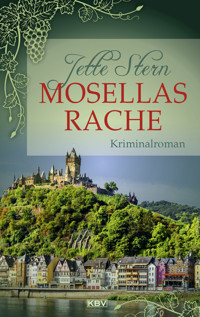
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: KBV Verlags- & Medien GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mosella - Zwei Gästeführerinnen auf Mörderjagd
- Sprache: Deutsch
Ein gutes Tröpfchen im Keller … aber auch eine Leiche! Die beiden Freundinnen Eva Engel und Steffi Schmitz leben da, wo andere Urlaub machen – an der Mosel. Als Gästeführerinnen zeigen sie den Besuchern die schönsten Ecken ihres pittoresken Heimatstädtchens Cochem im Schatten der berühmten Reichsburg. Am letzten Wochenende im August putzt sich der Ort wie jedes Jahr für sein legendäres Weinfest heraus. Alles könnte so schön sein, wenn da nicht Marlene Lenz wäre. Die stadtbekannte Querulantin tyrannisiert mit ihren ständigen Beschimpfungen und dem ewigen Gezänk sowohl Einheimische als auch Gäste. Da ist es nicht verwunderlich, dass sie an einem lauen Sommerabend auf einmal tot auf einer Bank in der idyllischen Altstadt gefunden wird – ausgerechnet von Eva und Steffi, von denen jede insgeheim glaubt, die andere könne beim Ableben der Nörglerin ihre Hand im Spiel gehabt haben. In ihrer Not lassen sie die Tote erst einmal verschwinden. Von da an haben sie die sprichwörtliche Leiche im Keller und sehen sich gezwungen, selbst zu ermitteln. Kein leichtes Unterfangen, denn mehr oder weniger steht ganz Cochem unter Verdacht, weil Marlene mit fast jedem Streit hatte. Dabei stoßen sie auf so manches dunkle Geheimnis, das hinter den friedlichen Fachwerkfassaden des Moselorts schlummert, und geraten schließlich sogar selbst in große Gefahr ... Mord im Moselidyll – Zwei Gästeführerinnen auf Mörderjagd. Ein liebenswertes Duo, das in Serie geht!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Hinter dem Pseudonym Jette Stern verbirgt sich das Autorinnenpaar Carolin Gilbaya und Ulrike Platten-Wirtz. Beide leben in Cochem an der Mosel.
Carolin Gilbaya, geboren 1978, hat deutsche und englische Literatur- und Sprachwissenschaften studiert und anschließend promoviert. Sie arbeitet als Dozentin. Zahlreiche ihrer Kurzgeschichten wurden in Anthologien veröffentlicht. 2015 war sie für den Deutschen Kurzkrimipreis nominiert.
Ulrike Platten-Wirtz, Jahrgang 1965, ist im Hunsrück aufgewachsen. Sie arbeitet als Journalistin für eine unabhängige Tageszeitung. Seit 2011 schreibt sie Kriminalgeschichten und hat seitdem einige Romane veröffentlicht.
Die Verbundenheit zur Region hat das Duo zu einem neuen Projekt inspiriert. Mosellas Rache ist ihr erstes gemeinsames Werk.
Jette Stern
Mosellas Rache
Kriminalroman
Originalausgabe
© 2023 KBV Verlags- und Mediengesellschaft mbH, Hillesheim
www.kbv-verlag.de
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0 65 93 - 998 96-0
Umschlaggestaltung: Ralf Kramp unter Verwendung von
© mh90photo und © neliakott - stock.adobe.com
Lektorat: Nicola Härms, Rheinbach
Druck: CPI books, Ebner & Spiegel GmbH, Ulm
Printed in Germany
Print-ISBN 978-3-95441-665-3
E-Book-ISBN 978-3-95441-673-8
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Epilog
Nachwort
1. Kapitel
Wir sollten über Marlene reden.
Marlene Lenz hatte nur noch wenige Tage zu leben. Doch das wusste sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Auch nicht, dass ihr niemand nachtrauern würde. Was ihr letzten Endes aber auch völlig egal gewesen wäre. Denn Marlene interessierte sich nur für eine einzige Person: sich selbst. Sie stand vor dem Spiegelschrank in ihrem sterilen Hochglanzbadezimmer und betrachtete sich. Sie war zufrieden mit dem, was sie sah, und lächelte.
Nur vielleicht die Lippen noch ein wenig betonen, dachte sie.
Marlene öffnete die Tür des Spiegelschranks und griff nach ihrem chanelroten Lippenstift. Als sie ihn gerade ansetzen wollte, hörte sie es wieder, das verhasste Geräusch, das ihr Blut zum Kochen brachte. Binnen Sekunden schäumte sie vor Wut. Der Lippenstift verirrte sich auf ihre makellosen Vorderzähne und hinterließ dort eine blutrote Spur. Das brachte Marlene erst richtig in Rage. Wie ein geölter Blitz schoss sie durch das angrenzende Schlafzimmer und riss das Fenster ihres von Grund auf sanierten historischen Fachwerkhauses auf.
Unter ihr auf dem Schrombekaulplatz, einer der vielen Sehenswürdigkeiten von Cochem, der idyllischen Kleinstadt an der Mosel, in der sie lebte, war wieder einmal überdeutlich ein lang gezogenes »Oooh« zu hören.
»Die Einheimischen sagen nicht ›Hallo‹ oder ›Guten Tag‹ zueinander, sondern begrüßen sich mit ›Oooh‹, was von: ›Na, wie geht’s?‹, bis: ›Lass mir meine Ruhe‹, alles heißen kann«, scherzte die Gästeführerin, die gerade unter Marlenes offenem Fenster stand und die Gäste dazu aufforderte, den außergewöhnlichen Gruß einmal auszuprobieren.
»Man spricht es nicht als geschlossenes O wie bei dem Wort ›Ofen‹«, dabei spitzte sie demonstrativ ihre Lippen, »sondern mit einem O wie bei dem Wort ›offen‹.«
Im Chor ahmte die Touristenschar die typische Cochemer Begrüßung nach. Da waren von einem schrillen Sopran bis zu einem sonoren Bass alle Facetten der menschlichen Stimme vertreten. Der Chor der unterschiedlichen »Oooohs« hallte über den ganzen Platz.
Doch sofort danach hatte es sich ausgeoooht.
»Welchen Teil meiner Aufforderung, sich nicht mehr hier unter mein Fenster hinzustellen, haben Sie eigentlich nicht verstanden? Sind Sie so dämlich oder tun Sie nur so? Muss ich etwa meine Beschwerde bei der Stadt wiederholen? Sie wissen wohl nicht, wen Sie hier vor sich haben?« Wie Giftpfeile schleuderte Marlene der Stadtführerin unter ihrem Fenster ihre Worte entgegen. »Und Sie, Sie können Ihre Münder wieder zumachen. Stehen da und glotzen wie eine Horde blökender Schafe«, wandte sie sich scharfzüngig an die Touristengruppe.
Mit Spuckefäden zwischen den in der Kontur verunfallten roten Lippen drehte sie sich um und schloss lautstark das Fenster.
»Die jäckisch Tuut«, sagte Steffi Schmitz leise zu sich selbst und schüttelte den Kopf. Die erfahrene Gästeführerin hatte ja schon so einiges erlebt. Aber Marlene Lenz brachte es immer wieder fertig, das moselländische Urgestein auf die Palme zu bringen.
Sichtlich um Fassung bemüht, wandte sie sich wieder ihrer Gruppe zu: »Sie müssen entschuldigen. Eigentlich sind wir Moselaner ein lustiges, gastfreundliches Völkchen. Aber es gibt auch bei uns die sogenannten Kneidela, die immer etwas zu meckern haben.«
Ohne ein weiteres Wort über den Zwischenfall zu verlieren, machte Steffi dann mit ihrer Stadtführung weiter. Schließlich standen sie vor einer der originellsten Sehenswürdigkeiten der Stadt, einem Ensemble aus drei Bronzefiguren. Zwei davon waren einst real existierende Personen: dä Kohhirte Hannes, der letzte Kuhhirte von Cochem, und die Lebenskünstlerin Anna Rosina Reichert, genannt Et Seijnche. Zwischen den beiden stehenden Figuren, die eine Bank aus heimischem Basalt flankierten, saß eine weitere Bronzefigur, die das Trio komplettierte.
»Bei diesem adretten Herrn hier handelt sich um eine Symbolfigur, den Cochemer Schmandelekker. Er steht für das Geschick der Cochemer, sich stets überall den Rahm abzuschöpfen«, fuhr Steffi heiter in ihrem Vortrag fort.
In Frack und Zylinder saß die bronzene Figur an einem Ende der Bank, im Arm einen Topf mit Schmand, in den er zuvor seinen Zeigefinger getaucht hatte, den er nun gierig abschleckte. Die andere Seite der Bank war frei geblieben und diente sowohl Gästen als auch Einheimischen als willkommene Möglichkeit zum Ausruhen und Verweilen. Vom Stadtoberhaupt bis zum Schulkind, vom weinseligen Liebespaar bis zum Zecher, dessen letztes Glas eins zu viel gewesen war, wurde die Bank gern als Ruhepol und Zufluchtsort genutzt.
Steffi Schmitz entging während ihres Vortrags nicht, dass die stadtbekannte Querulantin, Marlene Lenz, das Haus verließ. Vermutlich, um zur Arbeit zu gehen. Steffi sah aus dem Augenwinkel Marlenes roten Chiffonschal leuchten, den sie sommers wie winters trug und der nun durch ihren forschen Schritt wie eine Fahne hinter ihr her wehte.
Die Kirchturmuhr von St. Martin schlug soeben zum achten Mal. Die Stadtführerin war an diesem Morgen besonders früh unterwegs. Das war nicht weiter ungewöhnlich. Wie so oft hatte die Riverbeauty, ein Hotelschiff, im gegenüberliegenden Stadtteil Cond im Hafen angelegt. Die Gäste, meist Senioren, wünschten sich noch vor dem Frühstück eine Führung durch die Innenstadt. Aus gutem Grund, denn in der Regel war die Innenstadt am Vormittag noch relativ unbelebt, und man hatte ausreichend Gelegenheit, sich alles Sehenswerte in Ruhe und ohne von anderen Gästegruppen gestört zu werden, anzuschauen.
Steffis Tour führte über das Pumpengässchen vorbei an den ehemaligen Winzerhäusern. Gerade erklärte sie ihren Gästen, dass bei den Häusern in der Obergasse, in denen früher die Winzer wohnten, der Eingang zum Weinkeller direkt neben dem Hauseingang zu finden war, als sie sah, wie sich eine weitere Gruppe von Gästen näherte. Angeführt von ihrer jungen Lieblingskollegin Eva Engel. Im Vorbeigehen flüsterte Steffi der Jüngeren zu: »Die Luft ist rein. Hab sie gerade aus dem Haus gehen sehen.« Eva nahm die Information mit einem Kopfnicken zur Kenntnis und steuerte sichtlich erleichtert auf die drei Originale am Schrombekaulplatz zu. Eine Frau im hellen Sommerkleid, die sich gerade von ihrem Mann neben dem Schmandelekker sitzend hatte fotografieren lassen, sprang hektisch von ihrem Platz auf, als sie die Touristengruppe auf sich zukommen sah. Sie flüchtete mit ihrem Mann ins gegenüberliegende Altstadtcafé, wohl, um ungestört frühstücken zu können.
2. Kapitel
Kurze Zeit später im rosa Rathaus auf dem Marktplatz.
»Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen unbedingt etwas dagegen tun. Am Ende bewirft sie unsere Gäste noch mit faulen Eiern und Tomaten.«
Carla Sonnenschein schlug mit der flachen Hand auf den historischen Nussbaumschreibtisch aus dem 17. Jahrhundert, der das Büro der Stadtbürgermeisterin schmückte. Ihr gegenüber, auf einem ebenfalls antiken gepolsterten Armlehnstuhl, saß Alma Ritter, die Leiterin des städtischen Fremdenverkehrsamts.
»Die Beschwerden über die Dame häufen sich in letzter Zeit. Wir haben schon überlegt, ob wir die Touristen gar nicht mehr über den Schrombekaulplatz führen sollen. Aber dann …«
»… dann entgehen unseren Gästen die schönen Geschichten über unsere drei Originale«, fiel Sonnenschein der Touristikerin ins Wort. Beide Frauen seufzten und nickten dann bestätigend mit dem Kopf.
Carla Sonnenschein war vor zwei Jahren zur Bürgermeisterin gewählt worden. In der über eintausendjährigen Geschichte von Cochem führte sie nun als allererste Frau die Geschicke der Stadt. Darauf konnte sie zu Recht stolz sein. Und das war sie auch. Natürlich wollte sie ihre Sache besonders gut machen. Keinesfalls sollten ihre Neider ihr nachsagen, dass sie als Frau dieser Aufgabe nicht gewachsen wäre. Da konnte es einfach nicht angehen, dass ihre Arbeit ausgerechnet von solch einer streitsüchtigen Person zunichte gemacht wurde. Man musste etwas unternehmen. Bloß was?
Carla dachte scharf nach. Dabei legte sie Zeige- und Mittelfinger ihrer rechten Hand an ihre Stirn und begann leise das Lied vom Ächte Cochemer Jung vor sich hin zu singen. Alma Ritter wollte die Bürgermeisterin keinesfalls beim Nachdenken stören, und als Carla bei der Strophe angekommen war, in der es heißt: On däm Wein- un Heimatfest, of däm aale Moart, Vill jetronk jeft von dä Gäst, un de Schniß jeschwoart, stand sie leise auf und stellte sich ans Fenster. Es ging auf die Mittagspause zu, und auf dem Marktplatz, der bei ihrer Ankunft im Rathaus noch menschenleer gewesen war, herrschte bereits reges Treiben. Jetzt, wo das Weinfest kurz bevorstand, war die Zeit im Jahr, wo die meisten Touristen die Moselregion besuchten. Alma beobachtete, wie die Gäste nach einem Sitzplatz im Außenbereich eines der beliebten Cafés Ausschau hielten. Freie Stühle waren heiß umkämpft. Kaum wurde ein Tisch frei, war er auch schon wieder besetzt. In Cochem wurde so schnell kein Stuhl kalt. Hin und wieder konnte man sogar kleine Rangeleien beobachten, wie man sie sonst nur von Pennälern auf dem Schulhof kannte. Alma grinste amüsiert, während die Bürgermeisterin noch weitersang, und ließ ihren Blick umherschweifen.
Die meisten Cafés, die den Marktplatz säumten, waren in jüngerer Zeit in den typischen moselländischen Fachwerkhäusern eingerichtet worden. Früher wohnte in diesen sogenannten Bürgerhäusern die bessere Gesellschaft. Der Marktbrunnen aus Basalt mit dem Standbild des heiligen Martin, der seinen Mantel mit einem Bettler teilt, bildete das Zentrum des Platzes.
Jedes Kind kannte die Geschichte des Cochemer Schutzpatrons, die ihren Höhepunkt am 11. November, dem Namenstag des Heiligen, hatte. Es gehörte zur Tradition, dass ein als St. Martin gewandeter Reiter zu Pferd durch die Straßen der Innenstadt zog. Gefolgt von mit Fackeln und selbst gebastelten Laternen ausstaffierten kleinen und großen Kindern, die sich später an einem Feuer am Moselufer versammelten, um einen mit klebrigem Zucker umhüllten Martinsbrezel zu ergattern. Tatsächlich war die Brezel an der Mosel männlich. Daran sowie an weitere sprachliche Eigenheiten der Einheimischen hatte sich Alma, als sie aus dem Schwarzwald nach Cochem gezogen war, erst einmal gewöhnen müssen.
Auch in ihrem Heimatort gab es die Tradition des Martinsumzugs. Alma erinnerte sich gerne daran, wie sie als Kind den Zug durchs Dorf begleitet hatte. Mit einer selbst gebastelten Laterne in der Hand und das Lied vom heiligen Wohltäter und späteren Bischof lauthals mitsingend. Alma unterbrach ihre Gedanken und lauschte auf die Geräusche im Büro. Die Bürgermeisterin schien noch immer in Gedanken, inzwischen summte sie die Melodie von O Mosella. Na, das konnte ja heiter werden. Wenn die Bürgermeisterin sich jetzt alle traditionellen Cochemer Trinklieder zur Brust nahm, bevor sie sich wieder zu Wort meldete, musste Alma sich auf einen langen Tag einstellen. Dabei hatte ihr Magen bereits angefangen zu knurren. Gegen zwölf Uhr machte sie für gewöhnlich Mittagspause, und sie hatte sich daran gewöhnt, um diese Zeit etwas zu essen zu bekommen. Wenn ihr Hunger zu groß werden sollte, würde sie Carlas Sekretärin wohl um ein Schmandbrot bitten müssen.
Vom Marktplatz her war jetzt das Glockenspiel zu hören, das der ortsansässige Optiker auf eigene Kosten hatte anbringen lassen, um Gäste, Einheimische und letztlich natürlich auch sich selbst zu erfreuen. Viermal am Tag ertönten die Glocken in bekannten volkstümlichen Weisen. Wenn Alma sich nicht täuschte, spielte gerade: Wenn die bunten Fahnen wehen, geht die Fahrt wohl übers Meer …
Die Gäste blieben erstaunt stehen und suchten nach dem Ort, von dem die Musik kam. Sobald sie die Glocken am Giebel des Fachwerkhauses entdeckten, lächelten sie zufrieden und setzten ihren Weg durch die historische Altstadt fort. Alma hatte ihre Ausbildung zur Tourismuskauffrau in ihrer Heimat absolviert und hatte sich zum Berufseinstieg gewünscht, in einer sowohl landschaftlich reizvollen wie touristisch attraktiven Region zu arbeiten. Das Angebot von der Mosel kam ihr da mehr als gelegen. Alma liebte die Landschaft mit ihren besonderen Reizen, die die Region um Hunsrück, Eifel und Mosel zu bieten hatte. Denn auch die Weite der Moselhöhen, rechts- und linksseitig des Flusses, mochte sie sehr. In ihrer Freizeit erwanderte sie gerne die neu angelegten Klettersteige und Traumpfädchen. Im Büro der Tourist-Information herrschte ein angenehmes Arbeitsklima, und auch mit der Stadtbürgermeisterin verstand sie sich gut. Dass sie hier mit Kilian auch noch ihrer großen Liebe begegnet war, machte die Sache nun geradezu perfekt. Seit einiger Zeit waren Alma und der Jungwinzer nun schon ein Paar. Kilian betrieb im Nachbarort neben dem Weinbau auch noch eine kleine Vinothek, in der Alma, sofern es ihre Zeit zuließ, gern aushalf und die Gäste bewirtete. Eigentlich gab es für sie derzeit überhaupt keinen Grund, unzufrieden zu sein. Und dennoch hatte sie gelegentlich das unangenehme Gefühl, dass ihr Lieblingsstädtchen in der Hochsaison aus allen Nähten zu platzen drohte.
Im Grunde genommen wäre auch das ein durchaus lösbares Problem gewesen, wären da nicht die fehlenden Fachkräfte. Alle Welt jammerte über den Personalmangel in der Gastronomie, und genau das bekamen auch Alma und ihre Kollegen zu spüren. Eigentlich hatte Alma sich zum Ziel gesetzt, die bislang von Ostern bis Silvester dauernde Saison an der Mosel auf das ganze Kalenderjahr auszudehnen. Doch wie sollte das gelingen, wenn keiner den Job machen wollte? Einige Betriebe hatten schon laut darüber nachgedacht, auf Selbstbedienung umzustellen. Doch Alma hielt das für keine gute Idee. Vor allem für alteingesessene Restaurants und Cafés war das ein Unding. Die Gäste legten allergrößten Wert auf freundliche und zuvorkommende Bedienung. Diesen Service konnte auch kein Roboter übernehmen, wie der ein oder andere Kollege bei der letzten Sitzung der Gastronomen vorgeschlagen hatte.
Wenn sich jetzt allerdings herumsprach, wie Marlene Lenz hier die Touristen empfing, brauchte sie sich darüber bald nicht mehr den Kopf zu zerbrechen. Es durfte nicht so weit kommen, dass eine wie Marlene Lenz ihr die Gäste vergraulte. Dagegen musste man angehen. Koste es, was es wolle. Es dauerte noch eine ganze Weile, bis Carla Sonnenschein ihre musikalische Meditation beendete.
»Also, welche Möglichkeit haben wir noch, dieser … dieser … sagen wir, missgünstigen Frau … ihre Bosheit auszutreiben?«
Alma Ritter hatte auf diese Frage leider auch keine Antwort und zog ratlos die Schultern hoch. »Ehrlich gesagt habe ich gedacht, dass der freundliche Brief, den Sie ihr mit der guten Flasche Riesling Hochgewächs vom Valwiger Herrenberg haben zukommen lassen, seinen Zweck erfüllen würde. Aber offenbar habe ich mich getäuscht.«
»Ja, leider«, seufzte die Stadtbürgermeisterin. »Vermutlich verschmäht die Dame am Ende unseren guten Moselriesling«, und sie konstatierte trocken: »Was erklären würde, warum sie so boshaft ist.«
Die beiden Frauen tauschten ratlose Blicke. Dass eine einzige Person eine ganze Stadt in ein solch schlechtes Licht rückte! Mehr noch, man konnte sagen, sie brachte die idyllische Kleinstadt sogar in Verruf. Und das war doch mehr als unfair. Man war schließlich daran interessiert, auch weiterhin die Liste der beliebtesten Ferienorte Deutschlands anzuführen. Erst kürzlich war Cochem bundesweit zur gastfreundlichsten Kleinstadt gekürt worden. »Wenn das so weitergeht, können wir uns solche Auszeichnungen in Zukunft abschminken«, befürchtete Ritter.
Sonnenschein nickte. Sie zögerte kurz, bevor sie endlich mit dem herausrückte, über das sie zuvor so lange nachgedacht hatte. Sie sprach Alma Ritter damit geradezu aus der Seele, als sie sagte: »Da gibt’s nur eins, Alma. Marlene Lenz muss weg.«
3. Kapitel
Marlene mochte ihren Schreibtisch. Er war ihr eine willkommene Barriere zu dem Pöbel, mit dem sie es zu tun hatte – wie sie ihre »Kundschaft« so gerne mit der ihr eigenen unnachahmlichen Liebenswürdigkeit betitelte. Gerade war wieder so eine davon dagewesen. Silvia Meier. Wollte ihr doch tatsächlich weismachen, dass es für ihre Behörde viel günstiger sei, wenn ihre mittlerweile fünfundzwanzigjährige Tochter Tanja zusammen mit dem Rest der sechsköpfigen Familie eine größere gemeinsame Wohnung bezöge anstelle von zwei kleineren. Ja, wo kämen wir denn da hin, wenn ihr diese Bittstellerinnen und Bittsteller nun auf einmal mit gesundem Menschenverstand kamen! Es gab schließlich Regeln! Davon lebte doch jede Behörde. Von Struktur und Ordnung. Von Recht und Gesetz.
Zwei unterschiedliche Bedarfsgemeinschaften sind eben nun mal zwei unterschiedliche Bedarfsgemeinschaften! Marlene hatte ihre Vorschriften. Und da hielt sie sich auch eisern dran. Schluss! Aus! Basta! Hier kann doch nicht jeder Depp einfach machen, was er will! Das hatte sie auch der ach so klugen Frau Meier – in Wahrheit wusste die Dame noch nicht einmal, was eine Bedarfsgemeinschaft überhaupt war – mehr als deutlich klargemacht.
Hach, es müsste einfach mehr intelligente und universitätsgeprägte Menschen wie sie selbst geben, dachte Marlene. Aber diese Spezies war rar gesät. Stattdessen hatte sie es den ganzen Tag mit unsachlichem Volk zu tun. Sowohl aufseiten ihrer Kunden als auch unter den vom Helfersyndrom befallenen lieben Kollegen. Wie gut, dass sie, Marlene, das letzte Bollwerk der Prinzipien darstellte. Eine Lichtgestalt auf weiter Flur beziehungsweise in den weiten Fluren ihres Jobcenters.
Dieses Bild brachte Marlene kurz dazu, sich selbst in Gedanken ein gütiges Lächeln zu schenken, bevor sie wieder über den Termin von eben sinnierte. Diese Frau Meier, also wirklich, was wollte die denn überhaupt? Hatte die gute Frau ihr jetzt doch dreißig Minuten wertvolle Arbeitszeit gestohlen, nur um ihr etwas von Familienzusammenhalt vorzufaseln. Von Gefühlsduseleien dieser Art stand aber nichts in Marlenes Statuten. Und für das Familienidyll anderer Leute war sie ja nun wirklich nicht zuständig. Das wäre ja noch schöner. Schließlich kümmerte sich auch keiner um ihr Idyll. Ganz im Gegenteil. Trampelten doch täglich Horden von einfältigen Touristen nebst noch einfältigeren Gästeführern unter ihren Fenstern vorbei. Und der Mann, der sie anbetete, war zu feige, seine Angetraute zu verlassen.
»Ich bin ja auch wirklich überall nur von Kretins umzingelt. Einmal mit Profis arbeiten!«, rief sie laut aus, sodass es quer durch ihr großes Büro oben unter dem Spitzdach des Gebäudes hallte.
Durch die sechs großen Dachfenster über sich konnte sie den Himmel sehen. Das gefiel ihr. Es hatte so etwas Erhabenes. Das fand sie angemessen. Zusammen mit den acht Gaubenfenstern, die sie in dem großen, lichtdurchfluteten Raum umgaben, wirkte er fast wie eine Kathedrale. Mitten hinein in diese Herrlichkeit sprach sie trotzig: »Na wartet, ihr Stümper alle! Euch zeig ich’s! Ihr werdet schon noch sehen, was ihr davon habt, euch mit einer Marlene Lenz anzulegen!«
Diese Selbstmotivierung und die damit verbundenen Aussichten stimmten sie doch gleich wieder viel fröhlicher, genau wie die Tatsache, dass mit Silvia Meiers Unterlagen die Seite der Ablage auf ihrem Schreibtisch, die die abgelehnten Anträge enthielt, wieder um einen gewachsen war. Und die der angenommenen nun bei Weitem überragte. Da konnte die Delinquentin noch so sehr jammern und heulen.
Marlene ließ ihren Blick aus den Gaubenfenstern über die Dächer der Stadt schweifen. Hinter der Rückfassade des modernen Sparkassengebäudes blieb er zunächst an dem stattlichen Turm der katholischen Pfarrkirche St. Martin hängen. Seine drei barocken, kugelförmigen Ausbuchtungen glänzten in der Sonne. An den Stammtischen in den heimischen Wirtschaften stritten sich die sogenannten Fachleute gerne mal darüber, ob es »Knubbele« oder »Zwiwelle« waren oder doch, wie sie selbst mit ihren profunden historischen Kenntnissen vermutete, eine Welsche Haube.
Marlenes bernsteinfarbene Augen wanderten weiter bis hinauf zur Reichsburg. Gerade brachen sich die Strahlen der Sonne durch die Wolken Bahn. Pünktlich zum Feierabend. Das Mosaik des heiligen Christopherus auf dem Turm der Burg reflektierte das helle Licht. Die Reichsburg Cochem hatte eine bewegte Geschichte hinter sich. Um das Jahr 1000 erbaut, von den Franzosen bis auf die Grundmauern zerstört und von dem Berliner Industriellen Louis Ravené liebevoll wiederaufgebaut, gehörte die Burg seit 1978 den Cochemer Bürgerinnen und Bürgern. Quasi jedem ein kleines Stück. Und Marlene fand, sie selbst hätte ein besonders großes verdient. Hach, es ist ja auch kein Wunder, dass Fotos unserer schönen Burg mittlerweile häufiger auf Instagram und Co. hochgeladen werden als welche vom Brandenburger Tor, dachte Marlene voll Stolz. Es war aber auch einfach so schön hier. Wenn … ja, wenn doch bloß nicht alle diese lästigen Menschen um sie herum wären. Sie musste sich selbst zum Ausgleich dafür etwas Gutes tun, ein bisschen ungestörte, achtsame Me Time.
Und Marlene wusste auch schon ganz genau, womit sie gleich gebührend ihren Feierabend einläuten wollte. Mit einem Stück ihres Lieblingskuchens, der Roter-Weinbergspfirsich-Torte, das sie sich mit nach Hause nehmen würde. Die heimische Frucht des roten Weinbergspfirsichs hatte es Marlene in allen möglichen Variationen angetan, ob süß als Kompott, Marmelade oder eben als eingelegte Früchte oben auf der köstlichen Torte. Gerne auch herzhaft als Chutney oder Essig. Die kleine, äußerlich vielleicht eher unscheinbare Frucht hatte es nämlich in sich! Außen zwar grau, aber innen tief dunkelrot leuchtend und ebenso hocharomatisch wie schön anzuschauen, war sie längst ein regionaler Meilenstein der moselländischen Kulinarik geworden. Auf zahlreichen, eigens für das besondere Früchtchen erdachten Festen, wurde der rote Weinbergspfirsich gefeiert. Und seine perfekten prall-festen Rundungen erinnerten Marlene letzten Endes nur wiederum allzu gerne an sich selbst und ihren makellosen Körper. Vielleicht würde sie sich sogar noch einen Weinbergspfirsichlikör gönnen. Oder einen Moselkir, die Antwort auf Kir Royal, nur eben mit Weinbergspfirsich statt Cassis.
Und dann, ja, dann würde sie zwei neue Beschwerdebriefe an ihre allerliebsten Hassobjekte schreiben. Oh ja! Der erste würde an Alma Ritter gehen. Dieses junge zugezogene Ding, was wollte die ihr denn hier in Cochem, Marlenes höchsteigener Geburtsstadt, für Vorschriften machen?
»Aber Frau Lenz«, hatte sie neulich zu ihr gesagt – das musste man sich mal vorstellen –, »aber Frau Lenz, wir können doch nicht wegen Ihnen alle Stadtführungen umleiten!«
Ja, und wieso denn nicht, wer war denn schließlich zuerst da gewesen? Marlene und ihr liebevoll und äußerst kostspielig renoviertes, denkmalgeschütztes Winzerhaus oder dieses Pack, das die Straßen vermüllte und verstopfte?
Der zweite Brief, und bei diesem ging sie erst recht bereits in Gedanken gleich in den Angriffsmodus über, war natürlich an den ihr größten Dorn im Auge adressiert. An die Stadtbürgermeisterin Carla Sonnenschein. Wirklich, Marlene schüttelte sich bei dem Gedanken. Wie konnte man nur so ein Menschenfreund sein wie diese Frau? Und wie konnte man so fröhlich sein? Ekelhaft! Und dann hatte sie auch noch immer ein Lied auf den Lippen! Immer, wirklich immer sang sie irgendwas. Pah, dachte Marlene verächtlich, so eine naive Närrin! Wenn ich so ein großes Herz und so ein offenes Ohr für andere Leute hätte, dann hätte ich ja überhaupt keine Zeit und Freundlichkeit mehr übrig für die wichtigste Person auf diesem Planeten: mich selbst!
Und um das Ganze noch zu toppen, war Carla Sonnenschein wahrscheinlich die einzige Person der Stadt, deren Büro noch schöner war als ihres. Und das wurmte Marlene gewaltig. In diesem Moment flötete es ein munteres »Hallo–ooh« auf dem Flur.
Ohne auf Marlenes Herein nach dem Anklopfen zu warten, steckte ihre Kollegin Jenny den Kopf durch die Tür. Na toll, noch so eine von der Gutmenschfraktion. Die hat mir jetzt gerade noch gefehlt! Trotzdem versuchte Marlene, entgegen ihrer sonstigen Art, ihren Unmut über das Auftauchen der jungen Kollegin etwas zu verbergen, denn Jenny war an sich schon ganz praktisch. Sie war Marlenes Schoßhündchen. Wenn Marlene ihr etwas auftrug, erledigte sie es brav, im übertragenen Sinne jedes Stöckchen apportierend, das Marlene ihr zuwarf. Natürlich konnte man sie sich nur mit einfachen Dingen befassen lassen. Aber immerhin, so hatte sich Marlene diesen lästigen Kleinkram gespart.
Und die einfältige kleine blonde Maus war auch noch dankbar dafür. Unter ihrem gerade geschnittenen Pony schien sie Marlene anzuhimmeln, was diese wiederum sehr gut verstehen konnte.
»Na, wie war dein Tag?« Die Kollegin sah sie aus ihren braven blauen Augen an, die scheu hinter einer dieser Omabrillen mit übergroßem, dickem Hornrand hervorschauten, die heute bei den jungen Frauen anscheinend wieder so modern waren.
»Wie immer. Sehr produktiv und effektiv«, antwortete Marlene dann doch schärfer als geplant.
»Hm, ja, natürlich, natürlich, klar«, kam es gleich beschwichtigend von der jungen Kollegin zurück. »Ich wollte dich fragen …«
»Dann frag doch direkt«, unterbrach Marlene sie belehrend, »du bist ja schon wie unsere Kunden, die auch immer erst sagen, sie hätten da mal eine Frage, bevor sie dann umständlich mit der Sprache herausrücken. Das ist doch Zeitverschwendung. Und es nervt.«
»Äh, ja, sicher, du hast recht, entschuldige.«
»Und was sage ich dir noch immer, Jenny-Maus? Du darfst dich nicht immer für alles entschuldigen. Selbst bei mir nicht. Das zeugt von Unsicherheit. Aber was wolltest du denn jetzt fragen?« Marlene versuchte sich an einem etwas weniger überheblichen Tonfall, was ihr aber kaum gelang.
»Äh, ja, also, ich wollte nur fragen, ob du Lust hättest auf ein Feierabend-Sektchen oder -Aperölchen. Ich lade dich ein.«
In die etwas zu lange peinliche Stille, die nach Jennys freundlichem Angebot entstand, sagte Marlene: »Also, eigentlich passt mir das heute gar nicht. Ich muss noch ein paar wichtige Sachen erledigen. Aber wenn du mich so lieb bittest …« Man muss bei seinen Untergebenen ja auch mal über seinen Schatten springen können, dachte sie und gab sich gönnerhaft. »Na gut, aber nur für ein halbes Stündchen.« Wohl wissend, dass bei moselländischer Geselligkeit das berüchtigte halbe Stündchen leicht zu einem ganzen Abend werden konnte, meistens begleitet von gutem Wein. Das Moselaner Stündchen war schon bei so manch einem ziemlich ausgeartet und hatte nicht selten in einer Dummheit geendet. Das würde ihr aber keinesfalls passieren. Und heute schon gar nicht, da war sich Marlene sicher, zu verlockend war die Aussicht, ihrem Ärger über die Gästescharen erneut schriftlich Luft zu machen. So konnte sie schließlich die berühmten zwei Fliegen mit der einen Klappe schlagen, oder, wie die Engländer es sagten: »To kill two birds with one stone«, was ihr viel besser gefiel.
Durch das Schreiben der Briefe ließ sie auch den Frust über die nun schon fast sechs Monate andauernde Zauderhaftigkeit ihres Geliebten heraus, der sie jetzt ein Ende bereiten würde. Genauso wie der Plage unter ihrem Fenster. Aber wenn sie vor ihren heroischen Taten ihren Drink nicht selbst bezahlen musste, tant mieux. »Ja, dann komm, Jenny-Maus, was stehst du hier noch rum?«
Gekonnt und betont lässig warf sich Marlene ihren schimmernden roten Lieblingsschal um den Hals und marschierte schnurstracks in Richtung Tür.
4. Kapitel
Am Carlfritz-Nicolay-Platz traf Steffi Schmitz wieder auf Eva Engel. Die Stadtführerin hatte ihre Gästegruppe bis zum Aufgang der Moselbrücke begleitet, damit die älteren Herrschaften aus der Schweiz, denen sie zuvor die Stadt gezeigt hatte, auch ganz sicher an ihrem Hotelschiff ankamen. Das Schiff, das auf der anderen Flussseite vor Anker lag, würden sie hoffentlich alleine finden. Zurzeit hielt sich der Andrang im Hafen ja noch in Grenzen. Steffi bemerkte, dass erst zwei der acht Liegeplätze besetzt waren. Es sollte also kein Problem sein, den richtigen Dampfer auszumachen, dachte sie und ging dann freudig auf ihre Kollegin zu.
»Hast du noch Lust auf einen Kaffee im Germania?«, fragte sie Eva.
»Auch auf zwei«, antwortete diese augenzwinkernd.
Steffi grinste. Sie wusste genau, was es bedeutete, wenn Eva keine weiteren Termine, sprich, ausreichend Zeit zum Kaffeetrinken hatte. Das Germania war ein beliebtes Café in der Nähe der Brücke, direkt an der Moselpromenade gelegen, und bot nicht nur ausgezeichnete Kaffee- und Kuchenspezialitäten, sondern war auch an ein Weingut gekoppelt, das einen sehr guten Jahrgangssekt herstellte. Davon hatten Steffi und Eva sich schon mehrfach selbst überzeugen können. Der Gedanke an das prickelnde Getränk beflügelte Steffi augenblicklich. Geärgert hatte sie sich an diesem Morgen ja wohl schon zur Genüge. Da kam ihr ein Gläschen Sekt doch gerade recht. Auch wenn sie um diese Uhrzeit normalerweise noch keinen Alkohol zu sich nahm.
Sie hakte sich bei der Freundin unter und steuerte mit ihr schnurstracks auf den Eingang zu, den man über eine überdachte Terrasse erreichte.
Im Außenbereich herrschte Hochbetrieb. Die Hotelgäste genossen das ausgiebige Frühstück des Hauses, das hier für Langschläfer sogar bis dreizehn Uhr serviert wurde. Steffi und Eva betraten gemeinsam den Innenraum. Steffi sah auf den ersten Blick, dass ihr Stammplatz in der Nähe des Thekenbereichs noch frei war, aber Eva zog sie weiter. Ein paar Treppenstufen höher gab es einen größeren Raum, dessen rückseitige Fenster auf die belebte Einkaufsstraße hinausgingen. Im vorderen Bereich konnte man durch einen offenen Raumteiler den Eingang im Blick behalten. Hier oben waren nur wenige Tische besetzt. Die meisten Gäste nutzten das gute Wetter, um draußen zu frühstücken.
Eva entschied sich für einen kleinen runden Tisch, an dem man zwar ruhig saß, aber dennoch einen Überblick darüber hatte, wer das Café betrat. Kaum hatten die beiden Platz genommen, wetterte sie auch schon los: »Lass dich von dem Schinnòotz aus der Oberstadt bloß nicht fertigmachen.« Eva hatte absichtlich einen Begriff aus dem Moselfränkischen gebraucht, obwohl sie es im Gegensatz zu Steffi nie sprach. Aber Schinnòotz, das Wort gefiel ihr. Es beschrieb einfach so schön treffend Marlenes ganzen Charakter. Sie war eben Luder, Biest und böses Weib in einer Person. Eva sah ihre Kollegin herausfordernd an. Steffi war ja nicht die Einzige, die derartige Beschimpfungen, wie sie sie am Vormittag wieder erlebt hatte, aushalten musste. Anderen Gästeführern ging es genauso. Auch Eva.
»Du hast recht. Eigentlich sollten wir uns das nicht gefallen lassen«, entgegnete Steffi. »Aber weißt du was, ich habe jetzt überhaupt keine Lust, mir davon den ganzen Tag verderben zu lassen. Lass uns zuerst was trinken.«
Im selben Moment kam Mandy an den Tisch, um die Bestellung aufzunehmen. »Zweimal brut wie immer oder vorher noch einen Kaffee?«, schmunzelte sie.
»Nö, auf den Kaffee verzichten wir heute«, bestimmte Eva.
»Alles klar. Dann bringe ich den Schampus sofort«, scherzte die Bedienung und verschwand hinter der Theke.
Keine zwei Minuten später war sie zurück und stellte die Gläser mit dem goldig perlenden Inhalt auf den Tisch.
»Na dann, prost«, sagte Steffi und stieß mit Eva an, bevor sie den ersten Schluck nahm. »Einfach köstlich, das Zeug. Könnt ich mich glatt dran gewöhnen.«
»Da sagst du was. Jedenfalls köstlicher als mein Vormittag«, entgegnete Eva.
»Was ist passiert?«, fragte Steffi neugierig. Ihr war bei der Auswahl des Tisches schon der Verdacht gekommen, dass Eva ihr etwas mitteilen wollte, das nicht für





























