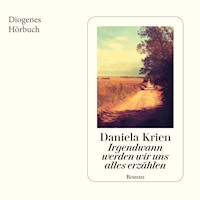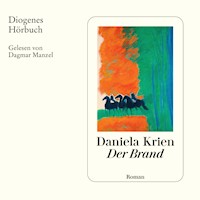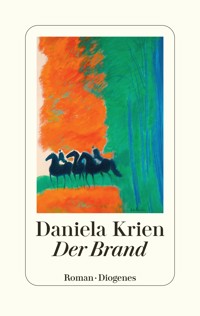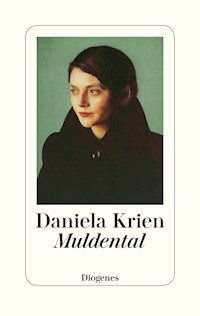
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jeder Umbruch fordert Opfer. Auch eine friedliche Revolution. Daniela Krien erzählt von Menschen, deren Leben an einem Kontrapunkt der Geschichte ins Wanken gerieten. Sie erzählt von Orientierungslosigkeit und tiefer Verzweiflung. Doch diese Romanminiaturen gehen über das Schicksal des Einzelnen hinaus; sie zeichnen ein Bild des Menschen von heute. Ein Buch über das Trotzdem-den-Kopf-über-Wasser-Halten, über das Trotzdem-Weitermachen, über das Es-trotzdem-Schaffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Daniela Krien
Muldental
Erzählungen
Diogenes
Ich begreife nicht, wie es in dieser Welt gleichgültige
Menschen, nicht zergrämte Seelen, nicht brennende
Herzen, nicht schwingende Empfindungen, nicht
weinende Tränen geben kann.
E.M. Cioran: Das Buch der Täuschungen
Vorwort
Als ich 2012 mit der Arbeit an Muldental begann, hatte ich ein kleines Notizheft voller Geschichten vor mir liegen. Es waren Skizzen von Lebensdramen, manchmal in nur einem Satz zusammengefasst. Überschuldeter Handwerker begeht Selbstmord, stand da zum Beispiel.
Oder: Ehepartner entpuppt sich als Stasi-Spitzel.
Oder: Junge Frau entscheidet sich für Spätabtreibung.
Keine dieser Notizen war Erfindung. Ich hatte sie über einen längeren Zeitraum gesammelt. Sie waren mir zugetragen worden, ich hatte sie aufgeschnappt oder in einer Zeitung gefunden. Zehn dieser Randnotizen, wie wir sie alle täglich hören oder lesen, bildeten schließlich die Grundlage dieses Buchs, das sich vor allem mit dem Kampf vor dem Fall beschäftigt.
Schicksal oder Schuld?, hatte ich hinter dem letzten Eintrag im Heft notiert.
Denn hier, in der Mitte Europas, in einer liberalen Gesellschaftsordnung des 21. Jahrhunderts, wo der Mensch in ein friedliches und materiell gesichertes Leben hineingeboren wird, trägt er die unausgesprochene Schuld für sein Versagen allein. Kein Gott, kein Kollektiv, keine übergeordnete Macht nimmt sie ihm ab. Frei wie nie zuvor trifft das Individuum seine Entscheidungen. Unter dem Diktat der Selbstoptimierung darf es keinen Stillstand geben. Aufgeben ist keine Option.
Wir lesen gern vom Scheitern – wenn am Ende ein Sieg steht. Wir lieben Geschichten über Menschen, die allen Widerständen zum Trotz das Beste aus ihrem Leben gemacht haben.
Meine Helden sind keine Gewinner. Dennoch finden einige von ihnen ihr Glück. Aber auch jene, deren Schicksal ihre Kräfte übersteigt, haben eine Stimme im großen Menschheitslied. Und auch sie verdienen einen Platz in der Literatur.
Daniela Krien, im November 2019
Muldental
Das Mühlenhaus steht schon lange am Rand der breiten Aue, fast zweihundert Jahre. Wenn Hans Novacek in den Vorraum trat, schaute er stets nach links. Dieser Blick war verlässlich. Dort, hinter einer Tür, wo sich früher einmal die Mahlstube eines Müllers befunden hatte, lagert auf breiten Regalen die Keramikkunst Hans Novaceks. Sie stammt aus einer Zeit, als die Leute von weither kamen, um sie zu sehen. Manches Stück schaffte es sogar über die Grenze bis in den Westen. Doch die meisten Arbeiten sind immer noch da, und die Tür hat verschlossen zu sein.
In die ebenerdige Küche dringt kaum Licht von außen. Auf dem breiten Fenstersims reihen sich große, kunstvoll bemalte Keramikgefäße, Spinnennetze hängen in den Ecken, und ein modrig feuchter Geruch beherrscht den Raum selbst im Sommer. Im Jahr der letzten großen Flut ging das Wasser der Mulde bis zum ersten Obergeschoss. Doch das Haus hat schon viele Fluten überstanden.
»Marie! Marie!«
Marie schaut in Richtung der Rufe; sie steigt von der Leiter und wischt sich die Hände an der Schürze ab. Ohne Eile geht sie ins Haus, durchquert die Küche bis zu dem gewölbten Durchgang, das Zimmer dahinter liegt eine Stufe höher.
»Was machst du da draußen?«, fragt Hans.
»Ich pflücke Kirschen.«
»Noch bin ich nicht tot, Marie, noch nicht!«
»Das weiß ich.«
»Schieb mich in die Küche rüber, mir ist kalt.«
»Es sind über zwanzig Grad hier drinnen. Wärmer wird es nicht«, sagt sie.
Ihr Gesicht bleibt ausdruckslos. Sie blickt zur Wanduhr, dann aus dem Fenster. Davor nichts als dichtes Gebüsch. Es ist bald Mittag und trotzdem dunkel im Zimmer.
»Mach Licht, Marie!«
Hans legt die Hände auf die Räder des Rollstuhls und schiebt sich langsam vorwärts.
»Gibt es bald Essen?«, fragt er.
»In einer Stunde. Erst mach ich den Eimer mit Kirschen voll.« Ihr Blick schweift einmal ringsum. Auch hier stehen die Fenstersimse voller Vasen, Krüge und Skulpturen. Spinnen haben dazwischen ihre Netze gewebt, Fliegen sich darin verfangen und gequält, bis sie nicht mehr zappelten.
»Hier staubt keiner ab, hier soll alles bleiben, wie es ist.«
Jedes Mal, wenn sie Hans an den Platz vorm Kamin fährt, von wo aus er fernsieht oder Zeitung liest oder sie durch einen eigens für ihn geschaffenen Durchbruch in der Wand, der auch als Durchreiche dient, bei der Küchenarbeit überwacht, spricht er dieselben Worte. Und jedes Mal antwortet sie ihm: »Nein. Hier staubt keiner ab.«
Schweigend nimmt sie eine Wolldecke aus einer Kommode und legt sie ihm über die Beine.
In dem Zimmer darüber war die Familie des Müllers gestorben, Vater, Mutter und die beiden Töchter, zwölf und vierzehn Jahre alt. Zuerst erschoss der Müller die Kinder, dann die Frau und schließlich sich selbst, aber das ist schon lange her, 1945, kurz bevor die Russen kamen. Den Parteiausweis des Müllers und die restlichen Insignien seiner kümmerlichen Macht fand man geordnet auf dem Esstisch.
Solange er denken kann, wohnt Hans in diesem Haus. Er meint, mit etwa vier das Denken begonnen zu haben.
»Was macht der Junge in der Werkstatt drüben?«, fragt er.
»Das weißt du genau.«
»Kommt auch mal was Gescheites dabei heraus?«
»Die Leute mögen seine Sachen.«
»Die Leute haben keine Ahnung.«
»Letzte Woche auf dem Mittelaltermarkt hat er guten Umsatz gemacht.«
»Ich sag’s doch. Seit der Wende sind die Leute noch dümmer geworden, als sie vorher schon waren. Mittelaltermarkt – so ein Quatsch.«
Marie verlässt den Raum. Sie atmet laut aus, dann steigt sie erneut auf die Leiter, um Kirschen zu pflücken. Schweißperlen treten auf ihre Stirn.
Es ist ein heißer Tag.
Auch an dem Tag im Jahr 1983, als die zwei Männer zum ersten Mal gekommen waren, hatte Marie Kirschen gepflückt und geschwitzt. Ihr üppiges blondes Haar hatte sie mit einem Tuch zurückgebunden.
»Guten Tag, Frau Novacek«, sagten die Männer, »haben Sie einen Moment für uns?«
Sie sahen zu ihr hinauf, dann schauten sie sich aufmerksam um und warteten. Marie war die Leiter heruntergekommen, hatte sich Hände und Stirn an einem Handtuch abgewischt.
Noch bevor sie fragen konnte, sagte einer der Männer: »Keine Sorge, wir beanspruchen Ihre Zeit nicht lange. Wir wollen nur eine Kleinigkeit mit Ihnen besprechen.«
Am Ufer des Bachs blühten Lilien. Auf alten Baumstümpfen thronten die Skulpturen ihres Mannes, der an diesem Tag in die Stadt gefahren war. Sie saßen am Gartentisch und tranken Kaffee aus dem Westen.
»Viele Leute gehen bei Ihnen ein und aus«, sagte der eine bedeutungsvoll.
»Wir wüssten gern, welche«, fügte der andere hinzu.
Sie ließ Zucker in die Tasse rieseln und schaute unbewegt.
»Ihr Mann ist krank. Wir wissen das. Er braucht Medikamente, nicht wahr?«
In einer Schale lagen frische Kirschen; sie steckte sich eine nach der anderen in den Mund und spuckte die Kerne in die Wiese. Sie hatte das Gefühl, als umschwirrten Insekten sie in Scharen. Ein stechender Schmerz an ihrem rechten Fuß ließ sie zusammenzucken. Sie sah, dass er voller Ameisen war. Hastig streifte sie sie mit dem linken ab.
»Sie sind eine vernünftige Frau, Frau Novacek«, sagte einer der Männer. »Ihre Eltern gehören zu unseren Besten. Gute Genossen, alle beide. Sie sorgen sich um Sie.«
Gelb, weiß und orange blühten die Lilien. Ihr Duft wehte zu ihnen herüber und vermischte sich mit dem scharfen Qualm von Zigaretten. Marie krümmte ihre Zehen und ließ wieder locker. Tat es noch einmal und noch einmal. Fand einen Rhythmus, der sie kurzzeitig beruhigte.
»Ihr Mann hat es in der letzten Zeit ein wenig übertrieben. Die Künstler Strutz und Malinke hatten Republikflucht geplant. Ihr Mann half ihnen, Sie brauchen das nicht zu leugnen. Nun, wie Sie sicher wissen, konnten wir das verhindern.«
Sie spuckte einen Kirschkern auf den Tisch und aß weiter.
»Wie alt ist Ihr Sohn? Zehn?«
Sie nickte.
»Guter Schüler, will sicher mal studieren.«
Sie zuckte mit den Schultern.
Die Männer wechselten sich ab. Ihre Gesichter ähnelten einander; beide rauchten Cabinet, beide rührten die Kirschen nicht an, beide tranken den Kaffee schwarz, aber mit Zucker.
»Multiple Sklerose ist eine schlimme Krankheit. Ihr Mann könnte von uns bessere Medikamente bekommen. Dann würde es vielleicht auch im Bett wieder besser gehen.«
Sie hob den Blick und sah ihnen abwechselnd in die Augen.
»Was?«, fragte sie. Ganz still saß sie nun. So still, dass ein Pfauenauge sich auf ihrem bloßen Knie niederließ und mit den Flügeln wippte.
»Na aber! Schauen Sie nicht so erstaunt. Georg Breitmann hat uns von seinem Verhältnis mit Ihnen erzählt. Ihr Mann wäre wohl nicht sehr erfreut darüber. Wenn er erführe, dass Sie sich von seinem Freund hin und wieder vögeln lassen, was würde er wohl sagen?«
Sie spürte ihren Herzschlag im Hals.
»Na, Frau Novacek, so schlimm ist das alles nun auch wieder nicht. Einmal pro Monat Bericht darüber, wer hier war und über was gesprochen wurde, und alles wird gut.«
Sie schüttelte so heftig den Kopf, dass ihr schwindelig wurde.
»Da hat der Breitmann nicht übertrieben. Sie sind wirklich eine schöne Frau, und Ihre erotischen Qualitäten, meine Herren, wenn das stimmt, was Breitmann über den vorletzten Donnerstag in Dresden berichtet hat. Donnerwetter.«
Maries Atem ging jetzt schnell, und die Männer nickten sich zu.
»So, Frau Novacek. Nun ist’s genug mit dem Theater. Sie tun ja grad so, als würden wir Sie mit Dingen konfrontieren, von denen Sie gar nichts wissen. Dabei haben Sie das alles nur sich selbst zuzuschreiben.«
Und während der Rechte sprach, zog der Linke einen Umschlag aus der Tasche.
»Sie unterschreiben dieses Papier, und wir erwarten einmal pro Monat Ihren Bericht.«
Drei Mal kamen sie. Beim dritten Mal saß Marie zusammengesunken vor ihnen. Seit ihrem letzten Besuch hatte sie in den Nächten kaum mehr als zwei Stunden am Stück geschlafen. Das Sprechen fiel ihr schwer. Sie antwortete einsilbig und leise, und als einer der Männer dicht an sie herankam, so dicht, dass sein nikotinschwerer Atem direkt in ihre Nase stieg, drehte sie sich angewidert weg. Er hatte seine Hände auf die Armlehnen ihres Stuhls gestützt. Fast berührten sich ihre Gesichter.
»Das ist Ihre letzte Chance, Frau Novacek. Ab jetzt reden wir nicht mehr. Ab jetzt handeln wir. Und glauben Sie uns, das wird kein Vergnügen für Sie sein.«
Aus dem Kopf des Weingottes, der rechts neben der Eingangstür hängt, wächst Gestrüpp. Eine der drei Katzen versucht vergeblich, nach einer Hummel zu schlagen. Marie auf ihrer Leiter ächzt.
Drüben im Anbau der Werkstatt stoppt der Sohn das Rührwerk. Nun drückt er den mit Wasser vermischten Grubenton durch ein Sieb, gießt ihn in ein Setzbecken und pumpt ihn anschließend durch eine Reihe Entwässerungskammern. Beinahe klar muss das Wasser sein, das unten heraustropft. Marie kennt jeden Arbeitsschritt.
»Brauchst du Hilfe, Mutter?«, schreit er durch die geöffnete Tür über die Wiese.
»Nein!«, ruft sie zurück.
Was wäre sie ohne den Sohn? Wäre sie überhaupt noch, ohne den Sohn?
Jetzt schiebt er gleich die entwässerten Filterkuchen in den Tonwolf. Er dreht die Kurbel, eine Schlange aus Ton windet sich aus der Öffnung der Maschine und fällt in einen darunterstehenden Kübel. Manchmal holt er sie dazu. Marie hat kräftige Arme.
»Aber wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid«, hört sie ihn rufen.
Drinnen in der Küche ein Geräusch. Ein Klopfen oder Schlagen. Dann Hans’ Stimme. Schon wieder: »Marie! … Marie!«
Wortlos steigt sie die Leiter hinunter und geht zu ihm.
»Ich brauche etwas zu trinken. Du meinst wohl, weil ich nicht mehr krauchen kann, habe ich auch sonst keine Bedürfnisse mehr, he?«
»Du kannst dir selbst etwas nehmen. Auf dem Tisch steht –«
»Ich will aber, dass du das machst. Das bist du mir schuldig, Marie.«
»Mein Gott, Hans, andere Leute haben auch ein Schicksal.«
»Andere Leute interessieren mich nicht.«
Sie nickt.
»Tee oder Wasser?«
»Fruchtsaft.«
»Haben wir nicht.«
»Den trinkt ihr allein, weil unsereiner ja nichts mehr braucht.«
Sie schenkt kalten Tee in ein Glas und gibt es ihm. Selbst hier drinnen hört sie Vögel singen.
»Soll Thomas dich in den Garten rausschieben?«
»Was soll ich da?« Er nippt an dem Glas.
»Jetzt reg dich nicht auf, ich kaufe nachher einen Saft.«
»Der Herr sei ihm gnädig«, sagt sie beim Hinausgehen laut.
»Der Herr kann mich am Arsch lecken!«, schreit er ihr hinterher.
Auch an dem Tag im vorigen Sommer, als Thomas sich endgültig vom Vater abwandte, hatte es über dreißig Grad. Hans, der seine Tage gewöhnlich im Haus verbrachte, verlangte plötzlich danach, in die Werkstatt geschoben zu werden. Seit vielen Monaten schon war er nicht mehr dort gewesen. Thomas legte ihm zwei Bretter über die Stufen am Eingang und hievte den Rollstuhl mit dem Vater hinauf. Marie folgte ihnen und blieb am Eingang stehen. Sie sah, wie Hans den Kopf erst nach links, dann nach rechts drehte, sie sah den Ausdruck in seinem Gesicht.
»Willst du nicht lieber mit in den Garten kommen, Hans?«
»Erst will ich mich umsehen in meiner Werkstatt.«
Langsam rollte er bis zu dem großen Tisch in der Mitte. Unter den Rädern des Rollstuhls knirschten Steinchen. Thomas suchte ihren Blick, sie konnte es spüren, aber Marie ließ die Augen nicht von ihrem Mann. Sie sah, wie er die Gegenstände auf dem Tisch betrachtete.
Dann nahm er einen von Thomas’ Tellern, die dort zum Trocknen lagen, drehte ihn hin und her und stellte ihn vorsichtig wieder ab.
»Kannst du uns einen Kaffee machen?«, fragte er.
Nichts regte sich in ihrem Gesicht, nur ihre Augen flackerten. Sie fühlte es, und sie wusste, dass er es sah.
»Einen Kaffee, Marie! Bring dem Thomas auch einen mit.«
Auf einem Tablett trug sie zwei Tassen, ein Päckchen Kondensmilch, eine Zuckerdose und eine Thermoskanne Kaffee aus dem Haus. Sie balancierte es gerade über den unebenen Weg zur Werkstatt, als sie die Stimme ihres Sohnes hörte: »Nein! Nicht!«
Marie stellte das Tablett auf die Wiese und rannte.
Mit einem Taschenmesser, das er immer in der Hosentasche trug, kratzte Hans Furchen in die noch nicht getrockneten Teller. Thomas versuchte, ihm das Messer zu entreißen, aber Hans fuchtelte derart damit herum, dass Thomas zurückwich.
Marie schlug die Hände vor den Mund, während Hans aufschaute, Luft holte und schrie, so laut er konnte:
»Ich habe es berührt. Es ist Kunst!«
Er warf das Messer in Thomas’ Richtung, legte seine Hände auf die Räder des Rollstuhls und fuhr mit kräftigem Schwung quer durch die Werkstatt. Als er genügend Tempo erreicht hatte, ließ er sich rollen und riss mit ausgebreiteten Armen alles von den Regalen herunter, was seine Hände erreichten.
»Es ist Kunst! Ich habe es berührt! Es ist Kunst!«, brüllte er, während Tongefäße durch die Luft flogen und auf dem Boden zersprangen.
Marie sah Thomas zwischen den Scherben stehen. Dann war es still. Nur das schrille und hohe Gezwitscher eines Zaunkönigs im Himbeergesträuch neben der Werkstatt tönte durch die geöffneten Fenster und die Tür hinein.
Marie drehte sich langsam um und ging hinaus.
Sie blickte über die Wiese bis zum Feld, weiter zum Fluss, dem unberechenbaren Fluss. Mehrmals schon war sie an seinem Ufer gesessen, mit Steinen in den Schürzen- oder Manteltaschen. Auch darinnen gestanden ist sie schon, bis zu den Knien im Uferschlamm und bis die Kleider sich vollgesogen hatten und nach unten zogen. Doch etwas hatte sie immer zurückgehalten. Vielleicht war es nur die Wäsche auf der Leine, die vor dem Regen abgenommen werden musste. Und dann warf sie die Steine in den Fluss und ging durch das Feld, über die Wiese, die kleine Treppe hinauf, ins Haus, wo alles von vorn begann. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, seit jenem Abend vor fünfzehn Jahren.
»Was soll ich tun?«, hatte sie Hans am Ende jenes Tages im Jahr 1993 mit tonloser Stimme gefragt.
Und Hans hatte ihr ohne Zögern geantwortet. »In Demut dienen«, sagte er. Und noch einmal: »In Demut dienen.«
Es war der Abend der Sommersonnenwende gewesen, sie saßen zu dritt am Gartentisch: Vater, Mutter, Sohn. Trotz der späten Stunde war es noch dämmrig. Fledermäuse jagten durch die Luft. Hans hatte sein Essen unangerührt weggeschoben. Es ging ihm schlechter. Noch konnte er laufen, noch arbeitete er, aber der nächste Schub der Krankheit würde ihn endgültig in den Rollstuhl zwingen.
Er legte seine Hände auf den Tisch und begann mit den Fingern einen Takt zu trommeln. Ba-bam. Ba-bam. Ba-ba-ba-bam. Ba-ba-ba-bam. Immer schneller trommelte Hans auf dem Tisch herum, und dann, plötzlich, schlug er beide Fäuste auf den Tisch.
Sie leugnete nichts. Sechs Jahre lang hatte sie jeden Monat einen pünktlichen und anfangs belanglosen Bericht an die Staatssicherheit geschickt. Thomas wusste Bescheid, ihm hatte sie sich bereits Monate vorher anvertraut.
»Wenn es einmal herauskommt«, hatte sie zu ihm gesagt, »musst du wissen, dass ich es nur tat, um dich zu schützen.«
Aber Hans wollte nichts hören. Nichts von der Angst um den Sohn, nichts von der Einschüchterung, nichts von ihrer Verzweiflung, als man ihr die Belanglosigkeit ihrer Berichte vorwarf und sie zwang, konkreter zu werden. Nichts von ihren quälenden Schuldgefühlen. Keine Entschuldigungen und keine Bitten um Vergebung.
In der Nacht vor ihrem Kircheneintritt hatte es stark geregnet. Die große Flut lag erst einige Monate zurück. Innerhalb weniger Stunden hatte das Wasser der Mulde die Aue in ein nasses Grab verwandelt. Als das Wasser zu steigen begann und sie anfingen, die untere Etage auszuräumen, gab es bei Marie einen winzigen Moment des Zögerns: Hans im Rollstuhl, seine Hilflosigkeit, das Wasser. Neun Jahre Dienen lagen hinter ihr.
Der neuerliche Regen erinnerte Marie an diesen möglich gewesenen Ausweg. Sie schlief nicht. Ebenso wenig wie Hans. Mehrfach rief er nach ihr. Einmal sollte sie das Fenster für ihn öffnen, weil er dem Klatschen und Prasseln der Regentropfen zuhören wollte, dann wieder musste es geschlossen werden, weil der Lärm ihn nicht schlafen ließ. Barfuß und im Nachthemd stieg sie die Treppe hinunter und wieder hinauf, hinunter und wieder hinauf. Ein Dankeschön gab es nicht, hatte es nie gegeben.
Noch einmal las sie die Geschichte, die den Wunsch in ihr geweckt hatte, sich taufen zu lassen und sich mit Gedanken zu befassen, die für sie neu und hilfreich waren. Wovon lebt der Mensch, hieß sie. Marie hatte sich viele Sätze angestrichen, einer aber war doppelt markiert: »Und der Engel sprach: So erkannte ich nun, daß nicht die Sorge um sich selbst und um ihr Wohlergehen die Menschen dem Leben erhält, ich begriff, daß der Mensch allein durch die Liebe zu leben vermag.«
Am Morgen hatte sie aus dem alten, blau gestrichenen Kleiderschrank einen langen schwarzen Rock und eine weiße Rüschenbluse geholt. Kurz nach Sonnenaufgang war sie fertig angezogen aus der Haustür getreten und bis zum Rand des Weizenfeldes gegangen. Es war kühl, regnete aber nicht mehr; die Sonne stand hinter den Baumwipfeln am Horizont, und über den Feldern waberte seltsam vielfarbig der Morgennebel. Sie schloss die Augen und hörte den Vögeln zu.
Zurück in ihrem Zimmer, bürstete sie ihr Haar, steckte es zu einem lockeren Knoten, legte Rouge auf und putzte ihre Schuhe.
Eine Weile saß sie in ihrer ganzen über die Jahre gewachsenen Körperfülle auf dem Stuhl vor der Kommode, las das Glaubensbekenntnis und betete das Vaterunser. Von einem kleinen Haken, der in einem der Wandbalken steckte, nahm sie eine goldene Kette mit einem Kreuz daran und legte sie sich um den Hals. Sie öffnete alle drei Fenster und atmete tief ein.
Auch Thomas zog sein bestes Hemd an. Gegen acht Uhr richteten sie dem Vater ein üppiges Frühstück her, dann verließen sie das Haus, ohne Hans zu sagen, wohin sie gingen.
Marie schwitzt. Schwüle Luft drückt auf sie nieder, Mücken saugen sich satt an ihrem Blut. Sie klettert die Leiter hinunter und geht zum Bach. Von der Hitze sind ihre Füße angeschwollen; sie hebt den Rock und steigt in den Bach. Mit den Händen schöpft sie kühles, sauberes Wasser. Sie benetzt ihr Gesicht, ihre Arme, ihren Hals und den Nacken, dann kehrt sie zurück zum Kirschbaum und setzt die Arbeit fort.
Am Abend wird entkernt. Hans wird vor dem Fernseher sitzen und den Ton viel zu laut stellen. Von seinem Platz aus kann er sie sehen, durch das halbrunde Loch in der Mauer. Flüsternd wird sie mit Thomas sprechen, und vielleicht liest er ihr später etwas vor.
Es gibt nicht viele Orte wie diesen, denkt sie und schaut um sich. Die Libellen schweben über dem Bach, die Lilien blühen, am Rande des Grundstücks, das keinen Zaun braucht, weil Bäume und Büsche es begrenzen, beginnen die Getreidefelder. Im Gemüsegarten wachsen Zwiebeln, Karotten, Kartoffeln, Lauch und Kürbisse. Den Salat haben die Schnecken gefressen, aber auch die Schnecken sollen leben. So denkt sie und schaut noch immer.
Thomas kommt aus der Werkstatt.
»Es ist so still drinnen«, sagt er. »Soll ich nachsehen?«
»Ist er endlich einmal still.« Sie schließt die Augen, atmet ruhig. Schweiß läuft ihr die Stirn hinab. »Aber ja, geh nachsehen«, fügt sie hinzu.
Seine große Gestalt verschwindet im Inneren des Hauses und erscheint gleich darauf wieder. Er taumelt die Stufen herab und stützt seine Hände auf die gebeugten Beine.
Ohne Eile steigt Marie von der Leiter. Sie geht durch die Küche bis zur Stufe, die zum Nebenraum führt. Das Licht darin ist wieder ausgeschaltet worden. Dunkles Blut fließt ihr entgegen, tropft von der Stufe auf den hellen Küchenboden.
Marie schwankt und lehnt sich gegen die Wand.
Es waren immer die heißen Tage.
Am Tag der Beerdigung ihres Mannes scheint der Himmel noch niedriger als sonst. Schwül-feuchte Luft strömt durch das Fenster ihres Schlafzimmers herein. Marie ist ausgeruht. Sie hat tief und traumlos geschlafen.
Siebzehn Menschen stehen um das Grab – Künstlerkollegen, alte Freunde, einige Verwandte, Dorfbewohner. Leise dankend nimmt Marie die Beileidsbekundungen entgegen. Einige gehen gruß- und wortlos an ihr vorbei.
Auf dem Rückweg laufen Thomas und sie durch ein Gewitter. Ein kurzer Regen ergießt sich aus schwarzen Wolkenmassen, später fallen von den gewaschenen Blättern der Bäume noch einzelne Tropfen. Marie läuft schneller.
Zu Hause legt sie die Trauerkleider ab und tauscht sie gegen eine helle Bluse und einen bunten Rock. Sie öffnet alle Türen und Fenster des Hauses und beginnt zu putzen.
Mimikry
Hallo Ossis!
Es ist an der Zeit, euch die Warheit zu sagen, und die get so: Keiner hat euch gewolt. Ich persöhnlich kenne keinen einzigen, der sich gefräut hat. Nicht einen. Und auch eure stinckenden Trabbis hat keiner gewollt. Sie verpessten unsere gute Luft und verstopfen unsere Strasen, die mit unsern Steuergeldern gebaut werden. Habt ihr irgendwas beigetragen? Irgendwas???
Haben haben haben!
Ich ich ich!
Was andres hört man von euch nicht. Und überhaupt: lernt erstmahl deutsch. Kleiner tip: Nehmt vorm sprechen die Thüringer Klösse aus dem Maul, sonst versteht euch nähmlich keiner. Und kriegt die Zäne auseinander. Das Genuschel, das man von euch zu hören kriegt, ist einfach das letzte. Aber besser ist eh, ihr haltet das Maul. Kommt nähmlich nur Dünnschiss raus. Und noch was: wir vermissen eure Dankbarkeit. Ihr kommt aus einem Entwiklungsland (!), das heisst ihr müsst euch noch entwikeln. Und wir helfen euch dabei, nicht mehr dumm und faul zu sein. Nur, wo bleibt die Dankbarkeit? Wenn sich das nicht ändert und ihr nicht einseht das ihr auf einer niedrigeren Stufe steht als wir und erstmahl höher klettern müsst und dazu muss man sich anstrengen, jawoll. Da staunt ihr. Also wenn sich da nichts endert dran, sind viele hier der Meinung das wir die mauer wieder hochziehen sollten. Aber diesmahl höher und sicherer. Und eins könnt ihr uns glauben: Auch das kriegen wir besser hin als ihr.
Seit wachsam, Ossis! Wir behalten euch im Auge!
Anne sieht sich um. Es ist keiner zu sehen.