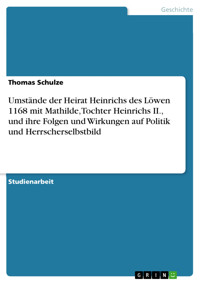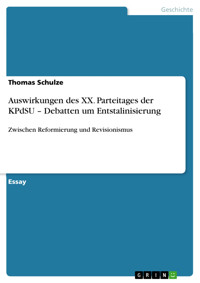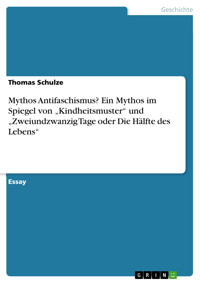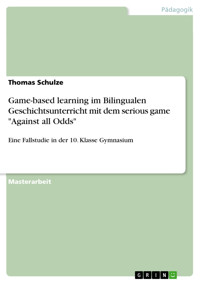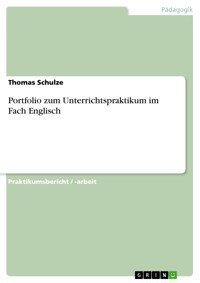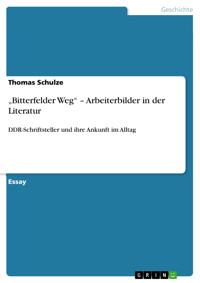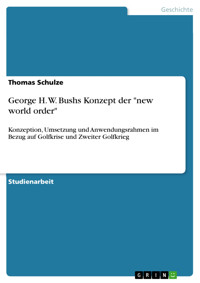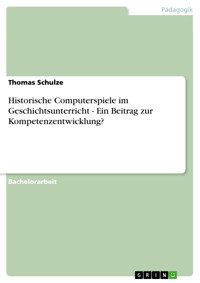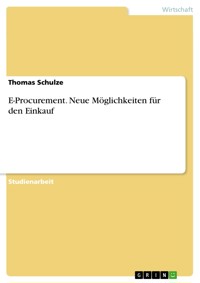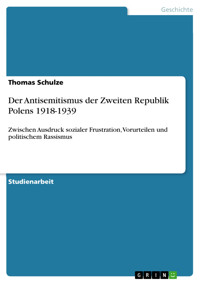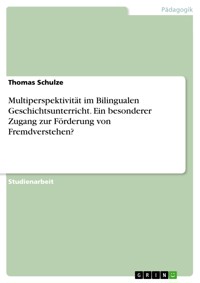
Multiperspektivität im Bilingualen Geschichtsunterricht. Ein besonderer Zugang zur Förderung von Fremdverstehen? E-Book
Thomas Schulze
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Didaktik für das Fach Englisch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: 1,0, Humboldt-Universität zu Berlin (Institut für Anglistik und Amerikanistik), Veranstaltung: Theoriegeleitetes Forschen und Handeln I: Content and Language-integrated Learning, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit wird untersucht, ob und inwieweit Multiperspektivität und Fremdverstehen im Rahmen des Bilingualen Geschichtsunterrichts in besonderer Weise gefördert werden. Ausgehend von dieser These stehen drei Fragen im Fokus: Aus welchen historischen, konzeptuellen und institutionellen Annahmen, Bedingungen und Schlussfolgerungen leitet sich dieses vermeintlich besondere Potential ab? Sind Multiperspektivität und Fremdverstehen als konstitutive Merkmale des Bilingualen Geschichtsunterrichts zu verstehen? Inwieweit ist das attestierte multiperspektivische Potential des Bilingualen Geschichtsunterrichts kausal, theoretisch und empirisch belegbar? Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit dem historischen Entstehungskontext des Bilingualen Sachfachunterrichts, nennt theoretische Konzeption und Zielsetzungen in Hinblick auf Multiperspektivität, analysiert diesbezüglich zwei einflussreiche Modellvorstellungen bilingual sachfachlichen Lernens und stellt die Erwartungen vor, die von institutioneller Seite an den Bilingualen Geschichtsunterricht gestellt werden. Im zweiten Teil wird Multiperspektivität als Kernprinzip des Historischen Lernens und Denkens identifiziert, dezidiert analysiert und in einen weiteren Bezugsrahmen zu den für die Geschichtsdidaktik fundamentalen Konzepten des Geschichtsbewusstseins und der Narrativen Kompetenz eingebunden. Anschließend stellt Teil drei Fremdverstehen als eine Grundoperation geschichtlichen Verstehens und einen Schnittpunkt zwischen Geschichts- und Fremdsprachendidaktik in den Mittelpunkt der Betrachtung. Im vierten Kapitel wird die Debatte um die attestierten einzigartigen multiperspektivischen Potentiale innerhalb des Bilingualen Geschichtsunterrichts abgebildet und anhand gängiger Erklärungstendenzen der Forschungsdebatte kritisch diskutiert. Schließlich werden im fünften Teil ausgewählte empirische Forschungsergebnisse hinsichtlich einer vermeintlich erhöhten Qualität der Fremdverstehensprozessen im Kontext des Bilingualen Geschichtsunterrichts kritisch diskutiert und die Argumentationslinien zu einer Abschlussbewertung zusammengeführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einführung
2. Multiperspektivität im Kontext des Bilingualen Geschichtsunterrichts
2.1 Entstehungshintergrund, Konzeption, Zielsetzungen und institutionelle Erwartungen
2.2 Multiperspektivität und Historisches Lernen im (Bilingualen) Geschichtsunterricht
2.3 Fremdverstehen und konzeptuelle Leerstellen
2.4 Multiperspektivität und Fremdverstehen in der Forschungsdebatte
2.5 Empirische Forschungsergebnisse und Schlussfolgerungen
3. Zusammenfassung
4. Literaturverzeichnis
1. Einführung
"Bilingualer Geschichtsunterricht ist im Wesentlichen nichts anderes als eine Form des Lehrens und Lernens, die in besonderer Weise den Prinzipien der Multiperspektivität und Interkulturalität verpflichtet ist"[1]. Peter Geis‘ Zuspitzung spiegelt innerhalb der Forschungsdebatte zum Bilingualen Geschichtsunterricht eine häufig artikulierte Position wider, die ein besonderes Förderungspotential multiperspektivischer Lernprozesse und Lernarrangements im Rahmen dieses Unterrichtsmodells nahelegt. In dieser Arbeit soll daher untersucht werden, ob und inwieweit Multiperspektivität und Fremdverstehen im Rahmen des Bilingualen Geschichtsunterrichts in besonderer Weise gefördert werden. Ausgehend von dieser These stehen drei Fragen im Fokus: Aus welchen historischen, konzeptuellen und institutionellen Annahmen, Bedingungen und Schlussfolgerungen leitet sich dieses vermeintlich besondere Potential ab? Sind Multiperspektivität und Fremdverstehen als konstitutive Merkmale des Bilingualen Geschichtsunterrichts zu verstehen? Inwieweit ist das attestierte multiperspektivische Potential des Bilingualen Geschichtsunterrichts kausal, theoretisch und empirisch belegbar?
Der erste Teil der Arbeit beschäftigt sich mit dem historischen Entstehungskontext des Bilingualen Sachfachunterrichts, nennt theoretische Konzeption und Zielsetzungen in Hinblick auf Multiperspektivität, analysiert diesbezüglich zwei einflussreiche Modellvorstellungen bilingual sachfachlichen Lernens und stellt die Erwartungen vor, die von institutioneller Seite an den Bilingualen Geschichtsunterricht gestellt werden. Im zweiten Teil wird Multiperspektivität als Kernprinzip des Historischen Lernens und Denkens identifiziert, dezidiert analysiert und in einen weiteren Bezugsrahmen zu den für die Geschichtsdidaktik fundamentalen Konzepten des Geschichtsbewusstseins und der Narrativen Kompetenz eingebunden. Anschließend stellt Teil drei Fremdverstehen als eine Grundoperation geschichtlichen Verstehens und einen Schnittpunkt zwischen Geschichts- und Fremdsprachendidaktik in den Mittelpunkt der Betrachtung. Im vierten Kapitel wird die Debatte um die attestierten einzigartigen multiperspektivischen Potentiale innerhalb des Bilingualen Geschichtsunterrichts abgebildet und anhand gängiger Erklärungstendenzen der Forschungsdebatte kritisch diskutiert. Schließlich werden im fünften Teil ausgewählte empirische Forschungsergebnisse hinsichtlich einer vermeintlich erhöhten Qualität der Fremdverstehensprozessen im Kontext des Bilingualen Geschichtsunterrichts kritisch diskutiert und die Argumentationslinien zu einer Abschlussbewertung zusammengeführt.
Der thematische Fokus auf das geschichtsdidaktische Prinzip der Multiperspektivität machte eine Reihe von inhaltlichen und strukturellen Eingrenzungen erforderlich: Multiperspektivität und Fremdverstehen werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit in erster Linie in Hinblick auf die Prozesse und Operationen betrachtet, die notwendig sind, um multiperspektivisches Lernen und Fremdverstehensprozesse zu initiieren, durchzuführen und zu fördern. Beide Prinzipien werden in vorrangig aus der Perspektive der historischen Fachdidaktik betrachtet und punktuell um einige Hinweise auf Ebene der Fremdsprachendidaktiken ergänzt. Zudem finden Dimensionen und Prozesse des interkulturellen Lernens, der Förderung interkultureller Kompetenz[2] und weiterführende Konzeptionen (etwa die Vorstellung einer intercultural language awareness oder intercultural communicative competence) nur an ausgewählten Stellung Erwähnung, um den Umfang der Arbeit zu beschränken.
Innerhalb des Forschungsfeldes zur Konzeption, Bedeutung und Bewertung des Bilingualen Geschichtsunterrichts bilden die Aufsätze Manfred Wildhages, Herbert Christs, Andrea Rösslers und Heike Rautenhaus‘ wichtige Grundlagen dieser Arbeit. Während Wildhage die Bedeutung grundlegender historischer Kategorien und Prinzipien, allen voran Geschichtsbewusstsein, für die Prozesse des multiperspektivischen Lernens im Bilingualen Geschichtsunterricht hervorhebt, betont Christ den Mehrwert des Bilingualen Geschichtsunterrichts durch dessen spezifische Konfiguration (fremd-)sprachlicher und inhaltlicher Lernprozesse und den daraus resultierenden Implikationen für die Perspektivübernahmen durch die Lernenden. Rössler unterstreicht den Konstruktcharakter kultureller Identitäten und charakterisiert (historisches) Fremdverstehen als einen Prozess, der zum Verständnis und zur Sensibilisierung für diese Konstrukte beitragen kann. Durch eine Verknüpfung der Fremdverstehenskonzeptionen von Geschichts- und Fremdsprachendidaktiken lässt Rautenhaus die gemeinsamen Motive beider Didaktiken hinsichtlich der Initiierung von Relativierungs- und Differenzierungsprozessen erkennbar werden. Die Monographien Klaus Bergmanns und Jörn Rüsens bieten durch ihre umfangreichen theoretischen Darlegungen zur Multiperspektivität und zum Historischen Erzählen Grundlagen für eine fachlich adäquate und hinreichend fundierte Diskussion beider Prinzipien. Insbesondere die Monographie Stefanie Lamsfuß-Schenks stellt in doppelter Weise einen hilfreichen Zugang zur Beantwortung der zuvor skizzierten Fragestellung dar, indem sie Multiperspektivität und Fremdverstehen als besondere Potentiale des Bilingualen Geschichtsunterrichts hervorhebt und diese Argumentation durch empirische Ergebnisse stützt. Schließlich erwiesen sich Wolfgang Hasbergs kritische Einschätzungen zum qualitativen Mehrwert der historischen Lern- und Erkenntnisprozesse im Bilingualen Geschichtsunterricht, die in deutlichem Kontrast zum Forschungstenor stehen, für eine konstruktive Diskussion unter Einbeziehung der empirischen Forschungsdaten als äußerst wertvoll. Mit Hilfe dieser und weiterer Forschungsbeiträge konnte umfassend diskutiert werden, ob und inwieweit Multiperspektivität und Fremdverstehen im Rahmen des Bilingualen Geschichtsunterrichts in besonderer Weise gefördert werden.
2. Multiperspektivität im Kontext des Bilingualen Geschichtsunterrichts
2.1 Entstehungshintergrund, Konzeption, Zielsetzungen und institutionelle Erwartungen