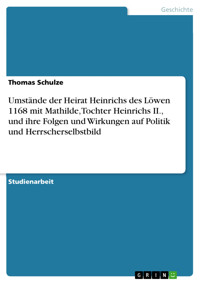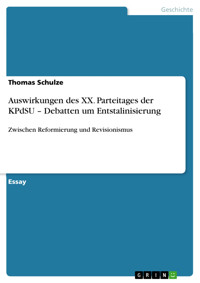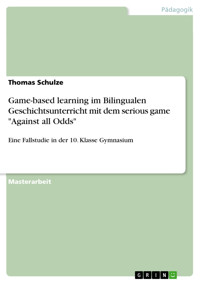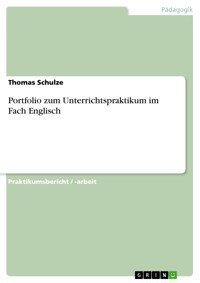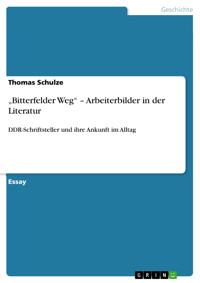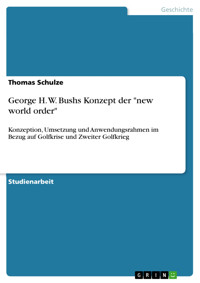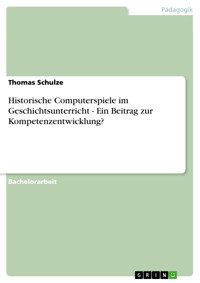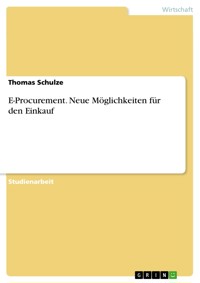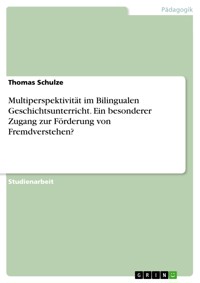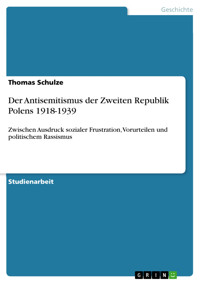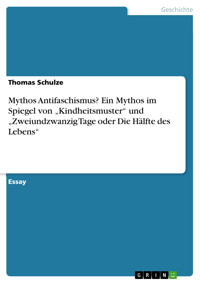
Mythos Antifaschismus? Ein Mythos im Spiegel von „Kindheitsmuster“ und „Zweiundzwanzig Tage oder Die Hälfte des Lebens“ E-Book
Thomas Schulze
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Essay aus dem Jahr 2010 im Fachbereich Geschichte Deutschlands - Nachkriegszeit, Kalter Krieg, Note: 1,3, Humboldt-Universität zu Berlin (Institut für Geschichtswissenschaften), Veranstaltung: Hauptseminar - Politik und Kultur in der SBZ/DDR 1945-1990, Sprache: Deutsch, Abstract: „Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd“ . Mit diesen Worten beginnt Christa Wolfs 1976 erschienener Roman „Kindheitsmuster“, der zum Sinnstück für eine Debatte um Schuld, Vergeltung, Vergessen und Verdrängung wurde. Auch Franz Fühmann und Hermann Kant warfen in ihren bedeutenden Werken der siebziger Jahre Fragen zum Umgang mit der eigenen und fremden nationalsozialistischen Vergangenheit und der Identifikation mit dem Mythos Antifaschismus auf. Im Kern dieses Essays soll die Frage stehen, inwieweit die literarischen Werke Christa Wolfs und Franz Fühmanns in Einklang oder Kontrast zum offiziellen antifaschistischen Gestus der DDR standen. Wolfs und Fühmanns Werke stehen stellvertretend für eine literarische Diskussion um Vergangenheitsbewältigung und authentische innere Auseinandersetzung. Dabei stehen zunächst die Grundzüge des politischen Antifaschismus in der DDR im Mittelpunkt. Ausgehend von den politischen Prämissen stellen die Darstellungen in „Kindheitsmuster“ und „Zweiundzwanzig Tage oder Die Hälfte des Lebens“ und ihr Beitrag zur Diskussion um den Mythos Antifaschismus den Kernpunkt der Betrachtung dar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Mythos Antifaschismus?
Ein Mythos im Spiegel von „Kindheitsmuster“ und „Zweiundzwanzig Tage oder Die Hälfte des Lebens“
„Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd“[1]. Mit diesen Worten beginnt Christa Wolfs 1976 erschienener Roman „Kindheitsmuster“, der zum Sinnstück für eine Debatte um Schuld, Vergeltung, Vergessen und Verdrängung wurde. Auch Franz Fühmann und Hermann Kant warfen in ihren bedeutenden Werken der siebziger Jahre Fragen zum Umgang mit der eigenen und fremden nationalsozialistischen Vergangenheit und der Identifikation mit dem Mythos Antifaschismus auf.
Im Kern dieses Essays soll die Frage stehen, inwieweit die literarischen Werke Christa Wolfs und Franz Fühmanns in Einklang oder Kontrast zum offiziellen antifaschistischen Gestus der DDR standen. Wolfs und Fühmanns Werke stehen stellvertretend für eine literarische Diskussion um Vergangenheitsbewältigung und authentische innere Auseinandersetzung. Dabei stehen zunächst die Grundzüge des politischen Antifaschismus in der DDR im Mittelpunkt. Ausgehend von den politischen Prämissen stellen die Darstellungen in „Kindheitsmuster“ und „Zweiundzwanzig Tage oder Die Hälfte des Lebens“ und ihr Beitrag zur Diskussion um den Mythos Antifaschismus den Kernpunkt der Betrachtung dar.
Antifaschismus in der DDR
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Ende des nationalsozialistischen Faschismus stand die ideologische Ausrichtung der DDR fest: Antifaschismus sollte die geistig-ideologische Grundlage des neuen Staates darstellen. Das Prinzip sollte der elitären Massenverachtung, der Verherrlichung des Brutalen und der Denunziation der Vernunft während des Nationalsozialismus[2] entgegenstehen. Trotz der späteren Mythisierung und Stilisierung war „Antifaschismus“ nach Ende des Krieges keineswegs ein aufgeladener Begriff. Er wurde von westlichen wie östlichen Politikern, Humanisten und Intellektuellen oft und gern zur Prämisse erhoben[3]. Doch während der Westen in ihm prinzipiell Mittel zum Zweck sah, repräsentierte Antifaschismus in der DDR vor allem eine Gegenposition zum Kapitalismus. Das Konzept des radikalen Antifaschismus erhielt Zuspruch. Die kulturelle Elite, unter ihnen die zurückgekehrten Intellektuellen Bertolt Brecht, Anna Seghers, Ernst Bloch und Hans Mayer, sah im Kapitalismus und Imperialismus die quasi-faschistischen Ursachen des Zweiten Weltkrieges und der NS-Diktatur[4]. Desweiteren traf eine antifaschistische Staatskonzeption den Zeitgeist. Die spezifisch deutschen Vorbedingungen, die Schuldgefühle innerhalb der Bevölkerung aufgrund der Mittäterschaft während des Nationalsozialismus und das Bewusstsein über die Notwendigkeit eines Neuanfangs, gaben der antifaschistischen Staatsausrichtung ihre Existenzberechtigung.