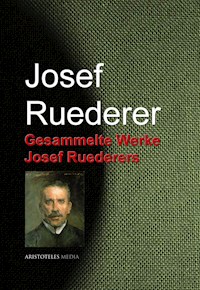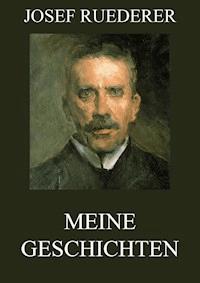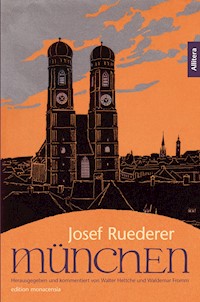
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Allitera Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: edition monacensia
- Sprache: Deutsch
Als eine Liebeserklärung an die Landeshauptstadt bezeichnete der Essayist Josef Hofmiller das 1907 für eine Stadtführerreihe geschriebene "München"-Buch Josef Ruederers. Doch die rigorose Kritik am spezlhaft verfilzten und überaus geschäftstüchtigen Isar-Establishment erweckt eher den Eindruck einer verzweifelten Kriegserklärung. Beißend polemisch und ohne Rücksicht auf jegliche Konventionen setzte Ruederer, zerrissen zwischen heftiger Abneigung und tiefer Verbundenheit, seiner Heimatstadt ein literarisches Denkmal eigener Prägung. Selbstverständlich nahm ihm die kulturell tonangebende Schicht Münchens seine Offenheit übel. Nie konnte Ruederer aus dem Windschatten seines Schriftstellerkollegen Ludwig Thoma treten ? zu Unrecht, wie die Wiederauflage eines seiner Hauptwerke zeigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
edition monacensia Herausgeber: Monacensia Literaturarchiv und Bibliothek Dr. Elisabeth Tworek
Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unter:www.allitera.de
Dezember 2012 Allitera Verlag Ein Verlag der Buch&media GmbH, München © 2012 für diese Ausgabe: Landeshauptstadt München/Kulturreferat Münchner Stadtbibliothek Monacensia Literaturarchiv und Bibliothek Leitung: Dr. Elisabeth Tworek und Buch&media GmbH, München Umschlaggestaltung: Alexander Strathern, München Printed in Europe · isbn 978-3-86906-336-2
München Ostern 1907
INHALT
Der Fasching
Die Vergangenheit
Der Bürger
Die Landschaft
Die Theater
Die Gesellschaft
Die Dichter
Die Neuesten Nachrichten
Das Ende, die Zukunft
Dokumente
Zur Edition
Erläuterungen
Nachwort
DER FASCHING
Mit Einteilung und Benennung von Kapiteln ist es so eine Sache. Besonders bei Büchern über europäische Kulturzentren. Der Verfasser könnte sich zum Beispiel denken, dass jemand über München schriebe und dreissig anderslautende Titel brächte als die auf vorstehender Tafel. Frei nach Baedeker oder Meyer. Über Verkehrsmittel, über Vergnügungslokale, über Hotels, über Restaurants, über Sehenswürdigkeiten. Wie es solche Werke ja massenhaft gibt. In grossem und kleinem Format, mit einfachen und kostbaren Einbänden. Mit Winken, wie man am besten kauft, mit Wegweisern zu Konsulaten, Desinfektionsanstalten, Hebammen und Totengräbern. Alles organisch geordnet, nach Berufen, Gewerben und staatlichen Sammlungen. Also streng der Materie nach. Nicht etwa wahllos, von einem Thema ins andere. So schreibt man Romane, Novellen. Und steht am Schlusse mit langer Nase da. Weil das Verzeichnis noch fehlt, der Hut, unter dem die wirren Eindrücke gesammelt werden. Der Name für das Gemälde. Der ist oft schwerer zu finden, als man im allgemeinen glaubt. Ja, dem Betrachter, dem Leser erscheint die Benennung gar häufig gesucht. Oder zu wenig umfassend. So wird er vielleicht schon beanstanden, dass dieses Kapitel statt des verheissenen Faschings eine langatmige Vorrede bringt, er wird sich wundern, dass der Verfasser im zweiten, vierten, siebten und neunten Abschnitte so viel von sich selber redet. Wird auch beim »Bürger«, bei der »Gesellschaft«, ja, vielleicht sogar bei den »Neuesten Nachrichten« das angeschlagene Thema nicht immer im Einklang mit der Überschrift finden. Am meisten aber wird ihn wohl wundern, dass in dem aufgestellten Verzeichnis mit keinem Worte der Maler, Bildhauer und Architekten gedacht ist. In einem Buche über München, über Deutschlands führende Kunststadt! Wo jede Zeile, jedes Wort darauf hinweisen sollte, wo eine eigene Geschichte geschrieben werden müsste, um Art und Ausbau zu zeigen, anfangend von Cornelius, Klenze, Ziebland, Kaulbach, Schwanthaler bis herab zum jüngsten Impressionisten, draussen im Dachauer Moos. Richtiger noch, mit Namen und Argumenten, dass München im Gegensatz zur gewaltigen Schule der Franzosen eine systematische Entwicklung ebensowenig aufzuweisen hat, wie die gesamte deutsche Kunst überhaupt. Alles steht da explosiv oder unvermittelt, häufig aus fremdländischen Einflüssen abgeleitet, oft aber geschaut von starken Temperamenten, und immer geschaffen inmitten eines frohen, ungebundenen Lebens, einer Künstlergesellschaft, wie sie die Allotria war, einer Fülle von Veranstaltungen, wie sie keine andere Stadt aufzuweisen hat, in ihrer Chronik.
Gleich der Tag, wo dieses Buch seinen Anfang nimmt, der 18. Februar, ruft eine der stärksten Erinnerungen wach. Da fand vor einem Vierteljahrhundert eine Maskenkneipe statt, die an Aufwand künstlerischer Kraft sowie an Eigenart der Ideen alles in Schatten stellte, was man bis dahin auf diesem Gebiete gesehen hatte. Ein Riesenschiff auf der Kneipreise um die Welt, das war der Grundgedanke. Rechts und links vom Verdeck und von den Segeln die Erdteile, die es berührte. Alle waren vertreten, die Chinesen mit einem verschnörkelten Turm, der wilde Westen Amerikas mit einem festgefügten Blockhaus, die Sandwich-Insulaner in einer dämmernden Höhle, die Eskimos in tranbefeuchtetem Zelte, ja, sogar ein Pfahlbauernhaus konnte man sehen. All das belebt von den Inwohnern in streng entsprechender Gewandung. Auf dem Verdeck des Schiffes endlich, wo unaufhörlich die Glocke zum Einsteigen lud, als lachende Passagiere so ziemlich alle Typen der Erde, vom Kaiser und König bis zum Handwerker, Urlauber und Hausknecht. Das strömte hinauf und hinunter, bald nach Asien, bald nach Amerika, bald nach Australien, am liebsten jedoch bliebs in Europa. Dort gabs von allen Kneipen der Weltkugel doch noch immer die besten. In einem weissgetünchten Gewölbe hielten fromme Klosterbrüder selbstgebrautes Bier feil, echten Bliemchen und Schnaps gab es in der sächsischen Kaffeebude, und in einem oberbayrischen Wirtshaus konnte man auf einer langen Bahn regelrecht Kegel schieben. In besonders verschwiegenen Ecken jedoch wurden einige jener Kuriositäten gezeigt, die damals übermütige Künstlerlaune noch erzeugen durfte, ohne am andern Tag der Sittenkommission zu verfallen. So bot Madame Lutetia dem ruhelosen Wanderer gegen prompte Bezahlung ein mehr wie gastliches Heim, der Henker der spanischen Inquisition zwickte auf der Folterbank den Delinquenten unter Beistand der lieben Geistlichkeit ein Markstück nach dem andern heraus, und ein Riesenfernrohr auf dem Verdeck des Schiffes zeigte gegen fünfzig Pfennige Entgelt die fratzenhaftesten Perspektiven. Dazu fiedelten wandernde Zigeuner und bliesen böhmische Musikanten greuliche Weisen. Da plötzlich, so um Mitternacht, als der Trubel am höchsten war, stürzte etwas durch den Saal. Was nicht hergehörte, was Prasselndes, Brennendes. Unheimlich wars und doch nur ein Augenblick. So schnell, dass es kaum auffiel. Was gabs denn? Neun Eskimos als wandernde Feuersäulen. Die stiessen in heller Verzweiflung gegen diese Welt von Leinwand und Holzgerüsten. Nichts brannte an, doch sie selber verkohlten unter furchtbarem Wehgeschrei draussen in der Vorhalle oder auf dem Weg zum Spital. Einige von dem Todesschiff sahen den Jammer und flohen davon, geschüttelt von Grauen; die meisten sahen ihn nicht. Sie kneipten fort bis zum frühen Morgen. Als man sie aber am hellen Mittag mit der Schreckensbotschaft aus dem Bette jagte, da wars, als grinste das Totengerippe selber zur Tür herein.
Und das uferlose Entsetzen griff weiter über die ganze Stadt. Auf Jahre lähmte es alle Unternehmungslust, alle Begeisterung, ja, es verschob mit der Zeit die ganze Linie des Münchner Karnevals. Denn wer nicht dabei gewesen war, schimpfte über die leichtfertigen Leute, und so mancher wollte in der Katastrophe den Finger Gottes erblicken, die gerechte Strafe für frevelhaften Übermut. Den Künstlern wurde bös in die Suppe gespuckt; nur zweimal noch kamen sie mit solchen Kneipen. Die aber erreichten nicht mehr jene schönste und grauenvollste. Und der Münchner schimpfte kräftig weiter. Er ist von Haus aus ein guter Kerl, der, was malt und bildhauert, gern leiden mag. Nur dürfens die Herren nicht gar zu bunt treiben. Die Behaglichkeit muss gewahrt bleiben. Die Kneipe mit allen Zutaten hätte ihm trefflich gefallen, die Spässe hätte er belacht, am stärksten die Zoten –das Unglück war ihm zu viel. Kein Pietist, kein Mucker, praktischer Katholik auf allen Gebieten, sieht er, trotzdem er gern in die Kirche geht, streng darauf, dass ihm die Alleinseligmachende mit ihren Vorschriften in keiner Weise lästig falle. Das Dogma kennt er nicht, Fanatismus ist ihm direkt zuwider, und doch, der Witze auf die Religion waren zuviel, und was die Unsittlichkeit betrifft, so hätten die dum-men Maler auch etwas mehr Mass halten können: »Muass ma a net alleweil gar a so sei.« Das ist sein Wahlspruch; den zitierte er hartnäckig von da an, wenn er auf den Unglücksabend zu sprechen kam. Erst nach und nach zog ein leises Vergessen ein, und so tauchte mit den Jahren ein Faschingsbild auf, das der Münchner und die neue Generation etwas besser verstand.
Glitzernde Lichter in scharf geschliffenen Schalen, ausgestreut über einen weiten Saal, schwere Sammtvorhänge in breiten Goldumrahmungen, weisse Putten als lachende Säulenträger, hohe Spiegel von schmalen Stäben in gleichmässige Scheiben geteilt, das ist der Rahmen, Zeus und Venus im hohen Olymp mit dem halbnackten Hofstaat, das ist die Decke, und glattgefegtes Parkett in regelmässiger Dreieckform gefalzt, das ist der Boden. Darauf wirbelts herum in allen Schattierungen, von gelb zu rot, von grün zu blau, es wirbelt in Flittern und Spitzen, in Federn und Bändern. Alles Bewegung, alles Rhythmus, erzeugt von den Klängen eines wiegenden Walzers. Hingebend wird er getanzt, die kleinen Logen entlang bis zum Hintergrund des Saales. Dort sendet eine Riesenmuschel leuchtende Sonnenstrahlen zur Höhe, und in ihr thront, als ob es zur Fuchsjagd reiten wollte, das grosse Orchester in scharlachfarbenem Frack, heller Weste und schwarzer Krawatte. Jetzt eben hört es zu spielen auf. Die Fiedelbogen, die hoch und nieder gingen in gleichmässigem Tempo, rasten wieder ein paar Minuten, die Bassgeigen werden an die Wand gestellt wie hilflose Gliederpuppen, die Blasinstrumente werden nach unten gehalten. Drinnen im Saale aber brichts los, schmetternd und jubelnd. Die Dominos schwingen die Fächer, die Tänzer streichen die Glatzen ab oder fahren mit dem Taschentuch über das heisse Gesicht. Und in den Logen krachts mit froher Verheissung von den Pfropfen der Sektflaschen. Aber schon rufts zum nächsten Tanz, zur Française. Und da stürzt es wieder aus allen Ecken mit jener Hast, die fürchtet, zu spät zu kommen. Man hebt kreischende Weiber über die Brüstung der Logen, man pufft nach allen Seiten, man drängt und schiebt ohne Rücksicht, ohne Pardon. Mit Not und Mühe stellen Tanzordner die einzelnen Schlachtreihen auf. Tönen aber die ersten Klänge, dann löst sichs in Vor-und Zurücktreten, in Komplimente und Kusshände, in Balancieren und Drehen. Immer lauter tönt der Jubel, immer kecker fliegen die Röcke –da, bei der vorletzten Tour hebt sich im rasenden Ringelreih das wiehernde Lachen zum bacchantischen Gebrüll. Als ob der Hörselberg losbräche mit Faunen und Nymphen. Alle die hochgehobenen Weiber mit fuchtelnden Armen und strampelnden Beinen erscheinen in diesem Augenblick wie ein ungeheures Ganzes, ein Riesenpolyp, der mit den Männern erst Fangball spielt, ehe er sie gänzlich verschlingt.
Das ist der Höhepunkt, die eigentliche Sensation des Karnevalfestes. Bal paré hat es der Münchener getauft, und das Theater, in dem ers alle Wochen feiert, das Deutsche. Ist die letzte Française getanzt, der Kehraus gespielt, dann verschwindet man langsam. Der eine ins Bett, wenn dies nützliche Möbel noch nicht ins Leihhaus gewandert ist, der andere zu Weisswurst und Bockbier, der dritte ins Café Luitpold. Viele schleichen in Frack und Lackschuhen durch Matsch und Schnee direkt wieder zum Ladentisch, um Rosinen oder Heringe zu verkaufen, andere sinnen auf neue Vergnügungen und gehen die paar Schritte weiter zum Prachtbau des Münchner Justizpalastes. Dort ists jetzt gerade sehr interessant. Ein Ehepaar sitzt vor den Geschworenen. Schelhaas heisst es, und er will ein Kunstmaler sein. Was sich halt in München so Kunstmaler nennt. Jeder Mensch, der von auswärts hierherzieht, tausend Mark Rente versteuert und draussen in den Anlagen von Gern oder Pasing eines der Grillenhäuschen kauft, kann sich Kunstmaler nennen. Hat die Villa zufällig noch ein Fenster mit Nordlicht, erst recht. Da man aber noch nicht leben kann, wenn man Farben und Leinwand ersteht, sinnt man auf Nebenverdienste. Die Angeklagten nahmen einen Pensionär auf, einen alten Herrn. Nicht den bekannten, freundlichen aus Romanen und Lustspielen, nein, einen Geizkragen, einen Sonderling. Hatte selber schon auf der Sünderbank gesessen und vier Jahre Zuchthaus bekommen. Doch er verfügte über das chemische Reinigungsmittel, das die Flecken dieser Jahre vom Antlitz wäscht: Geld hatte der Alte; das reizte die Angeklagten. Der Herr Kunstmaler kaufte eines Tages Cyankali. Das soll die Farben leuchtender machen –behauptete er. Denn wie er dieses Gift im Verein mit seiner Gattin verwandte, sollte den Nachbarn nicht lange ein Geheimnis bleiben. Dem Kamin der kleinen Villa entstieg eines Tages dicker Qualm, dass man sie für eine Fabrik halten konnte. Zugleich stank es so bestialisch, dass alles auf hundert Schritt Reissaus nahm. Verbranntes Fett, meinte man zuerst in der Nachbarschaft und schalt auf Frau Schelhaas. Geizkragen aber werden schon seit Harpagons Tagen selten üppig dargestellt. Und so klebte der Staatsanwalt eine Geschichte zusammen, die den Dichtern der Hintertreppe die grössten Gesichtspunkte eröffnet. Herr und Frau Schelhaas haben ihren Pensionär gemeinsam vergiftet. Dann zerschnitten sie ihn mit einem Tranchiermesser und heizten mit dem alten Herrn ein paar Wochen lang ihre Villa. Wozu? Mein Gott, die Märztage, wo das Verbrechen geschehen sein soll, sind auf der oberbayrischen Hochebene oft noch recht unfreundlich. Da war der dürre, alte Herr gut zu verwenden. Ausserdem, die Kunstmalersehegatten hatten Passionen. Er für den Automobilsport, sie für seidene Blusen. Und beiden machte es ein kindisches Vergnügen, sich draussen in der Villa an gemütlichen Abenden die alten Münchner Volksweisen durch ein Grammophon vorsingen zu lassen. Lebenskünstler, ausgesprochene Lebenskünstler. Lautet das Verdikt auf nichtschuldig, dann besuchen sie noch den letzten Bal paré. Sie tanzen die Française mit, sie ziehen sich in die Logen zurück, er mit seinem Domino, sie mit ihrem Liebhaber, sie gehen noch ins Nachtcafé, und im Morgengrau, wenn die Flitterpracht langsam zu erblassen beginnt, treffen sie sich wieder im ersten Vorortzug, um gemeinsam zur Villa hinauszufahren.
Leider wirds knapp mit der Zeit. Es nahen schon die drei närrischen Tage und immer noch hat man keine Spur, wo der alte Herr geblieben ist. Zeugen aus aller Herren Länder lud man vor, ja, man verbrannte fünfundzwanzig Pfund Pferdefleisch, um zu prüfen, obs gerade so roch wie der verschwundene Pensionär –alles vergebens. Im Zuschauerraum, wo man sich Brust und Beine wund drückt, geht die bange Sage, ein übelbeleumundeter Schweinemetzger habe ihn von den Angeklagten käuflich erworben, um daraus seine Schwartenmagen in gefälligen Formen erstehen zu lassen. Doch auch hiefür fehlt der Beweis. Und die Angeklagten leugnen weiter. Das wird langweilig auf die Dauer, drum eilt man zur Erholung wieder hinaus auf die Strasse. Dort gehts anregender zu. Tief blau ist der Himmel, feine Dunstwölkchen streichen über die Sonne wie der Dampf einer Zigarette, ein dichter Sprühregen geht durch die Luft von Myriaden roter, grüner, gelber, blauer und weisser Punkte. Dazwischen wimmelts von Reitern, Wagen, Radeln, Schnauferln, fauchend, schreiend, pustend. Schweinsblasen krachen, die Pritschen fallen und fortwährend –ein Geschrei von tausend neugeborenen Kindern –tönen kleine Trompeten. Ein ungeheures Skandalorchester, wie von Gasmotoren in Bewegung erhalten. Aber auch die Häuser sind rebellisch geworden nach langem Winterschlafe. Sie sehen aus, als schnitten sie vergnügte Grimassen, als rissen sie weit ihre Augen auf. Nun sausen aus allen Stockwerken Luftschlangen, Papierkugeln, Orangen. Und das Riesenorchester spielt weiter, und die Allotria dauert fort. Dort hauen sich Pierrots Bahn, Soldaten ziehen singend und schiebend durch die Menge, Mütze rechts, Mütze links, Lumpen, alte Weiber und alle zwei Schritte, wo immer man geht, ein besoffener Bauer. Der kommt in kurzen, in langen Hosen, in Joppe, ohne Joppe, er reitet auf einem Klepper, er fährt mit Weibern, Kindern, ja gleich mit der ganzen Gemeinde auf Leiterwagen spazieren, er trinkt Bier, er haut, sticht, singt, er ist die gefeierte Hauptperson des Tages.
Der Münchner aber schaut, schaut und schaut. Er schaut gemächlich nach rechts, nach links, er schaut nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten, er schaut sich die Augen heraus. Fest und steif steht er da, wie die in Erz gegossenen Standbilder der Könige, der Gelehrten, der Staatsmänner, die auf öffentlichen Plätzen in starrer Pose den Hexensabbath überragen. Nur das Maul sperrt er auf, bis ihm Konfetti hineinfliegen oder ein kräftiger Guss auf Deckel und Nase erfolgt. Würde der tote König vorübergefahren, ertönte das Miserere, der Münchner könnte nicht unbeweglicher dreinschauen. Auch jetzt nicht, wo auf einmal mitten durch den Faschingstrubel der königliche Hof in umfangreichen Staatskarossen zur Michelskirche zieht. Ein neues Bild, aber was ist da zu staunen? Morgen ist Aschermittwoch, der Tag der Busse, der Geldbeutelwäsche und der Stockfische. Das weiss er, der Münchner. Drum kanns ihm ganz recht sein, wenn Andere für ihn die Andacht verrichten, in dem nun beginnenden Vierzigstündigen Gebete. Kein Pferd bringt ihn weg, er bleibt auf seinem Platze, er lässt sich was vorspielen, stundenlang wie im Theater. Mit Frau und Kindern. Oder, wenn er unverheiratet ist, mit jenem weiblichen Wesen, das er Matschackerl nennt. Woher das Wort kommt, weiss er selber nicht. Er kennt nur dessen festen, greifbaren Sinn. Verkörpert in reichem Fleisch und hingebender Seele. So was, was er walzen und rumdrehen kann. Was nicht weggehen darf, was treuer sein muss als eine angetraute Gattin, was bleibt viele Jahre, und was er schliesslich aus Bequemlichkeit auch noch heiratet, wenns einmal das kritische Alter erreicht hat. Darum muss es auf der Redoute immer ein böses Gesicht machen, ja, es muss sogar Ohrfeigen austeilen, es darf sich nur von ihm Champagner zahlen lassen, es darf nur mit ihm tanzen, mit dem Liebhaber. Denn so ein Karneval ist eine ernste Sache, ob auf der Strasse, ob im Deutschen Theater, im Kolosseum oder gar auf dem Bauernball.
Dies letztgenannte Vergnügen mochte eigentlich in früheren Zeiten jener Mensch nicht, der sich im Vollbesitz eines waschechten Matschackerls einen Urmünchner nennen durfte. Jetzt aber kann er sich ihm so wenig entziehen wie die medizinischen Wissenschaften dem Gebrauche der Roentgenstrahlen oder die katholische Kirche dem Sakramente der Ehe. Denn der Bauer beherrscht nicht nur die Strasse; auch in Familien, bei Vereinsfesten regiert er. Das kam ganz leise, wie von selber. Die jungen Akademiker hatten einmal vor Jahren eine Kirchweih veranstaltet, und weil die gefiel, eine Nachkirchweih. Andere Künstler griffen es auf, Gesangsvereine kamen, Kostümfreunde, und heute steht dieses Fest im Mittelpunkt des ganzen Karnevals. Der Bal paré mag sich in acht nehmen: eines Tages wird München ein einziger, grosser Bauernball sein. Kein Wunder, es ist bequeme Tracht, leicht zu beschaffen, sie erlaubt jeden Unfug, man kann juchzen, jodeln, braucht sich niemals auf ausgeschnitten zu waschen und kann Männlein und Weiblein in froher Gemütlichkeit mit benagelten Stiefeln fest auf die Hühneraugen treten. Auch ist die Scheidewand zwischen den Tanzenden nicht zu dick bemessen. Manchmal nur eine durchsichtige Bluse, viel öfter noch nur ein Hemd. Und das steht meistens offen. Da gibts denn eine Kirchweih nach der andern. Wollte man sie einzeln nennen, müsste man die Namen aller oberbayrischen Nester auswendig wissen und die der niederbayrischen noch dazu. Ob aber Miesbach, ob Werdenfels, überall ists dieselbe Atmosphäre von Bier und gesottenem Fleisch. Von Tabaksqualm und Tiroler Spezial. Überall dieselbe Dekoration von Tannenbäumen und grünspanfarbenen Papierguirlanden. Gehts hoch her, dann plätschert im Hintergrund ein veritabler Wasserfall vor massiven Almenhütten und einem gekitschten Prospekt, der Felsen und Gletscher darstellt. Nichts mehr gemahnt an die Tage der Künstlerkneipe, nichts mehr an jene Kostümfeste, wie sie einst im Hoftheater abgehalten wurden, und die Gottfried Keller zur Schilderung begeisterten.
Freilich, jene Feste waren der Ausdruck der damaligen Zeit und der damaligen Malerei. Alle drei bis vier Jahre wiederkehrend, spiegelten sie sich erst in der pathetischen Art der Kaulbach und Piloty, später in der prunkvollen Umrahmung, die Gedon mit der künstlichen Wiederbelebung der Renaissance geschaffen, und die Lenbach in seinem Atelier und seinen Ausstellungsräumen so gerne verwandt hat. Aus jener Zeit stammen die Feste, wo die Bilder neun Meter lang und sechs Meter hoch waren, wo der Aktschluss eines grossen Schaustückes auf dem Theater, der entscheidende Augenblick einer Völkerschlacht oder gleich eine ganze Epoche auf einer Leinwand festgehalten wurde. Wo Schwanthaler die Bavaria modellierte, wo die Künstler noch Kragen und Samtjacket trugen, wos noch keine Sezession gab, keine Luitpoldgruppe und keine Gruppe der Kollegen, wo das Maximilianeum entstand, das die ganze Weltgeschichte in Riesengemälden aufnahm: da musste auch so gefeiert werden. Gestalten und Gruppen lösten sich los aus den reichen Goldrahmen und zogen belebt durch die Strassen. In strahlender Rüstung und purpurfarbener Gewandung, mit Kanonen und Hellebarden. Schlug das junge Laub aus den Buchen, dann gings hinaus ins Isartal zur Burg Schwaneck, die gestürmt wurde, lag der Schnee auf den Dächern, in das Hoftheater oder in das Odeon. Wo aber immer es war, überall herrschte ein Treiben, eine Laune, die man in München nicht mehr lebendig macht.
Das Kaufmannskasino, diese Vereinigung reicher Fabrikanten und selbstgewisser Couponabschneider, versucht zwar jeden Fasching so etwas in Szene zu setzen, was Leuten mit schlechtem Gedächtnis jene Stunden zurückrufen soll. Es zahlt einen Maler, der, je nach der Art des Festes, die Teilnehmer spanisch, italienisch oder altdeutsch kostümiert, es zahlt einen Dichter, der in schwungvollen Versen die Bedeutung des Tages erklärt und am Schluss den Landesvater anhocht. Die Herren Kommerzienräte, und die es gerne werden möchten, stolzieren da sehr schön mit Zwicker, Barett und Degen hocherhobenen Hauptes durch den Saal, sie strecken und recken sich wie ihre aufgedonnerten Damen, aber wenn sie es noch so fein machen, es bringt doch nicht jenen Eindruck hervor, den der Grüne Heinrich empfing, als er vor fünfzig Jahren schrieb: Jeder war für sich eine inhaltvolle Erscheinung und Person, und indem er selber etwas Rechtem gleichsah, schaute er freudig auf den Nächsten, welcher in der schönen Tracht nun ebenfalls so vorteilhaft und kräftig erschien, wie man gar nicht hinter ihm gesucht hätte, trotzdem der Kern der Festgebenden nicht aus leeren Figuranten und Lebemenschen, sondern aus schwungvollen, vom Genius gehobenen Jünglingen und längst in gediegener Arbeit ausgereiften Männern bestand, welche einen rechtsgültigen Anspruch besassen, die bewährten Vorfahren darzustellen.
DIE VERGANGENHEIT
Wohlverdientes Todesurteil des Josephus R. vulgo Patriot welcher auf höchste Anbefehlung eines Churfürstlich hochwohllöbl. Hofraths allhier in München
wegen teils einbekannt, teils überwiesenen, höchst vermessenen und tollkühnen Verbrechens der aufrührerischen Schrift: Wahrer Ueberblick der Geschichte der bayerischen Nation und insonderheit der der Stadt München sohin puncto criminis perduellionis nach dem klaren Inhalt des wohlbestellten Criminalcodex Plc. 8 § 1 und anderen Argravantien (beschwerenden Umständen) heut Samstag den 11. Oktober 1800 in einer Kuhhaut eingenäht, zur Richtstätte geschleppt, auf dem Wege öfter mit glühenden Zangen gezwickt und allda lebendig mit 4 Pferden zerrissen und so vom Leben zum Tode hingerichtet worden. Die 4 Viertel werden nebenbei zum abschreckenden Beispiel auf den Landstrassen der Landesgrenze auf Viertelgalgen, der Kopf aber hier auf einem besonderen Hauptviertelgalgen mit der Ueberschrift aufgehangen: Strafe in diesem Lande für Vaterlandsliebe und Aufklärung. Endlich wurde all sein Hab und Gut dem Fiscus anheimgeschlagen.
Vorstehendes Todesurteil fand ich heute unter alten Papieren. Ich las es, las es wieder. Dann stiegen mir so langsam schwere Bedenken auf. Bis hieher hatte ich geschrieben, so auf gut Glück, wie mirs just in die Feder kam. Mit dem Fasching hatte ich begonnen, weils gerade im Fasching war, von Herrn und Frau Schelhaas hatte ich berichtet, weil sie gerade verhandelt wurden. Nun ist der Fasching vorüber, das Ehepaar verurteilt, und ich muss fortfahren in meiner Epistel. Denn das ist mal so Sitte, hat man das erste Kapitel geschrieben, muss man das zweite vornehmen, das dritte usw. bis man findet, dass man nichts mehr zu sagen hat. So wollte ich denn in Gottes Namen erzählen –ja, was wollte ich denn eigentlich erzählen? Von der Litteratur? Ihre Vertreter hausen hier in bester Eintracht zusammen, zärtlich wie Turteltauben und wären schon deshalb einer Schilderung wert. Von den Theatern? Sie gehen friedlich weiter, einen angenehmen Trott, und stören in keiner Weise durch selbständige Ideen. Also etwa von bildenden Künstlern? Sie veranstalten Ausstellungen, zerfallen immer mehr in einzelne Gruppen und haben sich beinahe schon so lieb wie die Schriftsteller. Bliebe ausserdem noch der Bayrische Landtag, der jetzt schon sieben Monate in der Prannerstrasse tagt, es bliebe noch Herr von Possart, der, seitdem er die königlichen Bühnen nicht mehr leitet, Goethe, Schiller und Heine in angenehmer Abwechslung rezitiert oder das grosse Deutsche Bundesschiessen, das diesen Sommer wieder Alldeutschland zu löblichem Tun nach München führt. Stoff genug wäre vorhanden, und ich glaube, ich könnte ihn bewältigen. Hab’ ich doch schon öfters über München geschrieben und mich in Art und Sitten seiner Bewohner liebevoll vertieft. Dass ich mich damit besonders in Gunst gesetzt hätte, könnte ich allerdings nicht behaupten. Die Münchner wollten nie recht verstehen, wie ichs darstellte; sie wünschen retouchierte Photographien und verlangen, dass aus dem vorgehaltenen Spiegel ein anderes Gesicht herausschaut als das, was hineingrinst. Jedenfalls sind sie in diesem Punkt äusserst empfindlich, und dass sie das immer schon waren, beweist mir das Schicksal des Josephus R., das mir nicht mehr aus dem Kopfe will. Mit glühenden Zangen gezwickt, von vier Pferden zerrissen und dann gar noch mit allen möglichen und unmöglichen Körperteilen zur Warnung öffentlich aufgespiesst –ich danke für so was. Es ist ja wahr, unsere eminent aufgeklärte Zeit hat die Schrecken der damaligen Hinrichtungsmethoden wesentlich gemildert. Heute köpft man nur, ganz einfach, ganz schmucklos, draussen in Stadelheim, der entzückend gelegenen Strafvollstreckungsanstalt am Perlacher Forste. Zwölf Zeugen, sechs Journalisten, zwei Kapuziner, ein von Humanität triefender Staatsanwalt und in Smoking und schwarzen Glacéhandschuhen der Herr Scharfrichter mit zwei Assistenten. Alles geräuschlos, so ganz en petit comité. Vorüber die herrlichen Tage, wo München zu Füssen des Galgenberges jedesmal einen Wurstlprater errichtete, der dem der Oktoberfestwiese noch in den vierziger Jahren erfolgreiche Konkurrenz bot. Kein Armersünderkarren mehr, kein öffentliches Schafott, alles Bildung, alles Diskretion, alles Kultur. Trotzdem lockt michs nicht. Auch die Aussicht, in der Anatomie von der Zehe bis zum Scheitel als Präparat für wissbegierige Studenten zu dienen, kann mich nicht reizen. Deshalb will ich mir die Sache noch einmal gründlich überlegen, Schritt für Schritt, auf Personen und Umstände, ehe ich richtig hereintappe.
Und da drängt sich mir zunächst eine Frage auf: Was setzen die Münchner von einem voraus, der über ihre Stadt schreibt? Dass er gut schreibt, dass er lobt. Also etwa: München, die unvergleichliche Stadt, gelegen am Fusse der Alpen, mit seiner intelligenten Bevölkerung, seiner berühmten Strassenreinigung, seiner immerwährenden Kanalisation, München, die Stadt des trefflichen Wassers, München, die Stadt der Kunst etc. etc. –so muss es klingen. Und besonders die Kunst kann gar nicht genug betont werden. Sie ist den Münchnern eine Notwendigkeit geworden, wie das Vaterunser mit dem Ave Maria. Der Herr Bürgermeister sagt in jeder Festrede, wenn er die goldene Kette trägt: München ist eine Kunststadt, das Hauptblatt Münchens druckt täglich zweimal, früh und abends, für jeden ders lesen will: München ist eine Kunststadt, und schliesslich wiederholt der Eingeborene mit der selbstgewissen Freude, die er an jedem Besitze empfindet, seis ein Stück Geld oder ein schönes Mädel: München ist eine Kunststadt. Warum auch nicht? Es braucht sich ja keiner etwas zu denken dabei. Ausserdem ist es wahr. Es leben doch eine Masse Maler in München, überall sieht man Geschäfte, die Pinsel und Farben verkaufen, Modelle gibts, dass man sich gar nicht mehr retten kann und die Hauptsache: die zwei Pinakotheken, die Glyptothek, das Maximilianeum, das Ding da –na wie heissts denn gleich? –na, das Haus in der Briennerstrasse, wo auch so viele Bilder hängen? Richtig! Die Schackgalerie. Obendrein jedes Jahr eine Ausstellung im Glaspalast, die Sezession, alle fünf Jahre eine Internationale, und da soll einer behaupten, München sei keine Kunststadt, da soll einer –Was?
Die Prozessakten des Josephus R. starren mich wieder an, so mahnend, so forschend wie zuerst. Hat der Verbrecher etwa an der Kunststadt gezweifelt? Das war nicht gut möglich. Zu seiner Zeit gabs in ganz München, einige Ahnenbilder in der alten Kurfürstenresidenz ausgenommen, nichts, was an Kunst gemahnte. Ein Pfuhl, ein Morast war die Stadt, worin die Jauche fröhliche Furchen zog, wie am Hof eines Dachauer Moorbauern. Der Dreissigjährige Krieg hatte hier nichts zerstören können an Kultur, wie in der stolzen fränkischen Reichsstadt, dem freien Nürnberg, wo die Meister der Renaissance ihre Wunder wirkten. Ein Winkelwerk von Befestigungen, von elenden Häuschen und Gässchen, so war die Stadt emporgewachsen, von dem Tage an, da Heinrich der Löwe unten an der Isar eine Salzstätte errichtete. Nur die Alte Residenz, von der Gustav Adolf gesagt hatte, er möchte sie am liebsten auf Rädern nach Stockholm schaffen, konnte das Auge erfreuen und später da und dort noch ein Bau in Rokoko oder Barock, herübergebracht aus dem Lande, von dem bayrische Kurfürsten im 18. Jahrhundert, wie ihre liebwerten Vettern im übrigen Deutschland, alles bezogen, was an Kultur gemahnte, von Frankreich. Sonst weit und breit eine schreckliche Öde, und wie der Sumpf in der ganzen Stadt, so dünstete er aus in den oberen Gesellschaftskreisen. Ein korrumpiertes Beamtentum, ein versimpelter Adel, ein diese beiden ausschlachtender Klerus. An der Spitze der kaum ins Land gezogene Kurfürst Max Joseph I., jener grobe, pfiffige Pfälzer mit dem feisten Gesichte, den goldenen Ohrringen, den die Münchner, weil er gern mit ihnen verkehrte, kurzweg den Maxl nannten.
Mitten im Studium der Akten halte ich ein. Was ich da aus verschnörkeltem Schrifttum übertrug, wollte ich nämlich selber sagen, Wort für Wort. Auch mir wars kein Geheimnis, dass der braunschweiger Herzog, der finstere Heinrich, weil er da unten bei Föhring einmal seinen Löwen spazieren führte, der Gründer Münchens genannt wird. Dass ferner die bayrischen Kurfürsten mit gottergebener Demut Klöster zur Ablegung von Ordensgelübden und Lustschlösser zur Ablegung von Maitressen in Menge errichteten, kann man heute noch sehen, und von den Zuständen Münchens vor hundert Jahren hat mir auch der Ritter Heinrich von Lang in seinen Memoiren ausführlich berichtet. Ein gar trefflicher Kenner bayrischer Verhältnisse, ein noch besserer Erzähler heilloser, zum Teil schier unglaublicher Anekdoten. Ihn zerriss man gerade nicht in Stücke, aber man tat ihm, was man in Bay-erns Hauptstadt jedem tut, der kritisiert und eine halbe Stunde nördlich der Donau geboren ist: man nannte ihn öffentlich einen Preussen, heimlich einen Saupreussen. Dabei trug der gute Mann den Titel eines bayrischen Reichs-und Domänenrats, war von Ansbach nach München gekommen, verlebte also ausser der Zeit, wo der korsische Eroberer die fränkischen Fürstentümer Bayern einverleibte und Max Joseph zum König machte, auch jene Tage mit, wo in München der böse, französische Geist wieder zu weichen begann und einem brausenden Patriotismus in Schnauzbärten und himmelblauen Röcklein Platz machte. »Präsidenten, Kanzler und Räte fingen an zu exerzieren; die Herren Grafen und Barone suchten in den Kaffeehäusern und an den Wirtstafeln die alten, französischen Freunde auf, um vor ihnen ihre Verwünschungen und Flüche auszuschicken, und so ist sie nun mit Gottes Hilfe um den Preis unseres vielen Blutes wieder da, die alte schöne Zeit der Patrimonialgerichte, der Landessperren, der Siegelmässigkeit und Steuerprivilegien, der neuen Fideikommisse, der wiederbefestigten Leibeigenen Gütergebundenheit, der geheiligten Gemeindeordnungen, der Wallfahrten, des Kapuzinerbettels.«