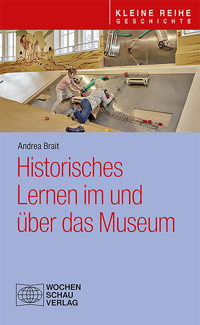39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: StudienVerlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Der Band präsentiert die Ergebnisse einer empirischen Studie, in der untersucht wurde, inwiefern im Zuge von Museumsbesuchen im Rahmen des Geschichtsunterrichts Möglichkeiten zur Förderung des historischen Denkens bei Schülerinnen und Schülern geboten werden. Die Untersuchung erfolgte am Beispiel des österreichischen Geschichtsunterrichts in der Sekundarstufe und der österreichischen Landesmuseen. Im Sinne einer Triangulation wurden Erhebungen im musealen und im schulischen Kontext durchgeführt (Ankündigungen von Kulturvermittlungsprogrammen, Experteninterviews in den Museen sowie mit Geschichtslehrkräften, Beobachtungen von Schulklassen bei Museumsbesuchen sowie in den Geschichtsstunden vor und nach diesen, schriftliche Berichte von Schülerinnen und Schülern zu diesen Museumsbesuchen). Bei der Analyse wurde auf das in den österreichischen Lehrplänen verankerte Kompetenz-Strukturmodell von FUER Bezug genommen. Der Band zeigt deutlich die Chancen, die Museumsbesuche für historisches Lernen bieten. Zudem wurden sechs Formen von gezielt durchgeführten Einbettungen von Museumsbesuchen in den Geschichtsunterricht durch die Lehrkräfte herausgearbeitet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1052
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Andrea Brait
Museumsbesuche im Geschichtsunterricht
Österreichische Beiträge zur Geschichtsdidaktik
Geschichte – Sozialkunde – Politische Bildung
Band 16
Herausgegeben von
Christoph Kühberger, Heinrich Ammerer, Wolfgang Buchberger
Andrea Brait
Museumsbesuche imGeschichtsunterricht
Eine empirische Studie zumhistorischen Lernen im Zuge vonBesuchen der österreichischenLandesmuseen
meinen MentorenManfried RauchensteinerMichael GehlerChristoph Kühberger
Inhaltsverzeichnis
Vorwort und Dank
1. Einleitung
2. Geschichtsdidaktische Theorien und normative Vorgaben
2.1 Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur
2.2 Fachspezifische Kompetenzorientierung in Österreich
2.2.1 Verankerung der fachspezifischen Kompetenzorientierung in Lehrplänen
2.2.2 Arbeit mit Quellen und Geschichtsdarstellungen als Voraussetzung für die Förderung von fachspezifischen Kompetenzen
2.2.3 Bisherige Erkenntnisse zur Umsetzung der fachspezifischen Kompetenzorientierung im österreichischen Geschichtsunterricht
2.3 Außerschulisches historisches Lernen
2.3.1 Zur Bedeutung außerschulischer Lernorte
2.3.2 Rechtliche Grundlagen zum Besuch von außerschulischen Lernorten in Österreich
2.3.3 Museen als außerschulische Lernorte
2.3.3.1 Kulturvermittlung als Aufgabe von Museen
2.3.3.2 Entwicklung der Kulturvermittlung in Österreich
2.3.3.3 Museen als historische Lernorte aus Sicht der Geschichtsdidaktik
2.3.3.4 Kulturelle Bildung in Museen
2.3.4 Ausstellungen und Museen in österreichischen Lehrplänen für den Geschichtsunterricht
2.3.5 Landesmuseen in Österreich
3. Methodisches Vorgehen
3.1 Experteninterviews mit Geschichtslehrkräften
3.2 Experteninterviews in den österreichischen Landesmuseen
3.3 Vermittlungsprogramme
3.4 Nicht-teilnehmende teilstrukturierte Beobachtungen
3.5 Texte der Lernenden
3.6 Grenzen der vorliegenden Studie
4. Historisches Lernen zwischen Schule und Museum
4.1 Rahmenbedingungen für Museumsbesuche in der schulischen Praxis
4.2 Kulturvermittlung in den österreichischen Landesmuseen
4.2.1 Rahmenbedingungen
4.2.2 Ausrichtung der Vermittlungsprogramme
4.2.3 Schulklassen als Zielgruppen
4.2.4 Vermittlungsprogramme aus geschichtsdidaktischer Perspektive
4.3 Lernmöglichkeiten im Zuge von Museumsbesuchen
4.3.1 „Es war super!“ Allgemeine Bewertungen von Museumsbesuchen aus der Perspektive der Lernenden
4.3.2 Historisches Lernen im Museum
4.3.2.1 Historisches Faktenwissen
4.3.2.2 Lernen mit Exponaten
4.3.2.3 Lernen über das Museum als geschichtskulturelles Produkt
4.3.3 Vermittlungsprogramme und die Rolle der Kulturvermittlerinnen bzw. -vermittler
4.3.4 Kulturelle Bildung durch Museumsbesuche
4.4 Einbettung von Museumsbesuchen in den Geschichtsunterricht
4.4.1 Vor- und Nachbereitungsstrategien
4.4.2 Einbettungsformen
4.4.3 Bezugnahmen auf frühere Museumsbesuche
5. Fazit und Ausblick
5.1 Empirische Erkenntnisse
5.2 Schlussfolgerungen für die Pragmatik
5.2.1 Möglichkeiten für Museen
5.2.2 Möglichkeiten für Geschichtslehrkräfte
5.2.3 Möglichkeiten für die Politik
6. Literatur- und Quellenverzeichnis
7. Abbildungs-, Diagramm- und Tabellenverzeichnis
8. Anhang
8.1 Interviewleitfaden – Lehrkräfte
8.2 Transkriptionsrichtlinien – Interviews Lehrkräfte
8.3 Interviewleitfaden – Kulturvermittlung
8.4 Beobachtungsleitfaden
Vorwort und Dank
Manfried Rauchensteiner steht am Beginn dieser Studie wie auch meiner wissenschaftlichen Tätigkeit. Er ist wesentlich dafür verantwortlich, dass ich mich während meines Studiums näher für Museen zu interessieren begann. Nach der Arbeit für Ausstellungen und Museen in Österreich und Deutschland sowie einer Dissertation zu gesellschaftlichen Diskursen über Museen schien der eingeschlagene Weg jedoch am Ende zu sein. Ein Forschungsprojekt zu den Auswirkungen der Umbrüche des Jahres 1989 auf Österreich führte mich zur Diplomatiegeschichte und zu meinem zweiten Mentor, Michael Gehler. Ein Lehramtsstudium und drei daran anschließende Jahre als Lehrkraft an Berufsbildenden höheren Schulen brachten eine neuerliche Wende in meiner beruflichen Laufbahn. Doch ganz ließen mich Museen nicht los. Die Museumsbesuche, die ich mit meinen Schülerinnen und Schülern durchführte, warfen Fragen nach der Vereinbarkeit von musealen und geschichtsdidaktischen Zielsetzungen auf. Der erste Eindruck einer gewissen Kluft zwischen den Diskursen der Geschichtsdidaktik einerseits und der Museumswissenschaften bzw. konkreter der Kulturvermittlung in Museen andererseits wurde zum Ausgangspunkt für die Konzeption meines Habilitationsprojekts Historisches Lernen zwischen Schule und Museum, das ich am Institut für Zeitgeschichte und am Institut für Fachdidaktik der Universität Innsbruck durchführen konnte und das von meinem dritten Mentor, Christoph Kühberger, begleitet wurde. Dabei war es mir überaus wichtig, die Besonderheiten von Museen bei aller Notwendigkeit von fachspezifischen, in den Lehrplänen auch staatlich verordneten Unterrichtszielen nicht aus den Augen zu verlieren. Letztlich hat sich gezeigt – Achtung: Spoiler –, dass Museen enorme Potentiale für außerschulisches historisches Lernen bieten und dass es sich um eine Institution handelt, die von Lehrkräften wie Lernenden gleichermaßen geschätzt wird. Die nun als Publikation vorliegende, um aktuelle Literatur ergänzte und damit im derzeitigen Forschungsstand verortete Habilitationsschrift, die 2021 von der Universität Innsbruck angenommen wurde, stand bereits unter dem Einfluss von meinem neuen Forschungsumfeld am Zentrum für Kulturen und Technologien des Sammelns der Universität für Weiterbildung Krems.
Forschung findet immer in einem bestimmten Rahmen statt, der Dinge ermöglichen oder auch verhindern kann. Dieser wurde in meinem Fall einerseits von Forschungseinrichtungen und andererseits von Einzelpersonen ausgestaltet. Neben meinen drei Mentoren, die mich seit vielen Jahren begleiten und mit zahlreichen fachlichen sowie darüber hinausgehenden Ratschlägen immer eine wichtige Stütze waren, gilt mein Dank zunächst jenen Personen, die sich für meine empirischen Erhebungen Zeit nahmen. Zu Interviews erklärten sich 85 Geschichtslehrpersonen und die Leiterinnen und Leiter der Kulturvermittlungsabteilungen aller neun österreichischen Landesmuseen sowie an zwei Institutionen je eine weitere Mitarbeiterin bereit. Darüber hinaus ermöglichten mir elf Geschichtslehrkräfte und deren Klassen Beobachtungen eines Museumsbesuchs sowie der Geschichtsstunde vor und nach diesem; 202 Schülerinnen und Schüler verfassten kurze Texte nach den Museumsbesuchen. Den Bildungsdirektionen von Niederösterreich, Tirol und Wien danke ich für die Genehmigung dieser Erhebungen.
Ein Dankeschön gilt auch der Universität Innsbruck und an dieser meiner Institutsleiterin Ingrid Böhler und Dekan Dirk Rupnow für die Schaffung des organisatorischen Rahmens, der für die empirischen Studien in ganz Österreich nötig war, sowie Dekanin Suzanne Kapelari vom Institut für Fachdidaktik für anregende Gespräche zum außerschulischen Lernen über die Fächergrenzen hinweg. Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei Claus Oberhauser, der sich dazu bereit erklärte, ein konsensuales Codieren der Ankündigungen der Vermittlungsprogramme der Landesmuseen mit mir gemeinsam durchzuführen und diese damit fachlich abzusichern. Auch zahlreichen weiteren Kolleginnen und Kollegen vom Verbund LehrerInnenbildung West danke ich für die wertvolle Zusammenarbeit in den letzten neun Jahren: Andrea Kronberger, Heike Krösche, Irmgard Plattner, Claudia Rauchegger-Fischer, Stephan Scharinger und Thomas Stornig. Jasmin Fischer, Nina Hechenblaikner, Laura Volgger und Magdalena Winkler waren mir im Rahmen ihrer Anstellungen eine große Hilfe bei diversen unterstützenden Tätigkeiten, wie der Transkription von Interviews. Nina hat darüber hinaus die Prüfung der Kategoriensysteme auf Intercoder-Reliabilität ermöglicht, wofür ich sehr dankbar bin.
Zudem gilt mein Dank meiner Zentrumsleiterin Anja Grebe und meinen Kolleginnen und Kollegen vom Zentrum für Kulturen und Technologien des Sammelns der Universität für Weiterbildung Krems, die nicht nur ein hervorragendes Arbeitsklima schaffen, sondern mich auch wissenschaftlich zu neuen Perspektiven inspirieren. Für wichtige fachliche Hinweise bin ich auch Sabine Fauland, Wolfgang Muchitsch, Roland Bernhard, der FUER-Gruppe sowie allen Kolleginnen und Kollegen dankbar, die mir bei Tagungen und anderen Gelegenheiten Feedback zu meinem Projekt gaben. Für weiteren fachlichen Austausch sowie für die wertvolle Zusammenarbeit und hilfreiche Gespräche zur und abseits der Habilitation danke ich außerdem ganz herzlich Richard Lein und Christopher Treiblmayr. Darüber hinaus bedanke ich mich bei Stefan Rädiker, der mir bei Fragen zum methodischen Vorgehen wertvolle Hinweise gab, sowie bei Karin Gilmore, die das mühevolle Korrektorat des Manuskripts übernahm. Angelika Moser danke ich für das verlagsseitige Korrektorat.
Für die finanzielle Förderung von Teilprojekten, die zur Habilitation führten, danke ich zudem dem Zukunftsfonds der Republik Österreich, der Richard & Emmy Bahr-Stiftung sowie dem HRSM-Projekt „Digitalisierung und Informationsaufbereitung für die Digital Humanities“ (DI4DH). Dem Dekanat der Philosophisch-Historischen Fakultät, dem Institut für Fachdidaktik und dem Forschungsschwerpunkt „Kulturelle Begegnungen – Kulturelle Konflikte“ der Universität Innsbruck bin ich außerdem für die Förderung der Drucklegung dankbar. Dem Studienverlag und bei diesem insbesondere Lisa Kropiunig und Danijela Pavic danke ich für die organisatorische Betreuung der Drucklegung.
Forschung wird jedoch nicht nur durch berufliche Kontakte und organisatorische Rahmung ermöglicht. Mein Freundeskreis und meine Familie haben nicht nur unendlich viel Verständnis gezeigt, wenn ich mal wieder keine Zeit für sie hatte, sie haben auch dafür gesorgt, dass es noch ein wenig „Leben neben der Habil.“ gab. Sylvia, Lutz, Cordula, Daniela, Sonja, Martin, Claudia, Sabine, Elfi, Walter (sen.) und Walter (jun.) – ohne Euch wäre es nicht gegangen!
Andrea BraitEnde August 2024
1. Einleitung
Geschichte ist omnipräsent: Im Fernsehen laufen zur Primetime Dokumentationen, Serien und Spielfilme zu verschiedensten historischen Themen, auf Smartphones und anderen Endgeräten werden diverse Kriege („nach“-)gespielt und in Kinderzimmern finden sich Hexenspiele und Ritterburgen, um nur einige Beispiele zu nennen. Zwar war die Beschäftigung mit Geschichte nie den akademischen Geschichtswissenschaften vorbehalten, jedoch ist seit den 1980er-Jahren ein immer größeres gesellschaftliches Interesse an der Vergangenheit und den vielfältigen Formen der Beschäftigung mit dieser zu beobachten. Das Eindringen von Geschichte in unseren Alltag scheint verschiedenste Bedürfnisse zu befriedigen:
„nach historischer Bildung und Unterhaltung, nach Entspannung und Zerstreuung, nach Identität und Orientierung, nach Abenteuer und Exotismus, nach neuen Erfahrungen und Erlebniswelten oder auch nach einer Flucht aus dem Alltag in eine Vergangenheit, die überschaubarer und weniger komplex erscheint als die Gegenwart.“1
Die Besuchszahlen von Ausstellungen und Museen reichen zwar bei Weitem nicht an die Einschaltquoten im Fernsehen heran, dennoch ist davon auszugehen, dass historische Ausstellungen und Museen einen nicht ganz unwesentlichen Faktor der sogenannten Geschichtskultur darstellen. Roy Rosenzweig konnte in einer Umfrage in den USA beispielsweise zeigen, dass 57 % der Befragten in den letzten zwölf Monaten ein Museum oder einen historischen Ort besucht hatten;2 in einer kanadischen Studie gaben dies 43 % der Befragten an.3
In Österreich gibt es (Stand: Juli 2024) 762 Museen.4 Dabei handelt es sich um Einrichtungen, die sich im Zuge einer Registrierung beim Museumsbund Österreich verpflichtet haben, die „Ethischen Richtlinien von ICOM – International Council of Museums“5 anzuwenden.6 Zu diesen zählen auch die neun österreichischen Landesmuseen, die laut Statistik Austria im Jahr 2019 2.800.056 Besuche verzeichneten;7 alle österreichischen Museen zusammen zählten in diesem Jahr 20.603.664 Besuche.8
Bei einer österreichweiten repräsentativen Umfrage gaben im Jahr 2007 44 % der Befragten an, in den letzten zwölf Monaten keine Ausstellung und kein Museum besucht zu haben; damit erreichten Ausstellungen bzw. Museen mehr Menschen als alle anderen angeführten Kultureinrichtungen (inkl. Kinos).9 In einer Ende 2022 bzw. Anfang 2023 durchgeführten Studie zeigte sich ein etwas anderes Bild, das von der COVID-19-Pandemie beeinflusst sein dürfte: Während 54 % der Befragten angaben, 2022 im Kino gewesen zu sein oder ein historisches Denkmal (z. B. Schlösser, Burgen, Kirchen) besucht zu haben, gaben nur 45 % an, in einem Museum gewesen zu sein; Museen landeten damit auf dem dritten Platz unter den abgefragten Kultureinrichtungen. Wie sich die Pandemie langfristig auswirken wird, ist derzeit noch nicht abzuschätzen. Ältere Personen ab 64, insbesondere aber jene über 74, gaben an, in diesem Jahr Kulturveranstaltungen oder Kulturstätten seltener als noch vor drei Jahren oder gar nicht mehr besucht zu haben und diese auch künftig nicht mehr besuchen zu wollen.10
Museen werden von Besucherinnen und Besuchern, wie internationale Forschungen zeigen, zu Bildungszwecken aufgesucht,11 als Orte wahrgenommen, an denen Informationen auf interessante Weise präsentiert werden,12 und von Jugendlichen weitgehend als „vertrauenswürdige Quellen“ zum Lernen über die Geschichte eingestuft,13 wobei speziell der dort gezeigten materiellen Kultur, wie eine australische Studie zeigte, als „echtes“ Zeugnis aus der Vergangenheit eine hohe Bedeutung beigemessen wird, da diese eine Verbindung zwischen der persönlichen Vergangenheit und historischen Prozessen erleichtern würde.14 Marlies Raffler beschreibt die Alleinstellungsmerkmale von Museen wie folgt:
„Im Unterschied zu Archiv, Bibliothek, Datenbank arbeitet das Museum mit authentischen Objekten und vermittelt deren Inhalt durch Präsentation. Durch die selbstgestellte Aufgabe des Museums, Objekte aus der Fülle der Wirklichkeit auszuwählen, zu erhalten, zu erforschen und zu präsentieren, werden Wertmaßstäbe einer Gesellschaft und ihrer wissenschaftlichen Selbstreflexion erkennbar.“15
Trotz der Entwicklung einer vielfältigen museumswissenschaftlichen Forschung in den letzten Jahrzehnten sind verschiedene Forschungsdesiderata auszumachen. Diese betreffen auch die museale Vermittlung.16 Wie Friederike Lassy-Beelitz vom Österreichischen Verband der Kulturvermittler:innen im Museums- und Ausstellungswesen berichtet, findet zwar bereits empirische Forschung in Österreichs Museen statt, doch „der Schritt, allfällige Ergebnisse dann wieder an die Quelle der Feldforschung zurückzutragen und die Praxis zu verändern – der wird nicht vollzogen.“17
Dies betrifft auch empirische Forschungen, die auf geschichtsdidaktischen Theorien basieren. Diese sind in den letzten Jahren auch im deutschsprachigen Raum vermehrt entstanden. Christian Kohler und Berit Pleitner setzten sich beispielsweise mit den Vorstellungen von Kindern und Jugendlichen in Bezug auf Museen auseinander,18 Felicitas Klingler analysierte Vermittlungsangebote,19 Hannah Röttele widmete sich der Wahrnehmung von Objekten20 und Julia Thyroff beforschte Aneignungspraktiken von Erwachsenen am Beispiel einer Sonderausstellung.21 Die zentralen Ergebnisse werden jedoch vornehmlich in Publikationsmedien und bei Tagungen vorgestellt und diskutiert, die sich hauptsächlich an die geschichtsdidaktische Community richten. Es verwundert daher nicht, dass in zahlreichen Publikationen die nach wie vor bestehende Kluft zwischen den Diskursen der Museumswissenschaften bzw. der Kulturvermittlung und der Geschichtsdidaktik beklagt wird,22 obwohl die Geschichtsdidaktik den Museumswissenschaften nähersteht als manch andere Fächer.23 Karl Heinrich Pohl fordert, dass die Erkenntnisse der Geschichtswissenschaften und der Geschichtsdidaktik von Museen berücksichtigt werden sollen24 – dies ist jedoch auch umgekehrt zu konstatieren: Für die Geschichtswissenschaften und die Geschichtsdidaktik ist es ebenso nötig, die Forschungen der Museumswissenschaften sowie die Ansätze der Kulturvermittlung zur Kenntnis zu nehmen. Das gilt insbesondere für die seit den 1990er-Jahren vorliegenden Erkenntnisse in Bezug auf die „individuell vorhandenen Verarbeitungsstrukturen und Überzeugungen“, die für Lernprozesse in Ausstellungen bzw. Museen entscheidend seien, wie Heiner Treinen hervorhebt,25 die daraus abgeleitete Notwendigkeit einer aktiven Rolle der Besucherinnen und Besucher im Zuge von Ausstellungs- bzw. Museumsbesuchen26 sowie die empirisch nachgewiesenen Unterschiede zwischen den Intentionen von Kuratorinnen und Kuratoren einerseits und den Wahrnehmungen und Lernprozessen der Besucherinnen und Besucher andererseits.27
Darüber hinaus ist festzustellen, dass sich die meisten Forschungsprojekte auf das Lernen im Museum konzentrieren, auch wenn sich diese auf Schülerinnen und Schüler beziehen. Diesbezüglich ist aus Sicht der Geschichtsdidaktik zu bedenken, dass außerschulische Lernorte keine Alternative zum Unterricht im Klassenzimmer darstellen können,28 sondern eine Ergänzung bedeuten, aus der sich insbesondere dann Lernchancen ergeben, wenn „Vermittlungskonzepte auf Seiten der Lernorte wie Museen mit der methodisch-didaktischen Aufbereitung im Unterricht verknüpft werden.“29 Das Aufsuchen von außerschulischen Lernorten sollte ein „konstitutives Element des Fachunterrichts“30 und demnach „fachdidaktisch inspiriert und sinnvoller Bestandteil einer Unterrichtseinheit sein“.31 Ein großes Forschungsdesiderat stellt jedoch die Verbindung eines Museumsbesuchs mit dem Geschichtsunterricht in den Schulklassen dar.
Hier setzte das 2015 bis 2020 von der Autorin an der Universität Innsbruck durchgeführte Habilitationsprojekt Historisches Lernen zwischen Schule und Museum,32 auf dem die vorliegende Publikation basiert,33 an: In diesem wurde besonderes Augenmerk auf die Einbettung von Museumsbesuchen34 in den Prozess des Lernens im Rahmen des Geschichtsunterrichts35 gelegt, womit es an entsprechende Studien in den Naturwissenschaftsdidaktiken anschließt.36 Damit wurde speziell berücksichtigt, dass das historische Lernen in der Schule zielgerichtet erfolgt; es kann mit Dietmar von Reeken als „die bewusste Förderung eines reflektierten Geschichtsbewusstseins beschrieben werden.“37 Die Untersuchung befasste sich also mit der „Spezifik von Angeboten geschichtskultureller Akteure und Institutionen für das schulische Lernen“ und untersuchte dabei, wie von Béatrice Ziegler gefordert, die „zentrale Zweckbestimmung […] von Museen“ ebenso wie die Frage, „welche Zielsetzungen Museumspädagogen verfolgen und ob sie von den geschichtsdidaktischen Vorstellungen abweichen.“38 Neben der Angebotsseite von Museen wurden auch die Geschichtslehrkräfte als zentrale Akteurinnen und Akteure bei der Ausgestaltung von Museumsbesuchen im Rahmen des Geschichtsunterrichts in den Blick genommen,39 womit die Studie an jene von Alan S. Marcus, Thomas H. Levine und Robin S. Grenier sowie von Joanna Wojdon anschließt, in denen die Haltungen und Praktiken von Lehrkräften analysiert wurden.40 Die Studie basiert also auf der grundsätzlichen Annahme, dass für die Förderung des historischen Denkens, also des spezifischen Denkstils für das Fach Geschichte,41 der auf „einen selbstständigen Umgang mit Geschichte“ abzielt, „historisch konstruierte Identitätsentwürfe sowie deren fachliche Triftigkeit reflektiert und ein kritisches, jedoch anschlussfähiges Verhältnis zu den umgebenden Geschichtskulturen entwickelt“,42 im Zuge von Museumsbesuchen nicht nur die Abläufe während des Museumsbesuchs selbst von Bedeutung sind, sondern auch die Geschichtsstunden vor und nach diesem. Für das Projekt war dabei zu bedenken, dass sich der österreichische Geschichtsunterricht in einer Umbruchphase befindet, zu der grundsätzlich noch kaum empirische Forschungen vorliegen und noch weniger solche, die auf Beobachtungen der sozialen Praxis basieren.43
Das Ziel der nachfolgenden Untersuchung ist eine Analyse, inwiefern Museumsbesuche im Rahmen des Geschichtsunterrichts dem historischen Lernen dienen. Dabei erfolgt eine Einschränkung auf den österreichischen Geschichtsunterricht in der Sekundarstufe (unter Berücksichtigung der Tatsache, dass dieser stets in einer Fächerkombination organisiert ist) und die neun österreichischen Landesmuseen. Gegenstand der Untersuchung sind nicht die in Ausstellungen bzw. Museen grundsätzlich vorhandenen Möglichkeiten für historisches Lernen,44 sondern speziell jene im Zuge von Museumsbesuchen im Rahmen des Geschichtsunterrichts.
Die Analyse wird insbesondere durch die folgenden Forschungsfragen geleitet:
• Welche Ziele werden von den österreichischen Landesmuseen bei der Geschichtsvermittlung für Schulklassen in ihren Dauerausstellungen vorrangig verfolgt?
• Welche Bedeutung messen Geschichtslehrkräfte einem Museumsbesuch im Rahmen des Geschichtsunterrichts bei und welche Ziele wollen sie mit einem solchen erreichen?
• Inwiefern wird Schülerinnen und Schülern bei einem Besuch im Klassenverband historisches Lernen in bzw. von den österreichischen Landesmuseen ermöglicht?
• Wie beschreiben Schülerinnen und Schüler ihr Lernen nach einem Museumsbesuch im Rahmen des Geschichtsunterrichts?
• Wie werden Museumsbesuche in den Geschichtsunterricht eingebettet?
Die Studie versteht sich als Grundlagenforschung in einem Feld, das bislang noch kaum empirisch erschlossen wurde, weshalb die Entscheidung für einen qualitativen Zugang fiel. Im Sinne einer Triangulation wurden sowohl im musealen als auch im schulischen Kontext empirische Erhebungen durchgeführt. Damit soll eine Grundlage für theoretische und pragmatische Schlussfolgerungen geschaffen werden – im Sinne der Feststellung von Joachim Rohlfes: „Empirie bedarf der Theorie, um gehaltvolle Befunde hervorzubringen; Theorie zielt auf Praxis, will sie sich nicht selbst zur Unfruchtbarkeit verdammen; Praxis muß durch Empirie kontrolliert sein, soll sie nicht im dunkeln tappen.“45
___________________
1 Korte, Barbara/Paletschek, Sylvia: Geschichte in populären Medien und Genres: Vom Historischen Roman zum Computerspiel, in: Korte, Barbara/Paletschek, Sylvia (Hrsg.): History Goes Pop. Zur Repräsentation von Geschichte in populären Medien und Genres (Historische Lebenswelten in populären Wissenskulturen/History in Popular Cultures 1), Bielefeld 2009, S. 9–60, hier S. 9.
2 Vgl. Rosenzweig, Roy: How Americans Use and Think about the Past. Implications from a National Survey for the Teaching of History, in: Stearns, Peter N./Seixas, Peter/Wineburg, Sam (Hrsg.): Knowing, Teaching, and Learning History. National and International Perspectives, New York/ London 2000, S. 262–283, hier S. 265.
3 Vgl. Conrad, Margaret/Ercikan, Kadriye/Friesen, Gerald/Létourneau, Jocelyn/Muise, Delphin/ Northrup, David/Seixas, Peter: Canadians and Their Pasts. The Pasts Collective, Toronto/Buffalo/ London 2013, S. 111 und S. 164.
4 Vgl. Museumsbund Österreich: Museen in Österreich, http://www.museen-in-oesterreich.at/ (online am 11.07.2024).
5 Vgl. International Council of Museums (ICOM): ICOM Code of Ethics for Museums, https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOM-code-En-web.pdf (online am 28.08.2024). Unter den registrierten Institutionen befinden sich auch Gedenkstätten, die in der folgenden Analyse jedoch nicht mit Museen gleichgesetzt werden.
6 Vgl. Museumsbund Österreich: Museumsregistrierung in Österreich, https://museen-in-oesterreich.at/museumsregistrierung/ (online am 11.07.2024). Gabriele Rath gab in ihrer 1998 publizierten Studie rund 1.600 Museen an. Vgl. Rath, Gabriele: Museen für BesucherInnen. Eine Studie, Wien 1998, S. 14 sowie S. 51. Es ist davon auszugehen, dass sich darunter auch „museumsähnliche Institutionen“ befanden (vgl. E-Mail-Auskunft des Österreichischen Museumsbundes an die Verfasserin, 04.06.2020), weshalb die aus der Zahl abgeleiteten Schlüsse nicht ganz zutreffen dürften.
7 Vgl. Statistik Austria: Landesmuseen 2019 und 2020, Anzahl der Besuche nach dem Zahlungsstatus, https://www.statistik.at/fileadmin/pages/366/Tabelle_M01_bis_M14_2020.ods (online am 11.07.2024). In der Gesamtzahl inkludiert sind jedoch auch Standorte, die nicht als Museen zu klassifizieren sind, wie beispielsweise der Schlosspark Eggenberg, der zum Universalmuseum Joanneum gehört. Der Wert für 2019 wird an dieser Stelle angegeben, da die Zahlen für die nachfolgenden Jahre, die zum Zeitpunkt des Abschlusses des Manuskripts bereits vorlagen (2020–2022), durch den Ausbruch der COVID-19-Pandemie und die damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen beeinflusst sind.
8 Vgl. Statistik Austria: Museumsstatistik 2019 – Überblick, https://www.statistik.at/fileadmin/pages/366/Museen_BJ_2019.ods (online am 11.07.2024).
9 Außerdem zeigte sich im Vergleich zu einer Studie aus dem Jahr 1989 ein deutlicher Zuwachs bei jenen Befragten, die angaben, Ausstellungen bzw. Museen zu besuchen. Vgl. Institut für empirische Sozialforschung GmbH: Kulturmonitoring. Bevölkerungsbefragung. Studienbericht 2007, https://www.bmkoes.gv.at/dam/jcr:fa2e411a-dcd0-4249-a0af-1a165afd3258/kulturmonitoring_2007.pdf (online am 26.08.2024), S. 20 und S. 23.
10 Vgl. Schönherr, Daniel/Glaser, Harald: Kulturelle Beteiligung in Österreich. Besuch von Kulturveranstaltungen, Kultureinrichtungen und -stätten. Executive Summary, https://www.bmkoes.gv.at/dam/jcr:e6d50d36-e3a5-4a96-926d-d58cb480d4e7/Kulturelle%20Beteiligung%20in%20%C3%96sterreich_Executive%20Summary%20DE.pdf (online am 26.08.2024). Zumal die Umfrage von 2007 belegt, dass Kinos von jüngeren Personen häufiger genutzt werden als von älteren, hat der Rückgang der Partizipation am kulturellen Leben durch ältere Personen diese weniger betroffen als Museen.
11 Vgl. Rombach, Julia: Trendsetter oder Traditionshüter? Die Zukunft der Museen (Zukunft. Bildung. Lebensqualität 3), Hamburg 2007, S. 124 f.
12 Vgl. Packer, Jan/Ballantyne, Roy: Motivational Factors and the Visitor Experience. A Comparison of Three Sites, in: Curator: The Museum Journal 45 (2002), Heft 3, S. 183–198, hier S. 195.
13 Vgl. Angvik, Magne/Borries, Bodo von (Hrsg.): Youth and History. A Comparative European Survey on Historical Consciousness and Political Attitudes among Adolescents. B: Documentation: Original and Combined Measures for Dimensions in Historical Consciousness, Hamburg 1997, S. 44 f.; Stoddard, Jeremy D.: Learning History Beyond School: Museums, Public Sites, and Informal Education, in: Metzger, Scott Alan/Harris, Lauren McArthur (Hrsg.): The Wiley International Handbook of History Teaching and Learning, Hoboken, NJ 2018, S. 631–656, hier S. 635 f.; Kipman, Ulrike/Kühberger, Christoph: Einsatz und Nutzung des Geschichtsschulbuches. Eine Large-Scale-Untersuchung bei Schülern und Lehrern, Wiesbaden 2019, S. 80.
14 Vgl. Ashton, Paul/Hamilton, Paula: Connecting with History: Australians and their Pasts, in: Ashton, Paul/Kean, Hilda (Hrsg.): People and their Pasts. Public History and Heritage Today, Basingstoke 2012, S. 23–41, hier S. 31.
15 Raffler, Marlies: Museum – Spiegel der Nation? Zugänge zur Historischen Museologie am Beispiel der Genese von Landes- und Nationalmuseen in der Habsburgermonarchie, Wien/Köln/Weimar 2008, S. 79.
16 Vgl. zur Diskussion über den Begriff der „Vermittlung“ (bzw. der „musealen Vermittlung“ bzw. der „Kulturvermittlung“) das Kapitel 2.3.3.1 Kulturvermittlung als Aufgabe von Museen.
17 Lassy-Beelitz, Friederike/Wolfram, Susanne: Wir sind ja keine Weltverbesserungsanstalt! Friederike Lassy-Beelitz im Gespräch mit Susanne Wolfram, in: NÖKU-Gruppe/Wolfram, Susanne (Hrsg.): Kulturvermittlung heute. Internationale Perspektiven, Bielefeld 2017, S. 49–59, hier S. 52.
18 Vgl. Pleitner, Berit: „Da kann man so viel lernen, gerade für junge Leute …“. Überlegungen zum Verhältnis von Jugendlichen und Museen, in: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik 5 (2006), S. 93– 108; Kohler, Christian: Schülervorstellungen über die Präsentation von Geschichte im Museum. Eine empirische Studie zum historischen Lernen im Museum (Geschichtskultur und historisches Lernen 16), Berlin 2016.
19 Vgl. Klingler, Felicitas: Lernort Museum. Eine empirische Untersuchung der Gestaltung museumspädagogischer Angebote für Schulklassen, Göttingen 2018 (ungedruckte Dissertation).
20 Vgl. Röttele, Hannah: „Objektbegegnungen“ im historischen Museum. Eine empirische Studie zum Wahrnehmungs- und Rezeptionsverhalten von Schüler_innen, München 2020.
21 Vgl. Thyroff, Julia: Aneignen in einer historischen Ausstellung. Eine Bestandsaufnahme von Elementen historischen Denkens bei Besuchenden der Ausstellung „14/18. Die Schweiz und der Grosse Krieg“ (Geschichtsdidaktik heute 12), Bern 2020.
22 Vgl. Gosselin, Viviane/Livingstone, Phaedra: Introduction: Perspectives on Museums and Historical Consciousness in Canada, in: Gosselin, Viviane/Livingstone, Phaedra (Hrsg.): Museums and the Past. Constructing Historical Consciousness, Vancouver/Toronto 2016, S. 3–15, hier S. 5.
23 Vgl. Ludwig, Andreas/Walz, Markus: Museen als Forschungsgegenstand anderer Wissenschaften, in: Walz, Markus (Hrsg.): Handbuch Museum. Geschichte – Aufgaben – Perspektiven, Darmstadt 2016, S. 375–381, hier S. 377.
24 Vgl. Pohl, Karl Heinrich: Wann ist ein Museum „historisch korrekt“? „Offenes Geschichtsbild“, Kontroversität, Multiperspektivität und „Überwältigungsverbot“ als Grundprinzipien musealer Geschichtspräsentation, in: Hartung, Olaf (Hrsg.): Museum und Geschichtskultur. Ästhetik – Politik – Wissenschaft (Sonderveröffentlichungen der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte 52), Bielefeld 2006, S. 273–286, hier S. 286. Im 2020 publizierten Leitfaden „Bildung und Vermittlung im Museum gestalten“ vom Deutschen Museumsbund und vom Bundesverband Museumspädagogik wird ebenso die Bedeutung der Kenntnis der Diskurse der Fachdidaktiken betont. Vgl. Deutscher Museumsbund e. V./Bundesverband Museumspädagogik e. V. (Hrsg.): Leitfaden Bildung und Vermittlung im Museum gestalten, Berlin 2020, S. 12.
25 Treinen, Heiner: Besucherforschung und Vermittlungsstrategien in kulturhistorischen Ausstellungen, in: Haus der Bayerischen Geschichte (Hrsg.): Besucherforschung und Vermittlungsstrategien in historischen Ausstellungen. Kolloquiumsbericht zu den Ergebnissen der Ausstellung „Geschichte und Kultur der Juden in Bayern“, München 1991, S. 11–13, hier S. 13.
26 Vgl. Kirchberg, Volker: Besucherforschung in Museen: Evaluation von Ausstellungen, in: Baur, Joachim (Hrsg.): Museumsanalyse. Methoden und Konturen eines neuen Forschungsfeldes, Bielefeld 2010, S. 171–184, hier S. 176.
27 Vgl. Thoma, Gun-Brit: Was lernen Besucherinnen und Besucher im Museum? Eine Untersuchung von Lerngelegenheiten einer Museumsausstellung und ihrer Nutzung, Kiel 2009 (ungedruckte Dissertation), S. 195.
28 Vgl. Pleitner, Berit: Außerschulische historische Lernorte, in: Barricelli, Michele/Lücke, Martin (Hrsg.): Handbuch Praxis des Geschichtsunterrichts. Band 2, Schwalbach/Ts. 2012, S. 290–307, hier S. 294.
29 Krösche, Heike: Historisches Lernen in altersgemischten Besuchergruppen. Ein didaktisches Vermittlungskonzept am Beispiel des Oberösterreichischen Schulmuseums, in: Flügel, Alexandra/ Gröger, Martin/Schneider, Daria Johanna/Wiesemann, Jutta (Hrsg.): Außerschulische Lernorte von Kindern. Reflexionen – Konzeptionen – Perspektiven, Siegen 2018, S. 53–70, hier S. 55.
30 Popp, Susanne: Historische Bildung und Kompetenzmodelle. Überlegungen zu einer aktuellen Debatte, in: Popp, Susanne/Schönemann, Bernd (Hrsg.): Historische Kompetenzen und Museen (Schriften zur Geschichtsdidaktik 25), Idstein 2009, S. 24–37, hier S. 25.
31 Pleitner, B. 2012, S. 294.
32 Zur Finanzierung einzelner Teilbereiche wurden folgende Drittmittelprojekte eingeworben: Förderung eines reflexiven Geschichts- und Demokratiebewusstseins durch Museumsbesuche im Geschichtsunterricht (Zukunftsfonds der Republik Österreich), Historisches Lernen im Museum. Einstellungen von Lehrkräften zum Historischen Lernen im Museum (Richard & Emmy Bahr-Stiftung), Teilautomatisierte Transkription von Experteninterviews in österreichischem Deutsch (Teil des HRSM-Projekts „Digitalisierung und Informationsaufbereitung für die Digital Humanities“, DI4DH). Der Projekttitel ähnelt dem Titel einer Publikation von Andreas Körber, deren theoretische Basis jener der vorliegenden Studie entspricht. Vgl. Körber, Andreas: Historisches Denken zwischen Museum und Schule, in: Christoph, Barbara/Dippold, Günter (Hrsg.): Museum und Schule – Erfolgreiche Partner?, Bayreuth 2010, S. 23–46. Bewusst wurde jedoch die Schule an die erste Stelle gestellt, da die normativen Grundlagen des Geschichtsunterrichts den zentralen Referenzrahmen für die Untersuchung darstellen.
33 Für die Drucklegung wurde insbesondere der Forschungsstand ergänzt, der seit Projektabschluss publiziert wurde.
34 Wenn in der Folge von Museumsbesuchen gesprochen wird, dann sind einmalige, kürzere Aufenthalte in einem Museum vor Ort gemeint. Nicht berücksichtigt wurden längerfristige Kooperationen, länger andauernde Schulprojekte oder die Einbindung virtueller Museen in den Geschichtsunterricht.
35 Dieser erfolgt in Österreich stets in einer Fächerkombination, meist mit der Politischen Bildung. In allen Lehrplänen sind jedoch fachspezifische Lernziele verankert. Auf diese bezieht sich der Begriff „Geschichtsunterricht“ in der vorliegenden Studie.
36 Vgl. u. a. Griffin, Janette/Symington, David: Moving from task‐oriented to learning‐oriented strategies on school excursions to museums, in: Science Education 81 (1997), Heft 6, S. 763–779; Wilde, Matthias/Bätz, Katrin: Einfluss unterrichtlicher Vorbereitung auf das Lernen im Naturkundemuseum, in: Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften 12 (2006), S. 77–88.
37 Reeken, Dietmar von: Historisches Lernen im Sachunterricht. Eine Einführung mit Tipps für den Unterricht (Dimensionen des Sachunterrichts 2), Baltmannsweiler 62017, S. 15.
38 Ziegler, Béatrice: Einleitung, in: Zeitschrift für Geschichtsdidaktik 16 (2017), S. 5–16, hier S. 10 f.
39 Vgl. dazu bereits Schneider, Gerhard: Bemerkungen zum Historischen Museum als Lernort, in: Raisch, Herbert/Reese, Armin (Hrsg.): Historia Didactica. Geschichtsdidaktik heute, Idstein 1997, S. 185–206, hier S. 187 f.
40 Vgl. Marcus, Alan S./Levine, Thomas H./Grenier, Robin S.: How Secondary History Teachers Use and Think About Museums: Current Practices and Untapped Promise for Promoting Historical Understanding, in: Theory & Research in Social Education 40 (2012), Heft 1, S. 66–97; Wojdon, Joanna: Museum Lessons and the Teacher’s Role, in: International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture 39 (2018), S. 93–105.
41 Vgl. Fenn, Monika/Zülsdorf-Kersting, Meik: Historisches Denken, historisches Wissen, historische Kompetenzen, in: Fenn, Monika/Zülsdorf-Kersting, Meik (Hrsg.): Geschichts-Didaktik. Praxishandbuch für den Geschichtsunterricht, Berlin 2023, S. 11–53, hier S. 13. In der Publikation wird eine „Zehnermatrix“ als Synthese der Teiloperationen historischen Denkens präsentiert.
42 Bräuer, Benjamin: Reflektiertes und orientierungswirksames historisches Denken als geschichtsdidaktisches Ziel, in: Weißeno, Georg/Ziegler, Béatrice (Hrsg.): Handbuch Geschichts- und Politikdidaktik, Wiesbaden 2022, S. 93–107, hier S. 94.
43 In dem von Christoph Kühberger geleiteten Forschungsprojekt Competence and Academic Orientation in History Textbooks (CAOHT) wurden von Roland Bernhard Beobachtungen durchgeführt, doch seine Habilitationsschrift basiert rein auf der Interviewstudie aus diesem Projekt. Vgl. Bernhard, Roland: Berufsbezogene Überzeugungen österreichischer Geschichtslehrpersonen und historisches Denken, Salzburg 2019a (ungedruckte Habilitationsschrift); Kühberger, Christoph/ Bernhard, Roland/Bramann, Christoph: Competence and Academic Orientation in History Textbooks. Final Report, https://www.plus.ac.at/wp-content/uploads/2021/02/CAOHT_Final_Report_05-2020_hp.pdf (online am 24.08.2024).
44 Für eine solche Analyse vgl. u. a. Schlutow, Martin: Das Migrationsmuseum. Geschichtskulturelle Analyse eines neuen Museumstyps (Geschichtskultur und historisches Lernen 10), Berlin 2012.
45 Rohlfes, Joachim: Theoretiker, Praktiker, Empiriker. Missverständnisse, Vorwürfe, Dissonanzen unter Geschichtsdidaktikern, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 47 (1996), Heft 2, S. 98–110, hier S. 101. Wie Wolfgang Hasberg jedoch zu Recht anmerkt, ist keine direkte Übertragung von empirischen Erkenntnissen auf die Pragmatik möglich. Vgl. Hasberg, Wolfgang: Risks and Perspectives Regarding Empirical Research for Historical Learning, in: Yearbook. International Society for the Didactics of History 2010, S. 195–214.
2. Geschichtsdidaktische Theorien und normative Vorgaben1
2.1 Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur
Geschichte wurde lange als Fach verstanden, in dem ein gewisser Kanon an historischen Daten und Fakten auswendig gelernt werden sollte.2 Dies änderte sich jedoch ab Mitte der 1970er-Jahre. Im Sinne eines gemäßigten Konstruktivismus3 wurde historisches Lernen als „Prozess, bei dem ein jeweils individuelles Bild der Vergangenheit entsteht“, definiert.4 Jörn Rüsen beschrieb diesen als „Sinnbildung über Zeiterfahrung durch historisches Erzählen“.5
Historisches Lernen definierte er als einen „Vorgang des menschlichen Bewußtseins, in dem bestimmte Zeiterfahrungen deutend angeeignet werden und dabei zugleich die Kompetenz zu dieser Deutung entsteht und sich weiterentwickelt.“6 Martin Lücke und Irmgard Zündorf folgend, geht es darum, „sich die Erfahrungen von Wandel in der Vergangenheit durch historisches Erzählen produktiv anzueignen.“7 Historisches Lernen beschreibt demnach einen „Denkstil“,8 der dazu beitragen soll, „dass der bzw. die Lernende […] historisch[e] Narrationen konstruieren und dadurch sein bzw. ihr Geschichtsbewusstsein – auch auf selbstreflexiver Basis – ausdifferenzieren kann.“9 Das Ziel des historischen Lernens besteht demnach nicht im bloßen Ansammeln von Wissen, sondern in der Förderung der „Fähigkeit historischen Denkens“.10 Diese grundlegenden Definitionen sind in der deutschsprachigen Geschichtsdidaktik allgemein anerkannt und bilden die Basis für die in Österreich gültigen Lehrpläne der Sekundarstufe, weshalb sie für die vorliegende Studie zentral sind.
Der an die Grundüberlegungen von Rüsen aus den 1970er-Jahren anschließende Diskurs führte zur Etablierung der Geschichtsdidaktik als akademische Disziplin innerhalb der Geschichtswissenschaften.11 Die Geschichtsdidaktik überwand in dieser Zeit ihre
„Beschränkung auf den Status einer reinen Schul oder Unterrichtsfachdidaktik, deren Aufgabe nur allzu oft darin bestanden hatte, einen überlieferten oder verordneten Kanon bewährter oder ideologisch erwünschter Inhalte mit möglichst großem methodischen Geschick in die Köpfe der Schülerinnen und Schüler zu transportieren.“12
Als „Gründungsurkunde der wissenschaftlichen Disziplin Geschichtsdidaktik“13 können – zumindest für den deutschsprachigen Raum – die von Karl-Ernst Jeismann am Mannheimer Historikertag 1976 präsentierten Ausführungen und seine Definition des „Geschichtsbewusstseins“ gelten, die bis heute grundlegend und gewissermaßen der kleinste gemeinsame Nenner aller seither entwickelten – und teilweise konkurrierenden – Theorien (insbesondere der verschiedenen Kompetenzmodelle) sind:
„Didaktik der Geschichte hat es zu tun mit dem Geschichtsbewußtsein in der Gesellschaft sowohl in seiner Zuständlichkeit, den vorhandenen Inhalten und Denkfiguren, wie in seinem Wandel, dem ständigen Um- und Aufbau historischer Vorstellungen, der stets sich erneuernden und verändernden Rekonstruktion des Wissens von der Vergangenheit. Sie interessiert sich für dieses Geschichtsbewußtsein auf allen Ebenen und in allen Gruppen der Gesellschaft sowohl um seiner selbst willen wie unter der Frage, welche Bedeutung dieses Geschichtsbewußtsein für das Selbstverständnis der Gegenwart gewinnt; sie sucht Wege, dieses Geschichtsbewußtsein auf eine Weise zu bilden oder zu beeinflussen, die zugleich dem Anspruch auf adäquate und der Forderung nach Richtigkeit entsprechende Vergangenheitserkenntnis wie auf Vernunft des Selbstverständnisses der Gegenwart entspricht. Dabei ist der Begriff ‚Geschichtsbewußtsein‘ hier in einem sehr allgemeinen Sinne als das Insgesamt der unterschiedlichen Vorstellungen von und Einstellungen zur Vergangenheit genommen.“14
Damit war eine bis heute „zentrale Kategorie“15 der Geschichtsdidaktik begründet,16 die später durch die von Hans-Jürgen Pandel beschriebenen Dimensionen17 weiter ausdifferenziert wurde, welche mittlerweile mehrfach infrage gestellt und erweitert bzw. adaptiert wurden,18 wie auch der theoretische Zugang insgesamt immer wieder kritisiert wird.19 So weist Susanne Popp darauf hin, dass auf „dem Weg über das Geschichtsbewußtsein, das die politisch-historische Identität mitbestimmt, […] der gegebene Herrschaftsanspruch als historisch legitimer und damit zustimmungsfähiger in Individuen und Gruppen mental verankert werden“20 soll. Bärbel Völkel gibt zu bedenken:
„Geschichtsbewusst zu sein im Sinne von sinnbildender Zeiterfahrung bedeutet […] stets auch, ethnozentrisch zu denken. Man kann es sogar noch stärker zuspitzen: Wenn es das Ziel des Geschichtsunterrichts ist, Geschichtsbewusstsein als Sinnbildung über Zeiterfahrung zum Gegenstand des historischen Lernens und Denkens zu machen, dann ist gleichzeitig Ethnozentrismus zentraler Gegenstand unseres Geschichtsunterrichts.“21
Der Ansatz ist dennoch in der deutschsprachigen Geschichtsdidaktik nach wie vor weit verbreitet, wird auch international breit diskutiert,22 fand Eingang in curriculare Vorgaben und mit einer gewissen Verzögerung setzten auch empirische Forschungen ein, die sich auf diese Theoriegrundlage stützten.23 „Der Reiz und der Erfolg des Begriffs ‚Geschichtsbewusstsein‘ lag und liegt vermutlich nicht zuletzt in seiner Offenheit und in seiner großen Reichweite“24, wie Michael Sauer betont. Ungeachtet verschiedener Definitionen herrscht Konsens über das Verständnis des Geschichtsbewusstseins als ein über „bloßes Wissen oder reines Interesse an der Geschichte“ hinausgehendes Phänomen, das auf „den Zusammenhang von Vergangenheitsdeutung, Gegenwartsverständnis und Zukunftsperspektive“25 abzielt.
Das von Jeismann beschriebene Geschichtsbewusstsein hat aber nicht nur eine individuelle, sondern auch eine kollektive Dimension.26 Damit war also von Beginn an die „Geschichtskultur“ inkludiert,27 wenngleich der Begriff erst Ende der 1980er-Jahre von Rüsen im geschichtsdidaktischen Diskurs verankert wurde,28 um kollektive Zugänge zur Geschichte zu beschreiben.29 Zu diesem Zeitpunkt war bereits ein stark gestiegenes gesellschaftliches Interesse an historischen Themen zu beobachten,30 das sich etwa im Erfolg großer Geschichtsausstellungen zeigte,31 weshalb es nicht verwundert, dass die Beschäftigung mit dem außerschulischen Geschichtslernen von der Geschichtsdidaktik als bedeutender eingestuft wurde.32 Die Geschichtsdidaktik versteht sich seitdem nicht mehr als eine hauptsächlich auf das Schulfach Geschichte ausgerichtete Disziplin.33
Die Verwendung des Begriffs „Geschichtskultur“ wurde von Rüsen im Zusammenhang mit historischen Museen vorgeschlagen, um jenen „Bereich der Lebenspraxis“ zu umschreiben, „in dem historische Museen34 angesiedelt sind und wirken. Geschichtskultur ist der durch Geschichtsbewußtsein entscheidend geprägte Teil der Kultur“.35 Wenig später folgten von Rüsen noch genauere Überlegungen, u. a. im dritten Band seiner Historik, wo es heißt:
„Mit diesem Ausdruck soll deutlich werden, daß das spezifisch Historische im kulturellen Orientierungsrahmen der menschlichen Lebenspraxis einen eigenen und besonderen Ort hat. […] Geschichtskultur ist […] mehr als und Anderes als die Domäne der von der Geschichtswissenschaft verwalteten Erkenntnis in der praktischen Verwendung historischen Wissens. […] Mit dem Terminus ‚Geschichtskultur‘ soll die von der Wissenschaft kultivierte kognitive Seite der historischen Erinnerungsarbeit systematisch mit der politischen und ästhetischen Seite der gleichen Arbeit verbunden werden.“36
In der Folge beschrieb Rüsen Geschichtskultur ganz allgemein als „praktisch wirksame Artikulation von Geschichtsbewußtsein im Leben einer Gesellschaft“,37 nannte unterschiedliche Institutionen, wie Museen, Universitäten, Massenmedien usw., als Träger38 und meinte in der 2013 überarbeiteten Gesamtdarstellung seiner Historik, dass es sich bei der Geschichtskultur um den „Inbegriff der Sinnbildungsleistungen des menschlichen Geschichtsbewusstseins [handelt]. Sie umfasst die kulturellen Praktiken der Orientierung des menschlichen Leidens und Handelns in der Zeit.“39 Rüsen versuchte also, die Dichotomie zwischen geschichtswissenschaftlichen und lebensweltlichen Bezugnahmen auf die Vergangenheit zu überwinden, was mittlerweile eingehend diskutiert wurde;40 kritisch gesehen wird etwa die anthropologische Fundierung seines Konzepts.41
Der von Rüsen artikulierte Zusammenhang zwischen Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur wird auch von Pandel beschrieben, der Geschichtskultur definiert als
„die Art und Weise, wie eine Gesellschaft mit ihrer Vergangenheit und ihrer Geschichte umgeht. Sie ist eine Produktion von Sinnbildungsangeboten, die sich auf Geschichte beziehen und die einer jeden Gegenwart spezifisch sind. Diese pluralen Sinnbildungsangebote werden dann von dem individuellen Geschichtsbewusstsein wieder verarbeitet.“42
Dem folgt auch Uwe Danker, der Geschichtskultur als „den gruppenspezifischen, meist den gesellschaftlichen (oder nationalen) Umgang mit Geschichte“ beschreibt.43 Bernd Schönemann sieht Geschichtskultur als gesellschaftliches Pendant zum Geschichtsbewusstsein: Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur seien ihm zufolge „zwei Seiten einer Medaille“44 – anders formuliert: Geschichtskultur kann mit Schönemann als „Außenseite des gesellschaftlichen Geschichtsbewusstseins“45 verstanden werden.46
Folgt man diesen Überlegungen, dann ist Geschichtskultur nicht nur im außerschulischen Bereich angesiedelt.47 Pandel verortet die Geschichtskultur hingegen klar jenseits von Schule (und Universität).48 Dieser Ansatz zeigt sich auch in den von ihm beschriebenen zentralen Merkmalen der Geschichtskultur: die lebensweltliche Präsenz, der Eventcharakter und der Gattungswechsel.49 Manifestationen der Geschichtskultur50 – im Folgenden (dem österreichischen Lehrplan für die Sekundarstufe I von 2016 folgend)51 als geschichtskulturelle Produkte bezeichnet52 – finden sich also in vielfältigster Form im Alltag von uns allen, denen wir teilweise nur kurzzeitig begegnen; zu ein und demselben historischen Thema liegen unzählige geschichtskulturelle Produkte vor, die auch unterschiedliche Zielgruppen ansprechen.53 Geschichtskultur ist Johannes Meyer-Hamme zufolge
„keineswegs eine harmonische Veranstaltung und kein monolithischer Blick identischer historischer Orientierungen, sondern ein prinzipiell konflikthafter Diskurszusammenhang. In ihm äußern sich Akteure aus ganz unterschiedlichen Kontexten und Perspektiven, und diese Akteure sind – bewusst und unbewusst – in spezifischer Art und Weise von ihren Familien, Nachbarschaften, Klassen oder Nationen oder auf andere Weise konstituierten Wir-Gruppen geprägt.“54
Um den Begriff „Geschichtskultur“ näher zu systematisieren, liegen mittlerweile Vorschläge für Ordnungssysteme vor. Rüsen verwies ursprünglich darauf, dass jede Form der Geschichtskultur ästhetische, politische und kognitive Elemente beinhaltet.55 „Der Zusammenhang der verschiedenen Dimensionen ist einmal dadurch charakterisiert, daß jeweils die eine Dimension die andere zu instrumentalisieren trachtet und damit zu Verengungen und Verwerfungen der Geschichtskultur führt“.56 Die drei Dimensionen können also nicht einem geschichtskulturellen Phänomen exklusiv zugeordnet werden – vielmehr kommen sie kombiniert und mit unterschiedlichen Gewichtungen vor, wobei Holger Thünemann zufolge eine ästhetische Wahrnehmung oft am Anfang des Prozesses historischen Denkens steht.57 Dies betrifft auch Museen, bei denen sich die Ästhetik sowohl in Bezug auf den Museumsbau als auch hinsichtlich der Ausstellungsgestaltung zeigt: Die Gestaltung kann sich mitunter stark auf die Narrative von Ausstellungen auswirken, wie sich etwa beim Jüdischen Museum in Berlin zeigt. Die politische Dimension kommt ebenso zum Tragen: Auch wenn in demokratischen Staaten selten direkte politische Einmischungen erfolgen, wirkt sich die Politik – man denke etwa an die Finanzierung – auf die Gestaltung aus. Die kognitive Dimension ist schließlich die zentrale Grundlage jedes historischen Museums.58
Pandel ergänzte die von Rüsen genannten drei Dimensionen um die „Ethik“ und die „Ökonomie“: Anhand eines aus Klemmbausteinen einer bekannten Marke angefertigten Konzentrationslagers zeigte er auf, dass ethische Fragen bei der Darstellung eine Rolle spielen; ebenso sei eine zunehmende Kommerzialisierung von Geschichte, beispielsweise im touristischen Bereich, zu beobachten, die auf ökonomischen Entscheidungen basiert.59 Diese Ansicht lässt sich klar durch Studien untermauern, die zeigen, dass „history sells“.60 2013 führte Rüsen zwar die Dimensionen „Ethik“ und „Religion“ ein,61 griff aber die ökonomische Dimension bislang nicht auf, was Thünemann zufolge daran liegen könnte, dass dieser die anthropologische Substanz fehle.62 Wie Christopher Georg Brandt in Bezug auf Spielfilme zu Recht feststellt, kann als weitere Dimension „Unterhaltung“ definiert werden.63
Schönemann beschreibt die Geschichtskultur als „heuristische Kategorie, mit deren Hilfe wir zu erkunden versuchen, wie Gesellschaften es fertigbringen, sich zu erinnern“. Er plädiert dafür, die drei Dimensionen von Rüsen „forschungspraktisch vom Anthropologischen ins Heuristische“ zu wenden und folglich „vier weitere Dimensionen ins Auge zu fassen: erstens die institutionelle, zweitens die professionelle, drittens die mediale und viertens die adressaten- oder publikumsspezifische Dimension.“64 Wolfgang Hasberg schlägt eine Korrelation der Dimensionen von Rüsen und Schönemann vor, sodass „ein zweidimensionales Modell entsteht, das den Gegenstandsbereich der Geschichtskultur in heuristischer Absicht kategorial erschließt“.65
Tabelle 1:Matrix geschichtskultureller Dimensionen nach Hasberg66
Zur Geschichtskultur gehören, so die weit verbreitete Ansicht,67 nicht nur gegenwärtige Beschäftigungen mit Geschichte, sondern auch historische.68 Mit Jan Assmann ist festzuhalten, dass ein Bemühen um die Weitergabe von Geschichte die Menschheitsgeschichte von Beginn an prägt – in schriftlosen Gesellschaften erfolgte diese in Form von mythischen Erzählungen, später kamen viele andere Medien hinzu.69 Solche historischen geschichtskulturellen Produkte dienen heute als wertvolle historische Quellen. Viele überdauern aber nur kurze Zeit. In Bezug auf Museen und Ausstellungen ist festzuhalten, dass zwar manchmal (mehr oder weniger detailreiche) Kataloge, Drehbücher und/oder Fotografien überliefert sind, doch ist es nur begrenzt möglich, sich eine nicht mehr gezeigte Schau vorzustellen. So kann man heute nur mehr grob erahnen, wie beispielsweise Beuteschauen in der nationalsozialistischen Diktatur auf die Besucherinnen und Besucher gewirkt haben mögen.
Zur Inklusion von historischen sowie von nicht-westlichen Formen plädieren Maria Grever und Robbert-Jan Adriaansen für ein “inclusive concept of historical culture”, das sich auf drei Analyseebenen stützt: “1. Historical narratives and performances of the past, 2. Mnemonic infrastructures, 3. Underlying conceptions of history”.70 Um der zeitlichen, räumlichen und kulturellen Heterogenität der Geschichtskultur Rechnung zu tragen, schlägt Thünemann als Definition vor:
„Geschichtskultur soll daher verstanden werden als ein multidimensionales, in seinen zeitlichen sowie räumlichen Strukturen vielfältiges und zugleich historischem Wandel unterliegendes Ensemble kultureller Orte, Formen und Praktiken, mittels derer einzelne Akteurinnen und Akteure, soziale Gruppen oder ganze Gesellschaften Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges in unterschiedlichen und teilweise miteinander konkurrierenden Konstruktionen aufeinander beziehen, um auf diese Weise insbesondere Bedürfnissen der Identitäts- und Sinnstiftung, der Bildung, aber auch der Unterhaltung durch den Umgang mit Historischem Rechnung zu tragen. Historische Vorstellungen werden in diesem Ensemble einerseits stets aufs Neue erzeugt und tragen andererseits dazu bei, dass sich die komplex strukturierten geschichtskulturellen Formationen materieller und immaterieller historischer Deutungsangebote, die mit unterschiedlicher Sichtbarkeit und Intensität in das, was jeweils als Gegenwart gilt, hineinragen, immer wieder verändern.“71
Zudem unterscheidet Thünemann fünf geschichtskulturelle Praktiken und schlägt damit ein neues Ordnungssystem vor. Die Praxisformen des Wiederherstellens, Überschreibens, Umschreibens, Konservierens und Historisierens lassen sich jedoch, wie Thünemann selbst einräumt, nicht trennscharf unterscheiden. Dies zeigt sich auch anhand von Museen, für die ihm zufolge die Praxisform des Konservierens besonders relevant sei.72 Zwar trifft das hinsichtlich der musealen Aufgabe des Bewahrens absolut zu, doch im Zuge von Ausstellungen und des Vermittelns73 zeigen sich auch die Praxisformen des Wiederherstellens und des Historisierens; besonders (aber nicht ausschließlich) in nicht-demokratischen Systemen ist (zudem bzw. alternativ) die Praxisform des Umschreibens zu beobachten.
Hinsichtlich der Bedeutung der Geschichtskultur für die Entwicklung des individuellen Geschichtsbewusstseins wird immer wieder argumentiert, dass geschichtskulturelle Produkte der Unterhaltungsindustrie Interesse für historische Themen wecken können.74 Andrea Becher und Eva Gläser wiesen nach, dass Kinder schon vor dem Geschichtsunterricht in der Sekundarstufe von der sie umgebenden Geschichtskultur stark beeinflusst werden.75 Christoph Kühberger betont ebenfalls den Einfluss der Geschichtskultur auf kindliche Vorstellungen von der Vergangenheit – Bücher, Brettspiele, PC-Spiele, Plastikfiguren oder auch Faschingskostüme usw. tragen hierzu bei.76
Von Borries nimmt an, dass geschichtskulturelle Produkte einen deutlich größeren Einfluss auf das Geschichtsbewusstsein von Jugendlichen haben als der Geschichtsunterricht.77 Dies konnte auch empirisch nachgewiesen werden: In einer 1992 durchgeführten Studie unter Jugendlichen in Hessen wurden Spielfilme an die erste Stelle der für das eigene Verständnis und die Kenntnisse von Geschichte bedeutenden Faktoren gereiht, erst an der dritten Stelle rangierte der Geschichtsunterricht; Museen belegten den sechsten Platz.78
Monika Rox-Helmer geht davon aus, dass das Geschichtsbewusstsein von Individuen stärker durch fiktional vermittelte Geschichte geprägt wird als durch wissenschaftsnahe Vermittlungsformen, weshalb sie dafür plädiert, fiktionale Elemente stärker in den Geschichtsunterricht einzubeziehen, sodass Schülerinnen und Schüler die Fähigkeit erwerben, diesen Geschichtsdarstellungen kritisch zu begegnen und Fiktion als solche einordnen zu können.79 Dabei müsste jedoch, von Borries folgend, auch thematisiert werden, dass beim Prozess des historischen Lernens auch Umwege und Irrwege möglich sind; „gelernt“ werden kann auch Falsches oder Inhumanes.80
Die Geschichtskultur beeinflusst aber nicht nur das individuelle Geschichtsbewusstsein, sondern auch jedes geschichtsbewusste Individuum wirkt auf die Geschichtskultur ein.81 Die Geschichtskultur ist somit nicht starr, sondern unterliegt ständigen Veränderungen, die durch gesellschaftspolitische Diskurse geprägt sind, wie beispielsweise in den letzten Jahren in Bezug auf öffentliche Symbole deutlich wurde, die in einem Zusammenhang mit dem Kolonialismus stehen.82 In diese Richtung gehen auch Martin Nitsches Annahmen zu einem „gesellschaftlichen historischen Lernen“, das ihm zufolge vorliege, „wenn sich Aspekte geschichtskultureller Tätigkeit aufgrund von Krisen gemeinschaftlich mittels absichtsvoll eingesetztem historischen Denken oder verwandter Tätigkeiten ändern.“83
Für den Kontext der hier vorliegenden Studie wesentlich ist insbesondere die Überlegung, dass die Geschichtskultur einen bedeutenden Faktor für das historische Lernen darstellt. Dieses umfasst Meyer-Hamme zufolge „mindestens drei Dimensionen, die sich gegenseitig bedingen“:
„1. Historisches Lernen ist immer eine Einführung in Geschichts- und Erinnerungskultur. In einer demokratischen-pluralen Gesellschaft sollte es aber zugleich auch eine Reflexion derselben beinhalten und die gesellschaftlichen Diskurse, in denen die historischen Erzählungen verhandelt werden, sichtbar machen.
2. Historisches Lernen ist als Entwicklung von Kompetenzen historischen Denkens zu konzipieren, dies schließt sowohl Fähigkeiten historischen Erzählens und des Umgangs mit historischen Narrativen als auch kategoriale Einsichten in die Logik historischen Denkens mit ein.
3. Historisches Lernen ist schließlich als Erweiterung und Umbau historischer Sinnbildungen zu kennzeichnen, denen subjektiv eine Relevanz zugeschrieben wird.“84
Meyer-Hamme und Cornelia Chmiel betonen zusammenfassend, dass die Geschichtskultur „Rahmenbedingung, Anlass und Ziel historischen Lernens“ darstelle. Die „Aktivitäten, die historisches Lernen anregen sollen,“ zielen „auf Reproduktion, Transformation oder Reflexion von Geschichtskultur“ ab.85
Folglich besteht – zumindest seit den 1990er-Jahren86 – im deutschsprachigen Raum weitgehend Einigkeit87 hinsichtlich des Einbezugs der Geschichtskultur in den Geschichtsunterricht, zumal es sich bei diesem um die einzige Institution handelt, die die Aufgabe hat, die Gesellschaft für die Teilhabe an der Geschichtskultur „fit zu machen“, wie es von Borries ausdrückt.88 Christian Heuer bezeichnet die im gegenwärtigen und zukünftigen Alltag der Schülerinnen und Schüler präsente Geschichtskultur als „Bewährungsfeld“89 für die im Geschichtsunterricht zu fördernden Kompetenzen. Die zentrale Bedeutung des Geschichtsunterrichts in diesem Zusammenhang betont auch Völkel:
„Ohne historische Bildung verbliebe das Geschichtsbewusstsein einer Erinnerungsgemeinschaft auf der Ebene von Geschichtsbildern. Geschichtsbilder sind […] Vorstellungen von der Vergangenheit, die an historisch rationalen Wissensbeständen vorbei den Geschichtsverlauf im Sinne einer gewünschten Deutung glätten. Geschichtsbilder haben […] also etwas [U]ndiszipliniertes an sich, das diszipliniert gehört. Daher kann man auch sagen, dass die historische Bildung der Disziplinierung des historischen Denkens dient. Ein geschichtskulturell erzeugtes Geschichtsbild soll auf die Ebene eines reflektierten Geschichtsbewusstseins transformiert werden.“90
Eine wesentliche Voraussetzung hierfür ist jene Fähigkeit, die Pandel als „geschichtskulturelle Kompetenz“ bezeichnet.91 Die Schülerinnen und Schüler sollen ihm zufolge die Besonderheiten der verschiedenen Formen der Geschichtskultur kennen und diese damit kritisch bewerten können, also eine „Gattungskompetenz in der Geschichtskultur“ entwickeln.92 Ein wesentlicher Faktor dabei ist die Frage der Realitätsnähe, doch die Analyse von geschichtskulturellen Produkten kann sich aufgrund ihrer vielfältigen Merkmale nicht allein in einer Prüfung der sogenannten empirischen Triftigkeit erschöpfen. Ziel ist es nach Pandel, dass die Schülerinnen und Schüler Faktualität, Fiktionalität und Fiktivität unterscheiden, mit Erinnerungskonflikten umgehen, die ästhetische Dimension des Geschichtsbewusstseins wahrnehmen sowie „kontrafaktische Aussagen erkennen und werten (Interessen, Lüge, Imagination)“ können.93 Die Förderung von geschichtskultureller Kompetenz im Geschichtsunterricht bedeutet, Schülerinnen und Schüler auf die Bewältigung der Herausforderungen vorzubereiten, die sich im Zusammenhang mit der Entwicklung der Geschichtskultur ergeben. Rüsen verweist diesbezüglich auf „eine wachsende Unsicherheit der historischen Identität“, „eine irritierende Erfahrung der kulturellen Vielfalt“, den „Angriff auf westliche Traditionen“ und die „überwältigende Bedeutung der neuen Medien“.94 Daniel Münch betont außerdem, dass ohne eine Berücksichtigung der Geschichtskultur das geschichtsdidaktische Prinzip des Lebensweltbezugs nicht umgesetzt werden könne.95 Der Einbezug von populären geschichtskulturellen Produkten wie Comics, Computerspielen oder Filmen kann für den kompetenzorientierten Geschichtsunterricht zudem vorteilhaft sein, da der Konstruktcharakter der Narration für Schülerinnen und Schüler leichter erkennbar ist, während sich beispielsweise Schulbuchautorinnen und -autoren oder Ausstellungskuratorinnen und -kuratoren sehr um eine möglichst objektive Darstellung bemühen.96
In Anbetracht der verschiedenen Definitionen und Vorschläge zur Strukturierung verwundert es nicht, dass in der Literatur weiterer Klärungsbedarf hinsichtlich des Konzepts der Geschichtskultur gesehen wird. Ziegler zeigt sich beispielsweise, wiewohl sie dessen Potential für die empirische Forschung anerkennt, von Schönemanns Ansatz wenig überzeugt, da „angesichts insbesondere diskurstheoretischer und poststrukturalistischer Auseinandersetzungen mit de[n] zutiefst gesellschaftlich und kommunikativ verwickelten individuellen Denk- und Sinnesleistungen die Komplexität nicht erfasst“ werde,97 und plädiert für eine neuerliche „Klärung des Zusammenhanges von individuellem Geschichtsbewusstsein und gesellschaftlicher Diskursivierung von Geschichtskultur.“98 Thünemann betont bezüglich des Verhältnisses von Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur die Bedeutung der Medien, die „sozusagen die kommunikativen Schnittstellen zwischen individuellem Geschichtsbewusstsein und gesellschaftlicher Geschichtskultur“ darstellen und auch in der Forschung stärker zu berücksichtigen seien.99 Lars Deile wiederum argumentiert, dass Kultur „niemals nur kollektiv“ möglich sei, sondern vielmehr „die Auseinandersetzung zwischen Individuum und Gesellschaft durch Prozesse von Internalisierung und Externalisierung“ beschreibe, weshalb Geschichtskultur „als gesamtes Feld der Anwesenheit von Vergangenheit in der Gegenwart verstanden werden“ müsse.100
Außerdem finde, wie Ziegler zu Recht anmerkt, bislang noch kaum eine „Reflexion über Geschichtskultur und deren Auseinandersetzung mit ‚Erinnerungskultur(en)‘ ‚Public History‘ sowie normativ aufgeladenem Gedenken im Hinblick auf Geschichtsunterricht“ statt.101 Sie verweist damit auf die wissenschaftlichen Diskurse, die parallel zu jenen um die Geschichtskultur entstanden sind und um die Begriffe „Geschichtspolitik“, „Erinnerungspolitik“, „Erinnerungskulturen“ und „Public History“ kreisen.102 Diese theoretischen Zugänge können auch in der vorliegenden Studie nicht berücksichtigt werden. Ausstellungen und Museen103 werden somit als geschichtskulturelle Produkte verstanden, deren Gattungsspezifika noch näher zu beleuchten sein werden.104
2.2 Fachspezifische Kompetenzorientierung in Österreich
2.2.1 Verankerung der fachspezifischen Kompetenzorientierung in Lehrplänen105
Das österreichische Schulwesen ist traditionell – ausgehend von den Reformen Maria Theresias – zentralistisch organisiert.106 Lehrpläne, in denen festgehalten wird, was Schülerinnen und Schüler lernen bzw. können sollen,107 gelten daher pro Schultyp für das ganze Bundesgebiet. Die Gliederung des Schulsystems erfolgt auf Basis der Alters- und Reifestufen der Kinder und Jugendlichen. Die Schulen sind einerseits nach dem Bildungsinhalt in allgemeinbildende und berufsbildende Schulen gegliedert und andererseits nach ihrer Bildungshöhe in Primar- und Sekundarschulen.108 Nach einem verpflichtenden Kindergartenjahr109 und einer vierjährigen Volksschule (Primarstufe), die in der Regel ab dem 6. Lebensjahr zu besuchen ist,110 kann in der vierjährigen Sekundarstufe I eine Mittelschule (MS), die gesetzlich verankerte Regelschule,111 oder die ebenfalls vier Schuljahre umfassende Unterstufe einer Allgemeinbildenden höheren Schule (AHS)112 besucht werden. In der Sekundarstufe II, die somit mit der 9. Schulstufe beginnt, können neben der vierjährigen Oberstufe der AHS, die mit der Reifeprüfung abschließt,113 verschiedene Formen von Berufsbildenden mittleren Schulen (BMS) mit unterschiedlicher Dauer oder von fünfjährigen Berufsbildenden höheren Schule (BHS), die mit der Reife- und Diplomprüfung abschließen, besucht werden;114 alternativ kann zur Beendigung der Schulpflicht die einjährige Polytechnische Schule (PTS) absolviert werden.115 Dazu kommen noch Berufsbildende Pflichtschulen (Berufsschulen), die nach Abschluss der Schulpflicht besucht werden können.116 Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf können eine Sonderschule oder eine Regelschule besuchen.117
Von den Berufsschulen und PTS abgesehen wird Geschichte in allen Schultypen gelehrt,118 nirgends jedoch als eigener Gegenstand und in durchaus unterschiedlichem Stundenausmaß.119 Eine Fächerkombination gab es bereits im 19. Jahrhundert als Geschichte gemeinsam mit Geographie unterrichtet wurde, bis eine Verordnung von 1892 eine Trennung der beiden Gegenstände durch eine Zuweisung von bestimmten Stundenkontingenten brachte.120 1962 wurde der Gegenstand um die Sozialkunde erweitert,121 die als Sozialgeschichte verstanden wurde122 und der zunächst in den Lehrplänen auch Themen gesondert zugeordnet wurden. Die Reformen des 20. Jahrhunderts führten dazu,123 dass der neueren und neuesten Geschichte immer mehr Raum gegeben wurde.124 Schließlich wurde das Fach um die Politische Bildung ergänzt:125 Nach jahrelangen Debatten126 und der Formulierung eines Grundsatzerlasses im Jahr 1978127 sowie der Einführung des Gegenstands „Politische Bildung“ an den Berufsschulen, PTS und mit unterschiedlichen Kombinationen an den BMHS128 wurde mit dem Schuljahr 2001/02 in den Oberstufen der AHS aus „Geschichte und Sozialkunde“ der Gegenstand „Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung“.129 Allerdings gab es zu diesem Zeitpunkt noch keinen Lehrplan und folglich auch keine approbierten Schulbücher. Bei der Ausformulierung des Lehrplans, der ein Jahr später in Kraft trat,130 wurden Erfahrungen der verschiedenen Schulversuche zur Politischen Bildung ebenso berücksichtigt wie neue Erkenntnisse und Fragestellungen der Politikwissenschaft und der Didaktik.131
Mit dem Schuljahr 2008/09 folgte die Erweiterung des Gegenstands in der Sekundarstufe I um die Politische Bildung.132 Unmittelbarer Anlass hierfür war die zuvor beschlossene Absenkung des Wahlalters auf das vollendete 16. Lebensjahr.133 Das damit in den Lehrplänen verankerte historisch-politische Lernen134 betont die mittlerweile in den Didaktiken beider Disziplinen anerkannte Verbindung der beiden Fachgebiete,135 wobei davon ausgegangen wird, dass sich „Politik nicht ohne Geschichte, Geschichte nicht ohne Politik verstehen“136 lässt. Der Geschichtsdidaktik wird zur Erreichung eines reflektierten Politikbewusstseins eine vorbereitende und ergänzende Funktion zugeschrieben.137 Eine Erhöhung der Stundenanzahl erfolgte jedoch nicht. Wie bereits im Lehrplan des Jahres 2000138 wurden für den Gegenstand ab der 6. Schulstufe je zwei Wochenstunden vorgesehen.
Mit der Reform des Lehrplans der Sekundarstufe I wurde im Jahr 2008 auch erstmals die fachspezifische Kompetenzorientierung verankert.139 Die curricularen Vorgaben folgen damit, wie Wolfgang Buchberger zusammenfasst, einem „dem gemäßigten Konstruktivismus zuzuordnende[n] narrativistische[n] Geschichtsverständnis […], das grundsätzlich zwischen der abgeschlossenen Vergangenheit und ihrer Re-Konstruktion durch historische Narrationen, z. B. fachwissenschaftliche Publikationen, aber auch Dokumentarfilme, unterscheidet.“140 Zwar wurde schon im allgemeinen Teil der Lehrpläne der Sekundarstufe I aus dem Jahr 2000 festgehalten, dass die Schülerinnen und Schüler „Sachkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz in einem ausgewogenen Verhältnis“ entwickeln sollen,141 und im Lehrplan für das neue Kombinationsfach „Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung“ aus dem Jahr 2002 für die AHS-Oberstufe war neben einer Sach- und einer Sozialkompetenz von einer Methodenkompetenz die Rede, die als „Fähigkeit der Anwendung analytischer Instrumente und Verfahren; Recherche aus unterschiedlichen Quellen usw.“ beschrieben wurde,142 doch folgten diese Zielvorgaben eher dem überfachlichen Diskurs zu Kompetenzen.143
2008 war die Ausgangslage für die Verfassung eines neuen Lehrplans anders: Ähnlich wie die Didaktiken anderer Fächer wurde auch die Geschichtsdidaktik von den Diskussionen und Entwicklungen geprägt, die auf den sogenannten „PISASchock“144 folgten. Die Testungen zeigten v. a. Defizite bei der Übertragung von Gelerntem auf unbekannte Anwendungsfälle auf.145 Der Blick auf die Lehrplantheorie und -praxis von Staaten, deren Bildungswesen als „erfolgreich“ gilt (meist begründet durch ein überdurchschnittliches Abschneiden bei den PISA-Testungen), und die Ausrichtung des Lernens an Kompetenzen, die schrittweise erreicht, nachgewiesen und anhand von Standards vereinheitlicht werden sollen, dominieren seither alle Überlegungen und Diskussionen zu Lehrplänen im deutschsprachigen Raum.146 Auf die Herausforderungen reagierte auch die deutschsprachige Geschichtsdidaktik in den 2000er-Jahren mit der Entwicklung von Kompetenzmodellen, nachdem bereits länger über Bildungsstandards und die Ausrichtung der Curricula diskutiert worden war.147 Wie Buchberger feststellt, geben die in der Folge entstandenen Kompetenzmodelle eine „Antwort auf die Frage, wie die Zentralkategorie des Geschichtsbewusstseins in Form von Kompetenzen historischen Denkens operationalisiert werden kann, welche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Bereitschaften also notwendigerweise grundgelegt werden müssen.“148
Obwohl zu diesem Zeitpunkt im deutschsprachigen Raum bereits mehrere Kompetenzmodelle publiziert waren,149 auf die an dieser Stelle jedoch nicht näher eingegangen werden soll,150 wurden im Lehrplan die Kompetenzbereiche des Kompetenz-Strukturmodells der internationalen Projektgruppe FUER151-Geschichtsbewusstsein152 verankert.153 Dies erklärt sich daraus, dass dieses Modell im österreichischen Diskurs am weitesten verbreitet war, zumal es unter österreichischer Mitwirkung entstand,154 was vom österreichischen Unterrichtsministerium unterstützt worden war.155
Das Modell basiert auf einem gemäßigten Konstruktivismus, womit die zwangsläufige Standortgebundenheit von allen Darstellungen betont wird, sowie auf einer narrativistischen Geschichtstheorie, der zufolge das Ergebnis jeglicher Re-Konstruktion eine historische Narration darstellt.156 Eine solch „narrativ-konstruktivistische Geschichtsdidaktik geht von einem auf individuellen Erfahrungen und Auseinandersetzungen mit Vergangenheit und Geschichte je unterschiedlich ausgeprägtem Geschichtsbewusstsein aus“157, wie Christoph Bramann zusammenfasst. Grundlage des Modells bildet die von Wolfgang Hasberg und Andreas Körber zu einem Prozessmodell historischen Denkens158 ausdifferenzierte disziplinäre Matrix von Rüsen.159 Holger Thünemann und Johannes Jansen folgend kann die Entwicklung dieses Modells als „Epochenschwelle“ angesehen werden, nach deren Überschreitung „aus Theorien des Geschichtsbewusstseins und Modellen historischen Denkens historische Kompetenzmodelle“ entstanden.160 Somit wurden, wie Hasberg resümiert, die Kompetenzbereiche des FUER-Modells „aus einer theoretisch fundierten Vorstellung des historischen Erkenntnisprozesses“ abgeleitet.161
Das Kompetenz-Strukturmodell beschreibt den Prozess des historischen Denkens als Regelkreis in drei Schritten, wobei als Ausgangspunkt eine Verunsicherung eines Individuums in der Gegenwart zu sehen ist, die ein Orientierungsbedürfnis auslöst. Unterschieden werden drei prozedurale Kompetenzbereiche, die Frage-, Methoden- und Orientierungskompetenzen, die jeweils Operationen beschreiben, die für den so ausgelösten historischen Denkprozess nötig sind, sowie die Sachkompetenzen, die durch Prinzipien und Konzepte strukturiert sind, indem also, wie Schreiber zusammenfasst, „die Ergebnisse der historischen Denkprozesse strukturiert werden.“162 Dabei werden jeweils Kernkompetenzen und Einzelkompetenzen unterschieden, wobei Letztere „nicht immer systematisch aus dem Modell historischen Denkens abgeleitet“ sind.163
Um entstandene Verunsicherungen bzw. das sich daraus ergebende Interesse an einem historischen Sachverhalt bearbeiten zu können, sind historische Fragen nötig, die einen historischen Denkprozess anstoßen. Die Fragekompetenzen beziehen sich auf die Fähigkeit, einerseits historische Fragen formulieren zu können und andererseits Fragen zu erkennen und zu bewerten, die historischen Narrationen zugrunde liegen.164 Kühberger folgend sind historische Fragen von allgemeinen Fragen, etwa nach dem Zeitpunkt eines Ereignisses, zu unterscheiden, indem sie darauf abzielen, mindestens zwei Zeitpunkte miteinander sinnstiftend in Form einer historischen Narration zu verbinden.165
Die Methodenkompetenzen, die bereits in der sogenannten Sechs-Felder-Matrix beschrieben wurden,166 umfassen die fachspezifischen Fähigkeiten, die zur Beantwortung der aufgeworfenen Fragen nötig sind. Es geht auf der einen Seite darum, auf Basis von historischen Quellen historische Narrationen zu entwickeln, wobei Heuristik, Quelleninterpretation sowie das Herausarbeiten von Vergangenheitspartikeln zentral sind (Re-Konstruktionskompetenzen). Auf der anderen Seite sollen bestehende historische Aussagen bzw. Darstellungen kritisch hinterfragt werden, womit ihre Tiefenstruktur erschlossen und eine Triftigkeitsprüfung durchgeführt wird (De-Konstruktionskompetenzen).167 Damit kommt im FUERModell dem analytischen Umgang mit historischen Narrationen eine zentrale Bedeutung zu, „indem es die De-Konstruktion als konstitutiven Bestandteil des historischen Denk- und Lernprozesses modelliert“.168
Die Orientierungskompetenzen zielen darauf ab, die erworbenen Erkenntnisse für ein besseres Verständnis von gegenwärtigen und zukünftigen Problemstellungen zu nützen. Der Kompetenzbereich beschreibt also Fähigkeiten, die es ermöglichen, Erkenntnisse über die Vergangenheit mit dem eigenen Leben in der Gegenwart und Zukunft in Beziehung zu setzen. Die Kernkompetenzen der Orientierungskompetenzen umfassen die Fähigkeit, Fertigkeit und Bereitschaft zur Re-Organisation des eigenen Geschichtsbewusstseins, die eigenen Vorstellungen auf Basis der gewonnenen Einsichten anzupassen bzw. zu revidieren, sowie die Reflexion der eigenen Identität und der Handlungsdispositionen.169
Der vierte Kompetenzbereich, die Sachkompetenzen, beschreibt die Fähigkeit, über fachspezifische Begriffe, Kategorien und Konzepte zu verfügen (Begriffskompetenz) und diese theorie-, subjekts-, inhalts- und methodenbezogen systematisieren zu können (Strukturierungskompetenz).170 Die Sachkompetenzen umfassen all jene Ansätze, die im englischsprachigen Diskurs als first order concepts und second order concepts171 bezeichnet werden, wie Peter Seixas betont.172 Es geht also „nicht um schlichtes Daten- und Faktenwissen. Sachkompetenz ist nicht an bestimmte Inhalts- und Wissenskanones gebunden und setzt diese auch nicht voraus.“173 Die „Sache“ beim Begriff der Sachkompetenz ist also nicht die Vergangenheit, sondern Geschichte als mentales Konstrukt und das historische Denken.174
Im österreichischen Lehrplan der Sekundarstufe I von 2016 fanden sich daran angelehnt folgende Kurzbeschreibungen der einzelnen Kompetenzbereiche:175
Historische Fragekompetenz
Geschichte gibt Antworten auf Fragen, die an die Vergangenheit gestellt werden. Im Unterricht sind in Geschichtsdarstellungen vorhandene Fragestellungen aufzuzeigen und die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, Fragen an die Vergangenheit zu erkennen und selbst zu formulieren.
Historische Methodenkompetenz
Die Eigenständigkeit im kritischen Umgang mit historischen Quellen zum Aufbau von Vorstellungen und Erzählungen über die Vergangenheit (Re-Konstruktion) sowie ein kritischer Umgang mit historischen Darstellungen (zB Ausstellungen, Spielfilme mit historischen Inhalten, Schul- und Fachbücher, Computerspielen) sind zu fördern (De-Konstruktion). Dazu sind Methoden zu vermitteln, um Analysen und Interpretationen vornehmen zu können.
Historische Sachkompetenz
Der Unterricht ist zudem so zu gestalten, dass fachspezifische Konzepte und Begriffe angewandt, reflektiert und weiterentwickelt werden. Dabei gilt es an vorhandene Vorstellungen der Lernenden anzuschließen und einer altersgemäßen Konkretisierung sowie Weiterentwicklung im Sinn eines Lernens mit Konzepten besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
Historische Orientierungskompetenz
Historisches Lernen soll – insbesondere unter Berücksichtigung der didaktischen Prinzipien des Gegenwarts- und Zukunftsbezugs sowie der Multiperspektivität – zum besseren Verstehen von Gegenwartsphänomenen und von zukünftigen Herausforderungen beitragen. Da unterschiedliche Schlüsse aus der Geschichte gezogen werden können, ist im Unterricht auf die Pluralität in der Interpretation zu achten. Die sich daraus ergebenden Synergien mit der historisch-politischen und politischen Bildung sind zu berücksichtigen.
Tabelle 2:Historische Kompetenzen laut Lehrplan Sekundarstufe I (2016)176
Historisches Lernen wird somit Körber zufolge als „Erwerb von Kompetenzen historischen Denkens für eine selbstständige Beteiligung an der Geschichts-(sowie Erinnerungs- etc.) -kultur und -politik der Gesellschaft“177 verstanden. Das Modell folgt dabei Franz E. Weinert, der Kompetenzen definiert als
„die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten[,] um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“.178
Im Gegensatz zum von Sauer publizierten Kompetenzmodell, in dem in der „Themenbezogenen Sachkompetenz“ Faktenwissen – im Sinne von „wichtige[n] Ereignisse[n], Entwicklungen und Strukturen“179 – ein eigener Wert zukommt,180 folgt das FUER-Modell der Überlegung, dass Kompetenzen an beliebigen Fallbeispielen angewendet und weiterentwickelt werden können. Faktenwissen ist „als dasjenige Substrat, auf welches die Kompetenzen angewendet und woran sie erworben werden“ zu sehen.181 Damit entspricht das FUER-Modell den Annahmen von Gerhard de Haan, der betont, dass Kompetenzen inhaltsneutral zu beschreiben seien, wiewohl die Aneignung von solchen anhand von inhaltlich definierten Fallbeispielen erfolgen müsse.182 Hasberg meint diesbezüglich: „Die Performanz der Kompetenzen historischen Denkens wendet zwar Wissen an und generiert im besten Fall sogar historisches Wissen. Wissen zu besitzen aber ist keine Kompetenz, sondern Voraussetzung historischen Denkens.“183 Ähnlich argumentiert auch Wolfgang Sander: „Geht man […] von einem komplexen Kompetenzbegriff aus, in dem insbesondere Fähigkeiten und Wissen miteinander verbunden sind, dann ist Wissen zwar eine notwendige Kompetenzdimension, aber kein eigener Kompetenzbereich.“184 Mit diesen Einschätzungen wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass „das letztlich notwendige Wissen für die Zukunft nicht vorhersehbar, fixierbar oder durch Vorratslernen erwerbbar ist“,185 wie Kühberger feststellt. Hellmuth argumentiert hingegen, dass der Wissensbegriff durch die Trennung von Kompetenzen eingeengt bzw. der Zusammenhang zwischen den beiden Bereichen undeutlich werde.186 Ausgehend von den Forderungen nach einem Wissensmodell187 sowie einem Modell, das Wissen und Kompetenzen zueinander in Beziehung setzt,188