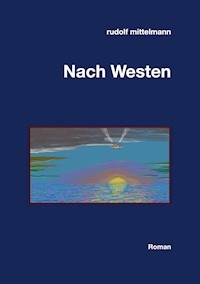
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Trash-Novelle wie ein Roadmovie. Ein Mann läuft vor seinem Leben davon, als er von seiner Frau verlassen wird. Nach Westen, bildet er sich ein, nach Westen! Doch so einfach ist das gar nicht, das Davonlaufen, immer neue Schwierigkeiten machen ihm zu schaffen. Doch immer kurz bevor er soweit ist, aufzugeben, eröffnet sich ihm eine neue Chance...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Nach Westen
Die Fahrerin
Flucht
Hassan
Die Riesin
Über den Wolken
Alles geheim
Die Sieben
Zu Gast
Ich
Ich-eins
Ich-zwei
Ich-drei
Ich-eins
Ich-zwei
Ich
Zu Hause
Vierzehn
Der Zet
1. Nach Westen
Schwellen und Schotter.
Wenn der Abstand nicht so doof wäre. Da finde ich keinen Rhythmus.
Heiß. Trocken. Wenigstens nicht staubig.
Die gleißenden Stahlbänder. Eins rechts, eins links.
Die Sonne - nicht hinschauen.
Ist die da festgewachsen? Müsste der glühende Ball nicht längst ein Stück zum Horizont gerutscht sein?
Schotter und Schwellen.
Ich gehe und gehe. Wohin? Jedenfalls weg.
Alles habe ich hinter mir gelassen.
Bis auf die paar Sachen in meinem Rucksack. Nicht viel. Aber so schwer.
Und meine Klamotten, die ich anhabe, meine kleinen Utensilien, ohne die ich nicht weggehe.
Taschentuch, ein richtiges aus Stoff, Schweizermesser mit zwei Dutzend Funktionen, Feuerzeug und einen kleinen runden Stein.
Dazu meine Geldtasche, die aber leer ist. Meine Brieftasche mit Ausweisen und Kreditkarte habe ich nicht mitgenommen.
Warum auch immer, Wut oder Selbstmitleid.
Au. Verflixt. Wenn ich so oft stolpere, werden die Schuhe nicht lange halten.
Zehn Jahre. Viel Zeit mit dieser Frau. Gute Jahre. Und nun ist sie weg.
Weg, die Zeit. Und die Frau. Mit einem anderen.
„Ein neues Leben anfangen“, so nennt sie das. Was aus mir wird, interessiert sie nicht. Hat sie nie interessiert. Keine Pläne, keine Bindung.
Schwellen und Schotter.
Jetzt steht die Sonne aber doch wohl tiefer? Vielleicht bilde ich mir das nur ein. Weil ich weiß, dass es so sein muss. In der Bibel gibt es diese Geschichte, wo die Sonne lange Zeit stehen bleibt. Hier sicher nicht. Diese endlose Ebene. Ein paar vertrocknete Sträucher und sonst alles kahl. Leer. Nicht mal ein Vogel. Über der Leere der goldene Nachmittagshimmel. Vor mir die Schienen.
Schotter und Schwellen.
Ich habe geglaubt, sie liebt mich. Nun ja, in einem sehr elementaren Sinne hat sie das wohl. Körperlich. Das war gut. Das war auch alles. Warum hab ich so lange gebraucht, das zu begreifen. Andererseits. Habe ich sie geliebt? Hab ich gedacht, ja. Aber so im Rückblick. Im Grunde war es Sex, vom Feinsten, und sonst nicht viel. Wenigstens keine Kinder. Jetzt ist sie mit dem Typen in der großen Stadt. Kann mir schon denken, was die heute Abend... Sollen sie halt. Mich geht das nichts an. Was ich mache, nur das ist wichtig.
Vielleicht ist es auch nicht wichtig, dann ist eben alles egal.
Mir auch egal. Deshalb gehe ich.
Gehen.
Nach Westen gehen.
In der Wohnung hätte ich es keine Nacht mehr ausgehalten. Zu teuer war sie außerdem. Ihr nicht. Sie hat gut verdient. Jetzt ist sie weg. Schwellen und Schotter.
Gehen? Ich kämpfe mich weiter. Bald werde ich mich schleppen. Kriechen. Drei Nächte habe ich schon in meinem winzigen Zelt verbracht, wenn auch fast ohne Schlaf. Mehr als drei Tage schon Müsliriegel und ein paar Schluck Wasser. Bei der Hitze. Lange halte ich das nicht mehr aus.
Müsste da nicht mal ein Ort kommen? Das Land ist groß. Aber seit wann so leer? Vielleicht hätte ich erst mal auf eine Karte schauen sollen. Ausgekannt habe ich mich nie in diesem Teil der Welt. Wenigstens ein ganz kleines Kaff. Mit einem Gasthof. Oder wenigstens einem kleinen Laden. Hier ist nichts.
Die zweite Flasche ist bald leer. Was mache ich dann? Wer kann denn ahnen, wie entsetzlich verlassen hier alles ist. Ist es jetzt dunkler geworden oder gewöhne ich mich an das grelle Licht?
Schotter und Schwellen.
Sie hat immer eine Sonnenbrille dabei gehabt. Aber das gehört zu ihrem Style. Überhaupt hat sie sich immer sehr perfekt hergerichtet. Nicht dass das nötig gewesen wäre. Schön ist sie, keine Frage.
Ob ich ihr auch gefallen habe? Wahrscheinlich, sonst hätte sie es nicht so lange mit mir ausgehalten. Sonst hätte sie mich nie angesprochen. Damals, auf dem Aussichtsturm. Wie sie an mir vorbeiwollte. „Darf ich mal?“ Und schon durchgedrängt. Dabei ist mein Jausenbrot über die Brüstung gestürzt. So süß, wie sie sich entschuldigt hat. Lieber nicht dran denken.
Aber so leicht werde ich sie nicht los. Wird noch lange in meinem Kopf herumlungern. Diese - diese - ach, ich mag sie noch immer.
Und vor mir, was liegt vor mir? Ein Leben ohne sie. Ein Leben?
Wenn jetzt ein Zug käme. Ich weiß nicht. Es wäre doch ganz einfach. Ich brauche bloß gar nichts zu machen. Dann kommt das große Nichts ganz schnell. Und aus.
Nein, das kann ich nicht. Das will ich nicht.
Es muss doch einen Weg geben.
Nach Westen. Der Sonne entgegen. Oder hinterher. Das eher, ja. Ihr nachlaufen, der Sonne.
Schwellen und Schotter.
Es hört nicht auf. Aber die Sonne ist nun fast weg. Wo kommen die Wolken auf einmal her?
Vorhin waren noch keine Wolken zu sehen, nirgends. Da. Jetzt wird es deutlich dunkler. Der Himmel violett. Und vor die Sonne hat sich eine lange Wolkenbank geschoben. Ganz weit weg, ganz weit da vorne. Dunkelgraublau sieht die aus. Kein Sonnenuntergang.
Hey, da weiter links, da ist ja ein Wäldchen. Ein Wald vielleicht, von hier ist das nicht zu erkennen. Ist da nicht ein ganz kleines Lichtchen? Das wäre doch das, was ich jetzt nötig habe. Ein Haus, eine Ortschaft, ein kleines bisschen Zivilisation. Dann brauche ich nicht verdursten und schon gar keinen erlösenden Zug von hinten.
Ob die Sonne nochmal unter der Wolkenbank durchscheinen wird? Nein, ich glaube, sie ist schon ganz untergegangen. Es wird dämmrig, ganz langsam. Und das Licht? Das Licht da drüben? Nicht mehr zu sehen.
Enttäuschung! Ob ich es mir eingebildet habe?
Schotter und Schwellen.
Hat das noch einen Wert?
Hier weiterzugehen?
Es wird schneller dunkel, als mir lieb ist. Noch sind die Schienen gut zu erkennen, noch sind die Schwellen auszumachen. Schritt für Schritt.
Mir ist nicht gut. In mir zieht sich alles zusammen. Ist das Hunger? Aber das Wäldchen, das sehe ich nicht mehr. Bin ich schon vorbei oder war das nur Wunschdenken? Da ist nichts. Nicht mal Bäume.
Kein Haus, kein gar nichts. Dunkelgrauer Himmel, über grauschwarzem Horizont. Davor:
Schwellen und Schotter.
Zwischen dunkelblau schimmernden Schienensträngen.
Ich gehe mechanisch weiter, wie ein Roboter. Nur, dass ich keine Maschine bin. Ich tue nur so.
Innerlich leer habe ich doch meine Wünsche, meine Bedürfnisse, meine Sehnsüchte. Wirklich? Es sollte so sein, aber jetzt spüre ich nichts davon.
Hohl wie eine Klopapierrolle. Ach.
Da!
Vor lauter sinnlosem Grübeln hätte ich fast die Lichter übersehen.
Da drüben, etliche hundert Meter voraus, wohl links von den Gleisen, zwei weiße Lichtpunkte.
Ach, nur ein Auto. Es kommt wenig näher, und verschwindet schnell, ganz nach links hinten.
Hoffnung und Enttäuschung.
Diese hässlichen, weil unzertrennlichen, Zwillinge. Vorbei.
Alles versinkt im Dunkeln.
Und doch, da war ein Mensch. Ein einziger Mensch zumindest, und nun ist er weg.
Wie ich mich nach der Einsamkeit gesehnt habe. Und wie schnell ich ihrer überdrüssig geworden bin.
Schotter und Schwellen.
Fast ganz dunkel. Über mir ein paar Sterne. So schauen die Schienen noch mal so schön aus, in diesem zarten Licht.
Und dieses Funkeln da, so golden. Herrlich.
Moment mal, das kommt aber nicht vom Himmel.
Da ist ja doch ein Licht.
Ich gehe immer zwischen den Stahlsträngen entlang, vorwärts, westwärts, nur weg.
Das Licht aber wandert links vorbei. Relativ.
Sollte ich nicht zu dem Licht abbiegen? Oder soll ich es ignorieren?
Bin ich von den Schienen gefangen? Warum kommt hier nie ein Zug vorbei?
Es ist alles so seltsam.
Einsam, keine Siedlungen, keine Menschen, kein Betrieb auf der sonst offensichtlich befahrenen Strecke.
Aber - das Licht.
Reflexe und Schienen.
Diesem einzigen Ziel weit und breit werde ich mich doch nicht entziehen?
Ich kann einfach weitergehen.
Entweder. Lange geht es sowieso nicht mehr, weil ich dann zusammenbrechen werde.
Oder.
Oder ich kann abbiegen. Und mich auf das einlassen, was da so beleuchtet ist.
Ich muss mich entscheiden, sonst ist es zu spät, und ich bin vorbei.
Schritt um Schritt.
Soll ich weitergehen? Soll ich abbiegen?
Schwellen und Schienen.
Meine Wegbegleiter, meine treuen, seit so langer Zeit.
Kilometer um Kilometer.
Und doch.
Ich gebe mir einen Ruck. Jetzt oder nie.
Ich steige über die linke Schiene, natürlich bleibe ich mit dem schwachen rechten Fuß fast hängen.
Der Bahndamm ist nahezu flach.
Vorsichtig taste ich mich voran.
Die Füße vorwärts schieben, abwechselnd, immer mit Hindernissen rechnend. Aber das Land ist völlig eben, keine Steine, keine Gräben, ganz wie es tagsüber immer ausgesehen hat.
Mir fehlen die Gleise, diese Leitschienen, die mich nun im Stich gelassen haben, oder nein, ich war es, der die Partnerschaft aufgekündigt hat.
Da vorne, das ist nicht nur ein Licht. Da sind mehrere.
Nach etlichen Minuten erkenne ich große Laternen.
Und da taucht vor mir im trüben Gegenlicht mehrerer Straßenleuchten ein Zaun auf.
Aus der Dunkelheit. Ein hoher Stacheldrahtzaun. Alles andere als einladend.
Überklettern unmöglich.
Meine Kräfte verlassen mich schlagartig. Diese neue Enttäuschung, das ist zuviel.
Ich sinke zu Boden.
Mit dem Rucksack lehne ich mich an den Zaun.
Was nun? Soll ich hier die Augen zumachen? Womöglich für immer?
Nein. Ich muss weiter. Nur ein bisschen rasten.
In der Ferne ein Schrei, vielleicht eine Eule, immerhin ein Lebewesen.
Hinter mir ein feines Summen, komisch, dass mir das nicht gleich aufgefallen ist.
Ganz gleichmäßig, aber das heißt nichts, kann ein Transformator sein.
Ein technisches Geräusch, das keineswegs die Anwesenheit eines Menschen verspricht.
Ich lehne den Kopf an.
Zaun und Nacht.
---
Ich schrecke hoch, war das ein Tierschrei? Mir ist kalt, und meine Beine spüre ich nicht mehr.
Ich muss unbedingt aufstehen.
---
Ein stechender Schmerz lässt mich zusammenfahren. Aua. Was soll das? Wo bin ich?
Ach ja.
Licht und Zaun.
Ich versuche aufzustehen. Es gelingt nicht recht, der Fuß, ich falle um, jetzt liege ich auf der Seite. Ich kann mit der einen Hand den Zaun erreichen. Zentimeter um Zentimeter kämpfe ich mich in die Senkrechte. Warum bin ich hier? Hmm. So langsam fällt mir das ganze Drama ein. Wie konnte ich mich auf diese Frau einlassen. Was für ein Fehler. Hätte ich das Desaster nicht vorhersehen können?
Doch, habe ich sogar, aber ich war zu bequem, mein Leben zu retten.
Die Sache in die Hand zu nehmen. Sie wegzujagen, so lange Zeit dafür war. Und so nahm das Ungemach seinen Lauf. Bis ich geflüchtet bin. Und jetzt sitze ich hier. Allein, verlassen, ohne Plan oder Ziel.
Langsam, unter allerlei Schmerzen, hantele ich mich am Zaun entlang. Es wird noch dunkler, der Weg führt von den Laternen weg.
Manchmal sehe ich noch meinen Schatten vor mir, später nicht mehr. Wie riesig ist denn dieses Gelände? Ich frage mich, ob ich umdrehen soll. Aber würde der Weg in die andere Richtung nicht genauso vom Licht in der Mitte wegführen?
Nacht und Zaun.
Auf einmal, während ich noch am Grübeln bin, zurück oder weiter, greife ich ins Leere. Ein kurzer Schreck, dann Erleichterung. Darauf habe ich ja gehofft.
Ich taste mich zurück, und da geht es wirklich im rechten Winkel um die Ecke.
Wenige Meter später reiße ich meine Hand mit einem Aufschrei zurück. Ich habe mich gestochen. Was ist das? Ganz vorsichtig befühle ich die Stelle. Da ist Stacheldraht. Und der kommt von oben. Es ist fast dunkel, aber nur fast. Und so langsam kann ich mit fühlen und sehen herausfinden: Hier ist ein Stück des Zaunes beschädigt. Etwas großes, rundes, dickes liegt da schräg über den niedergerissenen Zaun. Soll ich da reingehen?
Wieder muss ich überlegen. Ich könnte über den Stamm steigen und einfach weiter am Zaun entlanggehen. Außen. Bis ein offizieller Eingang kommt. Und dort stünde dann ein feierliches Begrüßungskomitee und würde mich willkommen heißen. Ich würde in eine komfortable Herberge geführt und bekäme ein Festessen serviert... träum weiter, Alter!
Oder, ich kann hier auf dem Baumstamm über den Stacheldraht in das Gelände eindringen. Wo ich dann früher oder später von Sicherheitspersonal entdeckt und festgesetzt werde. Oder schlimmer, ich könnte von scharfen Wachhunden angefallen und zerrissen werden. Oder, einfacher, von einer automatischen Schussanlage niedergestreckt werden.
Ich schüttele den Kopf, um die finsteren Gedanken zu vertreiben. Aber es fällt mir keine weitere Alternative ein. Außen herum oder hinein. Das ist die Frage.
Nach endlosem Zögern übersteige ich das schwarze Holz und suche die Fortsetzung des Zaunes.
Löcher und Draht.
Kaum habe ich das eiserne Geflecht in der Hand, neue Zweifel. Wieder bleibe ich stehen. Soll ich wirklich in diese noch finsterere Nacht hineinlaufen? Am Ende kommt ein verschlossenes Tor, und nach weiteren Zaunlängen stehe ich irgendwann an meinem Ausgangspunkt? Dann doch lieber auf das fremde Grundstück.
Was wird schon passieren. Hunde gibt es doch wohl nicht, in dieser Einsamkeit nicht.
Ich drehe mich um und balanciere einen halben Meter über dem liegenden Stacheldraht ins verbotene Reich. Mein Herz klopft laut.
Ein gutes Zeichen, diese Aufregung. Wie lange hat mich alles nur angeödet, gelangweilt, genervt.
Bummbumm, bummbumm, bummbumm. Heftig.
Ganz weit vorne ein Lichtschimmer, rechts scharf abgeschnitten. Das ist wohl die Silhouette eines Gebäudes. Und ganz da hinten werden diese Laternen leuchten, die ich schon von näher gesehen habe. Vor Tagen, wie mir vorkommt, dabei kann es kaum eine Stunde her sein. Trotz meines langsamen, tastenden Schrittes stolpere ich. Da ist ein kniehohes, hartes Hindernis. Ich bücke mich, obwohl die Schmerzen wie Blitze durch meinen Rücken schießen. Ein Eisenteil, rostig, mehr sagt mir der Tastsinn nicht. Ich weiche aus. Drei Schritt später knickt erst mein linker Fuß fast um, dann der rechte. Ich kauere nieder, es geht schon besser. Bewegung, nur Bewegung, immer Bewegung, predigte mein Heiler immerzu. Eine nutzlose Erinnerung an mein ehemals geregeltes Leben in der kleinen Industriestadt. Was ist das? Eine kleine Freude huscht durch meinen deprimierten Geist. Schienen!
Stahl und Asphalt.
Hier gibt es Schienen.
Und schon kommt die Ernüchterung. Das sind Gleise, wie man sie auf jedem Werksgelände findet. Mit Verkehr und Welt und Menschen hat das nichts zu tun. Dazu auch noch unbenutzt, vollkommen verrostet.
Obwohl mir diese Schienen nicht helfen können, sondern nur das Gehen erschweren, folge ich ihnen. Immerhin sind es Schienen, und nach ein paar Minuten scheint der rostige Teil in einen besser erhaltenen überzugehen, denn ich sehe erste Reflexionen der immer noch ein Stück entfernten Lampen.
Schienen und Licht.
Überhaupt wird es spürbar heller. Die nächsten herumliegenden Hindernisse werfen lange Schatten, aber ich kann sie problemlos umrunden, ohne zu stolpern. Meine Stimmung hebt sich. Dabei ist mir völlig klar, wie wenig Grund ich für meine Erleichterung habe. Ich nähere mich dem Lichtkreis der trüben Funzeln, ja und?
Vier sehr hohe Laternen. Aufgestellt in einem Quadrat. Im schwachen Schein erkenne ich nichts als Unkraut, das aus dem aufgebrochenen Asphalt wächst, auch über die hier im meist betonierten Gleisbett eingelassenen Schienen. Auf jeder Seite des Quadrats, deutlich zurückgesetzt und vom spärlichen Licht kaum erhellt, einfache, rechteckige Gebäudefronten mit großen, geschlossenen Toren. Fabrikshallen, vermutlich. Aber an den einen Schuppen schmiegt sich eine kleine Hütte. Und aus ihrem Fenster kommt ein gelbliches Licht. Ob da jemand ist?
Ich stapfe entschlossen auf das Häuschen zu, und bleibe gleich wieder stehen. Es kann sein, da ist niemand. Es kann aber auch sein, da passt einer auf, ein Wachmann oder ein Schichtarbeiter. Was soll ich denn sagen: „Hallo, hast du ein Bett für mich? Und ein Abendessen?“
- „Ja, ich kann dir ein Steak anbieten, setz dich nur, ich bringe es gleich, und wenn du willst kannst du in der Stube schlafen, es ist Platz genug.“ Sicher nicht. Oder er fährt mich an: „Hände hoch! Wer sind Sie? Können Sie sich ausweisen? Da rüber, da rein, da können Sie warten, bis die Polizei eingetroffen ist!“
Könnte sein.
Und doch. Ich muss es riskieren. Wozu bin ich sonst hier eingedrungen?
Ein langes Gähnen überkommt mich. Wenn ich länger hier rumstehe, fallen mir die Augen zu. Die Müdigkeit wird unerträglich. Nur nicht einschlafen!
Ich setze mich in Bewegung. Auf das gelbe Licht zu.
Fenster und Licht.
Durch die trübe Scheibe ist nichts zu erkennen. Ich schlurfe um die Ecke zur Tür. Soll ich klopfen? Anders wird es nichts werden. Also los.
Tock-tock-tock. Mein Herz setzt einen Schlag aus. Was nun?
Nichts passiert. Gar nichts.
Tock-tock-tock. Nichs.
Nochmal. Dreimal, im gleichen Rhythmus.
Nichts.
Ich gehe zum Fenster zurück. Wische mit dem Ärmel über das trübe Glas, vielleicht ist es nur Staub.
Ich sehe verschmierten Dreck.
Ein wenig heller, aber noch immer keine freie Sicht. Nur gelbliches Licht. Ich wische heftiger, dann schon wütend. Ich will reinschauen, verdammt, nach dem langen Weg will ich wenigstens wissen, woran ich bin.
Die Angst eingesperrt zu werden ist vergessen.
Da splittert die Scheibe, furchtbar laut, ich reiße den Arm zurück, die Scherben klirren auf den Betonboden.
Jetzt kommt die richtige Angst.
Ich kann sehen.
Ich sehe einen Körper halb unter einem Tisch liegen. Links ein umgefallener Stuhl. Auf dem Tisch eine Flasche, ein Wasserkrug und Gläser.
Das wäre alles weniger schlimm, wenn nicht unter dem Körper, wohl ein Mann in Arbeitskleidung, eine dicke Lache von vermutlich frischem Blut hervorquellen würde.
Mir wird übel, gleichzeitig aber spüre ich einen unerwarteten Strom von Energie im ganzen Körper. Ich atme tief ein, und versuche mich zu konzentrieren.
Das sieht böse aus, ein Unfall oder ein Mord. Vielleicht ist der Typ noch zu retten. Die Tür eintreten? Das würde ich kaum schaffen.
Hilfe rufen? Sinnlos. Das Fenster ist zu klein für mich.
Aber ich kann den doch nicht verbluten lassen!
Wut und Kraft.
Ich eile zur Tür um die Ecke, und werfe mich dagegen. Fast ohne Widerstand springt sie auf, und ich taumele in den Raum, mit einem Fuß im Blut. Ich bücke mich zu dem Körper nieder.
Der Mann ist eine Frau, so um die 65 schätze ich, und mausetot, kalt, da gibt es keinen Zweifel.
Jetzt, wie mir klar ist, dass ich zum Helfen zu spät komme, verfliegt die Reserveenergie sofort.
Mir wird schlecht.
Blut und Tod.
Und ich mittendrin.
Ich stolpere aus dem Häuschen ins Freie. Die Dunkelheit. Erst langsam gewöhnen sich meine Augen an das schwache Licht der fernen Lampen.
Ich sollte hier weg.
Aber wohin?
Ich bin schon einige zig Meter gegangen, als mein Kopf das Denken aufnimmt.
Entweder, ich suche mir als Rückweg die Lücke im Zaun. Und was dann weiter?
Oder, ich suche den Haupteingang.
Vielleicht ist da jemand, ein Wächter, oder zumindest ein Telefon, oder was immer.
Beides gefällt mir gar nicht.
Ich will nicht den gleichen Weg zurück. Immerhin, ich bin dabei, wegzulaufen!
Ich will nicht mit einem Wachhabenden zu tun bekommen. Immerhin, ich bin hier eingebrochen!
Dazu droht die Müdigkeit, mich zu überwältigen. Vielleicht sollte ich mir einfach etwas abseits der Gebäude eine Stelle suchen, um mein Zelt aufzubauen. Vielleicht kann ich jetzt schlafen.
Moment. Mein Zelt? Wo ist denn mein Rucksack geblieben? Ein heißer Schreck durchzuckt meinen Kopf. Meine Sachen!
Ich versuche mich zu erinnern, aber da ist nur Panik.
Erst nach etlichen Minuten kann ich mir so ungefähr die letzten Tage vorstellen, etwas deutlicher die letzten Stunden. Mein Rucksack?
Wann hab ich den zuletzt gehabt?
Der Zaun.
Wie der Zaun aufgetaucht ist aus dem Dunkeln. Da hab ich mich zu Boden sinken lassen. Und bin kurz eingenickt. Angelehnt an den Zaun. Im Rücken den Rucksack. Der war doch noch da?
Aber wie ich aufgestanden bin.
Der Schmerz. Der war da.
Der Rucksack. Der war weg. Hmm.
Wer hat mir meinen Rucksack weggenommen?
Eine kalte Gänsehaut kriecht den Rücken hinauf.
Diebe? Tiere? Monster?
Böse Gedanken vernebeln mein Hirn.
Mutlosigkeit und Ohnmacht.
Inzwischen ist es etwas heller um mich herum, und ein neues Geräusch ist zu hören, ein rhythmisches Stampfen.
Leise, fern, aber deutlich. Eine Maschine?
Weiter links eines der großen Gebäude.
Während ich näher komme, entsteht die Kontur eines Schiebetores vor meinen Augen auf der ansonsten eintönigen Fassade.
Groß genug, um einen LKW durchzulassen. Ob die Maschine dahinter werkelt?
Etwa einen Meter über dem Boden erkenne ich in dem großen Tor eine kleinere Klappe, und es gibt kleine Metallbügel darunter. Mir wird klar, das ist ein Eingang für Fußgänger.
Ohne viel nachzudenken versuche ich da hochzuklettern, was aber nicht eben einfach ist, kein Handlauf oder sonst welche Griffe zu sehen.
Aber ich schaffe es doch, auf dem obersten Bügel zu stehen, und halte mich an der versenkt angebrachten Klinke fest. Die rührt sich nicht. Wäre ja auch zu einfach gewesen.
Ich ziehe fester nach unten, dann schiebe ich nach oben, immer wilder rüttele ich an dem Eisenteil. Auf einmal rutsche ich ab und falle auf den Beton.
Alles tut mir weh, vor allem der Kopf.
Mühsam rappele ich mich auf, auch dieser Plan ist gescheitert, nochmal probiere ich das nicht.
Schmerzen und Müdigkeit.
Nach weiteren trostlosen Minuten schleppe ich mich um die Ecke.
Da quietscht es laut, und klappert und brummt, was ist nun wieder?
Lasst mich in Ruhe.
Ruhe und Tod.
Mit Gänsehaut am ganzen Rücken erkenne ich einen LKW, der mit schwachen Rücklichtern in die Dunkelheit rumpelt, um bald zu verschwinden. Nochmal das klappernde Kreischen, das ist wohl das große Tor. Wurde geschlossen.
Keine Chance. Ich bin zu langsam gewesen, sonst hätte ich während der Ausfahrt hineinschlüpfen können.
Müdigkeit und Erschöpfung.
Wenn ich nicht endlich schlafe, gehe ich kaputt.
Aber wohin legen? Sicher nicht bei der Leiche. Und in die großen Gebäude komme ich nicht rein.
Also auf dem Fabriksgelände unter freiem Himmel?
Ich suche eine geeignete Stelle, ohne Steine, ohne Metallteile, meine Ansprüche sind so gering wie nie.
Ich lasse mich zu Boden sinken, nicht nur meine Knie protestieren lautstark. Wie ich schon auf allen Vieren dahocke, sehe ich ein neues, kleines Licht in der Ferne. Es wird schnell größer. Zwei Lichter.
Ein Auto.
Und: es kommt genau auf mich zu.
Ich halte den Atem an. Werde ich jetzt überfahren?
Kurz vor mir beginnt das Auto zu schlingern, dann heftig zu bremsen.
Aus dem stehenden Fahrzeug springen mindestens fünf Leute, den lauten, übermütigen Stimmen nach Jugendliche. Zumindest ein Mädchen ist sicher dabei. Sehen kann ich nichts außer dem Scheinwerferlicht.
„Hey, das ist gar kein Hund!“
„Nein, sieht nach einem Landstreicher aus.“
„Wo der wohl herkommt?“
„Die kommen überall hin!“
„Gesindel. Früher haben die hier besser aufgepasst.“
„Das Personal wird saumäßig bezahlt.“
„Willst du die faulen Säcke noch verteidigen?“
„Wir könnten uns einen Spaß machen…“
„Wie in dem Film, wo sie den Alten als Zielscheibe benutzt haben?“
„Wir haben aber keine Pistolen.“
„Hier liegt genug rum, Schrott, fliegt sicher gut.“
Mir wird noch schlechter. Von denen ist nicht nur keine Hilfe zu erwarten. Eher bringen sie mich um und finden das noch lustig.
Aber vielleicht wäre es das beste. Wenn es nur schnell geht. Macht schon!
Doch die jungen Leute reden schon über was anderes, klettern in den Kleinbus zurück und brausen davon.
Ganz menschenleer ist es also nicht hier, aber was macht das für einen Unterschied.
Da fällt mir die Leiche wieder ein.
Noch einmal überkommt mich der Wille, hier abzuhauen. Nur weg.
Zwanzig unsichere Schritte in die Nacht. Und schon ist die Energie verbraucht.
Schmerzen und Übelkeit.
Ein anderes stampfendes Geräusch nähert sich. Schritte. Schwere Stiefelschritte.
Mein Herz sinkt noch ein Stück tiefer.
Bald erkenne ich die Konturen von zwei großen Kerlen, die auf mich zu kommen.
Ein Mann und ein Mann.
Finster und bedrohlich.
Ich spüre den Impuls wegzulaufen, aber nur ganz schwach, irgendwo hinten im Nacken oder noch dahinter. Wie wenn das gar nicht mein eigener Gedanke gewesen sei.
In Wirklichkeit bin ich unfähig zu irgendeiner Reaktion.
Die Typen entdecken mich, einer greift an seine Hüfte, sie erreichen mich, halten fünf Meter vor mir an. „Halt, stehenbleiben!“ bellt der eine.
„Wohin?“ fragt der andere.
Mein Kopf ist leer, mein Körper erstarrt.
Der erste fragt den zweiten: „Was machen wir mit dem?“
„Der kann wohl nicht sprechen, oder ist er Ausländer?“
„Hier lassen können wir ihn nicht.“
„Wir sollten wissen, wie er reingekommen ist. Nicht dass da noch mehr kommen.“
„Das wäre schlecht.“
„Die Chefin hat gesagt, …“
„Psst! Halt den Mund. Vielleicht versteht er uns ja doch.“
„Sollen wir ihn mitnehmen?“
„Bleibt uns wohl nichts anderes übrig.“
„Ich hole den Wagen.“
„Und ich soll mit dem allein bleiben? Nein, den nehmen wir zwischen uns. Ist sicherer.“
Zwischen die bulligen Kerle eingeklemmt, bleibt mir nichts anderes übrig als mitzugehen. Immerhin trampeln sie nicht zu schnell, und mir nicht auf die Füße. Einen Funken Dankbarkeit für diese kleinen Annehmlichkeiten, sonst spüre ich nichts als Schmerzen.
Nach ein paar Minuten kommen wir zu einem Schuppen, den ich bisher nicht entdeckt habe. Der erste Anflug von Morgendämmerung lässt die Trostlosigkeit dieses Ortes noch deutlicher werden.
Der eine Mann tritt mit dem Fuß gegen die Bretterwand, da öffnet sich eine Art Tür, aus groben Brettern angefertigt. Überhaupt sieht die Bude aus, als falle sie sehr bald zusammen. Drinnen ein Licht, darunter ein Tisch.
Am Tisch sitzt ein Mann, über Papiere gebeugt, einen Stift in der Hand.
„Verdammter Mist!“, höre ich ihn murmeln, „Zwölftausendfünfhundertachtzehn… nein siebzehn… so eine Kacke…“
„Wir haben den hier mitgebracht“, bringt mein linker Wächter vor.
„Sicherheitshalber.“ ergänzt etwas kleinlaut der rechte Wächter.
Ich sage nichts, der Mann am Tisch streicht etwas durch, flucht, und schreibt etwas.
So geht das eine Zeit, meine Wächter scheinen sich nicht zu trauen, ihn nochmal anzusprechen.
Endlich blickt er auf, zieht die Brauen zusammen, und fragt sarkastisch:
„Ach, sicherheitshalber. Ein übles Subjekt aufgegabelt und gleich ins Hauptquartier mitgebracht, zur Sicherheit. Euch werde ich lehren, die Sicherheit unserer Mission zu gefährden, ihr dämlichen Kretins!“
Mir kommt vor, meine beiden Kerle seien schlagartig ein paar Zentimeter geschrumpft.
Der Linke will sich verteidigen: „Aber, wir konnten ihn doch nicht…“ „Ruhe!“ Der Mann am Tisch wirft den Stift auf das Papier, fährt sich mit beiden Händen durch die Haare, lehnt sich zurück. Mit gefährlich leiser Stimme fährt er fort:
„Der Eindringling kommt in den Keller, Kammer 2B, unter dem Maschinenraum. Noch so einen Fehler, und ich melde euch bei der Chefin, oder noch besser, ich stecke euch gleich dazu, Zelle 2B, ha ha, ja, das wäre das Richtige für euch.“
Ich sehe ihm an, er meint es nicht so ernst, sondern macht sich einen Spaß draus, seine Leute zu verarschen.
Die aber lassen ihren Ärger an mir aus und zerren mich ohne Worte und sehr grob hinaus aus der Hütte. Hauptquartier? Von was eigentlich?
„So ein Arsch!“
„Hmm.“
„Dabei hat er vor der Chefin mehr Bammel als wir.“
„Hmm.“
„Und null Durchblick.“
„Kannst du mal die Klappe halten?“
„Okay okay.“
Und was er noch vor sich hin brummelt, kann ich nicht verstehen, sein Kompagnon sicher erst recht nicht.
Der Aufmüpfige und der Mürrische.
So nenne ich sie für mich.
Aufmüpfig und mürrisch.
Wir kommen zu einem der großen Gebäude. Neben einem riesigen Tor führt außen eine kleine Treppe mit rostigem Handlauf in den Keller hinunter. Der eine Kerl sperrt die eiserne Tür mit seinem großen Schlüsselbund auf. Drinnen ein niedriger, langer Gang.
Nach all den dunklen oder trübselig schwach beleuchteten Räumen bisher empfinde ich das Licht als grell und stechend.
Hell und blendend.
Wir erreichen ein Treppenhaus, und ich werde unsanft vorwärts geschoben, hinunter, noch ein Stockwerk tiefer unter die Erde.
Am nächsten Absatz nochmal tiefer. Endlich verlassen wir die Treppe, die hier noch nicht zu Ende ist.
Wir biegen in einen schmalen Gang ein, mit vielen Türen links und rechts. Wir müssen hintereinander gehen, der Aufmüpfige voraus, der Mürrische hinter mir.
Auf einmal reißt der Vordere links eine Tür auf und der andere schubst mich durch in einen winzigen Raum. Kaum fällt die Tür hinter mir ins Schloss, ist es absolut dunkel um mich her. Ein metallisches Schaben, das war wohl ein Riegel. Die Schritte entfernen sich schnell. Ich bin allein. Im Finsteren.
Die Kammer ist winzig, vorsichtig taste ich die Wände ab. Auf einer Seite ein Regal, und neben der Tür ein altmodischer Drehschalter. Ohne zu denken drehe ich ihn um, 90 Grad, und eine kleine Glühbirne gibt ein wenig Licht ab. Gegenüber, das sieht wie eine hohe Klappe aus, oder sollte das eine Schranktür sein? Ich finde keinen Griff oder irgendwas, was sich anfassen ließe.
Unten in dem Regal liegt ein kleines Kissen. Ich lasse mich nieder, lege meinen Kopf ins Kissen geschmiegt an die Wand, und möchte am liebsten sofort einschlafen. Aber zuerst laufen mir die Tränen.
Wieviel Unglück kann denn an einem Tag über einen hereinbrechen?
Aber dann muss ich doch eingeschlafen sein.
Als ich hochschrecke, kann ich mich an einen Traum erinnern. Von ihr hab ich geträumt, wie sie mit dem anderen Typen Arm in Arm weggegangen ist, und mir einen Kuss nachgeschickt hat, mit demselben süßen Lächeln wie in guten Zeiten, und mit einem Augenzwinkern, das ein baldiges Wiedersehen versprach. Falsche Schlange! Aber ich war ihr nicht mehr böse. Gar nicht, ganz im Gegenteil. Da fehlt nicht viel und ich verliebe mich aufs Neue in sie, denke ich, ich alter Trottel.
Mein Hals ist trocken, mein Mund ist noch trockener, die Lippen sind rissig. Kein Wasser hier.
Warum ist das Licht aus? Ob jemand hier drin war? Oder ob man das von außen abschalten kann, oder geht das gar automatisch aus? Letzteres wohl kaum, bei dem primitiven Drehschalter. Der Gedanke, jemand könnte hier eingedrungen sein, während ich geschlafen habe, macht mich unruhig. Das kleine Sicherheitsgefühl, dieser Anflug von Geborgenheit, in dieser winzigen Kammer, ist vergessen.
Nochmal suche ich alles um mich ab. Kann ich mich irgendwie befreien? Die paar Minuten Schlaf haben mir Mut gemacht, meine Sache selbst in die Hand zu nehmen.
Ich drehe am Schalter, zuerst instinktiv zurück, aber das geht nicht, also gleich herum wie zuerst.
Das Lichtchen geht an. Aha. Dann war wohl jemand drin.
Verzweiflung und Mut.
Neugier und Entdeckung.
Bei der dritten oder vierten Suche in der Kammer entdecke ich etwas, das ich zuerst übersehen habe bei dem trübseligen Funzellicht.
Im obersten Regalfach ganz hinten hineingezwängt findet sich eine schwarze, oder jedenfalls dunkle, Umhängetasche. Drinnen ein Päckchen Papiertaschentücher. Ein winziger Pappschuber mit vielleicht 20 Visitenkarten. Die lauten auf Nick Pavlos, Logistikmanager, NachschubCoop, EusiaTrans. Die Person, die Abteilung, die Firma: Sagt mir alles nichts. Dann gibt es noch einen kleinen Notizblock, ungebraucht, und ein paar Schreibstifte. Plötzlich hab ich ein eigenartiges Gefühl. Ob die Tasche für mich hier liegt? Soll ich mich als Nick ausgegeben? Aber nein, das kann nicht sein. Konnte doch niemand wissen, wie das alles ablaufen würde. Ich bin schließlich rein zufällig hier gelandet. Das kann niemand geplant, geschweige denn vorbereitet haben. Nein.
Und doch, mein Rucksack ist weggekommen. Die Tasche wäre eigentlich ganz praktisch. Ich kann sie mir zumindest mal ausborgen.
Diebstahl lehne ich zwar ab, aber andererseits, in meiner Situation kommt es darauf auch nicht mehr an. Ich werde die Tasche mitnehmen. Wer weiß, wo ich noch hingerate. Da könnte es sich als nützlich erweisen, wenn ich mal was einstecken kann.
Und weiter, alles absuchen, hab ich noch etwas übersehen?
Links, rechts, vorne, hinten. Nichts.
Hmm. Und der Boden? Ich bin schon 2 oder 3 Stockwerke unter der Erdoberfläche, noch tiefer muss nicht sein. Außer wenn es sein muss.
Ich entdecke aber nichts, keine Falltür, nicht den kleinsten Spalt.
Dann gibt es noch oben. Die Birne hängt an einem kurzen Draht, nicht in der Mitte, eher seitlich, dicht bei der Klappe oder was das ist, und leuchtet nur nach unten.
Die Decke kann ich nicht abtasten, dafür bin ich zu klein.
Aber. Ich kann ja am Regal hochklettern.
Es geht eher schlecht. Der rechte Fuß.
Aber ich komme hoch genug, ohne mir allzu weh zu tun, und habe noch die rechte Hand frei. Die Decke ist schwarz oder jedenfalls liegt sie im Schatten, aber beim Tasten erlebe ich eine Überraschung:
Sie ist voller Griffe, Hebel, Klinken oder was das alles ist. Ich hab irgendwann mal ein U-Boot von innen anschauen können, das war so ähnlich, jede Fläche voller Bedienelemente. Und wie damals habe ich hier keine Ahnung, wozu das alles gut sein soll.
Aber ich hab Zeit.
Gleich der zweite Schieber lässt sich bewegen, er ist über der Tür angebracht. Und es hört sich genau so an, wie als ich eingesperrt worden bin. Ein kurzes, metallisches Schaben.
Ob die Tür jetzt entriegelt ist? Ich springe auf den Boden, und handele mir einen stechenden Schmerz im Rücken und altbekannte Knieschmerzen ein, abgesehen vom schon lange lädierten Fuß.
Wichtiger: Die Tür lässt sich öffnen. Ich luge vorsichtig hinaus. Draußen ist es sehr hell, und es sind Schritte zu hören, von weit her, aber offensichtlich näher kommend. Schnell schließe ich die Tür, so leise ich kann.
Ich kann mich also befreien, aber ob das ratsam ist, sich auf eine Verfolgungsjagd in diesen Rattengängen einzulassen, besonders in meinem Zustand, das wage ich zu bezweifeln.
Hoffnung und Enttäuschung.
Nochmal zur Decke. Wenn der Schieber bei der Tür für diese zuständig ist, dann müsste diese mysteriöse Klappe doch eigentlich… Ich muss mich umdrehen um die Teile über der Klappe abtasten zu können. Kein Schieber, aber ein radförmiger Drehgriff.
Wieder muss ich an das U-Boot denken. Er lässt sich aber nicht drehen.
Mehrere kleine Schalter oder Hebel auf beiden Seiten. Ich probiere einige aus, jeder lässt sich bewegen, keiner scheint irgendwas zu bewirken.
Enttäuscht halte ich mich am Drehgriff fest.
Der gibt jetzt aber nach! Ob einer der Schiebeschalter ihn entriegelt hat?
Ich drehe das Rad ein Stück, nichts passiert. Ich drehe weiter. Bald eine ganze Umdrehung, kein Anschlag, keine Reaktion. Trotzdem drehe ich weiter.
Bei der dritten Umdrehung ein Geräusch. Tut sich was? Hab ich eine Bewegung gesehen oder mir nur eingebildet?
Langsam klettere ich hinunter, und schaue die Klappe an. Könnte sein, dass der Spalt größer geworden ist. Ich drücke auf die Klappe, sie rührt sich keinen Millimeter.
Frust und Hartnäckigkeit.
Nochmal hinauf und weiterdrehen, mindestens zehnmal rum, mir wird heiß.
Unten sehe ich, die Klappe hat sich eine Handbreit nach außen bewegt, lässt sich aber noch immer nicht mit der Hand wegdrücken oder zur Seite schieben.
Geräusche dringen keine durch den schwarzen Spalt.
Also nochmal.
Ich kurbele weiter. Bis ich etwas Neues höre, ein mehrfaches Klicken.
So schnell es mein Kreuz erlaubt, klettere ich zur Klappe.
Sie sieht kaum anders aus als vorher, der Spalt ist höchstens ein klein wenig größer geworden.
Aber nun lässt sich die ganze Klappe parallel zur Seite schieben.
Nach links zumindest. Plötzlich ist sie scheinbar verschwunden. Ich stehe vor einem schwarzen Loch.
Mit der Fußspitze ertaste ich einen versenkten Boden. Wohl zwanzig Zentimeter tiefer als drinnen in meiner Zelle. Soll ich mich trauen?
Etwas aufgeregt steige ich in das schwarze Loch hinunter. Meine neue Tasche, in die ich noch das winzige Kopfkissen geschoben habe, umgehängt.
Ich kann nichts sehen, alles schwarz, nur die Seite zu meiner Kammer ist halbwegs hell. Rundum wieder Wände, wie ich schnell bemerke, von einer Zelle in die nächste, vom Regen in die Traufe.
Ach ja.
Und doch. Neben dem Einstieg, im tiefen Schatten, fühle ich eine Reihe von 6 runden Tasten. Wie in einem…
Dann ist das ein Lift hier?
Und wenn ich eine der Tasten drücke, geht die Klappe zu, und ich fahre in ein anderes Stockwerk?
Wenn das so geht, warum haben die mich dann hierher gebracht? Soll ich etwa hier mit dem Aufzug in mein Verderben fahren? Oder soll ich frei kommen, damit sie keinen Ärger mehr mit mir haben? Oder ist das der Eignungstest für den neuen Agenten Nick? Allerlei Varianten schießen mir durch den Kopf, aber nichts davon hilft mir weiter.





























