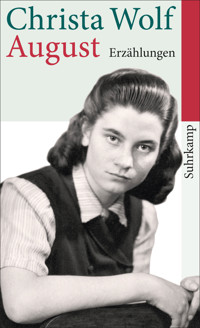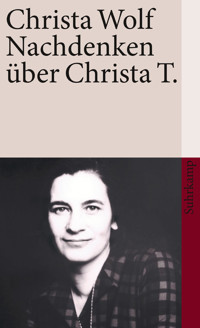
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nachdenken über Christa T. begründete den Weltruhm Christa Wolfs und gehört zu den wichtigsten Werken der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Mit nur 36 Jahren stirbt Christa T. an Leukämie. Ihre ehemalige Schulkameradin und Studienfreundin erinnert sich an sie: an eine Frau, die der Forderung nach Anpassung ihre Phantasie, ihr Gewissen und vor allem ihre Sehnsucht nach Selbstverwirklichung entgegensetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mit nur 36 Jahren stirbt Christa T. an Leukämie. Die Erzählerin dieses Romans, ihre ehemalige Schulkameradin und Studienfreundin, erinnert sich an sie, an ihre widersprüchliche Persönlichkeit und ihren schwierigen Lebensweg. Sensibel dafür, daß das Faktische und der utopische Anspruch des Sozialismus in der DDR nicht übereinstimmen, sucht Christa T. nach Wegen, das, was ist, und das, was werden soll, zusammenzubringen – und macht dabei die schmerzhafte Erfahrung, daß der Riß der Zeit durch sie selbst geht.
Nachdenken über Christa T. begründete den Weltruhm Christa Wolfs und gehört zu den modernen Klassikern der deutschsprachigen Literatur.
Christa Wolf, geboren am 18. März 1929 in Landsberg/Warthe (Gorzów Wielkopolski), starb am 1. Dezember 2011 in Berlin. Ihr Werk, das im Suhrkamp Verlag erscheint, wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Georg-Büchner-Preis und dem Deutschen Bücherpreis für ihr Gesamtwerk. Zuletzt veröffentlichte sie den Roman Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud (st 4275).
Christa Wolf
Nachdenken über Christa T.
Suhrkamp
Die Erstausgabe von Nachdenken über Christa T. erschien 1968 im Mitteldeutschen Verlag, Halle (Saale).
Der Text, der dem 1999 erschienenen Band 2 der von Sonja Hilzinger herausgegebenen Werke in zwölf Bänden folgt, wurde für diese Ausgabe neu durchgesehen und korrigiert.
Umschlagfoto: Lutfi Özkök
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2007
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag: Göllner, Michels, Zegarzewski
eISBN 978-3-518-74150-4
www.suhrkamp.de
Christa T. ist eine literarische Figur. Authentisch sind manche Zitate aus Tagebüchern, Skizzen und Briefen.
Zu äußerlicher Detailtreue sah ich mich nicht verpflichtet. Nebenpersonen und Situationen sind erfunden. Wirklich lebende Personen und wirkliche Ereignisse sind ihnen nur zufällig ähnlich.
C.W.
Was ist das:Dieses Zu-sich-selber-Kommen des Menschen?
Johannes R. Becher
Nachdenken, ihr nach – denken. Dem Versuch, man selbst zu sein. So steht es in ihren Tagebüchern, die uns geblieben sind, auf den losen Blättern der Manuskripte, die man aufgefunden hat, zwischen den Zeilen der Briefe, die ich kenne. Die mich gelehrt haben, daß ich meine Erinnerung an sie, Christa T., vergessen muß. Die Farbe der Erinnerung trügt.
So müssen wir sie verloren geben?
Denn ich fühle, sie schwindet. Auf ihrem Dorffriedhof liegt sie unter den beiden Sanddornsträuchern, tot neben Toten. Was hat sie da zu suchen? Ein Meter Erde über sich, dann der mecklenburgische Himmel, die Lerchenschreie im Frühjahr, Sommergewitter, Herbststürme, der Schnee. Sie schwindet. Kein Ohr mehr, Klagen zu hören, kein Auge, Tränen zu sehen, kein Mund, Vorwürfen zu erwidern. Klagen, Tränen, Vorwürfe bleiben nutzlos zurück. Endgültig abgewiesen, suchen wir Trost im Vergessen, das man Erinnerung nennt.
Vor dem Vergessen, beteuern wir aber doch, müsse man sie nicht schützen. Da beginnen die Ausreden: Vor dem Vergessenwerden, sollte es heißen. Denn sie selbst, natürlich, vergißt oder hat vergessen, sich, uns, Himmel und Erde, Regen und Schnee. Ich aber sehe sie noch. Schlimmer: Ich verfüge über sie. Ganz leicht kann ich sie herbeizitieren wie kaum einen Lebenden. Sie bewegt sich, wenn ich will. Mühelos läuft sie vor mir her, ja, das sind ihre langen Schritte, ja, das ist ihr schlenkriger Gang, und da ist, Beweis genug, auch der große rotweiße Ball, dem sie am Strand nachläuft. Was ich höre, ist keine Geisterstimme: Kein Zweifel, sie ist es, Christa T. Beschwörend, meinen Verdacht betäubend, nenne ich sogar ihren Namen und bin ihrer nun ganz sicher. Weiß aber die ganze Zeit: Ein Schattenfilm spult ab, einst durch das wirkliche Licht der Städte, Landschaften, Wohnräume belichtet. Verdächtig, verdächtig, was macht mir diese Angst?
Denn die Angst ist neu. Als sollte sie noch einmal sterben, oder als sollte ich etwas Wichtiges versäumen. Zum erstenmal fällt mir auf, daß sie sich seit Jahr und Tag in meinem Innern nicht verändert hat und daß da keine Veränderung mehr zu hoffen ist. Nichts auf der Welt und niemand wird ihr dunkles, fußliges Haar grau machen, wie das meine. Keine neuen Falten werden in ihren Augenwinkeln hervortreten. Sie, die Ältere, nun schon jünger. Fünfunddreißig, schrecklich jung.
Da weiß ich: Das ist der Abschied. Das Ding dreht sich noch, schnurrt dienstbeflissen, aber zu belichten ist da nichts mehr, mit einem Ruck springt das schartige Ende heraus, dreht mit, einmal, noch einmal, stoppt den Apparat, hängt herab, bewegt sich wenig in dem leichten Wind, der da immer geht.
Die Angst, ja doch.
Fast wäre sie wirklich gestorben. Aber sie soll bleiben. Dies ist der Augenblick, sie weiterzudenken, sie leben und altern zu lassen, wie es jedermann zukommt. Nachlässige Trauer und ungenaue Erinnerung und ungefähre Kenntnis haben sie zum Schwinden gebracht, das ist verständlich. Sich selbst überlassen, ging sie eben, das hat sie an sich gehabt. In letzter Minute besinnt man sich darauf, Arbeit an sie zu wenden.
Etwas von Zwang ist unleugbar dabei. Zwingen, wen? Sie? Und wozu? Zu bleiben? – Aber die Ausreden wollten wir hinter uns lassen.
Nein: daß sie sich zu erkennen gibt.
Und bloß nicht vorgeben, wir täten es ihretwegen. Ein für allemal: Sie braucht uns nicht. Halten wir also fest, es ist unseretwegen, denn es scheint, wir brauchen sie. In meinem letzten Brief an sie – ich wußte, es war der letzte, und ich hatte nicht gelernt, letzte Briefe zu schreiben – fiel mir nichts anderes ein, als ihr vorzuwerfen, daß sie gehen wollte, oder mußte. Ich suchte wohl ein Mittel gegen ihre Entfernung. Da hielt ich ihr jenen Augenblick vor, den ich immer für den Beginn unserer Bekanntschaft genommen habe. Für unsere erste Begegnung. Ob sie ihn bemerkt hat, diesen Augenblick, oder wann ich sonst in ihr Leben gekommen bin – ich weiß es nicht. Wir haben niemals darüber gesprochen.
1
Es war der Tag, an dem ich sie Trompete blasen sah. Da mag sie schon monatelang in unserer Klasse gewesen sein. Da kannte ich ihre langen Glieder und den schlenkrigen Gang und den kunstlosen, kurzen Haarschwanz in der Nackenspange schon auswendig, ebenso wie ihre dunkle, etwas rauhe Stimme und ihr leichtes Lispeln.
Das alles zum erstenmal gesehen und gehört am ersten Morgen, als sie bei uns erschien, anders möchte ich es nicht nennen. Sie saß in der letzten Bankreihe und zeigte keinen Eifer, mit uns bekannt zu werden. Eifer hat sie nie gezeigt. Sondern sie saß in ihrer Bank und sah genauso unsere Lehrerin an, uneifrig, eiferlos, wenn man sich darunter etwas vorstellen kann. Denn aufsässig war ihr Blick nicht. Doch mag er so gewirkt haben unter all den hingebenden Blicken, an die unsere Lehrerin uns gewöhnt hatte, weil sie, wie ich heute glaube, von nichts anderem lebte.
Nun, willkommen in unserer Gemeinschaft. Wie hieß denn die Neue? Sie erhob sich nicht. Sie nannte mit angerauhter Stimme, leicht lispelnd, ihren Namen: Christa T. War es möglich, hätte sie mit den Brauen gezuckt, als unsere Lehrerin sie duzte? In weniger als einer Minute würde sie in ihre Schranken gewiesen worden sein.
Wo kam sie denn her, die Neue? Ach, nicht aus dem bombardierten Ruhrgebiet, nicht aus dem zerstörten Berlin? Eichholz – du lieber Himmel! Bei Friedeberg. Zechow, Zantoch, Zanzin, Friedeberg, wir dreißig Einheimischen fuhren in Gedanken die Kleinbahnstrecke ab. Entrüstet, das versteht sich. Kraucht aus einem Dorfschullehrerhaus, keine fünfzig Kilometer von hier, und dann dieser Blick. Ja, wenn einer ein paar Dutzend rauchende Zechenschornsteine hinter sich hat, oder wenigstens den Schlesischen Bahnhof und den Kurfürstendamm ... Aber Kiefern und Ginster und Heidekraut, denselben Sommergeruch, den auch wir bis zum Überdruß und fürs Leben in der Nase hatten, breite Backenknochen und bräunliche Haut, und dieses Benehmen? Was sollte man davon halten?
Nichts. Nichts und gar nichts hielt ich davon, sondern ich sah gelangweilt aus dem Fenster, das sollte jeder merken, der von mir etwas wissen wollte. Ich sah, wie die Turnlehrerin mit den Fähnchenständern ihr ewiges Völkerballfeld markierte, das war mir immer noch lieber, als zuzusehen, wie diese Neue mit unserer Lehrerin umging. Wie sie die bei der Stange hielt. Wie sie aus dem Verhör, das in der Ordnung gewesen wäre, eine Unterhaltung machte und wie sie auch noch bestimmte, worüber man sprechen wollte. Ich glaubte meinen Ohren nicht zu trauen: über den Wald. Das Spiel da unten wurde angepfiffen, aber ich drehte den Kopf und starrte die Neue an, die kein Schulfach nennen wollte, das sie am liebsten hatte, weil sie am liebsten in den Wald ging. So hörte sich die Stimme der Lehrerin an, wenn sie nachgibt, das hatten wir noch nicht.
Verrat lag in der Luft. Aber wer verriet, wer wurde verraten?
Nun, die Klasse werde, was sie ja immer tue, die Neue, Christa T., die Waldschwärmerin, freundschaftlich in ihrer Mitte aufnehmen.
Ich zog die Mundwinkel herab: Nein. Nicht freundschaftlich. Überhaupt nicht aufnehmen. Links liegenlassen.
Schwer zu sagen, warum sie mir trotzdem Nachrichten über die Neue zutrugen. Na wenn schon, sagte ich nach jedem Satz, aber zuerst hatte ich den Satz gehört. Daß sie ein Jahr älter war als wir, denn sie kam von einer Mittelschule und mußte eine Klasse wiederholen. Daß sie in der Stadt »in Pension« wohne und nur übers Wochenende nach Hause fahre. Na wenn schon. Daß man sie zu Hause Krischan nenne. Krischan? Sieht ihr genau ähnlich: Krischan.
So habe ich sie dann meistens genannt.
Sie bewarb sich übrigens nicht um Aufnahme. Nicht um freundliche, nicht um widerwillige. Um gar keine. Wir interessierten sie nicht »übermäßig«, das Wort war gerade unter uns aufgekommen. Übermäßig höflich ist sie ja nicht, wie? Ich sah in die Luft und sagte: Na und? Verfluchter Hochmut von dieser Neuen. Die spinnt ja. Die Wahrheit war: Sie brauchte uns nicht. Sie kam und ging, mehr ließ sich über sie nicht sagen.
Da habe ich schon das meiste über sie gewußt. Und wenn nicht das meiste, so doch genug, wie sich dann zeigte.
Die Fliegeralarme wurden länger, die Fahnenappelle düsterer und schwächlicher, wir merkten nichts, und darüber wurde es wieder November. Ein grauer Tag jedenfalls, also wohl November. Ein Monat ohne die mindeste Weisheit, auch uns fiel nichts zu. Wir zogen in kleinen Rudeln durch die Stadt, die Entwarnung hatte uns überrascht, zu spät, um zur Schule zurück, zu früh, um schon nach Hause zu gehen. Schularbeiten kamen seit langem nicht in Frage, Sonne schien auch keine; was suchten wir bloß zwischen all den Soldaten und Kriegerwitwen und Luftwaffenhelfern? Und dann noch am Stadtpark, wo die Rehwiese eingezäunt war wie immer, aber Rehe gab es keine, und Schlittschuh laufen sollten wir hier auch nicht mehr.
Wer hatte das gesagt? Keiner. Was sahen wir uns denn so an?
Keine Ursache. Wer nie ausschläft, sieht Gespenster oder hört welche.
Blieb der Film am Nachmittag, »Die goldene Stadt«, nicht jugendfrei wie gewöhnlich. Da muß man die Sybille bitten, daß sie sich die Haare hochsteckt und Hackenschuhe von ihrer Mutter anzieht, daß sie sich ihre roten Lippen noch röter malt, damit sie zur Not aussieht wie achtzehn und wir alle hinter ihr an der Platzanweiserin vorbeikommen. Sie wollte gute Worte, wir gaben sie ihr, wir scharwenzelten um sie herum, aber auf Christa T., die Neue, die bei uns war, weil sie ebensogut bei uns sein konnte wie anderswo, auf sie achtete keiner.
Da fing sie zu blasen an, oder zu rufen, es gibt das richtige Wort dafür nicht. Daran hab ich sie erinnert oder erinnern wollen in meinem letzten Brief, aber sie las keine Briefe mehr, sie starb. Lang ist sie ja immer gewesen, auch dünn, bis auf die letzten Jahre, nach den Kindern. So ging sie vor uns her, stakste erhobenen Hauptes auf der Rinnsteinkante entlang, hielt sich plötzlich eine zusammengedrehte Zeitung vor den Mund und stieß ihren Ruf aus: Hooohaahooo, so ungefähr. Sie blies ihre Trompete, und die Feldwebel und Unteroffiziere vom Wehrbezirkskommando hatten gerade Pause und sahen sich kopfschüttelnd nach ihr um. Na, die aber auch, hat der Mensch Töne? Da siehst du nun, wie sie sein kann, sagte eine zu mir.
Da sah ich’s nun. Grinste dazu wie alle, wußte aber, daß ich nicht grinsen sollte. Denn anders als alle erlebte ich diese Szene nicht zum erstenmal. Ich suchte, wann sie schon einmal so vor mir hergegangen sein konnte, und fand, daß es kein Vorbild für diesen Vorgang gab. Ich hatte es einfach gewußt. Nicht, daß ich mit der Trompete gerechnet hätte, da müßte ich lügen. Aber was man nicht weiß, kann man nicht sehen, das ist bekannt, und ich sah sie. Sehe sie bis heute, aber heute erst recht. Kann auch besser abschätzen, wie lange es dauert und was es kostet, dieses dümmliche Grinsen endlich aus dem Gesicht zu kriegen, kann lächeln über meine Ungeduld von damals. Nie, ach niemals wieder wollte ich so am Rand eines Stadtparks stehen, vor der eingezäunten Rehwiese, an einem sonnenlosen Tag, und den Ruf stieß ein anderer aus, der das alles wegwischte und für einen Sekundenbruchteil den Himmel anhob. Ich fühlte, wie er auf meine Schultern zurückfiel.
Wie bringt man sie dazu, sich nach mir umzudrehen? Das war die Frage. Friedeberg. Ich interessierte mich ja für die Gegend um Friedeberg. Für ein Dorf mit Namen Eichholz. Für ein Dorfschullehrerhaus mit tief herabgezogenem bemoostem Dach ... Das alles kenne ich so wenig wie damals. Wenn wir Ausflüge machten, sind wir kaum über Beyersdorf und Altensorge hinausgekommen, oder zweimal die zwei Stunden Fahrt nach Berlin, Zoologischer Garten. Da stand das Schloß noch; dann ließen wir es lieber sein, so weit wegzufahren, wer hätte auch das Herz dazu gehabt, mitten im Krieg! Christa T. fuhr übrigens trotzdem, im Sommer vierundvierzig, mit einer Freundin, auf die ich eifersüchtig war und die ihr abends im Musikzimmer ihrer verlassenen Berliner Wohnung Beethoven vorgespielt hat, bei Kerzenlicht, bis der Alarm kam. Da löschten sie die Kerzen und stellten sich ans Fenster. Nein, man konnte ihre Art nicht billigen, es drauf ankommen zu lassen, auf ein Unglück, auf einen Tod, auf eine Freundschaft. Und das Schloß konnte sie zu jener Zeit sowieso nicht mehr sehen, die Ruine vielleicht noch, das grüne Kupferdach. Mehr habe ich allerdings auch nicht davon im Gedächtnis.
Ich gebe nicht vor, mich zu erinnern, was sie mir damals erzählt haben mag. Bloß daß die Wälder in der Friedeberger Gegend dunkler sein müssen als anderswo und daß es mehr Vögel gab, offenbar. Oder daß es mehr werden, wenn man jeden einzelnen mit Namen kennt, was weiß ich. Das wäre aber auch alles.
Was sie mich wissen ließ, auf ausdrückliches Befragen, ich habe es vergessen. Nach ihrem Tod erst hat sie Antwort gegeben, wider Erwarten gründlich haben mich ihre Papiere belehrt, über die Gewißheiten und Ungewißheiten ihrer Kindheit. Auch darüber, daß es nicht schaden kann, bestimmter Erscheinungen, der wichtigsten vielleicht, als Kind ein für allemal gewiß zu werden. So daß, wenn man aus diesem Land weggeht, siebzehnjährig zum Beispiel, vieles schon gesehen ist, und für immer. Womit man ja rechnen muß, wenn man nur noch einmal so lange zu leben hat.
Nichts davon damals zu mir.
Immerhin, sie ließ mich einiges wissen. Sie erteilte Auskünfte, jedermann konnte sehen, wer die Fragen stellte und wer die Antworten gab. Wir weckten schon Neid, wir galten schon als tabu, da hatten wir noch kein vertrauliches Wort gesprochen. Schnell und achtlos hatte ich alle anderen Fäden zerrissen, ich fühlte auf einmal mit Schrecken, daß es böse endet, wenn man alle Schreie frühzeitig in sich erstickt, ich hatte keine Zeit mehr zu verlieren. Ich wollte an einem Leben teilhaben, das solche Rufe hervorbrachte, hooohaahoo, und das ihr bekannt sein mußte. Ich sah sie mit anderen gehen, freundlich reden, wie sie mit mir ging, redete. Ich fühlte die kostbaren Wochen mir durch die Finger rinnen, fühlte meine Ohnmacht zunehmen, mußte es erzwingen, machte alles falsch. Ich fragte sie – erst heute begreife ich meine Ungeschicklichkeit – : Kannst du dir denken, fragte ich, wer ausgerechnet der Metz, der Mathematiklehrerin, die Blumen aufs Pult gelegt hat? Nein, log sie gleichmütig, wie soll ich das wissen? Denn unter uns galt als ausgemacht, die Metz war makaber, wahrhaftig, das war das Wort. Ihr war nicht beizukommen, wer legte so einer Blumen aufs Pult? Jetzt weiß ich, daß sie es war, Christa T., und daß sie mich belog, weil sie keinen Grund sah, es mir zuzugeben. Die Metz nämlich, schrieb sie Jahre später in ihr Tagebuch, sei die einzige gewesen, die sie nicht unfrei und unglücklich machte. – Wie töricht dieser Stich nach all der Zeit.
Die Zwischenträger ließ ich nun abfahren; warum merkten sie nicht, daß sie zu spät kamen mit ihrem Tratsch? Ich genierte mich nicht, zu ihr hinüberzusehen, ob sie es auch bemerkt habe. Sie hatte verstanden, sie antwortete mit einem dunklen spöttischen Blick, daß sie keinen Anlaß sehe, darüber aus dem Häuschen zu geraten. Sie lehnte an der Balustrade der Galerie, wo wir uns umzogen, und blickte auf die Turnhalle hinunter, auf den Spruch an der gegenüberliegenden Wand: Frisch – Fromm – Froh – Frei. Sie zog ihre weiße Bluse an, sie band das schwarze Dreiecktuch um und schob den Lederknoten hoch wie wir alle, denn auf den Führer war ein Anschlag verübt worden, und zum Zeichen unserer unverbrüchlichen Treue zu ihm trugen wir die Uniform. Ich glaubte sie nun zu kennen, ich rief sie sogar an, und sie antwortete gelassen, aber was sie eben gedacht oder gesehen hatte, wußte ich nicht. Mich brannte mein Unvermögen, ihr zu erklären, warum ich es um jeden Preis erfahren mußte.
Ich fing an, Vorleistungen anzubieten. Einmal, als unsere Lehrerin vorbeigegangen war, mit ihrer klingenden Stimme unseren Gruß erwidert und uns gleichzeitig von Kopf bis Fuß gemustert hatte, so daß man sich jedesmal fragte, was vielleicht Falsches immer noch an einem sein könnte – da brachte ich fertig zu fragen: Du kannst sie nicht leiden? Jetzt war ja klar, wer hier verriet und wen und um wessentwillen. Christa T. sah sich nach unserer Lehrerin um, ich auch. Da war ihr Gang nicht mehr ausgreifend, sondern selbstgerecht, und die hoch in die Waden hinauf gestopften Strümpfe waren häßlich gestopfte Strümpfe und nicht das stolze Opfer einer deutschen Frau im textilarmen fünften Kriegsjahr. Ich blickte erschrocken Christa T. an, als sei es an ihr, das Urteil zu sprechen. Sie ist berechnend, sagte sie im Ton einer Feststellung. – Das wollte ich am liebsten nicht gehört haben, aber ich fühlte, sie sah die Dinge, wie sie waren. Sie hatte recht. Sie kam von Gott weiß woher, denn Eichholz kann jeder sagen, lief ihre Figuren auf unserem viereckigen Schulhof, die auf schwer bestimmbare Weise von den unseren abzuweichen schienen, ging unsere paar Straßen ab, die alle auf dem Marktplatz endeten, setzte sich auf den Rand des Brunnens, der den Namen unserer Lehrerin trug, denn die stammte aus einer der einflußreichsten Familien der Stadt – hielt ihre Hand in das Wasser und sah sich mit ihrem gründlichen Blick um. Und ich mußte auf einmal denken, daß dieses Wasser da vielleicht doch nicht das Wasser des Lebens war und die Marienkirche nicht das erhabenste Bauwerk und unsere Stadt nicht die einzige Stadt der Welt.
Dieser Wirkungen, das weiß ich, war sie sich nicht bewußt. Ich habe sie später durch andere Städte gehen sehen, mit dem gleichen Gang, mit dem gleichen verwunderten Blick. Immer schien es, als habe sie auf sich genommen, überall zu Hause und überall fremd zu sein, zu Hause und fremd in der gleichen Sekunde, und als werde ihr von Mal zu Mal klarer, wofür sie zahlte und womit.
Dabei lieferte sie Beweise, daß es ihr nicht ganz und gar zuwider war, sich in Abhängigkeit zu begeben, wenn nur sie es sein konnte, die wählte. Unbefangen, spöttisch und voller Selbstironie sprach sie mir als Zeichen ihres Vertrauens von dem jungen Lehrer, der, schwer verwundet und vom Heeresdienst befreit, ihrem Vater als Hilfe beigegeben war. Wie er Orgel spielt, sagte sie, und ich hatte mir vorzustellen, wie sie Sonnabend nachmittags im Kirchenschiff saß und er für sie spielte; denn daß sie seinetwegen am Sonntag zum Gottesdienst ging, war nicht wahrscheinlich. Sie sah meinen ungeschickten Gedanken zu und lächelte tiefer, als mir keine Antwort einfiel, beklommen vor Blödigkeit, wie ich war, da sie mir also auch »darin« voraus war und mich für kindisch halten mußte. Sie solle sich bloß vorsehen, brachte ich schließlich heraus, als verstünde ich das mindeste von den Angelegenheiten, die ihr schon so nahe gerückt waren. Wir lehnten an der Schulmauer, sie drückte bucklig in unsere Schultern, unsere Taschen standen neben uns, und mit den Fußspitzen malten wir Kreise in den Kies. Krischan, sagte ich, ohne sie anzusehen, schreib mal, Krischan, ja? – Die Weihnachtsferien begannen.
Warum nicht? sagte sie. Mal sehn. Vielleicht.
Dünner, kalter Schnee begann zu fallen. Wir blieben länger da stehen, als wir etwas zu sagen wußten, und wenn ich malen könnte, würde ich jene lange Mauer hierhersetzen und uns beide, sehr klein, an sie gelehnt, und hinter uns die große, neue viereckige Hermann-Göring-Schule, roter Stein, leicht verschleiert von dem sacht fallenden Schnee. Das kalte Licht würde ich nicht beschreiben müssen, und die Beklemmung, die ich spürte, würde ohne weiteres von dem Bild ausgehen. Denn für jedermann sichtbar wäre der Himmel über uns glanzlos und leer, und das konnte, ob wir es wahrhaben wollten oder nicht, nie ohne Folgen bleiben. Auch würde man ahnen, daß man sich schnell verlieren kann unter solchem Himmel, in diesem Licht. Und daß uns kurz bevorstand, uns verlorenzugehen: einander und jeder sich selbst. So daß man ungerührt »ich« sagt zu einem Fremden, die Unbefangenheit bewahrt, bis zu einem Augenblick, da dieses fremde Ich zu mir zurückkehren und wieder in mich eingehen wird. Mit einem Schlag wird man befangen sein, das läßt sich voraussagen. Vielleicht ist man darauf aus und darauf angewiesen, diesen Augenblick zu wiederholen. Vielleicht hat es Sinn, daß sie, Christa T., Krischan, noch einmal dabei ist.
Es schneite stärker, Wind kam auf. Wir gingen auseinander. Ich schrieb ihr noch, denn ihr siebzehnter Geburtstag fiel in diese Ferien. Ich trug ihr unverhohlen meine Freundschaft an. Ich wartete auf nichts als auf ihre Antwort, während meine Stadt, die unverrückbar festzustehen hatte, sollte sie mir bleiben, was sie war, schon von den Wellen der Flüchtlinge und der Uniformierten, die auch flüchteten, hochgehoben wurde wie ein Schiff von der Flut und unaufhaltsam abtrieb. Ich sah das alles treiben und wußte nicht, was ich sah. Ich wartete auf einen Brief. Er kam nach Neujahr mit dem letzten Postauto aus dem Osten, und ich trug ihn dann lange mit mir herum, viele Kilometer, bis ich natürlich auch ihn verlor. Dieses Pfand hatte ich immerhin, obwohl er, genaugenommen, keine Versprechungen enthielt, keine Versicherung, nur ein paar vertraulichere Dankesworte und einen suchenden, tastenden Bericht über diesen jungen Lehrer. Ich habe ihn nie gesehen, auch ist er nicht wieder zwischen uns aufgetaucht, jetzt zweifle ich schon, daß es ihn gab. Damals aber hat mir Hoffnung gemacht, daß sie von ihm sprach.
Den ganzen Januar über, während die Namen der Ortschaften immer bekannter wurden, die uns die Flüchtlinge von der Straße zuriefen, war mir die Hoffnung wirklicher als immer die gleichen Gesichter der Menschen, die vorbeizogen. Bis eines Tages eine müde Stimme aus dem Zug »Friedeberg« rief. Da war die Hoffnung mit einem Schlag überwunden. Ich gehörte zu diesen Leuten da. Ich probierte schon ihren Ausdruck, da hatten wir noch fünf Tage Zeit. Dann einen, dann gar keinen Tag mehr. Dann war ich einer von ihnen und vergaß in wenigen Stunden, daß man mit Grauen und Mitleid aus festen Häusern auf Vorüberziehende blicken kann.
Christa T. vergaß ich nicht. Es war mir leid um sie, wie einem um ein unwiederholbares, unerfülltes Versprechen leid ist. Darum gab ich sie mit einem einzigen schmerzhaften Ruck ganz und gar verloren, wie alles, was dahinten blieb. Dreh dich nicht um, dreh dich nicht um, wer sich umdreht oder lacht ...
Aber wir lachten nicht, beileibe nicht. Eher warfen wir uns in den nächsten Straßengraben und weinten, das war wenigstens etwas. Die Geschichte von unserem verlorenen und nach Jahren wiedergefundenen Lachen ist eine andere Geschichte.
2
Oder auch nicht. Merkwürdig, wie alle Geschichten aus dieser Zeit sich von selbst zu ihr, zu Christa T., in Bezug bringen. Wer hätte das zu ihren Lebzeiten gedacht? Oder braucht man nur darauf zu bestehen, daß ihre Lebenszeit weitergeht bis auf den heutigen Tag, um den Bezug auf alles zu haben, was Geschichte wird oder unförmig bleibt, Material?
Sie hat, was man nur vermuten konnte, die äußerste Abneigung gegen das Ungeformte gehabt. Das ist das Zeichen, wenn es überhaupt eins gibt. Hat, als es wahrhaftig darum ging, mit leichtem Gepäck davonzukommen, doch ein Büchlein bei sich behalten, das nun in meine Hände gefallen ist, lose Blätter nur noch, in blaue Blümchenseide eingebunden, und auf dem Deckel steht in kindlicher Krakelschrift: Ich möchte gerne dichten und liebe auch Geschichten.
Die Zehnjährige, im Ton einer Feststellung. Dichten, dicht machen, die Sprache hilft. Was denn dicht machen und wogegen? Hat sie es denn nötig gehabt inmitten ihrer Gewißheiten? Inmitten ihres festen Hauses, inmitten des Dorfes, über das die Jungen ein Segelflugzeug kreisen ließen, und auf die Tragflächen hatten sie in großen schwarzen Buchstaben ihren Namen gemalt? Inmitten der dunklen Wälder, Kiefern übrigens, hochstämmig wie überall in unserer Gegend, oder das, was man Busch nennt. Der Himmel heiterer, weißere Schönwetterwolken als irgendwo: auch das setzen wir stillschweigend unter die Gewißheiten. Und Erwin natürlich, den Schmiedejungen, dessen gußeiserner Ring in einem Geheimfach des Tagebuchs ruht, wovon er nichts zu wissen braucht. So wie man selbst nicht ahnt, daß Großvater, der von Löwenjagden erzählt wie kein zweiter, niemals in Afrika gewesen ist; aber ein Mann, der mit Bienen umgehen kann wie er – was sollte dem unmöglich sein?
»Ein Kanadier, der Europens übertünchte Höflichkeit nicht kannte«, das war sein Lieblingsvers, und daran sieht man, was für ein Mann er war. Im Gegensatz zum Vater, dem Dorfschullehrer T., der Ölbilder malt und in alten Kirchenbüchern die Geschichte des Dorfes auskundschaftet, zum Mißvergnügen schließlich des Rittmeisters, dem das Gut gehört und der nicht ruhig zusieht, wie seine Familie schlecht abschneidet in den Aufzeichnungen des Dorfschulmeisters, dieses kränklichen Mannes, der nicht zum Militärdienst taugt, aber seine jüngere Tochter, diesen halben Bengel mit dem Jungennamen, mit den Dorfgören zusammen in den gutseigenen Wald nach Pilzen schickt, ohne Sammelschein, versteht sich, und in den Gutsgarten auf die Apfelbäume, so daß der Vogt die ganze Bande mit »Steinelesen« auf den Äckern des Herrn Rittmeisters bestrafen muß.
Sternkind – kein Herrnkind. Wer mag ihr das gesagt haben? Später hat sie es aufgeschrieben, kommentarlos unter die Gewißheiten gesetzt, sie wußte: Es stimmte; aber es wäre ungehörig gewesen, ein Wort darüber zu verlieren.
Die Angst vor dem Vogt ist unwiderlegbar, stillschweigend ist anerkannt: kein Herrnkind. Dunkel unter Dunklen stehen, wenn Feuer abgebrannt werden. Schwarzrotgoldene Fahnen brennen, da ist man fünf Jahre, und die Schwester, wenig älter, kommt mit schreckensbleichem Gesicht und zerrt einen nach Hause, man geht mit und erwartet das Schlimmste, aber da sind nur im Wohnzimmer die Scheiben kaputt, es zieht, und niemand hat Licht gemacht, das soll plötzlich gefährlich sein. Da möchte man am liebsten die Großen aufklären, daß jedermann natürlich so schnell wie möglich ausreißt, wenn er den Mut gefaßt hat, irgendwo die Scheiben einzuschlagen. Doch man hört, der Melker vom Gut sei es gewesen, ein Erwachsener, und »Soziknecht« habe er dann gerufen, und nicht geflohen sei er, weil er mutig war durch seine neue Uniform.
So behält man die brennenden Fahnen, nicht wegen der Flammen, denn auf dem Dorf brennt schnell mal was, sondern wegen der Gesichter. Steht dann, mit fünfzehn, wieder unter den anderen, am Parktor diesmal, und die Feuer sind Fackeln, und in ihrem flackernden Licht treten die festlich gekleideten Gutsbewohner mit ihren Gästen aus dem Portal, der frischgebackene Ritterkreuzträger mitten unter ihnen. Da ist man froh, daß man in der zweiten Reihe steht, dunkel unter Dunklen, daß der junge Herr Leutnant niemanden erkennen könnte, auch wenn er es wollte. Aber wie soll der noch wollen können? Wie soll der sich noch nach Krischan umdrehen, Krischan in ihren kurzen Hosen und der Windbluse, Krischan als einziges Mädchen in der Jungenshorde, Krischan, den anderen Langhaarigen stolz entgegentretend: Mäkens spellen nich mit! Krischan bei den Todessprüngen vom Dachfirst auf das Faß, Krischan als alter Türke auf dem Kostümfest, Krischan, die mit auf Treibjagd geht, die mit ihrem Ewigtrampler mitten im Dorf in den Filmstab von »Das war mein Leben« rollt – rollt und rollt, denn sie kann nicht bremsen. Platzt in die Szene, da der Raddatz für Hansi Knotek mit einem gezielten Wurf einen Apfel vom Baum zu holen hat, und den Jungen, der mit einer Mütze voll Äpfel in der Krone sitzt, den sieht man nicht; es war aber Jochen, der junge Herr Leutnant, Ritterkreuzträger Jochen, und er fiel vor Lachen vom Baum.
Sternkind. Was ja nicht heißen muß: Glückskind, Sonntagskind. Nicht jeder Stern strahlt hell und beständig. Von schwierigen Sternen hat man gehört, von wechselndem Licht, schwindend, wiederkehrend, nicht immer sichtbar. Worauf es auch nicht ankommt. Und worauf käme es an?
Mit den letzten Fahrzeugen, im engen Fahrerhäuschen eines Munitionsautos, fuhr sie im Januar fünfundvierzig nach Westen. Schlimmer als die wirklichen Ereignisse war, daß nichts, nicht einmal das Grauen selbst, einen noch überraschen konnte. Unter dieser Sonne nichts Neues mehr, nur das Ende, solange es dauert. Dazu die Gewißheit: so mußte es kommen. So muß ein Dorfgasthof aussehen, wenn die Menschheit sich verschworen hat, aus unwissender Angst in ihm zusammenzuströmen. Blasse Frauen, übermüdete Kinder und Soldaten bei ihrem Alltagsgeschäft der Flucht. Die Müdigkeit, die nicht nur von sechs durchwachten Nächten kommt; was das wichtigste war, fällt einem aus der Hand, man bemerkt es nicht. Hockt sich auf den Boden; glücklich, wer ein Stück Wand hat, an das er sich lehnen kann. Christa T., um die Verzweiflung abzuwehren, zieht ein Kind auf ihren Schoß. Da beginnt das Radio über ihr zu dröhnen: Noch einmal, auch in der Hölle noch, diese fanatische, sich überschlagende Stimme, Treue, Treue dem Führer bis in den Tod. Sie aber, Christa T., noch ehe sie den Mann verstanden hat, fühlt sich kalt werden. Ihr Körper hat, wie auch sonst, eher begriffen als ihr Kopf, dem nun allerdings die schwere Aufgabe des Nacharbeitens bleibt, den Schreck aufzuarbeiten, der ihr in den Gliedern sitzt: Das ist es also gewesen, und so hat es enden müssen. Die hier sitzen, sind Verfluchte, und ich mit ihnen. Nur daß ich nicht mehr aufstehen kann, wenn das Lied nun kommt: Da ist es. Ich bleibe sitzen. Ich drücke das Kind fest an mich. Wie heißt du? Anneliese, ein schöner Name. Über alles in der Welt ... Ich hebe den Arm nicht mehr. Ich habe das Kind, kleiner, warmer Atem. Ich singe nicht mehr mit. Wie die Mädchen singen, die auf der Theke gesessen, wie sogar die Soldaten, die rauchend und fluchend an den Wänden gelehnt haben, noch einmal gestrafft stehen, geradegerückt durch das Lied, o eure geraden Rücken, wie sollen wir wieder hochkommen?
Fertigmachen, rief der Beifahrer, sie hatten ihren Wagen wieder flott, Christa T. sprang auf und quetschte sich neben ihn, da fing die Nacht erst an, der Schneesturm auch. Schon vor dem übernächsten Dorf bleiben sie stecken, da half kein Schaufeln, Hilfe mußte herbei; Sie, Fräulein, bleiben am besten hier sitzen. Sie sagte nichts, alles, was ihr zustieß, war zu genau eingepaßt in den Alptraum. Nun war sie wohl für immer in die andere Welt geraten, die dunkle, die ihr ja seit je nicht unbekannt war – woher sonst ihr Hang, zu dichten, dicht zu machen die schöne, helle, feste Welt, die ihr Teil sein sollte? Die Hände, beide Hände auf die Risse pressen, durch die es doch immer wieder einströmt, kalt und dunkel ...
Wie bin ich zu bedauern, ich armes, armes Kind, sitz hinter festen Mauern, und draußen geht der Wind ... Zehn Jahre alt, ausgeschlossen aus der Gesellschaft der anderen wegen Ungezogenheit, da ist das Büchlein, mit Blümchenseide bezogen. Da ist der Trost entdeckt: in den geschriebenen Zeilen. Das Staunen vergißt man nicht mehr, auch nicht die Erleichterung.
Nachts wird sie wach, da sind der Pächter und seine Frau immer noch da, nun haben sie getrunken, und das Grammophon spielt. Ich tanze mit dir in den Himmel hinein. Sie tanzen auch, hinter der Glastür bewegen sich ihre Schatten, erstarren plötzlich. Kreischen. Da hat die Frau Pächter auf den Kater getreten, unseren guten schwarzen Kater, der ist sanft und alt, nun aber faucht er die Frau Pächter an, sie hat gekreischt, dann wird es still. Ahnungsvoll springt man ans Fenster, der