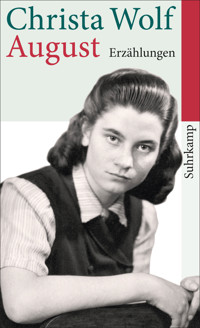11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1973 erklärte Christa Wolf, dass für sie kein grundsätzlicher Unterschied bestehe zwischen ihrer Prosa und ihrer Essayistik, denn deren gemeinsame Wurzel sei »Erfahrung, die zu bewältigen ist: Erfahrung mit dem ›Leben‹, mit mir selbst, mit dem Schreiben, das ein wichtiger Teil meines Lebens ist, mit anderer Literatur und Kunst. Prosa und Essay sind unterschiedliche Instrumente, um unterschiedlichem Material beizukommen«. Das sind auch die Themen ihrer Essays und Reden, die in der chronologischen Reihenfolge ihres Entstehens in dieser Ausgabe versammelt sind. Christa Wolf bezieht als kritische Zeitgenossin Position, setzt sich mit poetologischen Reflexionen über ihr Selbstverständnis als Autorin auseinander und nähert sich über wesentliche Berührungspunkte Gefährt:innen und Kolleg:innen an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Titel
Christa Wolf
Sämtliche Essays und Reden
Band 2: 1981-1990 Wider den Schlaf der Vernunft
Herausgegeben von Sonja Hilzinger
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Preisverleihung. Günter de Bruyn
Berliner Begegnung
Lieber Heinrich Böll. Zum 65. Geburtstag
Haager Treffen
Kleists »Penthesilea«
Frankfurter Poetik-Vorlesungen
Erste Vorlesung. Ein Reisebericht über das zufällige Auftauchen und die allmähliche Verfertigung einer Gestalt
Zweite Vorlesung. Fortgesetzter Reisebericht über die Verfolgung einer Spur
Dritte Vorlesung. Ein Arbeitstagebuch über den Stoff, aus dem das Leben und die Träume sind
Vierte Vorlesung. Ein Brief über Eindeutigkeit und Mehrdeutigkeit, Bestimmtheit und Unbestimmtheit; über sehr alte Zustände und neue Seh-Raster; über Objektivität
Fünfte Vorlesung. Kassandra. Arbeitsfassung der Erzählung
Kassandra
Netzwerk
Zeitschichten
Rede auf Schiller
Irritation
Franz Fühmann. Trauerrede
Struktur von Erinnerung. Elisabeth Reichart: Februarschatten
Krankheit und Liebesentzug. Fragen an die psychosomatische Medizin
Warum schreiben Sie?
Wiener Rede
Erinnerung an Friedrich Schlotterbeck
Der weiße Kreis
Transit: Ortschaften
Für Erich Fried zum 65. Geburtstag
Ein Modell von der anderen Art
Zum 80. Geburtstag von Hans Mayer
Prioritäten setzen
Laudatio für Thomas Brasch
Dankrede für den Geschwister-Scholl-Preis
Zwei Plädoyers
I
. Brief an den Kongreß des Schriftstellerverbandes der
DDR
in Berlin im November 1987
2. Rede auf der Bezirksversammlung der Berliner Schriftsteller im März 1988
»Nach Kräften gegen das Unrecht«. Nachruf auf Erich Fried
Überlegungen zum 1. September 1939. Rede in der Akademie der Künste, Berlin
»Das haben wir nicht gelernt«
»Wider den Schlaf der Vernunft«. Rede in der Erlöserkirche
Sprache der Wende. Rede auf dem Alexanderplatz
Einspruch. Rede vor dem Schriftstellerverband
»Es tut weh zu wissen«
Für unser Land
Zwischenrede. Rede zu Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Hildesheim
Nachtrag zu einem Herbst
Heine, die Zensur und wir
»Der Mensch ist in zwei Formen ausgebildet«. Zum Tod von Irmtraud Morgner
Rummelplatz 11. Plenum. Erinnerungsbericht
Dankrede
Ein Deutscher auf Widerruf. Rede für Hans Mayer
An Konrad Wolf erinnern
1. Zum Gedächtnis
2. Ein Bericht
Anhang
Nachwort
Editorische Notiz
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Preisverleihung
Günter de Bruyn
»Gestatten Sie mir, meine Damen und Herren, und gestatte vor allem du mir, lieber« Günter, »meine Ausführungen mit einem Zitat zu beginnen. Es lautet: Wem geben wir Einsen: den Nachbetern oder den Selbstdenkern, den Gleichgültigen oder den Aufrichtigen, den Braven oder den Schöpferischen?
Und wer kriegt die Preise?«
Wer es, wie der Autor, den ich vom ersten Wort an zitiert habe – mit Ausnahme des Vornamens, versteht sich, der lautet bei ihm »Paul« –, riskiert, einen seiner Romane »Preisverleihung« zu nennen, hat Boshaftes, mindestens Maliziöses zu gewärtigen, nun, da er sich selbst einer Preisverleihungsprozedur unterwerfen muß. Doch muß ich nicht boshafter werden, als er selbst es war. »Es gibt so viele Literaturpreise, daß im Laufe der Zeit jeder bedacht werden kann«, las ich schadenfroh und nahm mir vor, hier anzumerken, daß es nicht den Autor, sondern die Institution beschämen muß, wenn ein Preis, wie nach meiner Ansicht dieser hier, reichlich spät an den gerät, dem er lange schon gebührt. »Und überall werden Lobreden gehalten«, las ich weiter, »und kein Redner macht sich soviel Sorgen« – hier stock ich doch – »wie er«. Dr. Teo Overbeck nämlich, der die Preisrede für seinen Freund Paul Schuster zu halten hat und in dessen Haut ich nicht schlüpfen kann: Nicht nur, weil ich mich einem Geschlechtertausch mit allen Mitteln widersetzen würde, und nicht etwa, weil Günter de Bruyn nicht mein Freund wäre: er ist es, aber eben nicht über den Zeitabgrund von siebzehn Jahren hinweg und nicht nur, hoffe ich, in dem von ihm scharfzüngig beschriebenen Sinn, daß man Freunde suche, »deren Wesen und Wissen einem nicht ständiger Vorwurf ist, sondern Bestätigung« – denn gerade das Wissen dieses Freundes ist mir ständiger Vorwurf und Anlaß zu neidvollem Vergleich, und ein Teil seines Wesens auch: Fleiß, Disziplin, Beharrlichkeit, Gründlichkeit, Genauigkeit, Zurückhaltung. Doch bei Preußen sind wir noch nicht, sondern immer noch bei dem Germanisten Teo Overbeck, in dessen Haut ich doch nicht so weit hineinschlüpfen kann, wie ich es, einiger Pointen wegen, gewünscht hätte. Schon daß ich es nicht fertigbrächte, mit zwei verschiedenen Schuhen und einer unausgearbeiteten Rede hier zu erscheinen, trennt uns, und doch sind diese Äußerlichkeiten nur Symptome dafür, daß dieser Laudator sich in die Klemme manövriert hat: Er mußte entdecken, daß er das preisgekrönte Buch nicht ehrlichen Herzens loben kann. Da bin ich in entgegengesetzter Lage; paradoxerweise muß ich, zumindest für diesen konkreten Fall, befestigen, was Günter de Bruyns gesellschaftskritisch angelegter Roman gerade in Frage stellt: die Institution einer solchen Preisverleihung. Darüber ließe sich reden, finde ich, doch nicht heute.
Heute nehme ich diesen Teo Overbeck als das, was er doch hoffentlich ist: eine literarische Figur. Eine von denen – wie übrigens auch sein Mit- und Gegenspieler, der Schriftsteller Paul Schuster –, in denen der Autor sich selber prüft, ohne je in die heroische, auch nicht in die tapfer-tüchtig-unerschrockene, die moralisch wünschbare Variante zu verfallen. Teo Overbeck hat ja diesen Autor, den er nun nicht mehr rühmen will, einst selber mit »gemacht«, aber eben auch verdorben, indem er seinem Erstlingsbuch ganz nach dem damals gültigen Maßstab die Individualität austrieb (»Ich wußte, was in der Literatur richtig und falsch, aber nicht, was sie selbst ist«). Er ist klüger geworden, der Autor aber ist auf der Strecke geblieben – so verschlungen laufen, wenn kein Eiferer, sondern ein maßvoller Beobachter ihnen nachgeht, die Wege gesellschaftlicher, auch die persönlicher Moral, wer wollte da richten?
Über den »autobiographischen Kern künstlerischer Literatur«. Ohne erwarten zu können, daß Sie mir glauben werden, versichere ich, daß sich, nach der neuerlichen Lektüre einiger Bücher dieses Autors, auch meine Notizen auf eben dieses Thema konzentriert haben, welches der verwirrte Overbeck ins Zentrum seiner verunglückenden Laudatio stellt: »Jeder Autor beutet sein Ich literarisch aus – sein Rang aber bestimmt sich unter anderem dadurch, wieviel auszubeuten da ist.«
Und dadurch, was da ist, erlaube ich mir hinzuzufügen. Welche Qualitäten freigesetzt werden, wenn ein Autor sich selber heran- und unter die Lupe nimmt. Nüchternheit, zum Beispiel, auch bei dieser schärfsten Probe, Skepsis manchmal, Selbstkenntnis und Selbstironie, die, das bekenne ich gerne, den Umgang mit diesem Autor nicht nur, auch den mit seinen keineswegs harmlosen Büchern ersprießlich, provozierend und produktiv machen. Dem psychologischen Detail entspricht das topographisch-historische, die suggestive Wirkung der Fakten, eine Freude, die de Bruyn sich selber macht, und seine Art von Höflichkeit gegenüber dem Leser. Wenn er etwas verabscheut, ist es Geschwafel, sind es allgemein formulierte Bekenntnisse, doch sind alle seine Bücher ein Bekenntnis zum Konkreten, zu der greifbaren, sinnlich wahrnehmbaren Wirklichkeit. Liebe zum genau beobachteten, durch Studium genau gekannten Detail also, zu bestimmten Städten, Stadtvierteln, Straßen; zu einer bestimmten Landschaft und ihrer Geschichte, zu einem bestimmten Menschenschlag, einer bestimmten Flora und Fauna. Und, alles in allem, zu einer bestimmten, nämlich unaufwendigen, aber auch unbeirrbar humanen Weise, auf dieser Welt zu sein.
Nicht also durch starke, blendende Scheinwerfer, die ein aufgestelltes Ich als übergroßen Schatten an eine sonst leere Wand werfen, wird diese Prosa beleuchtet. Sie empfängt ihr Licht aus einer Vielzahl von Quellen, die, jede für sich, nicht viel von sich hermachen, alle zusammen aber jenen Schein hinter den Arbeiten dieses Autors erzeugen, an dem man sie erkennt. Ein Licht, wie es – falls solche Übertragung erlaubt ist – auf märkischen Kiefernwäldern und auf märkischem Sandboden liegen kann; denn die Mark ist es ja, von der Günter de Bruyn in immer neuen Varianten sprechen, auch schwärmen kann, es ist, noch genauer gesagt, die Gegend um die Oberspree und um die Landstädte Beeskow und Storkow, es ist die Stadt Berlin, genauer gesagt, Berlin-Mitte. Dort ist er geboren und aufgewachsen, da lebt er heute, zu Hause in mehr als einem Sinn, und er kann nicht anders, als dieses Gebunden- und Verhaftetsein, diese immer noch wachsende Faszination und Bezauberung auch literarisch auszudrücken und so seiner literarischen Provinz reichlich heimzuzahlen, was er ihr entnimmt: nicht achtend, nicht allzusehr achtend, glaub ich, ob diese Treue und Bindung – eine Art »Freiheitsberaubung« ja auch (einer seiner Titel) – auf Verständnis, gar auf den gehörigen Respekt stoßen. Nicht daß er unempfindlich wäre. Doch nimmt er seine Würde aus der Sache, die ihn besetzt hält. Denn die Besessenheit, mit welcher der Amateur-Forscher Ernst Pötsch, die bisher letzte Verwandlungsfigur de Bruyns, seine märkischen Forschungen betreibt, die besitzt der Autor selbst in hohem Maße, und die Versuchung, sich in dieser Entdeckerlust, in Akten- und Quellenstudium, in penibelster, durch Lokaltermine erworbener Detailkenntnis zu verlieren, mag auch an ihn herangetreten sein, doch bannt er sie (und da benötigt er die Fiktion, die Erfindung eben doch), indem er sich durch einen Kunstgriff Distanz verschafft: Ganz wenig nur, um einige Grade, verrückt und verschiebt er die Figur des dörflichen Schwedenow-Forschers ins Provinzielle, Skurrile, Abseitige, zuletzt Abwegige – und hat ein Neben-, kein Ebenbild geschaffen, immer noch gut als positive Kontrastfigur zu dem karrierelüsternen, seine Forschungsergebnisse manipulierenden Berliner Professor, aber doch auch selbst ein kleines bißchen belächelnswert –, bis ganz am Ende sein Schicksal noch einen tragischen Zug bekommt. Die Frage nach den Verhältnissen, die den autoritären, berechnenden Professor Menzel nach oben tragen und den an den Rand gedrückten braven Pötsch verrückt machen – die muß der Leser sich selber stellen.
Das Zeitgenössische – de Bruyn hat es immer mit dem Persönlichen zusammen genannt, er hat (nach seinem ersten Buch, dem er später die Legitimierung entzieht) nie versucht, eine Zeitgenossenschaft nach Vorbild oder gar Vorschrift herzustellen, rückhaltlos hat er – und das mag manchmal irritiert haben – »nur« das gegeben, was er verantworten konnte, nämlich sich selbst. Denn – mag es Nebensonnen geben, die sein Werk erleuchten – die zentrale Sonne ist doch das Ich-Interesse, das ich mit dem Beiwort »scheu« charakterisieren möchte, damit auf die Spannungen in Leben und Werk, zwischen Leben und Werk eines derart angelegten Autors hinweisend. Daß »von sich aus«, »über sich« schreiben immer etwas mit Selbstentblößung, also Überwindung der Schamschwelle, selbst Schamlosigkeit zu tun hat – auch dazu hat er sich geäußert. Aber ein Schreib-Prozeß wird eben nicht authentisch durch die Anlässe und Materialien, derer er sich bedient, die er aufgreift und mit sich führt – die können zufällig sein, angenommen, anempfunden: authentisch ist das Werk, das eine Fixierung, eine Leidenschaft hervorgetrieben hat, eine persönlichste Erschütterung.
Dies bringt mich darauf, von dem Geflecht zu sprechen, das – entstehend aus einer Reihe wiederkehrender Motive und deren Verknüpfung untereinander und mit den Figuren – alles, was de Bruyn geschrieben hat, durchdringt. Manchmal wird das zentrale Motiv ganz rein und unverschlüsselt angeschlagen: »Wenn einer Provinz sagte oder Mark Brandenburg oder Preußen, fühlte er sich gemeint, nach seiner Herkunft befragt, sagte er immer: aus der Berliner Gegend.« So über Karl Erp in »Buridans Esel«, der Bibliothekar ist, wie de Bruyn es war (nebenbei: ein Einblick in diesen Schriftstellerhaushalt, der nichts umkommen läßt, schon gar nicht einen Fundus, wie die genaue Kenntnis eines Berufes es ist); der zwar nicht, wie sein Autor, in der Auguststraße wohnt, sondern in einer gehobenen Siedlung an der Oberspree, doch das Fräulein Broder in der Auguststraße findet, dem Autor also Gelegenheit gibt, diese Straße zu verewigen, sogar eines ihrer Häuser, und dazu noch eine kleine Berlin-Chronik anzubringen. Selbstverständlich, dieses Buch handelt von einer Liebe, an der dieser Karl Erp – auch wieder alles andere als eine Idealgestalt – doch ein bißchen enttäuschend versagt. Mindestens beim zweiten Lesen aber »handelt« es noch von einer anderen, weiter zurückliegenden Verletzung dieses nicht ganz glücklichen Liebhabers. »Die Kindheit: das Muttermal, das mit den Jahren größer wird« – nach einer Fahrt Karl Erps in sein Kindheitsdorf zu Fräulein Broder gesagt, die, »ganz neue Zeit«, nichts »von den Gefühls- und Erkenntnisschichten« begreift, »die sich manchmal nur überlagern, aber nicht überall durchdringen«. Ein zeitgemäßer Mangel, das kann man wohl sagen, eine generationsbedingte Not, die einer, der es genau nimmt, nicht wegdrücken kann wie die meisten; an der so einer, ohne auch davon viel Aufhebens zu machen, schon leiden kann; eine Versehrung, die er nicht zu verleugnen, sondern der er durch eine fast fieberhafte Suche nach seiner, unserer Herkunft im engen, weiteren, weitesten Sinn beizukommen sucht; dabei abstößt, was dieser persönlichsten, aber geschichtlich bedingten Not nicht angemessen ist, und, immer sicherer, selbstbewußter werdend, an sich zieht, was er brauchen kann, mit ihr zu leben, mit ihr fertig zu werden. Auch Bücher natürlich, literarische Ahnherren, die in diesen Sog der Selbstfindung geraten, oft nennt de Bruyn Thomas Mann, Theodor Fontane (»Immer wieder Fontane«) und, endlich fällt der wichtigste Name: Jean Paul.
Zwar habe ich versucht zu zeigen, daß Günter de Bruyn sich in allen seinen Büchern Geschichte vergegenwärtigt, Gegenwart als Geschichte erlebt, doch ist das Zentralwerk, um dessentwillen ein Preis in Feuchtwangers Namen so besonders genau zu ihm paßt, zweifellos sein Buch über Jean Paul Friedrich Richter, und ich müßte dieses Buch hier vorlesen, wollte ich erschöpfend über das Verhältnis de Bruyns zu eben diesem großen Romanschreiber Auskunft geben, der ihm keine Ruhe ließ, bis er über ihn geschrieben hatte. Lange schon hat ihn dieser Mensch gereizt, in seinen früheren Büchern finden sich Verweise auf Buchtitel Jean Pauls, resignierte Bemerkungen: Aber wer kennt ihn schon? (Das Geflecht!) Blieb de Bruyn bis dahin – wäre ich er, würde ich den geheimen Motiven auch dieses Kunstgriffs noch nachspüren – als Autor und als Person – doch wie das trennen! – über seinen Figuren, nahm ihn jetzt einer in die Pflicht, dem er sich als gleichrangig erweisen mußte. Der Glücksfall also einer Idealfigur, alles andre natürlich als ideal, aber so komplex, widersprüchlich, ausschweifend, daß der Autor, sich ihr nähernd, bewundern, verehren, sich identifizieren kann (das exzessive Lesevergnügen, das dieser unbändige Verfasser ungebändigter Prosa seinem Biographen bereitet hat!); daß er andere Züge, Skurrilitäten, Marotten, verstehen, analysieren, erklären, den ganzen Mann und seine Zeitumstände jedenfalls von Grund auf darstellen muß: das Schreibvergnügen nun also auch, das de Bruyn am meisten liebt, nämlich: schreiben aufgrund genauer Recherchen, dabei die Freiheit genießen, Charaktere zu erschaffen. Da wäre es denn ein Wunder, wenn er, de Bruyn, sich in diesem Buch irgend etwas entgehen ließe, was sein Thema oder den Mann, der sein Thema ist, berührt. Seien es die Aufklärung oder die Werther-Mode, die Schulmeistermisere und das Hofmeisterelend der Intellektuellen, sei es, natürlich, das ständige Gerangel mit der Zensur in den deutschen Ländern und der Nachweis ihrer ständigen Wirkungslosigkeit. Menschenhandel. Kleiderordnung.
Die Lage der deutschen Autoren gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Verlagsgepflogenheiten. Verlegerlaunen. Wechselnde Schicksale ganzer Länder während der Napoleonischen Kriege. Freiheitsdichtung (oder was damals so hieß). Freundschaftskult und Liebessitten: Wir werden informiert, sachlich, knapp oder ausführlich, genüßlich, ironisch, satirisch, auch aufgebracht. Hier wird Geschichte aufgearbeitet, Herkunft, unter Stichwörtern und in einem Geist, die denen etwas sagen, die heute leben und lesen. Das ist ja kein zahmes Buch, es arbeitet mit Anzüglichkeiten, Spitzen, allen möglichen Arten von Verweisen auf unsere Zeit und unsere Zustände. Sein doppelter Zeitbezug macht es lebendig, sein Autor hat seinen ganzen Apparat in Bewegung gesetzt. Berührt aber wird der Leser, wurde ich, am stärksten durch den Ton der Seelenverwandtschaft, durch jene Verbindung von Sachlichkeit und Einfühlung, bis in den Stil hinein (nein: durch ihn), die dem Autor de Bruyn, glaube ich, vorschwebt, wenn er »Prosa« sagt. Denn nach allem soll man nicht erwarten, hier ginge ein Autor im anderen auf, es bliebe etwa kein Bruch, es gebe keine Abstoßung, selbst Abgrenzung. »Was dieses Leben«, schreibt de Bruyn, »so faszinierend und, bei aller Rationalität, auch unheimlich macht, ist, daß er immer genau weiß, was er will.« »Unheimlich« – ein Wort, das man hier nicht erwartet hätte, es signalisiert Gefahren und Gefährdungen, die Doppelbödigkeit des scheinbar Eindeutigen, ein Erschrecken auch vor der nicht ganz geheuren Problematik von Leben und Kunst, vor der Kälte, die den bedroht, »dem alles Erleben sich in Stoff für seine Arbeit umformt«, vor der »Zerstörung des Gefühls durch seine Vorwegnahme im Intellekt«.
Wenn die Jean-Paul-Biographie de Bruyns die allgemeine Problematik einer progressiven kleinbürgerlichen Existenz im Deutschland nach der Französischen Revolution behandelt, so ist sie, mindestens im gleichen Maß, auch ein Essay über diffizilste, letzten Endes moralische Fragen der Kunst und dessen, der ihr verfallen ist. (»Er kann nicht anders; nur schreibend realisiert sich sein Leben.«)
Denn ihre Moral ist es, die alle Figuren de Bruyns mit ihrer Zeit verbindet, nicht grundlos hat man ihn einen Moralisten genannt – wenn dieses Wort nur nicht im Kopf des deutschen Lesers sogleich die Vision eines erhobenen Zeigefingers erstehen ließe. Doch ein Moralprediger, ein Besserwisser, Spaß- und Spielverderber ist dieser Autor eben gerade nicht, sondern von alledem das genaue Gegenteil. Er kennt die Menschen und kann sie nicht in »kleine« und »große« Leute aufteilen; er weiß, auch von sich selbst, daß ihre Stärken die Kehrseiten ihrer Schwächen sind, und umgekehrt. Er ist, als Autor, gerecht zu ihnen, ohne jemals selbstgerecht zu sein, er nimmt sie und sich, wo immer es angeht, mit Humor. So zögere ich nicht, ihn freundlich zu nennen; ja – diesmal paßt das so selten zutreffende Wort: menschenfreundlich.
September 1981
Berliner Begegnung
Liebe Kollegen, beinahe wäre es mir lieber gewesen, ich wäre nicht mehr drangekommen; dann wäre noch deutlicher geworden, als es so schon ist, daß es sich bei dem Thema, über das wir sprechen, um eine Männerangelegenheit handelt: Das ist meine Überzeugung.
Im Laufe dieses letzten Jahres habe ich einmal – ich glaube, es war im April – eines jener Erlebnisse gehabt, die man selten im Leben hat und die man nicht vergißt: Das war angesichts einer Fernsehnachrichtensendung. Der Sprecher oder die Sprecherin referierte, daß eine Expertenkonferenz – ich glaube, sie tagte in London – zu dem Ergebnis gekommen war, Europa habe noch eine Überlebenszeit von drei oder vier Jahren – für den Fall, daß die jetzige Politik weitergeführt würde.
Da hatte ich eine Minute, in der das geschah, was in drei oder vier Jahren geschehen soll.
Ich muß sagen, daß diese Minute nicht nur negativ in mir gewirkt hat – lähmend –, sondern sie hat auch sehr viel Zorn freigesetzt und Freiheit. Wenn es so ist oder so sein soll, wenn manche es sich wünschen oder es jedenfalls planen, daß dieses Europa zugrunde geht, dann darf man sich ja wohl noch einiges herausnehmen; zumindest fragen. Zum Beispiel frage ich – nicht erst seitdem, aber besonders seitdem: Was eigentlich – wenn Überleben von Verdiensten abhängt, was ja natürlich nicht der Fall ist; aber da wir Intellektuelle sind, in bestimmten ethischen Begriffen erzogen, kommen uns eben auch solche Fragen –, was eigentlich hat diese Kultur gegeben, daß sie zu überleben verdient.
Es ist mir einiges eingefallen. Ich war über mich selbst ein wenig erstaunt: Bisher hatte ich eher dazu geneigt, die mörderischen, expansionistischen, andere Völker und Erdteile unterdrückenden und ausraubenden Züge in der Geschichte des Abendlandes zu betonen. Ich stelle diese Frage hier, im positiven Sinn, daß Ihnen auch einiges einfallen möge. Ich glaube nämlich, das gehört zur Friedensvorbereitung und zur Kriegsverhinderung. Ich glaube, diese neue Durcharbeitung unserer Kultur gehört zu unseren Aufgaben als Schriftsteller.
Ein Satz war mir in dieser Minute auch eingefallen – wiederum eine Frage –, den ich seitdem nicht mehr aus meinem Kopf herauskriege, der mich sehr stört und den ich nicht ohne Bedenken weitergebe: Hat Hitler uns eingeholt? – Dieser Satz kam mir spontan, dann erst fragte ich mich, wie mein Kopf, mein Unbewußtes ihn gemeint haben mochten. Gemeint war er wohl so: Hitler hat es nicht geschafft, Europa zu vernichten, wonach es ihn ungeheuer verlangte, wie wir wissen; wenn er schon die Tür hinter sich zuschlug, dann sollte das mit einem solchen Krach geschehen, daß ganz Europa davon zusammenstürzen sollte. Dies hat er nicht geschafft, auf Grund von historischen Bedingungen, auf Grund der Leistungen von Armeen, die wir kennen.
Nun ist eine historische Lage eingetreten, die diese selbe Frage wieder auf die Tagesordnung setzt, und ich muß sagen, neben dieser großen Freiheit, die sich mir da auftat, machen eine ungeheure Beklemmung und ein schweres Gefühl von Verantwortung mir zu schaffen.
Daraus ergibt sich meine nächste Frage, die für mich weitreichend geworden ist, die ich hier nur andeuten kann: Sollten wir nicht, angesichts der »Lage«, in der wir uns nun befinden, ernsthaft beginnen – mehr, als wir es bis jetzt tun, mehr, als es auch durch diese Tagung angefangen wurde –, zu denken und für möglich zu halten, was eigentlich nicht geht? Ich bin nämlich der Meinung, uns kann nur noch helfen und retten, was eigentlich nicht geht. Was für möglich zu halten wir uns abgewöhnen ließen.
Beispielsweise muß ich mich dazu bekennen: Hätte Hermlin mich gefragt, als er diese Tagung in seinem Kopf herumtrug, ob ich es für möglich halte, daß sie zustande kommt – ich hätte gesagt: Nein, ich halte das nicht für möglich. Sie ist aber zustande gekommen. Ich finde sie sehr wichtig, mit allem, was gesagt wurde, sehr wichtig, und in ähnlicher Weise stelle ich mir vor weiterzugehen.
Mehr noch als die Frage, die ich vorhin zitierte, plagt mich eine Überlegung, von der ich mich nur langsam und widerstrebend, inzwischen aber so fest überzeugt habe, daß es sehr schwerfallen würde, mir das Gegenteil zu beweisen: Diese Raketen, diese Bomben sind keine Zufallsprodukte dieser Zivilisation. Eine Zivilisation, die imstande war, derartig exakt ihren eigenen Untergang zu planen und sich, unter solch furchtbaren Opfern, die Instrumente dafür zu beschaffen – eine solche Zivilisation ist krank, wahrscheinlich geisteskrank, vielleicht todkrank. Diese Raketen, diese Bomben sind ja entstanden als genauester und deutlichster Ausdruck des Entfremdungssyndroms der Industriegesellschaften, die mit ihrem »Schneller, Besser, Mehr« alle anderen Werte diesem »Wert« Effektivität untergeordnet haben, die Massen von Menschen in ein entwirklichtes Scheinleben hineingezwungen und die besonders die Naturwissenschaften in den Dienst genommen haben. Ihre »Wahrheiten«, das heißt: Fakten, als die Wahrheit anerkennen, bedeutet: Was nicht meßbar, wägbar und verifizierbar ist, das ist so gut wie nicht vorhanden. Es zählt nicht, so wie überall, wo das »Wirkliche« und Wichtige entworfen, hergestellt und geplant wird, Frauen nicht zählten und nicht zählen. Man muß sich doch einmal vorstellen, wie es sich auswirken muß, wenn die Hälfte der Menschen, die in einer Kultur lebt, von Natur aus überhaupt keinen Anteil hat an ihren Hervorbringungen; und eben auch daran nicht – hindernd –, wenn diese Kultur ihren eignen Untergang plant. Vielleicht sollte man einmal nicht nur mit einem Lächeln darüber hinweggehen, nicht nur abwehren, was eine Frau da wieder mal vorzubringen hat in bezug auf Wirksamkeit oder Unwirksamkeit ihres Geschlechts. Dieses Wegdrängen des weiblichen Faktors in der Kultur hat genau in dem Zeitraum begonnen, über den Helmut Sakowski eben sprach: als die minoische Hochkultur durch die mykenischen Expansoren überlagert, vernichtet wurde. Homer hat diese Kämpfe Hunderte Jahre später in seinem berühmten Epos verherrlicht: Kampfbeschreibungen sind die ersten Beschreibungen der abendländischen Literatur, Schlachtenschilderungen, Beschreibung von Schlachtgeräten: der Schild des Achill. Daran, ist mir klargeworden, kann ich nicht anknüpfen. Das kann meine Tradition nicht sein. Es ist kein Hymnus denkbar auf die Schönheit der Atomrakete. Auch unsere Ästhetik muß neu durchdacht werden.
Eine letzte Bemerkung. Das Wort: »Im Krieg schweigen die Musen« – gilt es etwa schon? Ich habe den Eindruck, daß unsere Gesellschaft, daß wir zu leicht bereit sind, uns in einen Vor-Krieg hineinzubegeben: Darüber bin ich am meisten betroffen, davor möchte ich am meisten warnen.
Was die Kunst seit Hölderlin, Goethe und Büchner behauptet hat, dann wieder, mit Nachdruck, in diesem Jahrhundert; wofür die Künstler mißverstanden, verhöhnt, ihre Bücher verboten und verbrannt wurden und werden, wofür sie vertrieben, eingesperrt, gefoltert und umgebracht wurden und werden, das hat sich leider bestätigt: Das Absurde ist die Wahrheit, das Phantastische ist realistisch, und das Denken des »gesunden Menschenverstands« ist wahnwitzig. Angesichts solcher Tatsachen und Zustände muß ich mich weigern, in meine Arbeit das Kalkül eines Atomkriegs hineinzunehmen. Ich kann nur arbeiten für diese Zeit, die nicht Kriegszeit ist, und für die Zeit »danach«, in der, hoffentlich, die Abrüstung zunächst beginnt, dann durch Verträge gesichert ist. Ich hoffe, es noch zu erleben, daß dann eine Zeit ohne Waffen kommt, in der der bleierne Druck, der auf uns liegt, weicht. Ich denke, für diese Zeit muß die Literatur heute schon arbeiten, so phantastisch und utopisch es erscheint: Das mit schaffen helfen, was, nach den Definitionen von Wissenschaft und Politik, überhaupt nicht »wahr« ist oder nicht einmal vorhanden, nämlich nicht »effektiv«: all das, dessen andauernde Abwesenheit eben jene Todesverzweiflung hervorgebracht hat, an der die »zivilisierte« Menschheit leidet und die sie dazu treiben könnte, sich in den Tod zu stürzen: Freundlichkeit, Anmut, Duft, Klang, Würde, Poesie; Vertrauen, auch Spontaneität – das eigentlich Menschliche. Das, was am ehesten verfliegt, wenn eine Vorkriegsatmosphäre sich breitmacht. Dagegen, finde ich, müssen wir anschreiben – auf Hoffnung hin, wie Bobrowski sagte.
Auf die Frage, die junge Leute mir oft stellen, wie man leben soll in einer solchen Zeit, kann ich nur sagen, wie ich es versuche: ignorieren, was alles nicht »wahr« sein soll, und es in seinem persönlichen Leben wahr zu machen suchen. Und als Autor: so schreiben, daß die Gesellschaft, in der man lebt, den größten Nutzen davon hat. Das bedeutet: kritisch. Die Gesellschaft durch Kritik auf das aufmerksam machen, was ihr helfen könnte, zu leben und zu überleben. Davon kann ich mich auf keinen Fall abhalten lassen.
Dezember 1981
Lieber Heinrich Böll
Zum 65. Geburtstag
Einmal, vor Jahren, zeigte mir ein gemeinsamer Freund in einem Ihrer Briefe einen Halbsatz, der sich auf einen Dritten bezog; er lautete: »… vom Ruhm bedroht wie wir alle …« Meine Reaktion auf Ihre wie beiläufige Aussage machte mir klar, daß ich Sie nicht als »vom Ruhm bedroht« sah, und daran hat sich seitdem nichts geändert. Ich hätte nie gedacht, daß ich Ihnen das einmal sagen würde, denn zu Ihrem nicht vom Ruhm-Gefährdetsein gehört es gerade, daß Ihr Gesicht solche Bekenntnisse einfach nicht entgegennimmt; darum höre ich damit auf und frage lieber mich, nicht Sie, wie Sie es fertigbringen, als Instanz, die Sie glücklicherweise sind (übrigens auch für mich), nicht Schaden zu nehmen. Ich erinnere mich an Seiten in Ihren Büchern, an Auftritte im Fernsehen, an polemische Artikel und sanfte Artikel, in denen Sie sich ungeschützt zeigten, wütend, verletzt, traurig, entsetzt, angstvoll, dankbar und liebevoll: dies ist nicht der Weg der Instanzen. Ist eine Instanz lustig, ironisch, selbstironisch, listig? Mutig? Und noch dazu scheint Ihnen gar nichts anderes übrigzubleiben, als dem Bedürfnis so vieler nach einem Menschen, der »zuständig« ist, zu genügen und es gleichzeitig, »mit der andern Hand«, zu ignorieren.
Wenn man die Wörter zurückverfolgt – was Sie tun; die Wörter beim Wort zu nehmen ist ein Teil Ihrer Arbeit –, dann kommt man ja an den Punkt, an dem sie lebendig waren. Und so finden wir ja denn »instare«, »auf etwas bestehen«, als Quelle für das eingetrocknete »Instanz«, und das ist ja ein höchst lebendiger Vorgang – gewiß kein einfacher, konflikt- und schmerzloser –: auf sich zu bestehen und dieses »Sich« in aller Bescheidenheit groß zu nehmen. Sie haben es sich selbst zugeschrieben, und Sie schreiben es sich immer weiter zu, daß wir auf Sie hören.
Von vielen Ihrer Bücher weiß ich den Ort, an dem ich sie las: ein Garten, ein Krankenhauszimmer, Hotelzimmer, ein Zugabteil. Nichts, was Sie geschrieben haben, hat mich kalt gelassen, ungeachtet, welchen literarischen Rang es in Ihrem Werk einnimmt. Die Rheinländer kannte ich, ehe ich sie »in Wirklichkeit« kennenlernte, durch Sie. Durch Sie die Lehre, daß man Abstrakta wie Güte, Gewissen, Hoffnung genauso konkret nehmen und beschreiben kann und soll wie ein Haus, eine Landschaft, eine Familie. Und daß Güte, Gewissen, Hoffnung politische Tugenden sein können. Daß es doch menschenmöglich ist, in einer Person private, literarische, politische Tugenden zu vereinen, zu einer widersprüchlichen Einheit, die ich »Lauterkeit« nenne.
Lieber, verehrter Heinrich Böll, ich nutze den Anlaß Ihres Geburtstages schamlos aus, um Ihnen einmal zu sagen: Ich bin froh, daß es Sie gibt.
Mai 1982
Haager Treffen
Ausgehend von der Beobachtung, daß seit der Berliner Begegnung europäischer Schriftsteller und Wissenschaftler im Dezember 1981 die Ablehnung der Kriegsvorbereitung, die sich am deutlichsten durch die wahnsinnigen Rüstungsanstrengungen beider Seiten manifestiert, allgemein geworden ist, daß nicht nur Autoren und Wissenschaftler, sondern Massen von Menschen wissen und sagen, was sie nicht wollen: Krieg und alles, was zum Kriege führt; daß auch die Regierungen beider, im Kriegsfall einander vernichtender Seiten wieder und wieder bekundet haben und bekunden, daß sie Krieg nicht wollen; daß also eine weitgehende Übereinstimmung in Europa herrscht, was zu verhindern ist, wenn auch noch nicht wie: von all dem ausgehend, scheint es mir an der Zeit, deutlicher und genauer zu sagen, was wir wollen. Ich bin nämlich davon überzeugt, daß wir alle, alle die Länder, aus denen wir kommen, Friedfertigkeit lernen müssen, ernst und ehrlich in einen Lernprozeß eintreten müssen, der jede Art geistigen Streits nicht nur zuläßt, sondern voraussetzt, übt und wahrscheinlich steigert, der aber jeden Neben- und Hintergedanken an eine Machtlösung der Spannungen zwischen den Blöcken und innerhalb der Blöcke vollständig ausschließt und bis in die Generalstäbe hinein die Versuchung, mit einem Erst-, Zweit- oder Drittschlag auch nur vorbeugende Planspiele zu betreiben, absolut ächtet.
Über die Schwierigkeit, eine solche Forderung nicht nur verbal anzuerkennen, sondern zu leben, mache ich mir keine Illusionen, aber ich bin sicher, daß aus einem Zustand des Nicht-Kriegs, in dem wir uns befinden, immer wieder, und schnell, wirklicher Krieg werden kann, und daß Friede nur von friedensfähigen Völkern ausgehen wird. Mir scheint, daß Autoren in besonderem Maße verpflichtet und in der Lage sind, vertrauensbildend zu wirken, was heißt: Friedensfähigkeit herzustellen.
Den Vernichtungsphantasien, die heute so viele Kräfte binden, so viele Kräfte unterdrücken, müssen schöpferische Phantasien entgegengesetzt werden, konkrete Utopien. Das Humanum fördern. Die Ethik nicht den Waffensystemen anpassen. Dem Hauptargument beider Seiten, die jeweilige Gegenseite würde in jede Blöße, die man sich gäbe, hineinschlagen, in allem Ernst vertrauensbildende Maßnahmen entgegensetzen. Auf diesem Feld können Konferenzen wie diese praktisch Fortschritte erzielen, z. B. indem von ihnen die Anregung ausgehen kann, gemeinsame Lesungen von Schriftstellern verschiedener Länder in möglichst vielen Ländern zu veranstalten, unter dem Motto: Schriftsteller lesen für den Frieden; indem der Kreis der Autoren, die an der Arbeit dieser Konferenzen teilnehmen, bewußt und systematisch erweitert wird, nämlich besonders auf jüngere Schriftsteller und Schriftstellerinnen, die Generationen vertreten, die die Erfahrung »Krieg« nicht hatten und die ein Recht darauf haben, sich selbst gegen die Bedrohung ihrer Zukunft mit ihren Mitteln zu wehren. Ferner, indem man überlegt, wie diese Reihe: Appell der Schriftsteller; Berliner Begegnung, Haager Konferenz, Interlit in Köln – fortgesetzt wird und ob zwischen den einzelnen Tagungen irgendeine Art von Kontinuum denkbar wäre, damit die Arbeit eine Beständigkeit bekommt.
Meine Anregungen, die selbstverständlich offen und fair jede Modifikation erlauben, zielen darauf, daß die Impulse der Berliner Begegnung, die in der DDR, aber nicht nur dort, ein großes Echo hatte, Hoffnungen weckte, lebendig bleiben.
Wir als Schriftsteller haben in unserer Arbeit an untergründige, unbewußte Ströme in uns zu rühren, aber wir wollen damit keinen Irrationalismus freisetzen, sondern beitragen zu jener Vernunft, in der beides beschlossen ist: Rationales und Emotionales.
Mai 1982
Kleists »Penthesilea«
Zärtlichen Herzen gefühlvoll geweiht!
mit Hunden zerreißt sie
Welchen sie liebet, und ißt, Haut dann
und Haare, ihn auf.
heinrich von kleist
Dedikation der »Penthesilea«
Die »Penthesilea« bleibt ein entsetzliches Schauspiel, selbst uns, die wir an Entsetzliches gewöhnt sind. An eine Wurzel des Grauens muß Kleist gerührt haben, daß ihm, über solche anderthalb Jahrhunderte, ein Vorgriff auf unsere nicht leicht zu bewegenden Gemüter gelang.
Wir vernichten, was wir lieben – das ist, auf eine allgemeine Formel gebracht, die Aussage der »Penthesilea«. Recht genau scheint diese Formel auf unsre Zeit zu passen. 1807, als sie doch mit dem Beginn der kapitalistischen Industrialisierung und der rigorosen Arbeitsteilung gerade erst zur Geltung kam, fand sich ein Dreißigjähriger, dessen Lebensformel sie war und dem nichts übrigblieb, als sie auszusprechen. »… der ganze Schmutz zugleich und Glanz meiner Seele …«
Bezeichnenderweise wurde dieser Satz über mehr als hundertdreißig Jahre, durch verschiedene Kleist-Ausgaben hindurch »verlesen«. Kleists allzu kühne Selbstaussage aus dem Brief an seine vertraute Verwandte, Marie von Kleist in Potsdam, wurde in aller Unschuld veredelt: »Unbeschreiblich rührend ist mir alles, was Sie mir über die Penthesilea schreiben. Es ist wahr, mein innerstes Wesen liegt darin, und Sie haben es wie eine Seherin aufgefaßt: der ganze Schmerz zugleich und Glanz meiner Seele.«
Viel, viel lieber Schmerz als Schmutz, das Stück war problematisch genug. – Ein ähnliches Bekenntnis hat Kleist über kein anderes seiner Stücke abgelegt.
Kleist sehe ich beinahe jedes Jahr anders. Einmal gewonnene Nähe kann bis zur Distanzierung schwinden, je nachdem, welcher Zug seines Wesens mir gerade am deutlichsten hervortritt. Er liebte das Versteckspiel, die Mystifikation – falls »liebte« das Wort dafür ist. Er hatte sie nötig. Der Spionageverdacht, dem er sich öfter ausgesetzt hat, ist vielleicht nichts anderes als ein unvermeidlicher Reflex seiner Umwelt auf seine Gewohnheit, Spuren hinter sich zu verwischen. Dabei muß der Geheimauftrag, in dem er zu reisen schien, nicht notwendig von einem preußischen Ministerium, er könnte sehr wohl von ihm selbst ausgegangen sein, ein innerer Zwang, die wahren Motive für seine Exkursionen, die Ausbruchsversuche sind, sorgsam zu verbergen. Er war im Wortsinn ein »unaussprechlicher Mensch«. Weil in jeder seiner Bewegungen beinahe gleich stark die Gegenbewegung war, brauchte er eine mehr als gewöhnliche Kraftanstrengung für jeden Schritt. Nie blieb er ohne bitterste Zweifel; nie ging er ohne scharfes Schuldgefühl.
Das mag seine Gelassenheit erklären, wenn ihm, und sei es durch unbequemste Umstände, jede eigene Entscheidung abgenommen ist: Als er, zum Beispiel, im Januar 1807 – ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, da preußisches Königshaus und Heer gen Osten fliehn – mit zwei Kameraden unbefangen in der Gegenrichtung loszieht und, von Königsberg aus in Berlin eintreffend, alle drei als ehemalige preußische Offiziere den Verdacht der französischen Besatzer wecken, festgenommen, observiert und schließlich als Gefangene unter Spionageverdacht nach Frankreich expediert werden. Kleist habe sich, schreibt der höfliche französische Festungskommandant an die intervenierende Schwester Ulrike, »der Gefahr ausgesetzt, als Spion betrachtet zu werden, als er sich aus dem feindlichen Hauptquartier hinter die französische Armee begab«, deren Befehlshaber Napoleon ist, ebender Kaiser, den Kleist für einen bösen Dämon hält. Nun schreibt er – man muß seine anderen, oft tief unglücklichen Briefe als Gegenbeispiele zu diesem kennen! – von unterwegs an die Schwester: »Ob mich gleich jetzt die Zukunft unruhig macht, so bin ich doch derjenige von meinen beiden Reisegefährten, der diese Gewalttat am leichtesten verschmerzen kann; denn wenn nur dort meine Lage einigermaßen erträglich ist, so kann ich daselbst meine literarischen Projekte ebensogut ausführen, als anderswo. Bekümmere Dich also meinetwegen nicht übermäßig, ich bin gesunder als jemals, und das Leben ist noch reich genug, um zwei oder drei unbequeme Monate aufzuwiegen.« Und dies, nachdem er in Königsberg, wieder einmal mit der aussichtslosen Vorbereitung auf ein Staatsamt beschäftigt, unter schweren gesundheitlichen Störungen gelitten und eben deshalb seine Entlassung erwirkt hatte: Die Gefangenschaft befreit ihn von Verantwortung und Rücksichten.
Unter den literarischen Projekten, die er erwähnt, ist, halb fertiggestellt, die »Penthesilea«. Alle die Spielregeln, die, verblüffend für uns, damals zwischen den Offizierkorps gegnerischer Seiten noch gelten, sind in dem Stück, das er, auf Ehrenwort bewegungsfrei, in Châlons-sur-Marne zu Ende schreibt, außer Kraft gesetzt. Das Anstößigste, was sich denken läßt, hält ihn besetzt, Kannibalismus aus auswegloser Liebesleidenschaft. In der Geschichte der Amazonenkönigin, die nur lieben darf, den sie besiegt hat, findet Kleist das Material zu einer der vertracktesten Identifikationen, die ich kenne; die ja erst der Funke war, die kalte Glut hinter den Versen der »Penthesilea« zu entzünden.
Den Stoff mag Kleist schon früher gekannt haben, jeder Gebildete seiner Zeit war mit der Mythologie und den Heroengeschichten der alten Griechen vertraut. Der Umgang mit ihnen ist kanonisiert, die »Nachahmung der Alten« gilt als der »einzige Weg« für den zeitgenössischen Künstler, »groß«, ja »unnachahmlich« zu werden. Winckelmann hat die Postulate aufgestellt, denen Goethe und Schiller beipflichteten und die eher ein Harmoniebedürfnis der frühbürgerlichen Aufklärung in Deutschland als Einsicht in die Rolle der Kunst in der griechischen Polis spiegeln: »Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterwerke ist endlich eine edle Einfalt und eine stille Größe, sowohl in der Stellung als im Ausdrucke. So wie die Tiefe des Meeres allezeit ruhig bleibt, die Oberfläche mag noch so wüten, ebenso zeigt der Ausdruck in den Figuren der Griechen bei allen Leidenschaften eine große und gesetzte Seele.«
Es ist, als ob Kleist nicht erst die »Penthesilea«, sondern schon den »Amphitryon« dagegen angeschrieben hat. Dem hatte Goethe bereits angemerkt, daß er nicht dazu beitragen würde, Antikes und Modernes zu vereinigen, sondern eher dazu, das Moderne vom Antiken zu trennen. Er dachte wohl nicht, daß Kleist das Ziel nicht anstrebte, an dem der Klassiker seine Produkte maß.
Was menschlich ist, kann man auf zweierlei Weise bestimmen: indem man möglichst viele, auch unheimliche, Erscheinungen des Menschlichen in den Begriff hineinnimmt oder indem man möglichst vieles aus ihm verbannt. Den letzteren Weg gingen die Griechen, und nach ihnen ging diesen Weg die abendländische Kultur; inselhaft, wie der freie Polisbürger, umgrenzt der griechische Philosoph und Tragiker, was zur menschlichen Gesittung gehört; jenseits dieses abgezirkelten Bereichs, der schon die griechische Frau nicht mehr aufnimmt, geschweige Sklaven und Angehörige anderer Völker, beginnt das Niedere, Barbarische. Beginnt der Herrschaftsbereich anderer Götter als der klar gegliederten Götterhierarchie des zwölfköpfigen Olymp. Eine Kenntnis über die allmähliche Verfertigung dieses Götterhimmels in jahrhundertelangen Auseinandersetzungen der Griechen mit einem vielgestaltigen Völkergemisch, das, aus sehr alten matriarchalischen Traditionen her, ganz andere Götter, meist nämlich Göttinnen, verehrte – eine solche Kenntnis können die Autoren um 1800 nicht besitzen. Auch Kleist ist angewiesen auf Quellen wie Benjamin Hederichs »Gründliches Lexicon Mythologicum«, in dem er immerhin Varianten zu der Grund-Geschichte der Penthesilea fand: daß sie nach Troia kam, um mit ihrem Heer den Troern gegen die griechischen Belagerer beizustehn; daß zuerst sie es war, die den Griechenheros Achill tötete; daß der aber auf Bitten seiner Mutter, der Meeresgöttin Thetis, von Zeus wiedererweckt wurde und nun seinerseits die Amazonenkönigin erschlug; daß er sich in die Leiche der Frau, die sich ihm zum Kampf gestellt hatte, verliebte. – Daß er also – doch dies ist mein sarkastischer Kommentar – nur eine tote Frau lieben konnte, nicht eine, die ihm widerstand.
Kleist, weit entfernt von Ironie, womöglich noch weiter von Selbstironie, muß in diesen verschiedenen möglichen Enden der Geschichte blitzartig seine Lesart des Stoffes gesehen haben, jene Wendung, die ihm erlaubte, sich bis an die Grenzen seiner Natur zu entäußern und sich dabei zugleich hinter einem undurchdringlichen Fabelgeflecht zu verbergen. Ein weiteres, das bisher schärfste Instrument seiner Selbsterforschung, so beschaffen, daß es Intimes, Persönliches, zugleich aber Allgemeingültiges hervorbringen mußte. »Und gilt's den Meisterschuß ins Herz des Glückes, / So führen tück'sche Götter uns die Hand.« Penthesilea? Kleist? Oder die Erfahrung einer ganzen Generation?
Die Klassiker wollen an keine Götter glauben, die Lust daran hätten, ihre Geschöpfe zu quälen. Ebendies aber ist Kleists Bewußtsein; gutartige Widersprüche sind es nicht, in die er sich verstrickt sieht. Sicherlich hat er die griechischen Tragödien nicht so gelesen, wie wir sie heute nur noch lesen können: als Zusammenfassungen, vorläufige Endprodukte ungeheuerster jahrhundertelanger Kämpfe, in denen die Moral der Sieger formuliert ist, doch hinter der Fabel, die sie diktieren, die Bedrohung durch Älteres, Wildes, Ungezügeltes durchschimmert. Das 18. und frühe 19. Jahrhundert hat, aus unterschiedlichen Gründen, die Rechtfertigungs- und Abwehrmechanismen in den griechischen Tragödien nicht bemerken können; hat sich an ihre Überlieferung gehalten und nicht danach gefragt, wie weit die vom Bedürfnis eines Siegervolkes, einer Klasse innerhalb dieses Volkes geprägt war, was alles sie also ausschließen, verdrängen, verteufeln mußte. Warum zum Beispiel die griechischen Geschichtsschreiber die Amazonensage, die Geschichte von den wilden, wehrhaften Frauen, die an der Nordküste des Schwarzen Meeres – in den skythischen Regionen – und in Libyen Frauenreiche errichtet hätten, in denen Männliches entweder gar nicht oder nur in verkrüppelter und versklavter Form geduldet wurde, derart faszinierte; zwischen Furcht, Abscheu und Bewunderung hin und her gerissen, haben sie sie immer wieder in den verschiedensten Varianten kolportieren müssen. Ihnen war ja die Minderwertigkeit der Frau selbstverständlich, sie hatten ihre Frauen entrechtet, ins Haus verbannt, unschädlich und ungefährlich gemacht. Barbarisch, widernatürlich, angsteinflößend sind ihnen jene Frauen der grauen Vorzeit, von denen es heißt, daß sie sich die Männer, um mit ihnen Kinder zu zeugen, in Raubzügen jenseits der Grenzen ihres Reiches erobern; daß sie nur Mädchen aufziehen, denen die Mütter die rechte Brust ausbrennen, um sie zum Waffendienst mit Lanze und Pfeil und Bogen tauglicher zu machen; daß sie eine Menge Städte in Nordafrika und entlang der kleinasiatischen Westküste gegründet hätten und daß auch das berühmte Heiligtum der Diana in Ephesos von ihnen gestiftet sei. Die großartige Literatur der Griechen kann man auch als eine Literatur unaufhörlicher Verdrängung weiblicher Kultur, weiblicher Lebensansprüche im weitesten Sinne lesen. Die deutsche Aufklärung nun, zunächst begrenzt auf eine schmale Schicht gebildeter Männer, suchte in der Anlehnung an die Alten eine Bestätigung und Befestigung der eigenen Vernunftmoral, die sie über den unvernünftigen, unentwickelten deutschen Verhältnissen aufpflanzte: eine heroische Anstrengung. Daß unter diesen Befestigungen und Eindämmungen, welche Aufklärung und Klassik durch ihr Ideal der Erziehung zu Humanität gegen das Barbarische, Untergründige, Unbeherrschte der menschlichen Natur aufrichten, ein Strom weiterläuft, von dessen Wildheit und Beschaffenheit sie kaum eine Ahnung haben, zeigt sich mit den Romantikern; zeigt sich an Figuren wie Kleist. Und zeigt sich, vor allem, scheint mir, an einem Stück wie der »Penthesilea«.
Auch sie ist eine Aufnahme antiker Themen. Aber anders als in den Werken der Klassiker die Antike ans Licht gehoben wird, bricht hier der Strom, der so lange unterirdisch floß, hervor – reißend, zerstörerisch, zum Entsetzen der am klassischen Humanismusbegriff Gebildeten. »Ich bin nach dem Lesen der ›Penthesilea‹ neulich gar zu übel weggekommen«, sagt Goethe nach der Lektüre des neuen Stückes; und an Kleist schreibt er, kühl und höflich: »Mit der Penthesilea kann ich mich noch nicht befreunden. Sie ist aus einem so wunderbaren Geschlecht und bewegt sich in einer so fremden Region, daß ich mir Zeit nehmen muß, mich in beide zu finden.« Und dies nach dem glühenden Dedikationsbrief Kleists an Goethe vom Januar 1808. »Es ist auf den ›Knieen meines Herzens‹, daß ich damit vor Ihnen erscheine«, so lautet der berühmte Satz in diesem Brief. Ein indirektes Zitat aus dem Gebet Manasse in den Apokryphen, das sich im Zusammenhang so liest: »Ich habe deinen Willen nicht befolgt und deine Gebote nicht gehalten … Darum beuge ich nun die Kniee meines Herzens und bitte dich, Herr, um Gnade.« Was heißt denn das. Erhebt Kleist den Adressaten des Briefes in Götternähe, nur um ihm im gleichen Atemzug seinen eigenen Ungehorsam gegen seine Gebote und Richtlinien ins Gesicht hinein zu vermelden? Während in der »Penthesilea«, wo diese merkwürdig exaltierte Wendung ja auch vorkommt, die so Angeredete sich soeben in grauenhafter Weise vergangen hat; nach ihrer Untat an Achill ruft Prothoe, die Freundin, der Penthesilea zu:
O du,
Vor der mein Herz auf Knien niederfällt,
Wie rührst du mich!
Gibt es also auch ein heimliches Bestreben Kleists, Goethe mit der Gestalt der Penthesilea zu identifizieren? Manche Deutungen wollen in der »Penthesilea« ja nichts anderes sehn als einen Ausschnitt aus dem fortwährenden Zweikampf Kleists mit Goethe. Goethe, der dieses Stück auch als eine Zurücknahme seiner »Iphigenie« lesen mußte: sie, die imstande ist, zwischen den Ansprüchen zivilisierter Menschen und einer barbarischen Göttin zu vermitteln; das Menschenopfer zu verhindern; Aussöhnung zwischen unauflöslichen Widersprüchen zu bewirken: Alle menschlichen Gebrechen / Sühnet reine Menschlichkeit.
Aber Gebrechlichkeit ist Kleists Wort, nicht das des über fünfzigjährigen Goethe. Ach, wie gebrechlich ist der Mensch, ihr Götter! – Dieser Stoßseufzer der Oberpriesterin gehört zu den letzten Zeilen der »Penthesilea«. Wie kann dieser Kleist sich die Aufgabe stellen, mit der Summe seiner zusammengerafften Gebrechen über die Summe der Stärken des anderen zu triumphieren? Sein Unglück ist: Er hängt ja an den Werten der Klassiker. Nur: Wenn er sich ihnen nähert, verändern sie sich ihm bis zur schauerlichen Fratze. Der Mensch, der sich an sie zu halten sucht, wird in peinlichste, sogar tödliche Verwirrung gestürzt, Gut und Böse, Recht und Unrecht sind nicht mehr zu unterscheiden, welche Wahl er auch treffen mag: Nach einer der Gesetzesreihen, die er anerkennt, muß er schuldig werden. Kleists Helden, flatternden Gewissens zwischen unsichere Gebote gestellt, die einander ausschließen, aber unbedingten Gehorsam beanspruchen, zerfleischen sich selbst. Kein schöner Anblick. Die Moderne beginnt. Schwer verständlich bleibt uns besserwisserischen Späteren, wie Kleist – ambivalent natürlich auch in seinem Verhältnis zu Goethe, maßlos verehrend, maßlos ehrgeizig ihn herausfordernd –, wie also Kleist auch nur eine Minute lang hoffen konnte, diese »Penthesilea« könnte den Beifall dieses Goethe finden; Goethe, der sein Lebtag nicht von dem Schock loskam, den die anmaßende und beunruhigende Figur des Jüngeren ihm verursacht hat; der noch 1826 über Kleist schrieb: »Mir erregte dieser Dichter, bei dem reinsten Vorsatz einer aufrichtigen Teilnahme, immer Schauder und Abscheu, wie ein von der Natur schön intentionierter Körper, der von einer unheilbaren Krankheit ergriffen wäre.«
Ein Fall zwanghafter Verkennung von beiden Seiten, wie er in Kleists Stücken so häufig vorkommt.
Warum aber kann – oder muß – Kleist sein »innerstes Wesen« ausdrücken durch das Schicksal, durch den Mund einer Frau?
Kleist als Mann – dies wäre eine gesonderte Studie. Doch soll man ein so tief und absichtsvoll verschleiertes Geheimnis aufbrechen wollen? Denn, daran ist nicht zu zweifeln, es ist nicht zuletzt seine Sexualität, sein von den üblichen männlich-weiblichen Beziehungen schmerzvoll und auch wieder stolz abweichendes und abgesondertes Dasein, die ihn zu Mystifikationen treiben – ihn, den zugleich ein unwiderstehlicher Drang beherrscht, sich ganz auszusprechen. Dieser Widerspruch regiert, wenn mich nicht alles täuscht, die geheimen Motive zur Ausarbeitung der »Penthesilea«: Kleists Ich in einer weiblichen Heldin. Kleist, der, wie manche Biographen für möglich halten, nie eine Frau berührte; der die offensten, sinnlichsten, werbendsten Liebesbriefe an Freunde schrieb; die frühe einzige Braut vor allem bilden und belehren wollte, und zwar nach einem abstrus philiströsen Weiblichkeitsideal; der diese Braut floh, als es unvermeidlich geworden wäre, ihr platonisches Verhältnis zu konkretisieren; der hinter seinem eignen Rücken die Auflösung dieser Verbindung betreibt, indem er sie mit unangemessenen Ansprüchen überfordert; der auch später gerne abreist, wo Frauenfreundschaft in Frauenliebe überzugehen droht; der manche seiner Reisen mit der Schwester macht: Ulrike, die »Männin«, angeblich ein Urbild der Penthesilea; Ulrike, die ehelos bleibt; über die er, das weiß er, verfügen kann, auch wenn seine literarischen Ambitionen ihr fremd bleiben; die in jener Königsberger Zeit um ihn ist, als er mit der »Penthesilea« beginnt – ebenso, seltsamerweise, auch die frühere Braut Wilhelmine, nun als Gattin des Philosophieprofessors Krug ein unverfänglicher Umgang für den oft und gern erscheinenden ehemaligen Bräutigam, der ihre gemütliche Häuslichkeit rein genießt.
Kleist, der im Jahr der »Penthesilea«, 1807, von Châlons-sur-Marne aus seiner Schwester unbekümmert anträgt, sich doch einen kleinen Haushalt einzurichten, so daß er sich bei ihr in Kost begeben könne. »Du liesest den Rousseau noch einmal durch, und den Helvetius, oder suchst Flecken und Städte auf Landkarten auf; und ich schreibe.« Folgt einer jener Sätze, deren ahnungslose Unbefangenheit ihre Unverfrorenheit noch steigern: »Vielleicht erfährst Du noch einmal, in einer schönen Stunde, was Du eigentlich auf der Welt sollst.« Jedenfalls: »Wir werden glücklich sein! Das Gefühl, miteinander zu leben, muß Dir ein Bedürfnis sein wie mir. Denn ich fühle, daß Du mir die Freundin bist, Du Einzige auf der Welt!« So steht es als bindende Verabredung in dem gleichen Brief, dessen Nachsatz ungeniert diese ganze Einrichtung wieder umwirft, da sich ihm der Weg nach Dresden, sein eigentliches Ziel, nun doch eröffnet hat. – Eine Frau ist es ja schließlich auch, die Kleist jenen Dienst erweist, den Männer ihm öfter abgeschlagen haben: mit ihm in den Tod zu gehn, indem sie einwilligt, sich von ihm erschießen zu lassen.
Kleist steht am Anfang jener Reihe Dichter, deren Genie sich ganz unbekümmert zur Erfüllung seiner Bedürfnisse und Zwecke der weniger talentierten Frau bedient. Und was sollte er sonst tun; beide, er und die Frauen, sind für diese Rollen zugerichtet. Er, ein wahrscheinlich wenig geliebtes sensitives Kind, früh der Kadettenanstalt ausgeliefert, eingebunden in Familie, Heer, Staat – in Preußen! –, an steilen Prinzipien und Idealen orientiert, früh sich aufreibend in ohnmächtigen Ausbruchsversuchen, in die Kunst nach zähem Widerstand buchstäblich hineingetrieben als der letzten einzigen Zufluchtsstätte – aber wie ungesichert ist die. Er, dem wie in einer ausgeklügelten Dramaturgie alle Alternativen nach und nach zusammenbrechen: Er unternimmt es, mit dieser Dramaturgie der Alternativlosigkeit vor die bestürzten Zeitgenossen zu treten, zerfressen von Ruhmsucht und Ehrgeiz, welche die Kehrseite maßlosen Liebesverlangens sind, immer wieder hoffend, er werde angenommen.
Gerade der Frau aber, die vorbehaltlos alles annimmt, was von ihm kommt, die »Kleisten« in Potsdam; der er über die »Penthesilea« schreibt: »Erschrecken Sie nicht, es läßt sich lesen; vielleicht hätten Sie es unter ähnlichen Umständen vielleicht ebenso gemacht«; die sich begeistert zeigt – gerade ihr muß er mitteilen (Komik unterläuft Kleist fast immer unfreiwillig), dieses Drama sei »für Frauen … im Durchschnitt weniger gemacht als für Männer«, und, seinem Einfall die Zügel lassend: »Wenn man es recht untersucht, so sind zuletzt die Frauen an dem ganzen Verfall unsrer Bühne schuld, und sie sollten entweder gar nicht ins Schauspiel gehen, oder es müßten eigne Bühnen für sie, abgesondert von den Männern, errichtet werden. Ihre Anforderungen an Sittlichkeit und Moral vernichten das ganze Wesen des Dramas, und niemals hätte sich das Wesen des griechischen Theaters entwickelt, wenn sie nicht ganz davon ausgeschlossen gewesen wären.« Frappierend, wie Kleist in dieser Klage seine eignen Versuche, weibliche Wesen zu gezähmten Haustieren zu modeln, verdrängt hat; wie er nicht auf die Idee kommt, daß er Ursache und Wirkung verwechseln könnte: Man kann halt nicht über zweieinhalb Jahrtausende die abendländische Frau in eine rigorose und monströse Tugendgesetzgebung einsperren und dann von ihr moralinfreie Anregung der männlichen Kunst erwarten. Der Punkt ist erreicht, an dem die patriarchalischen Strukturen den Männern zum Hindernis werden.
Vor allem aber, beinahe erheiternd, jener Irrtum über die Motive der Griechen, Frauen als Akteure aus dem Trauerspiel zu entfernen: nicht weil sie zu sittsam waren, sondern weil sie einst, als wilde mänadenhafte Frauen bei den Dionysien, allzu ungezügelt einem alten Ritus angehangen hatten – ebenjenem, aus dem die Tragödie der Griechen sich entwickeln sollte –, mußte man sie eliminieren. Die Entstehung des griechischen Theaters, eine der großartigsten und erleuchtetesten Erfindungen, ist ein wichtiger Bestandteil jenes langen, kampf- und schmerzreichen Prozesses der Umwertung der Werte zu einer patriarchalischen Kultur. Kein anderes Stück, das auf uns gekommen ist, spiegelt diesen Prozeß direkter als die »Backchen« des Euripides, das Kleist natürlich gekannt hat und das, überraschenderweise, zu Goethes Lieblingsstücken gehörte. Es spiegelt die Furcht eines Mannes vor einem offenbar uralten Weiberritual: das jährliche Zerreißen und Aufessen des Gottessohnes, Dionysos, oder eben dessen Stellvertreters: eines Knaben, eines Jünglings, später eines gehörnten männlichen Tieres, durch rasende Frauen. Ein Fruchtbarkeitskult, der offenbar bei den Frauen jener von den Griechen kolonisierten Randvölker während der Kolonisierung ihrer Kulte als irrationaler Exzeß immer wieder durchbrach; den der Grieche Euripides aller ideologischer Verbrämung entkleidet und in seiner schauerlichsten Form – die Mutter ißt, in sinneverwirrende religiöse Raserei verfallen, den eigenen Sohn – zum nackten Mord erklärt. Die Gründe für die ausweglose Raserei der Frauen werden nicht erzählt, welche Lebensabschnürung sie zum Wahnsinn treibt, bleibt unsichtbar; fassungslos stehen sie bei Euripides vor einer unverstandenen entsetzlichen Schuld, die unsühnbar ist, aber bestraft werden muß. Bestraft durch den männlichen Gott und sein Gebot der Rationalität.
Was Kleist in der »Penthesilea« heraufholt, ist ein Reflex der alten Angst der Männer vor starken, unkontrollierbaren, verrückten Frauen: Dies ist aber nur ein Aspekt des Stückes; losgelassen ist in diesen brennenden, doch gebändigten Versen die Angst eines Mannes vor der Entfesselung des Wahnsinns in ihm selbst – eine Art von Wahnsinn, die nach zweieinhalbtausend Jahren männlicher Kultur als »weiblich« erscheinen muß. Wie alle Werke Kleists, mehr noch als die anderen außer dem »Prinzen von Homburg«, entspringt dieses Stück dem Schmerz über eine zuckende, niemals heilende Wunde: daß er nicht, wie er es braucht, geliebt wird; daß er nicht lieben kann.
Die »Penthesilea« ist ein Stück, unter dessen Oberfläche immer neue Schichten hervortreten, je nachdem, auf welche Tiefenschärfe wir unsere Augen einstellen. Auch wenn Kleists eigene Seelenlage uns unbekannt wäre – der Kampf der Amazone Penthesilea mit dem griechischen Heros Achill bleibt ein großer Vorwurf. Daß er nicht in Kleists Zeit, daß er nur in der Antike zu finden war, verstand sich von selbst: zwei gleichgestellte, im gleichen Maße handlungsfähige Menschen, Mann und Frau, in Liebe einander verfallen, doch jeder von beiden an das Gesetz seines Volkes gebunden, das zugleich das Gesetz seines Geschlechtes ist: Sie muß – und darf nur – lieben, den die Schlacht ihr zutreibt und den sie besiegt. Ihm ist natürlich, daß die Frau ihm bedingungslos folgt; nur zum Schein kann er sich ihr für kurze Zeit ergeben, und schon dieser Vorsatz macht ihn in den Augen der Gefährten toll. Das Mißverständnis, die Verkennung regieren mit Notwendigkeit die Dramaturgie; als sollten Nord- und Südpol zueinanderkommen, als sollten die beiden Enden eines Magnets zusammengebogen werden: In der Art einer verheerenden Naturkatastrophe entladen sich die unvereinbaren Gegensätze. So gesehen, ist die »Penthesilea« eine Metapher für die hoffnungslose Trennung von Mann und Frau. Eine zweite, nahebei liegende Lesart könnte den Kampf einer Frau um ihr Recht auf individuelle Liebe hervorheben. Aber natürlich ist das Stück auch, tritt man nur einen Schritt zurück und läßt es als allgemeingültiges Muster auf sich wirken, ein geschlossenes Modell für die Verstrickung eines Menschen in unvereinbare Bedürfnisse und Pflichten, die ihn, mag er sie vernachlässigen oder strikt erfüllen, so oder so zugrunde richten müssen.
Kleists Fall. Aus der Amazonenüberlieferung der Griechen, an sich schon ein Zeugnis für ein patriarchalisch beeinflußtes Verkehrtbild, macht Kleist ein weiteres Negativ, entsprechend einer neuen Stufe männlicher Entfremdung in der ökonomisch produktiver, das heißt: arbeitsteiliger werdenden männerzentrierten Gesellschaft. »Krank«? Mag sein. Doch war es die Zeitkrankheit, an der Kleist mehr litt als andere. Er, im Zentrum seiner Lebenskraft von der Entfremdung betroffen, dem Schreiben verfallen als dem einzigen schmalen Rettungshorizont; äußerste Entfremdung darstellend, deren Opfer er zugleich ist.
Impotenz ist ein nie aussprechbares Stichwort zu den Automatismen, die zwischen den Liebenden ablaufen. Das Noli me tangere – es kann nicht gesagt werden, in Handlungen, die dem Unbewußten direkt entspringen, wird es errichtet. Wollen diejenigen, die ihrer Vereinigung derart unüberwindliche Hindernisse entgegenstellen, diese Vereinigung überhaupt? Können sie sie wollen? Wird nicht durch die Unmöglichkeit die Unfähigkeit ausgedrückt – eine jener Offenbarungen des »innersten Wesens«, die zugleich in tiefster Verborgenheit geschützt bleiben? Viel Schuldgefühl schwingt hinter der Selbsttötung der Penthesilea. »Küsse, Bisse, das reimt sich …« freilich in einem anderen, nicht der Norm entsprechenden Liebeskanon als dem, auf den die Frauen und die Männer des beginnenden 19. Jahrhunderts hindressiert sind. Kleist kennt die Aufschwünge und Zusammenbrüche der Penthesilea. Heillos steht sie zwischen zwei Moralsystemen, die für sie ein gleiches Gewicht haben: So auch er. Er kennt ihre Sterbenssehnsucht und Todesentschlossenheit. Und er muß es erfahren haben, wie in dem Augenblick, da man hoffnungslos zwischen den Fronten steht, als ein Irrsinnssignal das Wort »frei« in einem aufblitzt. Der Penthesilea schleudert es die Oberpriesterin, welche die Ideologie der Ahnin Tanaïs vertritt, wie einen Fluch entgegen:
Frei, in des Volkes Namen sprech ich dich;
Du kannst den Fuß jetzt wenden, wie du willst …
Aber noch kann Penthesilea diese Freiheit nicht verwenden. Noch schnürt ihr die Furcht, ihrem Volk zu schaden, jeden Ausweg ab: »Ich will in ew'ge Finsternis mich bergen.« Freiheit – die Art Freiheit, die hier noch zu haben ist – gewinnt sie erst durch die Untat. Daß sie, zur Raserei getrieben, das Liebste selbst vernichtet hat, reißt ihr die Augen auf. Da sieht sie – nichts. Alles, was sie glaubte, war ein Wahn. Der Göttersturz hat die Welt verwandelt. Himmel und Hölle gibt es für sie nicht mehr. Keine Fessel, kein Glaube, kein Spruch binden sie noch. Vom Gesetz der Frauen, das sie als Person vernichten mußte, sagt sie sich los. Und frevelhafter als alles, was sie tun konnte, so grell, bizarr, pervers es war, ist dann am Schluß ihr stiller glaubensloser Satz: »Der Tanaïs Asche, streut sie in die Luft!«
Also kein Ausweg, keine Möglichkeit, keine Hoffnung? So ist es: Nichts davon. Trauer.
Und eben darum ist der Vorwurf der Barbarei gegen die »Penthesilea« nicht gerechtfertigt. Wenn die Abschaffung des Menschenopfers, wenn seine Ersetzung im Ritual durch Tieropfer, Zeichen und Symbol, die Loslösung von dem abergläubischen Bedürfnis nach einem Sündenbock ganz gewiß ein, vielleicht der Maßstab für Kulturfortschritt in menschlichen Gemeinschaften sein mag, so zeigt ein Stück wie Kleists »Penthesilea« an, wie bedroht eine auf Einzwängung errichtete Vernunft durch den Wahn ist; wie hauchdünn die Wand ist zwischen fragloser Gesetzestreue und hemmungsloser Gesetzesverletzung – in Gesellschaften, in denen »Aufklärung« eine Verabredung unter Privilegierten, Gebildeten bleibt und Massen von Menschen ein sinnentleertes Leben führen. Das »Unschöne, das Beängstigende«, mit dem sich nach Goethes Überzeugung »die Dichtung weder befassen noch aussöhnen könne«, verschwindet ja nicht, indem man sich weigert, es wahrzunehmen. Schockierend ist es freilich, auch für uns noch, ein strenges Denk-Tabu, den Kannibalismus unserer Kultur, als Gegenstand der Kunst zu sehen. Die Klassiker, die sich, weil sie es nötig brauchten, ihr humanes Griechenland erfanden, wollen dem ruchlosen Gedanken nicht nachhängen, dem nach Sittlichkeit strebenden Menschen könne einmal der Ausweg verlegt sein. Kleist weiß es. Heute müßte für blind und unempfindlich gelten, wer es leugnen wollte. Unser Jahrhundert hat aus jenen seelischen Hohlräumen, welche Aufklärung und Vernunft nicht berührt haben, Extremismen und Exzesse herausgepreßt, Wahndenken und Wahnsinnstaten, vor denen ein einzelner gräßlicher Mord aus auswegloser Liebesraserei verblaßt.
Goethe hielt dafür, daß keine Position, welche die Kultur errang, je wieder aufgegeben werden dürfe. Bedeutet nun aber die Faszination durch den Mythos, die Wiederheraufholung mythologischer Themen, die Ergriffenheit vom Doppelsinn des Wortes »sacra«, das »heilig« wie »verflucht« heißen kann, in der Kunst unweigerlich eine Rückkehr oder auch nur eine Sehnsucht nach früheren, ungegliederten Zuständen? Nach Primitivismen, Atavismen, Barbarismen? Bei Kleist, scheint mir, bedeutet das Penthesilea-Motiv all dieses nicht. Die Untat, der Rückfall in die Barbarei, wird in vollkommener Geistesabwesenheit verübt und trennt die Unselige, als ihr Realitätssinn wieder erweckt ist, für immer von ihrer Umgebung und von sich selbst. Eine Ernüchterung zum Tode, der mit einer Ästhetik scheinhafter Alternativen nicht beizukommen ist. Dieser Penthesilea, diesem Kleist ist auf Erden nicht zu helfen. »Daß die Poesie das glückliche Asyl der Menschheit bleiben wird«, ist, wir wissen es nur zu genau, ein frommer Wunsch des alten Goethe geblieben. Für unser Auge tritt, so seh ich es, aus Kleists Trauerspiel ein Mensch hervor, leidenschaftlich und unbedingt, gebrechlich und verletzlich, mutig und ohnmächtig, fehlbar und der Hilfe bedürftig, verkörperter Schrei nach einer realen Möglichkeit für eine lebbare Existenz.
August 1982
Frankfurter Poetik-Vorlesungen
Diesem düsteren Geschlecht ist nicht zu helfen; man mußte nur meistenteils verstummen, um nicht, wie Kassandra, für wahnsinnig gehalten zu werden, wenn man weissagte, was schon vor der Tür steht.
goethe
Meine Damen und Herren,
»Poetik-Vorlesungen« heißt dieses Unternehmen, aber ich sage Ihnen gleich: Eine Poetik kann ich Ihnen nicht bieten. Meinen Verdacht, daß ich selber keine besitze, konnte ich mir durch einen einzigen Blick ins »Lexikon der Antike« bestätigen. »Poetik«: Lehre von der Dichtkunst, die, im fortgeschrittenen Stadium – Aristoteles, Horaz –, eine systematische Form annimmt und deren Normen seit dem Humanismus in zahlreichen Ländern »weithin Gültigkeit« erlangen. Der Weg zu neuen ästhetischen Positionen, lese ich, führe über die Auseinandersetzung mit diesen Normen, in Klammern: Brecht. Ich spotte ja nicht, und ich leugne selbstverständlich den Einfluß nicht, den herrschende ästhetische Normen auf jeden haben, der schreibt (auch auf jeden, der liest und der die verinnerlichten Normen seinen persönlichen Geschmack nennt). Aber den wütenden Wunsch, mich mit der Poetik oder dem Vorbild eines großen Schreibers auseinanderzusetzen, in Klammern: Brecht, habe ich nie verspürt. Dies ist mir erst in den letzten Jahren merkwürdig geworden, und so kann es sein, daß diese Vorlesungen nebenbei auch die gar nicht gestellte Frage mit behandeln, warum ich keine Poetik habe.
Hauptsächlich aber will ich Sie bitten, mir auf eine Reise zu folgen, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Ich bin in den letzten ein, zwei Jahren einem Stichwort nachgegangen, das hieß: KASSANDRA, und ich hatte Lust (sie verging mir zwischendurch, kam wieder), dieses eine Mal in groben Umrissen die Wege nachzuzeichnen, die das Wort mich führte. Vieles, das meiste vielleicht und Wichtigstes, bleibt ungesagt, auch wohl ungewußt, und das Gewebe – das übrigens, falls