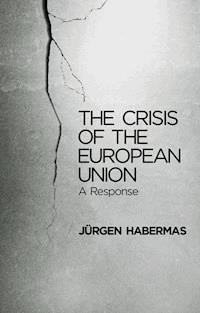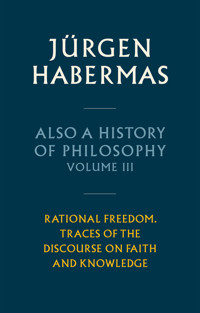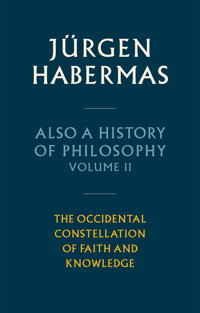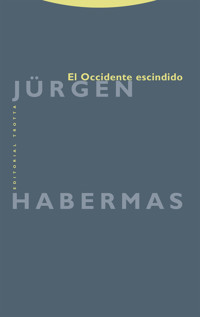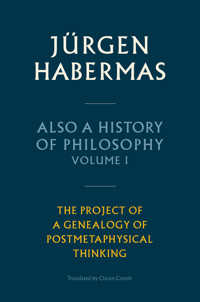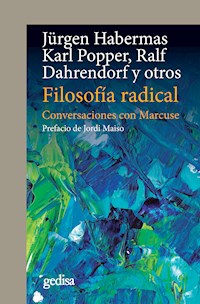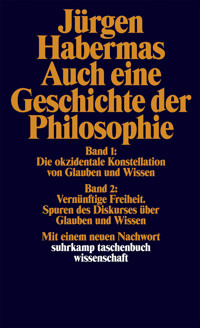27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Wir haben zum nachmetaphysischen Denken keine Alternative.« Dieser Satz, geschrieben von Jürgen Habermas in seiner 1988 erschienenen Aufsatzsammlung Nachmetaphysisches Denken, gilt noch heute. »Nachmetaphysisches Denken« – das ist zunächst die historische Antwort auf die Krise der Metaphysik nach Hegel, deren zentrale Denkfiguren vor allem durch gesellschaftliche, aber auch innerwissenschaftliche Entwicklungen ins Wanken geraten sind. In der Folge wurden das Erkenntnisprivileg der Philosophie erschüttert, ihre Grundbegriffe detranszendentalisiert und der Vorrang der Theorie vor der Praxis in Frage gestellt. Aus guten Gründen hat die philosophische Theorie, so die Diagnose damals, »ihren außeralltäglichen Status eingebüßt«, sich damit aber auch neue Probleme eingehandelt. In »Nachmetaphysisches Denken II« widmet sich Habermas einigen dieser Probleme in zum Teil bisher unveröffentlichten Texten. Im ersten Teil des Buches geht es um den Perspektivenwechsel von metaphysischen Weltbildern zur Lebenswelt. Letztere analysiert Habermas als »Raum der Gründe« – auch dort, wo die Sprache (noch) nicht regiert, etwa in der gestischen Kommunikation und im Ritus. Im zweiten Teil steht das spannungsreiche Verhältnis von Religion und nachmetaphysischem Denken im Vordergrund. Habermas schließt hier unmittelbar an seine weitsichtige Bemerkung von 1988 an, wonach die »Philosophie auch in ihrer nachmetaphysischen Gestalt Religion weder ersetzen noch verdrängen« kann, und erkundet etwa das neue Interesse der Philosophie an der Religion. Den Abschluss bilden Texte über die Rolle der Religion im politischen Kontext einer postsäkularen, liberalen Gesellschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
»Wir haben zum nachmetaphysischen Denken keine Alternative.« Dieser Satz, geschrieben von Jürgen Habermas in seiner 1988 erschienenen Aufsatzsammlung Nachmetaphysisches Denken, gilt noch heute. Nachmetaphysisches Denken – das ist zunächst die historische Antwort auf die Krise der Metaphysik nach Hegel, deren zentrale Denkfiguren vor allem durch gesellschaftliche, aber auch durch innerwissenschaftliche Entwicklungen ins Wanken geraten sind. In der Folge wurden das Erkenntnisprivileg der Philosophie erschüttert, ihre Grundbegriffe detranszendentalisiert und der Vorrang der Theorie vor der Praxis in Frage gestellt. Aus guten Gründen hat die philosophische Theorie, so die Diagnose damals, »ihren außeralltäglichen Status eingebüßt«, sich damit aber auch neue Probleme eingehandelt. In Nachmetaphysisches Denken II widmet sich Habermas einigen dieser Probleme in zum Teil bisher unveröffentlichten Texten.
Im ersten Teil des Buches geht es um den Perspektivenwechsel von metaphysischen Weltbildern zur Lebenswelt. Letztere analysiert Habermas als »Raum der Gründe« – auch dort, wo die Sprache (noch) nicht regiert, etwa in der gestischen Kommunikation und im Ritus. Im zweiten Teil steht das spannungsreiche Verhältnis von Religion und nachmetaphysischem Denken im Vordergrund. Habermas schließt hier unmittelbar an seine weitsichtige Bemerkung von 1988 an, wonach die »Philosophie auch in ihrer nachmetaphysischen Gestalt Religion weder ersetzen noch verdrängen« kann, und erkundet etwa das neue Interesse der Philosophie an der Religion. Den Abschluss bilden Texte über die Rolle der Religion im politischen Kontext einer postsäkularen, liberalen Gesellschaft.
Jürgen Habermas, geboren 1929, ist Professor em. für Philosophie an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sein Werk erscheint im Suhrkamp Verlag. Zuletzt erschienen: Philosophische Texte. Studienausgabe in fünf Bänden, 2009; Zur Verfassung Europas. Ein Essay, 2011.
Jürgen Habermas
Nachmetaphysisches Denken II
Aufsätze und Repliken
Suhrkamp
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© Suhrkamp Verlag Berlin 2012
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
eISBN 978-3-518-73955-6
www.suhrkamp.de
5Inhalt
Versprachlichung des Sakralen.Anstelle eines Vorworts
I DIE LEBENSWELT ALS RAUM DER GRÜNDE
1. Von den Weltbildern zur Lebenswelt
2. Die Lebenswelt als Raum symbolisch verkörperter Gründe
3. Eine Hypothese zum gattungsgeschichtlichen Sinn des Ritus
II NACHMETAPHYSISCHES DENKEN
4. Ein neues Interesse der Philosophie an Religion.Ein Interview von Eduardo Mendieta
5. Religion und nachmetaphysisches Denken.Eine Replik
6. Ein Symposion über Glauben und Wissen.Replik auf Einwände, Reaktion auf Anregungen
III POLITIK UND RELIGION
7. »Das Politische« – Der vernünftige Sinn eines zweifelhaften Erbstücks der Politischen Theologie
8. Das »gute Leben« eine »abscheuliche Phrase«.Welche Bedeutung hat die religiöse Ethik des jungen Rawls für dessen Politische Theorie?
9. Rawls’ Politischer Liberalismus.Replik auf die Wiederaufnahme einer Diskussion
10. Religion in der Öffentlichkeit der »postsäkularen« Gesellschaft
Nachweise
Namenregister
7Versprachlichung des Sakralen
Anstelle eines Vorworts
In der 1988 unter gleichem Titel erschienenen Aufsatzsammlung[1]ging es um eine Selbstvergewisserung philosophischen Denkens. An diesem Thema hat sich nichts geändert. Die Philosophie ist keine wissenschaftliche Disziplin, die sich über eine feststehende Methode oder einen festgelegten Objektbereich definieren könnte. Die Einheit der philosophischen Diskurse bestimmt sich vielmehr durch Kanonbildung, das heißt anhand der Texte, die seit zweieinhalbtausend Jahren zur Geschichte der Philosophie gerechnet werden. Daher bleibt die Frage, was Philosophie leisten kann, grundsätzlich strittig. Gleichwohl ist es keine müßige Frage, der wir ausweichen dürften. Denn auch das nicht-festgestellte Denken muss sich for the time being festlegen, wenn es nicht im Ungefähren herumschweifen soll.
Schon der erste Blick auf unseren wissenschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Kontext belehrt uns darüber, dass sich Philosophen nicht mehr im Kreise der Dichter und Denker aufhalten. Weise und Seher, die – wie noch Heidegger – einen privilegierten Zugang zur Wahrheit reklamieren, können sie nicht mehr sein. Weil die Philosophie auch zu einer wissenschaftlichen Disziplin geworden ist, beginnt die Überzeugungsarbeit im Kreise der peers. Wer nicht durch die Schleuse der professionellen Kritik hindurchgeht, gerät mit Recht in den Verdacht der Scharlatanerie. Auch philosophische Argumente können heute nur noch im zeitgenössischen Kontext der eingespielten natur-, sozial- und geisteswissenschaftlichen Diskurse, der bestehenden Praktiken der Kunstkritik, der Rechtsprechung, der Politik und der öffentlichen, über Medien vermittelten Kommunikation darauf rechnen, prima facie als erwägenswert akzeptiert zu werden. Nur in diesem weiteren Kontext grundsätzlich falliblen Wissens können wir den schmalen Pfad suchen, auf dem philosophische Gründe noch »zählen«.
8Aber diese Suche wird kaum anders als performativ gelingen; metatheoretische Überlegungen bleiben im schlechten Sinne abstrakt. Wer sich am Geschäft der philosophischen Selbstvergewisserung beteiligen möchte, muss selber Philosophie betreiben. Dieser Zirkel ist selbst dann unvermeidlich, wenn man sich eine Kanonisierung des Wissensbestandes noch zutraut. Um das ausgewählte Kompendium an Wissen, das man »von Philosophen lernen kann«, plausibel zu machen, musste Herbert Schnädelbach die Argumente, von denen er seine Leser überzeugen will, selber auf philosophische Weise entwickeln.[2] Auch die Autoren, für die sich die Frage eher problematisierend als in abschließender Weise stellt, können die philosophische Denkweise von anderen Gestalten des Geistes nur in der Weise abgrenzen, dass sie zu zeigen versuchen, was Philosophie ist. Die Empfehlung beispielsweise, heute nur noch im Modus des »nachmetaphysischen Denkens« zu philosophieren, könnte ich nicht begründen, ohne gleichzeitig um Verständnis für den Begriff der »kommunikativen Vernunft« zu werben. Darum beginnt Nachmetaphysisches Denken II mit einem systematischen Abschnitt über »Die Lebenswelt als Raum der Gründe« (so wie der vorangehende Band einen entsprechenden Abschnitt über die sprachpragmatische Wende enthält).
Freilich behandele ich dasselbe Thema nun aus einem entwicklungsgeschichtlichen Blickwinkel, denn im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte hat sich eine veränderte Konstellation ergeben. Die philosophische Szene war seinerzeit von Tendenzen einer Rückkehr zur Metaphysik bestimmt. Es gab auf der einen Seite differenzierte Versuche, nach den deflationierenden Denkschulen der analytischen Philosophie wieder auf spekulative Gedanken zurückzugehen – sei es, dass metaphysische Denkfiguren unmittelbar aus klassischen Quellen rehabilitiert,[3] sei es, dass Motive des Deutschen Idealismus auf dem Wege der Wiederaufnahme der nachkantischen Problematik des Selbstbewusstseins erneuert 9werden sollten.[4] Auf der anderen Seite hatte die vernunftkritische Anknüpfung an Nietzsche und den späten Heidegger zu Versuchen ermutigt, die Dimension des Ursprungsdenkens auf andere Weise wiederzugewinnen.[5] Inzwischen haben politisch-historische Entwicklungen des letzten Jahrzehnts einem ganz anderen Thema Aktualität verliehen: Die weitgehend säkularisierten Gesellschaften Europas begegnen im Zuge der Globalisierung der Wirtschaft und der digitalen Kommunikation sowohl im eigenen Hause wie weltweit religiösen Bewegungen und Fundamentalismen von unverminderter Vitalität.
Dieser Umstand hat nicht nur der sozialwissenschaftlichen Diskussion über den Zusammenhang von Säkularisierung und gesellschaftlicher Modernisierung eine andere Richtung gegeben, sondern auch die Philosophie herausgefordert, und zwar in doppelter Hinsicht.[6] Als normative politische Theorie muss sie zunächst jenes Verständnis von säkularisierter Staatsgewalt und religiösem Pluralismus überprüfen, das die Religionsgemeinschaften aus der politischen Öffentlichkeit ins Private verbannen möchte. Darüber hinaus sieht sich die Philosophie in ihrer Rolle als Erbin der europäischen Aufklärung provoziert. Was bedeutet für sie als »Hüterin der Rationalität« der Umstand, dass sich Religionsgemeinschaften und religiöse Lehren mit ihrer archaischen Verwurzelung in kultischen Praktiken inmitten der gesellschaftlichen Moderne als eine gegenwärtige und kulturell produktive Gestalt des Geistes zu behaupten scheinen? Die Philosophie muss sich von dieser Zeitgenossenschaft der Religion insofern bedrängt fühlen, als eine Beziehung auf gleicher Augenhöhe die seit dem 18. Jahrhundert gewohnte Konstellation gründlich verändern würde. Seit dieser Zeit hatte die Philosophie, Seite an Seite mit den Wissenschaften, die Religion nämlich entweder als ein undurchsichtiges und daher erklärungsbedürftiges Objekt behandelt (so etwa Hume) oder sie 10(wie von Kant bis Hegel) als vergangene, aber transparente Gestalt des Geistes auf ihren eigenen philosophischen Begriff gebracht. Wie müsste sich demgegenüber eine Philosophie verstehen, die der Religion nicht als einer Gestalt der Vergangenheit, sondern als einer einstweilen – wie immer auch opaken – Gestalt im Präsens begegnet?
Der erste Beitrag »Von den Weltbildern zur Lebenswelt« beleuchtet die Veränderung der Konstellation im Verhältnis der Philosophie zu den Wissenschaften. Ich nehme darin die szientistische Verhärtung des Selbstverständnisses der Philosophie im Sinne des Anwaltes eines »wissenschaftlichen Weltbildes« zum Anlass, einen »weichen« Naturalismus zu verteidigen. Der neue Naturalismusstreit bringt die Aspekte zu Bewusstsein, unter denen sich Philosophie – als eine im wissenschaftlichen Geist betriebene diskursive Form des Welt- und Selbstverständnisses – von den objektivierenden Wissenschaften unterscheidet. Im Rahmen einer groben Skizze der Entstehung des nachmetaphysischen Denkens aus der im Okzident entstandenen Symbiose von Glauben und Wissen entwickle ich in diesem Text die systematischen Grundbegriffe von »kommunikativem Handeln« und »symbolisch strukturierter Lebenswelt«.
Diesen kommunikationstheoretischen Ansatz vertiefen die beiden folgenden Beiträge des ersten Abschnittes aus evolutionstheoretischer Sicht. Michael Tomasello hat die Entstehung der menschlichen Kommunikation aus Zusammenhängen einer Kooperation erklärt, in der die Teilnehmer ihre Intentionen und Handlungen über einfache symbolische Gesten aufeinander abstimmen.[7] Dieser sozialkognitive Ansatz betont das aus der Gestenkommunikation hervorgehendende intersubjektiv geteilte Wissen, das eine zweckmäßige Koordinierung von Handlungen und Intentionen möglich macht. Aus den sozialkognitiven Erfordernissen der kooperativen Verwirklichung gemeinsamer Ziele erklärt sich freilich nur die Kommunikation von Tatsachen, Absichten und Aufforderungen, nicht aber die von normativen Verhaltenserwartungen. Aufforderungen und Absichtserklärungen genießen nicht von Haus aus 11die verpflichtende Kraft von Geboten. Der intersubjektiv geteilte normative Sinn des Sollens zehrt von Bindungsenergien, die sich nicht aus Kooperationszwängen erklären lassen. Sofern der sozialpragmatische Ansatz ausreicht, um die Anfänge der sprachlichen Kommunikation zu erklären, muss sich der Sinn sprachlicher Verständigung unabhängig von einem »starken« normativen Einverständnis über Werte und von gegenseitigen Verhaltenserwartungen explizieren lassen. Dann bedarf die Dimension von Verpflichtungen jedoch einer anderen, von der sprachlichen Form der sozialen Integration unabhängigen Erklärung.
Die Hypothese über den Ursprung der Sprache aus der Gestenkommunikation lenkt die Aufmerksamkeit auf rituelle Praktiken, die offenbar die Alltagskommunikation als eine außeralltägliche Form der Kommunikation ergänzt haben. Obwohl diese in auffälliger Weise von der Alltagskommunikation abweicht, indem sie aus allen handgreiflichen Funktionszusammenhängen herausfällt und sich nicht auf innerweltliche Gegenstände und Sachverhalte bezieht, weist sie strukturell ähnliche Merkmale auf wie die Gestenkommunikation. Schon Durkheim hat in diesen rituellen Praktiken die Quelle von gesellschaftlicher Solidarität gesehen. Rituell erzeugte normative Bindungsenergien könnten dann – im Zuge der Entwicklung der Gestenkommunikation zu voll ausgebildeten grammatischen Sprachen – in dieses Sprachmedium eingeholt und entsprechend ausdifferenziert worden sein. Die illokutionären Kräfte vieler regulativer Sprechakte (wie befehlen und versprechen, ernennen, in Kraft setzen usw.) lassen sich ohnehin als das Ergebnis einer veralltäglichenden Konventionalisierung von Bedeutungen ritueller Herkunft verstehen. So hat J. L. Austin den Begriff der »illokutionären Kraft« am Beispiel von institutionell gebundenen Sprechakten wie taufen, schwören, beten, verkündigen, verheiraten usw. entwickelt, die unmittelbar ihren sakralen Hintergrund verraten. Aus dieser evolutionstheoretischen Sicht fällt übrigens Licht auf zwei Probleme der Sprachtheorie, die ich im Vorbeigehen wenigstens erwähnen möchte.[8]
12Die sozialkognitive Sprachentstehungsthese lenkt den Blick auf Kooperationszusammenhänge als den Ursprungsort der Sprache. Dieser Entstehungskontext spricht gegen die geläufige intentionalistische Auffassung, der Sinn der menschlichen Kommunikation bestehe darin, sich wechselseitig über die eigenen Wünsche und Absichten in Kenntnis zu setzen. Wenn der Austausch symbolischer Gesten ursprünglich der arbeitsteiligen Verfolgung gemeinsamer Ziele dient, erklärt sich der Sinn sprachlicher Kommunikation aus der praktischen Notwendigkeit, unter Handlungsdruck Einverständnis unter den Beteiligten herbeizuführen. Einer will sich mit dem anderen über etwas verständigen, sei es über die Existenz oder das Auftreten von Zuständen und Ereignissen in der Welt oder über Absichten, Wünsche und Aufforderungen, in die Welt einzugreifen, um entsprechende Zustände oder Ereignisse zur Existenz zu bringen. Unter dem Zwang, ihre Handlungen zweckmäßig zu koordinieren, genügt es nicht, den Adressaten das Gemeinte bloß erkennen zu lassen. Der Sprecher verfolgt mit seiner Äußerung vielmehr das illokutionäre Ziel, dass der Hörer seine Aussage für wahr halten, seinen Wunsch oder seine Ankündigung ernst nehmen, gegebenenfalls seine normativen Erwartungen oder Vorwürfe für richtig halten, seinen Aufforderungen Folge leisten soll. Denn jede Äußerung richtet sich an Personen, die mit »Ja« oder »Nein« Stellung nehmen können. Das Gelingen der Kommunikation bemisst sich daran, ob der Angesprochene den für das Gesagte erhobenen Wahrheits- bzw. Wahrhaftigkeits- oder Richtigkeitsanspruch als gültig (oder im Hinblick auf potentielle Gründe als ausreichend) akzeptiert.[9]
In Verbindung mit der Annahme einer sekundären Versprachlichung des Sakralen erklärt die Hypothese von zwei gleichursprünglichen Kommunikationsformen weiterhin die auffälligen Asymmetrien, die zwischen den Geltungsansprüchen von Wahrheit und Wahrhaftigkeit auf der einen, der normativen Richtigkeit auf der anderen Seite bestehen. Elementare Sprechhandlungen lassen sich durchgängig sowohl im Hinblick auf die Wahrheit von Aussagen (bzw. der Existenzpräsuppositionen der Aussagegehalte) 13als auch im Hinblick auf die Aufrichtigkeit der (sei es thematisch ausgedrückten, sei es implizit mitlaufenden) Sprecherintentionen in Frage stellen. Die Sprache scheint mit diesen beiden kognitiven Geltungsansprüchen intrinsisch verknüpft zu sein. Hingegen kommen die motivational bindenden Richtigkeitsansprüche erst ins Spiel, wenn Sprechhandlungen in normative, als verbindlich oder rechtfertigungsfähig schon unterstellte Kontexte eingebettet sind.
Normativ »freistehende« Aufforderungen und Ankündigungen sind durch nichts weiter autorisiert als durch die begründete Absicht und den rational nachvollziehbaren Willen des Sprechers. Daher verstehen wir solche Sprechakte, wenn wir die aktorrelativen Gründe für die Rationalität der entsprechenden Absichten (und die Bedingungen ihrer Durchführbarkeit) kennen.[10] Dagegen entlehnen Befehle ihre bindende Autorität, oder Ansagen ihre Rechtskraft, einem vorgängig als gültig unterstellten normativen Hintergrund. Wir verstehen solche Sprechakte nur in Kenntnis der autorisierenden Gründe, die dem Hintergrund zu entnehmen sind. Diese Kontextabhängigkeit der normativen Richtigkeitsansprüche lässt sich mit der Hypothese erklären, dass sich die zunächst rituell erzeugten Bindungsenergien mit der aus alltäglichen Kooperationszusammenhängen hervorgegangenen Sprache erst sekundär verbinden. Daraus ergibt sich andererseits auch die Konsequenz, dass wir der Versprachlichung des Sakralen nicht zu viel aufbürden dürfen.
Ich bin in der Theorie des kommunikativen Handelns vorschnell von der überinklusiven Annahme ausgegangen, dass sich die rational-motivierende Bindungskraft guter Gründe, die für die handlungskoordinierende Funktion sprachlicher Verständigung den Ausschlag gibt, allgemein auf die Versprachlichung eines zunächst rituell gesicherten Grundeinverständnisses zurückführen lässt: »Die Aura des Entzückens und Erschreckens, die vom Sakralen 14ausstrahlt, die bannende Kraft des Heiligen wird zur bindenden Kraft kritisierbarer Geltungsansprüche zugleich sublimiert und veralltäglicht.«[11] Im Lichte einer Differenzierung zwischen alltäglicher und außeralltäglicher Kommunikation stellt sich mir heute die Versprachlichung des Sakralen anders dar. Normative Gehalte mussten aus ihrer rituellen Verkapselung erst gelöst und dann in die Semantik der Alltagssprache übertragen werden. Der rituelle Umgang mit Mächten des Heils und des Unheils hatte sich zwar immer schon mit einer semantischen Polarisierung von »gut« und »böse« verbunden. Aber erst mit der Versprachlichung ritueller Bedeutungen in Gestalt mythischer Erzählungen hat sich diese psychodynamisch besetzte Opposition von Gut und Böse an die in der Alltagssprache ausgebildete binäre Kodierung von Aussagen und Äußerungen (als wahr/falsch und aufrichtig/unwahrhaftig) assimilieren und zu einem dritten, mit regulativen Sprechakten verknüpften Geltungsanspruch (richtig/falsch) ausbilden können.
Ich erwähne diese spekulative Konstruktion einer sprachlichen Entbindung rituell erstarrter Bedeutungen, weil sich die Entwicklung der Weltbilder keineswegs nur, aber eben auch als eine Entzauberung und reflexive Verflüssigung sakraler Semantiken verstehen lässt.
Blicken wir noch einmal zurück. Wenn wir Michael Tomasello folgen,[12] verdankt sich die grammatische Komplexität der heute bekannten Sprachen einer vorgeschichtlichen, nur hypothetisch nachzukonstruierenden Ausdifferenzierung von Gebärdensprachen zu propositional gegliederten Sprachen. Wenn es denn eine solche menschheitsgeschichtlich frühe Periode der »sprachlichen«,[13] aber allein über deiktische und ikonische Gesten vermittelten Kommunikation gegeben haben sollte,[14] hat sich erst mit der Entstehung 15grammatischer Sprachen die Möglichkeit geboten, die von Durkheim analysierte brüchige Solidarität des gesellschaftlichen Kollektivs und die Anerkennung seines normativen Gefüges, das heißt der institutionalisierten Verwandtschaftsbeziehungen, nicht mehr nur durch Riten zu stützen, sondern auch durch mythische Erzählungen zu interpretieren, zu erklären und zu rechtfertigen. Das Zusammenspiel von Ritus und Mythos begründet ja die sakralen Komplexe, wie sie sich bis heute, oft in hochreflektierter Form, erhalten haben. Bis zur Entwicklung eines säkularen, nachmetaphysischen Selbst- und Weltverständnisses während der westlichen Moderne haben sich alle kulturellen Deutungssysteme in einem solchen sakralen Rahmen entwickelt.
Von einer Versprachlichung des Sakralen möchte ich nun in dem engeren Sinne sprechen, dass sich in diesen Weltbildern ein Bedeutungstransfer aus Quellen sakraler Kommunikation in die Alltagssprache vollzogen hat. Die Leistung mythischer, religiöser und metaphysischer Weltbilder besteht darin, die in kultischen Praktiken versiegelten semantischen Potentiale in der Sprache mythischer Erzählungen oder dogmatisch ausgestalteter Lehren freizusetzen und gleichzeitig im Lichte des jeweils verfügbaren mundanen Wissens zu einem identitätsstabilisierenden Deutungssystem zu verarbeiten. Dabei stellen die Weltbilder einen Zusammenhang zwischen dem einst aus sakralen Quellen gespeisten kollektiven Selbstverständnis der jeweils intersubjektiv geteilten Lebenswelt einerseits und dem erfahrungsgestützten, im profanen Umgang mit der Natur erworbenen Weltwissen andererseits her. Sie stiften einen internen, also begrifflichen Zusammenhang zwischen dem traditionsgeschützten konservativen Selbstverständnis und dem in ständiger Revision begriffenen Weltverständnis.[15]
16Nun bedürfte es einer Untersuchung zur Genealogie von Glauben und Wissen, um die reflexive Verflüssigung, Sublimierung und Verschiebung semantischer Potentiale ursprünglich ritueller Herkunft wenigstens in wichtigen Stationen, also in Umrissen der Weltbildentwicklung plausibel zu machen. Dafür bieten die vorliegenden Aufsätze keinen Ersatz, bestenfalls Anhaltspunkte. Aber die Idee einer solchen, bisher unausgeführten Genealogie mag erklären, warum ich überhaupt die Tatsache einer vitalen Zeitgenossenschaft religiöser Überlieferungen und Praktiken als eine Herausforderung für die Philosophie begreife.
Die Philosophie besteht – nach dem behaupteten Ende der Metaphysik – nicht länger auf ihrem anfänglichen platonischen Heilsweg der kontemplativen Vergewisserung der kosmischen Alleinheit. Sie konkurriert also in dieser Hinsicht nicht mehr mit religiösen Weltbildern. Befördert von der nominalistischen Revolution, hat sie sich aus der Umklammerung der Religion gelöst und beansprucht nun, Moral und Recht, überhaupt den normativen Gehalt der Moderne aus Vernunft allein zu begründen. Andererseits kann die Kritik an einem verfehlten szientistischen Selbstverständnis darauf aufmerksam machen, dass die Philosophie nicht in Wissenschaft aufgeht. Im Unterschied zu den objektivierenden Wissenschaften teilt sie mit religiösen und metaphysischen »Weltbildern« noch die selbstreflexive Einstellung, in der sie das (heute durch den Filter der institutionalisierten Wissenschaften hindurchgehende) Weltwissen verarbeitet. Sie beteiligt sich nicht unmittelbar an der Vermehrung unseres Wissens über die Welt, sondern fragt danach, was das wachsende Weltwissen, das im Umgang mit der Welt Gelernte, jeweils für uns bedeutet. Statt beispielsweise in der Rolle einer Hilfsdisziplin für die Kognitionswissenschaften aufzugehen, sollte die Philosophie nach wie vor ihrer Aufgabe nachgehen, im Lichte der verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse ein begründetes Selbst- und Weltverständnis zu artikulieren.
Es besteht kein Grund, am säkularen Charakter des nachmetaphysischen Denkens zu rütteln. Aber das Faktum, dass Religionsgemeinschaften mit ihrer kultischen Praxis eine wie auch immer reflexiv gebrochene und sublimierte Verbindung mit archaischen 17Anfängen der rituellen Erzeugung normativer Bindungsenergien aufrechterhalten, konfrontiert das nachmetaphysische Denken mit folgender Frage: Können wir wissen, ob der Prozess der Versprachlichung des Sakralen, der sich in der Arbeit an Mythos, Religion und Metaphysik über die Jahrtausende hinweg vollzogen hat, erschöpft und abgeschlossen ist? Allerdings stellt sich für die Philosophie die Aufgabe einer Fortsetzung der bisher innerhalb religiöser Lehren vollzogenen, gewissermaßen »theologischen« Versprachlichung des Sakralen nun »von außen«. Für sie kann Versprachlichung nur heißen, in religiösen Überlieferungen die noch unabgegoltenen semantischen Potentiale zu entdecken und mit eigenen begrifflichen Mitteln in eine allgemeine, über bestimmte Religionsgemeinschaften hinaus zugängliche Sprache zu übersetzen – und so dem diskursiven Spiel öffentlicher Gründe zuzuführen.
Die Überlegungen und Repliken, die der zweite Abschnitt des Buches enthält, dienen der Variation dieser einzigen Frage. Sie sammeln Evidenzen für eine veränderte Konstellation im Verhältnis der Philosophie zu den Wissenschaften auf der einen, den religiösen Überlieferungen auf der anderen Seite. Und sie exemplifizieren ein dialogisches Verhältnis zu religiösen Gesprächspartnern, das eine lernbereite Philosophie einnehmen könnte, ohne diesen Dialog als ein Nullsummenspiel zu betrachten.[16] Die Relevanz, die das für politische Fragen des weltanschaulichen Pluralismus hat, liegt auf der Hand. Der dritte Abschnitt knüpft daher an diejenigen aktuellen Diskussionen an, die belegen, dass die Religionsgemeinschaften auch noch nach der Säkularisierung der Staatsgewalt für eine demokratische Legitimation der Herrschaftsordnung relevant bleiben. John Rawls geht in seiner politischen Theorie von der Einsicht aus, dass die Säkularisierung der Staatsgewalt nicht ohne weiteres eine Säkularisierung der Bürgergesellschaft bedeutet. Mich beschäftigen die Konsequenzen, die sich daraus für die Rolle von Religionsgemeinschaften in der politischen Öffentlichkeit ergeben.
18In demokratischen Verfassungsstaaten ist aus normativer Sicht das Verhältnis von Religion und Politik ziemlich übersichtlich. Umso befremdlicher sind die ausgeflippten Reaktionen auf Ausbrüche der religiösen Gewalt und auf die Schwierigkeiten, die unsere postkolonialen Einwanderungsgesellschaften damit haben, fremde Religionsgemeinschaften zu integrieren. Ich will das Gewicht dieser politischen Probleme nicht herunterspielen, aber was die politische Theorie dazu zu sagen hat, ist nicht wirklich strittig. In unserer Situation überzeugt die Beschwörung »des Politischen« als Heilmittel gegen eine administrativ verselbständigte und zugleich global entmächtigte Politik ebensowenig wie der Streit zwischen Säkularisten und vermeintlichen Multikulturalisten, die sich gegenseitig des Aufklärungsfundamentalismus oder der Aufweichung der Grundrechte bezichtigen.
Starnberg, im Juni 2012
Jürgen Habermas
191. Von den Weltbildern zur Lebenswelt
Wenn wir unser Welt- und Selbstverständnis auf Begriffe bringen, sprechen wir von Weltbildern oder Weltanschauungen. Während in »Weltanschauung« der Prozess der Erfassung des Ganzen mitschwingt, betont »Weltbild« eher das Ergebnis, den theoretischen oder darstellenden, Wahrheit beanspruchenden Charakter einer Weltdeutung. Beide Ausdrücke haben die existentielle Bedeutung einer Lebensorientierung – Weltanschauungen und Weltbilder orientieren uns im Ganzen unseres Lebens. Dieses Orientierungswissen darf selbst dann nicht mit wissenschaftlichem Wissen verwechselt werden, wenn es mit dem Anspruch einer Synthese von einstweilen gültigen Forschungsergebnissen auftritt. Das erklärt den distanzierten Sprachgebrauch: Wenn wir heute »Weltbild« oder »Weltanschauung« nicht überhaupt als pejorative Fremdzuschreibungen gebrauchen, um die Philosophie von fragwürdigen Konkurrenten abzusetzen,[1] wenden wir diese Ausdrücke lieber retrospektiv auf die »starken« Traditionen der Vergangenheit an. In erster Linie meinen wir dann Konzeptionen, die in der einen oder anderen Weise auf die kosmologischen und theozentrischen Weltbilder der Achsenzeit zurückgehen. Dazu gehört in wesentlichen Teilen auch die griechische Philosophie.
Soweit philosophische Lehren ihren Bezug aufs Ganze der Welt, auf den Kosmos, auf die Welt- und Heilsgeschichte oder auf eine Mensch und Kultur einbegreifende Evolution der Natur beibehalten haben, erfüllen sie auch heute noch die Funktion von Weltbildern.[2] Sie lassen sich als Gestalten einer ethischen Selbstverständigung rechtfertigen; aber die mehr oder weniger explizite Selbstauslegung eines besonderen Ethos kann unter den modernen Bedingungen des weltanschaulichen Pluralismus keine Allgemeingültigkeit mehr beanspruchen. Auch die Philosophie tut gut daran, in Gestalt eines nachmetaphysischen Denkens von bloßer 20Weltbildproduktion Abstand zu nehmen. Wie kann sie dieser Forderung genügen, ohne zugleich den Bezug zum Ganzen preiszugeben? Heute zerfällt die Disziplin in die Fragmente ihrer Bindestrichphilosophien, indem sie sich auf die Rekonstruktion jeweils einzelner Kompetenzen wie Sprechen, Handeln und Erkennen spezialisiert oder auf die vorgefundenen kulturellen Gestalten von Wissenschaft, Moral oder Recht, Religion oder Kunst reflektiert. Lassen sich diese Fragmente wieder zu einem Ganzen zusammensetzen, wenn wir vom Fokus der Lebenswelt ausgehen? Der Weg von den Weltbildern zum Konzept der Lebenswelt, den ich skizzieren werde, eröffnet die Aussicht, auf nichtfundamentalistische Weise doch noch zu einer Philosophie »ohne Bindestrich« zu gelangen.
Die Welt der Lebenswelt ist freilich eine andere als die der Weltbilder. Sie hat weder die Bedeutung des erhabenen Kosmos oder der vorbildlichen Ordnung der Dinge noch die eines schicksalsschweren saeculum oder Weltalters, das heißt der geordneten Folge heilsrelevanter Ereignisse. Die Lebenswelt steht uns nicht theoretisch vor Augen, wir finden uns vielmehr vortheoretisch in ihr vor. Sie umfängt und trägt uns, indem wir als endliche Wesen mit dem, was uns in der Welt begegnet, umgehen. Husserl spricht vom »Horizont« der Lebenswelt und von ihrer »Bodenfunktion«. Vorgreifend lässt sich die Lebenswelt als der jeweils nichtüberschreitbare, nur intuitiv mitlaufende Erfahrungshorizont und als nichthintergehbarer, nur ungegenständlich präsenter Erlebnishintergrund einer personalen, geschichtlich situierten, leiblich verkörperten und kommunikativ vergesellschafteten Alltagsexistenz beschreiben. Wir sind uns dieses Existenzmodus unter verschiedenen Aspekten bewusst. Wir erfahren uns performativ als erlebende, in organische Lebensvollzüge eingelassene, als vergesellschaftete, in ihre sozialen Beziehungen und Praktiken verstrickte, und als handelnde, in die Welt eingreifende Subjekte. Was in dieser kompakten Formel zusammengepresst wird, kann nicht wie der gestirnte Himmel über uns angeschaut oder im Vertrauen auf Gottes Wort als verbindliche Wahrheit akzeptiert werden.
Indem wir uns miteinander explizit über etwas in der Welt verständigen, bewegen wir uns in einem Milieu, das sich aus solchen 21performativen Gewissheiten immer schon aufgebaut hat. Es ist Sache der philosophischen Reflexion, die allgemeinsten Züge, gewissermaßen die Architektonik der Lebenswelt, ins Bewusstsein zu heben. Diese Beschreibung erstreckt sich mithin nicht darauf, wie die Welt selbst zusammenhängt, sondern auf die Bedingungen unseres Zugangs zum Geschehen in der Welt. Vom Bild der Welt bleibt nach dieser anthropozentrischen Rückwendung zum Boden und Horizont des In-der-Welt-Seins nur noch der leere Rahmen für mögliches Weltwissen übrig.
Damit verliert die Analyse des lebensweltlichen Hintergrundes auch die Orientierungsfunktion von Weltbildern, die mit ihrem theoretischen Zugriff auf das Ganze zugleich einen praktischen Aufschluss über das richtige Leben versprechen. Gleichwohl möchte Husserl einer Phänomenologie der Lebenswelt, die er in streng deskriptiver Absicht vornimmt, eine wichtige praktische Botschaft abgewinnen. Mit dem Konzept der Lebenswelt möchte er nämlich das vergessene »Sinnesfundament« der Wissenschaften freilegen und damit die Wissensgesellschaft vor einem folgenreichen Objektivismus bewahren. Angesichts der Herausforderung eines szientistisch zugespitzten Naturalismus stellt sich heute eine ähnliche Frage: ob und gegebenenfalls in welchem Sinne die epistemische Rolle der Lebenswelt einer naturwissenschaftlichen Revision des im Alltag operativen Selbstverständnisses von Personen Grenzen zieht.
Ich möchte Husserls These vom vergessenen Sinnesfundament aus dem Blickwinkel einer grob skizzierten Weltbildentwicklung einem Plausibilitätstest unterziehen. Die europäische Philosophie hat mit der Ausarbeitung eines ontologischen und später mit der Konstruktion eines erkenntnistheoretischen Weltbegriffs[3] einerseits einen bedeutenden Anteil an der kognitiven Entflechtung der wissenschaftlich erfassbaren objektiven Welt von den projektiv vergegenständlichten Aspekten einer jeweils im Hintergrund operierenden Lebenswelt. Als eine säkulare Gestalt des Geistes kehrt die Philosophie der Religion den Rücken und verabschiedet sich gleichzeitig von starken metaphysischen Erkenntnisansprüchen. 22Andererseits hat sie, während sie zur Genealogie eines entzauberten und versachlichten Konzepts der Erfahrungswelt beitrug, die epistemische Rolle der Lebenswelt verdrängt. Daher interessiert mich die Frage, wie sich das Selbstverständnis des nachmetaphysischen Denkens mit der Reflexion auf diesen verdrängten Hintergrund verändert.
Zunächst will ich im Vorgriff auf den kommunikationstheoretischen Begriff der Lebenswelt klären, wie sich »Lebenswelt«, »objektive Welt« und »Alltagswelt« voneinander unterscheiden (1). Diese Grundbegriffe werden dazu dienen, die wissenschaftskritische Fragestellung auf den Zusammenhang der Weltbildentwicklung zu beziehen. An dieser Entwicklung interessiert mich die schrittweise kognitive Befreiung der »objektiven Welt« von Projektionen der »Lebenswelt« (2) sowie die transzendentalphilosophische Bearbeitung der Folgeprobleme eines naturwissenschaftlich versachlichten Bildes der objektiven Welt (3). Dieses Bild kompliziert sich noch einmal durch den Aufstieg der Geistes- und Sozialwissenschaften, die gleichzeitig für die Transzendentalphilosophie eine Herausforderung darstellen (4). Die bipolare Versachlichung unseres Bildes von der objektiven Welt und eine entsprechende Detranszendentalisierung der leistenden Subjektivität erklären, warum sich Husserls wissenschaftskritische Fragestellung zu einem Dilemma zuspitzt. Mit der komplementären Beziehung zwischen Lebenswelt und objektiver Welt, die wir in actu nicht hintergehen können, verbindet sich ein epistemischer Dualismus, der dem Bedürfnis nach einer monistischen Weltdeutung widerstreitet (5). Am Schluss gehe ich kursorisch auf einige Versuche ein, aus diesem Dilemma einen Ausweg zu finden (6).
(1) Der Begriff der Lebenswelt stützt sich auf die Unterscheidung zwischen performativem Bewusstsein und falliblem Wissen. Der eigenartige Modus des mitlaufenden, intuitiv gewissen, aber implizit bleibenden präreflexiven Hintergrundwissens, das uns in unseren täglichen Routinen begleitet, erklärt sich daraus, dass uns die Lebenswelt nur performativ, im Vollzug von Akten, die jeweils auf etwas anderes gerichtet sind, gegenwärtig ist. Wie man die Furcht, im lockeren Geröll den Halt zu verlieren, erlebt; was man beim Erröten über einen peinlichen Fehler spürt; wie es sich anfühlt, wenn 23man sich auf die Loyalität eines alten Freundes plötzlich nicht mehr verlassen kann; wie es ist, wenn eine lange praktizierte Hintergrundannahme überraschenderweise ins Wanken gerät – alles das »kennt« man. Denn in solchen Situationen gestörter Lebensvollzüge wird eine Schicht impliziten Wissens aufgedeckt, ob es sich um ein habitualisiertes Können handelt, um eine Befindlichkeit, um eine verlässliche soziale Beziehung oder eine unerschütterliche Überzeugung. Diese Komponenten des abgeschatteten Vollzugswissens bilden, solange sie im Hintergrund bleiben und nicht zum Thema gemacht werden, ein Amalgam.
Im Prinzip kann sich jede dieser Gewissheiten aus einer Ressource der gesellschaftlichen Kooperation und Verständigung in ein Thema verwandeln, insbesondere dann, wenn der normale Vollzug gestört wird und Dissonanzen auftreten. Deshalb lässt sich die phänomenologisch beschriebene Lebenswelt auch als Hintergrund kommunikativen Handelns begreifen und auf Verständigungsprozesse beziehen.[4] Im Zentrum des lebensweltlichen Horizonts steht dann nicht mehr wie bei Husserl das Bewusstseinsleben eines transzendentalen Ego, sondern die kommunikative Beziehung zwischen mindestens zwei Teilnehmern, Alter und Ego. Für beide Kommunikationsteilnehmer erschließt sich die Lebenswelt als der mitlaufende, nur implizit gegenwärtige, beliebig zu erweiternde Horizont, worin die jeweils aktuelle Begegnung in den ebenfalls nur performativ gegenwärtigen Dimensionen des erfahrenen sozialen Raums und der erlebten historischen Zeit lokalisiert ist.
Dieser kommunikationstheoretische Ansatz eignet sich zur Klärung der Grundbegriffe »Lebenswelt«, »objektive Welt« und »Alltagswelt« (a), mit deren Hilfe ich die Analyse der Weltbildentwicklung vornehmen möchte (b).
(a) Lebensweltliche Gewissheiten stellen eine intensivierte und gleichwohl defizitäre Form von »Wissen« dar; sie können nämlich nur unter Verlust ihres performativen Modus in Aussageform gebracht werden. Was nicht in der Form von Aussagen wahr oder falsch sein kann, ist auch kein Wissen im strengen Sinne. Wir 24müssen das Hintergrundwissen, von dem bisher die Rede war, in Anführungszeichen setzen. Das, was wir auf diese intuitive Weise »kennen«, können wir nämlich nur explizit machen, indem wir es in eine Beschreibung umformen; dabei löst sich jedoch der Vollzugsmodus des bloß »Bekannten« auf – er zerfällt gewissermaßen. Interessanterweise bilden davon allein illokutionäre Akte eine Ausnahme. Die illokutionären Bestandteile von Sprechhandlungen – wie »ich gestehe dir, dass ich […]«, »ich empfehle dir, dass du […]« oder »ich bin fest davon überzeugt, dass p« – bringen den Vollzugsmodus von Gelebtem oder Erlebtem, von interpersonalen Beziehungen und von Überzeugungen als solchen zum Ausdruck, ohne ihn ausdrücklich zu repräsentieren; denn in jedem Fall handeln die mit dem illokutionären Akt geäußerten propositionalen Gehalte von etwas anderem. Das peinliche Geständnis, der freundschaftliche Rat und die feste Überzeugung können beliebige Inhalte haben. Aber dieses Was wird nur im Fall einer konstativen Sprechhandlung als ein bestehender Sachverhalt präsentiert. Im Falle der expressiven Äußerung wird der Inhalt zum Inhalt eines privilegiert zugänglichen Erlebnisses, den eine erste Person anderen »eröffnet«, und im Falle der regulativen Sprechhandlung wird er zum Inhalt einer interpersonalen Beziehung, die eine erste zu einer zweiten Person aufnimmt. Alle drei Modi spiegeln sich in den Geltungsansprüchen der korrespondierenden Sprechhandlungstypen – in den Wahrhaftigkeits-, Richtigkeits- bzw. Wahrheitsansprüchen, die Sprecher für Sätze der ersten Person, für Sätze, die an zweite Personen adressiert sind, bzw. für deskriptive Aussagen erheben. Dank dieser Trias von Geltungsansprüchen gelangt der performative Sinn des subjektiv Gelebten, des intersubjektiv Verbindlichen und des als objektiv Vermeinten über die sprachliche Kommunikation in den öffentlichen Raum der Gründe.
In unserem Zusammenhang interessiert nun das Verhältnis von Lebenswelt und objektiver Welt, das sich in der Doppelstruktur der Sprechhandlungen spiegelt. Die Sprecher gehören im Vollzug ihrer illokutionären Akte einer Lebenswelt an, während sie sich mit der Verwendung der propositionalen Bestandteile dieser Akte auf etwas in der objektiven Welt beziehen. Im kommunikativen Handeln unterstellen sie diese objektive Welt gemeinsam als die 25Gesamtheit der beschreibungsunabhängig existierenden Gegenstände oder Referenten, von denen Sachverhalte ausgesagt werden können. Das bedeutet allerdings nicht, dass Aussagen über die Lebenswelt selbst unmöglich wären. Die beteiligten Personen können gegenüber ihrem eigenen Engagement die Einstellung einer dritten Person einnehmen und eine performativ hergestellte kommunikative Beziehung in einem weiteren Akt der Verständigung zum Thema machen, und das heißt: als etwas in der Welt Vorkommendes behandeln. Denn alles, was zum Inhalt einer Proposition gemacht wird, wird als etwas in der Welt Gegebenes oder Bestehendes zum Thema.
Trotz des unüberbrückbaren intentionalen Abstandes von dem, was in der objektiven Welt geschieht – zwischen dem Vollzug und dem expliziten Inhalt einer Kommunikation –, gehört es zur Erfahrung der Kommunikationsteilnehmer und zu ihrem Hintergrundwissen, dass sich der Kommunikationsvorgang, in den sie aktuell verwickelt sind, in derselben Welt ereignet, der auch die Referenten ihrer im selben Augenblick gemachten Aussagen angehören. Die Lebenswelt als Bestandteil der objektiven Welt genießt gewissermaßen einen »ontologischen Primat« vor dem jeweils aktuellen Hintergrundbewusstsein des einzelnen Angehörigen, denn die performativ gegenwärtigen Lebensvollzüge – also Erlebnisse, interpersonale Beziehungen, Überzeugungen – setzen den organischen Leib, die intersubjektiv geteilten Praktiken und die Überlieferungen voraus, in denen sich die erlebenden, handelnden und sprechenden Subjekte »immer schon« vorfinden.
(b) Auf die Existenzweise dieser in symbolischen Formen artikulierten Lebenswelten und auf die objektivierende Beschreibung dieser »soziokulturellen Lebensformen« komme ich noch zurück. Zunächst geht es um das »Bild«, das wir uns im Alltag von der alles einschließenden objektiven Welt machen. Zwar können wir uns von der im Hintergrund präsenten Lebenswelt, in deren Horizont wir uns intentional auf etwas »in der Welt« richten, so lange nicht lösen, wie wir im Vollzug dieser intentionalen, ob nun sprachlichen oder nichtsprachlichen, Aktivitäten begriffen sind. Aber wir können wissen, dass dieselbe objektive Welt – aus der Perspektive eines distanzierten Beobachters – wiederum uns, unsere Interakti26onsnetze und deren Hintergrund Seite an Seite mit anderen Entitäten einschließt. Das prägt unsere inklusive Alltagswelt, die Welt des Common Sense. Diese dürfen wir mit dem philosophischen Begriff der Lebenswelt nicht gleichsetzen, obwohl die performativen Züge der Lebenswelt auch die Struktur unserer Alltagswelt – ihre Zentrierung um uns, unsere Begegnungen und Praktiken, unsere Befindlichkeiten und Interessen – bestimmen. Aber die »Alltagswelt« ist inklusiv, enthält nicht nur die performativ vertrauten, sondern auch die wahrgenommenen Elemente der natürlichen Umgebung, die uns frontal begegnen. Die Alltagswelt erschöpft sich nicht in ihren lebensweltlich konstituierten Ausschnitten, in den performativ vertrauten subjektiven Lebensvollzügen, sozialen Beziehungen und kulturell überlieferten Selbstverständlichkeiten. Unmittelbar ist es diese Alltagswelt, die das Bild, das wir uns von der »objektiven Welt« machen – unser Weltbild also –, prägt.
Im Alltag kategorisieren wir die Dinge, die uns in der Welt begegnen, nach den Ebenen des praktischen Umgangs. Grob gesagt kategorisieren wir sie als Personen, wenn sie uns in kommunikativen Beziehungen begegnen können; oder als Normen, Sprechakte, Handlungen, Texte, Zeichen, Artefakte usw., wenn wir sie als etwas von Personen Hervorgebrachtes verstehen können; oder als Tiere und Pflanzen, wenn sie uns durch den Eigensinn organischer, das heißt sich selbst reproduzierender und grenzerhaltender Systeme zu enthaltsamen Formen des Umgangs (wie Hege und Pflege oder Züchtung) nötigen; oder wir begreifen die Dinge als manipulierbare Körper, wenn wir ihnen alle lebensweltlichen Qualitäten abstreifen können, die ihnen aus anderen Umgangserfahrungen anhängen (z. B. die Qualitäten eines »Zeuges« oder einer Naturschönheit). Nicht zufällig erinnert die alltagsnahe Ontologie, die wir noch bei Aristoteles finden, an dieses von Umgangserfahrungen geprägte »Bild« der »objektiven Welt«.
Die Produktion von Weltbildern – der geschichtlich variierenden Bilder, die wir uns jeweils von der objektiven Welt machen – setzt offenbar an den trivialen Schichten der Alltagswelt an. Während die wissenschaftliche Weltsicht an die Alltagskategorie der Körper anschließt und das Universum als die naturgesetzlich geregelte Gesamtheit physikalisch messbarer Zustände und Ereignisse begreift, 27ordnen die ältesten mythischen Überlieferungen fast alles Geschehen in die kommunikativen Beziehungen zwischen Personen ein. Die Welt, die sich in diesen mythischen Erzählungen spiegelt, ist, wenn man den kulturanthropologischen Darstellungen vertrauen darf,[5] monistisch verfasst; es gibt nur eine Ebene von Phänomenen, kein »An-sich-Seiendes« hinter den Phänomenen. Das erzählte Geschehen strukturiert sich in der Form sozialer Interaktionen, an denen Personen und Tiere, aber auch die Geister der Ahnen und imaginierte Natur- und Ursprungsgewalten, überpersönliche Mächte und personalisierte Götter teilnehmen.[6] Beinahe jeder kann mit jedem und alles mit allem kommunizieren, Gefühle und Wünsche, Absichten und Meinungen ausdrücken und reziprok aufeinander einwirken.
Aus den Narrativen entsteht ein Netz von »Korrespondenzen«, in das auch rituelle Handlungen eingebettet sind; aus dieser Einbettung zieht der in Begräbnis- und Opferriten, in Ahnenkulten und Naturzaubern organisierte Umgang mit den mythischen Mächten seine Evidenz. So verschmilzt in magischen Praktiken die performative Einstellung, in der sich eine erste Person auf eine zweite Person einstellt, um sich mir ihr über etwas zu verständigen, mit der objektivierenden Einstellung eines Technikers gegenüber unpersönlichen oder überpersönlichen Mächten, auf die er kausalen Einfluss ausüben möchte. Indem der Zauberer mit einem Geist kommuniziert, erlangt er Gewalt über ihn. Das bezeugt eindrucksvoll die Dominanz einer einzigen Kategorie, nämlich der des kommunikativen Handelns.
28Offenbar werden sogenannte mythische Weltbilder nicht nur von den totalisierenden Zügen einer zentrierten, jeweils »von uns« bewohnten Lebenswelt geprägt; sie werden vom performativen Bewusstsein der Lebenswelt so durchdrungen und strukturiert, dass die ins kommunikative Handeln grammatisch eingebaute und von den Beteiligten im Alltagsleben praktisch gehandhabte Unterscheidung zwischen Lebenswelt und objektiver Welt in den Weltbildern früher Stammesgesellschaften verfließt. Die Kategorien des verständigungsorientierten Handelns strukturieren das innerweltliche Geschehen im Ganzen, so dass aus unserer Sicht das Weltgeschehen von den lebensweltlich konstituierten Ausschnitten der Alltagswelt absorbiert wird.
Für uns besteht zwischen diesen mythischen Anfängen und dem Weltbild der modernen Wissenschaft ein eigentümlicher Kontrast. Dieser Gegensatz suggeriert eine Weltbildentwicklung, in deren Verlauf die »an sich« bestehende objektive Welt für die Beteiligten schrittweise von den projektiven Überschüssen lebensweltlicher Qualitäten gereinigt worden ist. Die Sicht auf die objektive Welt wird auf dem Wege der Bewältigung empirisch ausgelöster und bewältigter kognitiver Dissonanzen versachlicht. Müsste nicht aus dieser Sicht ein szientistisch zugespitzter Naturalismus das letzte Wort behalten? Oder lässt sich Husserls These vom vergessenen Sinnesfundament der Wissenschaften mit dem Argument verteidigen, dass der fortschreitende Versachlichungstrend zu einer immer schärferen Polarisierung zwischen der nur noch formal bestimmten, aber epistemisch nicht hintergehbaren Lebenswelt und einer wissenschaftlich objektivierten Welt geführt hat?
(2) Die folgende, sehr grobe Skizze der Weltbildentwicklung ist ein Vorschlag, drei Zäsuren auf dem Wege »von den Weltbildern zur Lebenswelt« als kognitive Schübe zu begreifen, die zu erweiterten Weltbildperspektiven geführt haben. Aus diesem selektiven und entsprechend voreingenommenen Blickwinkel geht es mir zunächst um den Schritt von dem soeben skizzierten weltverhafteten mythischen Denken zu einer Perspektive auf die Welt im Ganzen; sodann um die eigentümliche okzidentale Verbindung eines theozentrischen mit einem kosmologischen Weltbild, die zu einer Polarisierung zwischen Glauben und Wissen führt; und schließlich um 29die Emanzipation des naturwissenschaftlichen Weltwissens von der Metaphysik, welche den Zusammenhang von Kosmologie und Ethik auflöst und damit die gemeinsame Vernunftbasis von Glauben und Wissen zerstört.
Da dieses Vorhaben den Blick auf die okzidentale Entwicklung einengt und selbst dann mehrere Bücher oder gar Bibliotheken füllen müsste, kann ich meinen Vorschlag im Hinblick auf unser Thema nur unter einem einzigen Aspekt verfolgen: wie sich in der Folge dieser präsumtiven Lernschritte die begrifflichen Konstellationen von »Lebenswelt«, »objektiver Welt« und »Alltagswelt« verschoben haben.
Karl Jaspers hat mit dem Konzept der Achsenzeit die Aufmerksamkeit auf das Faktum gelenkt, dass sich während einer relativ kurzen Zeitspanne um die Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends in der Welt der Hochkulturen vom Nahen bis zum Fernen Osten ein kognitiver Durchbruch vollzogen hat.[7] Damals entstehen in Persien, Indien und China, in Israel und Griechenland die bis heute wirksamen religiösen Lehren und kosmologischen Weltbilder. Diese »starken Traditionen« – Zoroastrismus, Buddhismus und Konfuzianismus, Judaismus und griechische Philosophie – haben einen Wandel der Weltanschauung von der Mannigfaltigkeit der narrativ auf derselben Ebene verknüpften Oberflächenphänomene zur Einheit eines theologisch oder »theoretisch« begriffenen Weltganzen herbeigeführt. Im Monotheismus nimmt die kosmische »Ordnung der Dinge« die verzeitlichte Gestalt einer teleologischen Ordnung der Weltalter an.
Inzwischen hat das Konzept der Achsenzeit eine weitverzweigte internationale Forschung inspiriert.[8] In unserem Zusammenhang interessiert vor allem die Befreiung aus der kognitiven Befangenheit eines beteiligten Akteurs, der sich das Weltgeschehen nur aus der Innenperspektive eines selber in mythische Geschichten Verstrickten vergegenwärtigen kann. Die neuen dualistischen Weltbilder brechen mit diesem flächigen Monismus. Sie erschließen mit der Konzeption eines einzigen Gottes jenseits der Welt oder mit 30Begriffen einer kosmischen Gesetzmäßigkeit Perspektiven, aus denen die Welt als ein objektiviertes Ganzes in den Blick gelangt. Der Bezug auf den ruhenden Pol des Einen Weltenschöpfers, des Alles im Gleichgewicht haltenden Nomos, der tiefliegenden Realität des Nirwana oder des ewigen Seins verschafft dem Propheten und dem Weisen, dem Prediger und dem Lehrer, dem kontemplativen Betrachter und dem Mystiker, dem Betenden und dem Philosophen, der sich in intellektuelle Anschauung versenkt, die nötige Distanz von dem Vielen, Zufälligen und Veränderlichen. Gleichviel, ob die dualistische Weltsicht wie in den Erlösungsreligionen Israels oder Indiens stärker oder wie in der griechischen Philosophie und den chinesischen Weisheitslehren schwächer ausgeprägt ist, diese intellektuellen Eliten vollziehen überall den kognitiven Durchbruch zu einem transzendenten Standpunkt.
Von hier aus betrachtet lässt sich alles, was in der Welt geschieht, von der Welt im Ganzen unterscheiden. Und dieser Blick auf das Seiende und die Menschheit im Ganzen erzeugt jene kategoriale Unterscheidung zwischen Wesen und Erscheinung, welche die ältere, expressivistische Unterscheidung zwischen der Geisterwelt und deren Manifestationen ablöst (und im Übrigen magischen Vorstellungen den weltanschaulichen Boden entzieht). Mit der Differenzierung in »Welt« und »Innerweltliches« wird die Alltagswelt zur Sphäre der bloßen Erscheinungen abgewertet. Dieser theoretische Durchgriff auf Wesenheiten erweitert die explanative Kraft von Erzählungen. Der konzeptuelle Rahmen kann nun die Masse des praktischen, naturkundlichen und medizinischen Wissens, auch die astronomischen und mathematischen Kenntnisse, die sich inzwischen in den städtischen Zentren der frühen Hochkulturen angesammelt hatten, verarbeiten und zu einem kohärenten, überlieferungsfähigen Ganzen integrieren.
Während der Mythos mit den Alltagspraktiken eng verwoben blieb und noch nicht die Eigenständigkeit eines theoretischen »Bildes« von der Welt erlangte, artikulieren sich in den Weltbildern der Achsenzeit philosophische und theologische Begriffe einer »objektiven«, alles einbegreifenden Welt. Mit diesem gläubig oder kontemplativ erfassten Weltganzen löst sich für die Beteiligten jene Fusion der »objektiven Welt« mit der »Lebenswelt« auf, die wir31heute aus mythischen Weltbildern herauslesen. Mit der Ein- und Unterordnung der zum bloßen Phänomen herabgestuften Alltagswelt wird aus unserer Sicht der Tatsache Rechnung getragen, dass die performativ gegenwärtige Lebenswelt zusammen mit den Praktiken und Verweisungszusammenhängen, in denen sie sich den kommunikativen Handelnden erschließt, wie alle übrigen Entitäten in der Welt vorkommt.
Diese Versachlichung hat freilich ihren Preis. In den Weltbildern der Achsenzeit taucht die Lebenswelt nicht als solche auf, sondern verschmilzt mit den Erscheinungen der Alltagswelt. Für die Gläubigen und die Philosophen verschwindet die eigene, in ihrem Rücken fungierende Lebenswelt derart hinter den ontotheologisch vergegenständlichten Bildern der Welt, dass ihnen die projektiven Züge verborgen bleiben, die diese Weltbilder nach wie vor dem performativen Bewusstsein ihrer vital gelebten und geleisteten Existenz in der Welt entlehnen. Das lässt sich an drei Aspekten der Lebenswelt zeigen, die sich in der Welt der Kosmologien und Theologien widerspiegeln:
– Der Kosmos und die Heilsgeschichte werden in Dimensionen des gelebten sozialen Raums und der erfahrenen historischen Zeit entworfen. Daher verfließen die Grenzen der objektiven Welt mit dem ins Übermenschliche projizierten lebensweltlichen Horizont einer bewohnbaren, auf uns zentrierten Welt, von der die flüchtigen Erscheinungen unserer Alltagsexistenz wiederum einen Bestandteil bilden. In dieser Architektonik des »Umgreifenden« (Jaspers) behält das teleologisch verfasste Weltganze die lebensweltlichen Charaktere unseres alltäglichen Umgangs mit Mensch, Tier, Pflanze und unbelebter Natur.
– Zweitens sind die Weltbilder der Achsenzeit keineswegs Theorien im Sinne einer wertneutralen Beschreibung bekannter Tatsachen. Denn die theoretische Weltdeutung ist schon in ihren starken, evaluativ gehaltvollen Grundbegriffen mit Geboten der praktischen Lebensführung verklammert. Wenn die Beschreibung des Ganzen mit der Hilfe von Konzepten wie »Gott« oder »Karman«, »to on« oder »Tao« vorgenommen wird, gewinnt die Beschreibung der Heilsgeschichte bzw. des Kosmos den zugleich wertenden Sinn eines exemplarischen Seienden, dessen Telos für die Gläubigen 32und Weisen normativ, als Gesolltes und Nachahmenswertes, ausgezeichnet wird. Diese konzeptuelle Verschmelzung der Sollgeltung normativer Aussagen mit der Wahrheitsgeltung deskriptiver Aussagen erinnert an das Syndrom des lebensweltlichen Hintergrundes, das sich erst im Zuge einer sprachlichen Thematisierung auflöst und in die verschiedenen Geltungsdimensionen der entsprechenden Typen von Sprechhandlungen verzweigt.
– Schließlich hängt mit dem praktischen Sinn der theoretischen Weltdeutung auch der Unfehlbarkeitsanspruch zusammen, mit dem religiöse und metaphysische »Wahrheiten« auftreten. Wenn sich die verschiedenen Konzeptionen der Welt und der Weltalter in Heilswegen oder politisch maßgebenden Modellen der Lebensführung »auszahlen« sollen, müssen theoretische Überzeugungen den Anforderungen an die Belastbarkeit von ethisch-existentiellen Gewissheiten genügen. Daraus erklärt sich die dogmatische Denkform, die den Glaubens- und Weisheitslehren die Gestalt »starker« Theorien verleiht. Mit dem Anspruch auf infallible Wahrheiten reicht gleichsam der performative Wissensmodus aus der Lebenswelt in den Bereich des expliziten Weltwissens hinein.
Soweit sich die Weltbilder der Achsenzeit retrospektiv durch eine undurchschaute Projektion von solchen Aspekten der Lebenswelt auf die objektive Welt charakterisieren lassen, zeichnet die Struktur des Weltkonzepts auch schon den Weg zu einer möglichen Versachlichung vor. Die Entwicklung weist erstens in Richtung eines dezentrierten Begriffs der Welt als der Gesamtheit physikalisch beschreibbarer Zustände und Ereignisse; zweitens in Richtung einer Trennung der theoretischen von der praktischen Vernunft; und schließlich in Richtung eines fallibilistischen, aber nichtskeptischen Verständnisses von theoretischem Wissen. Diese Fluchtpunkte verweisen natürlich auf unsere eigene hermeneutische Ausgangssituation, das heißt auf ein nachmetaphysisches Welt- und Selbstverständnis, wie es sich seit dem 17. und 18. Jahrhundert herausgebildet hat. Um dieser narzisstischen Konstruktion wenigstens den geschichtsphilosophischen Anschein von Notwendigkeit zu nehmen, müsste ich nun auf die historisch zufälligen Konstellationen eingehen, die erst den unwahrscheinlichen und singulären Fall der systematischen Verkoppelung eines kosmologischen Weltbildes 33mit einer theologischen Lehre erklären – und damit die produktive Zusammenführung des paulinischen Christentums und der griechischen Metaphysik zur Doppelgestalt eines hellenisierten Christentums und eines theologisch verwahrten Platonismus. In den folgenden Jahrhunderten arbeitet sich der Diskurs über Offenbarung und natürliche Vernunft am Sprengsatz von Wissenschaften ab, die – wie die Mathematik, Astronomie, Medizin und die Naturphilosophie – ihrer jeweils eigenen Logik folgen. Der Diskurs über Glauben und Wissen entfaltet allerdings erst mit der arabisch vermittelten Aristotelesrezeption im 12. und 13. Jahrhundert seine explosive Kraft.[9] Dabei schärfen die Oppositionsbegriffe »Glauben« und »Wissen« ihr Profil aneinander.
Die gemeinsame Vernunftbasis von Glauben und Wissen zerbricht aber in dem Maße, wie die Naturphilosophie ihre Anschlussfähigkeit an eine Theologie, die doch auf der Höhe der zeitgenössischen Wissenschaften bleiben wollte, verliert. Die teleologisch angelegte Ontologie des Aristoteles enthält noch ein Sinnpotential, das für den soteriologisch gedeuteten Praxisbezug offen ist. Aber der scholastische Nominalismus bahnt den Weg zu einer unbefangenen empirischen Naturbetrachtung sowie schließlich zu einer nomologischen Erfahrungswissenschaft, die im Buch der Natur keine göttliche Handschrift mehr entdecken kann; er bereitet auch eine Erkenntnistheorie vor, die die Natur dieser modernen Naturwissenschaft dem menschlichen Verstand zuordnet.[10] Mit dieser zweiten Weichenstellung verkehren sich bei der Kompatibilitätsprüfung von Religion und Wissenschaft die Beweislasten, weil sich um die modernen Erfahrungswissenschaften und um die säkularen Staatsgewalten fortan eigensinnige philosophische Diskurse bilden, die sich gegenüber der Theologie verselbständigen.[11]
Auf dieser Linie nimmt die bis dahin theologisch eingehegte Metaphysik während des 17. Jahrhunderts die Gestalt philosophischer 34Systeme an, die ihre formativen Anstöße sowohl von der Erkenntnistheorie wie vom Vernunftrecht erhalten. Die physikalisch erkannte Welt der bewegten und kausal aufeinander einwirkenden Körper verliert den Charakter eines »Worin« des menschlichen Daseins. Gleichzeitig büßt das theoretische Wissen von dieser Welt, das nicht länger mit der praktischen Vernunft verschwistert ist, seine lebensorientierende Kraft ein. Aus diesem Grund muss auch das christliche Naturrecht von einem aus praktischer Vernunft allein konstruierten Menschenrecht abgelöst werden. Von nun an lässt das Interesse der Philosophie an ihrem Verhältnis zur Religion nach. Das nachmetaphysische Denken konzentriert sich auf das Verhältnis der Philosophie zur Wissenschaft. Auf diese Weise entsteht ein Defizit, auf das ich hier nicht näher eingehe.[12]
Mit dem Schub zum säkularen und verwissenschaftlichten Weltverständnis der Moderne verändert sich erneut die begriffliche Konstellation von Lebenswelt, objektiver Welt und Alltagswelt. Weil die objektive Welt aus allem besteht, worüber wahre Aussagen gemacht werden können, begreifen die philosophischen Zeitgenossen Newtons die Welt nach dem mechanistischen Bild, das die moderne Physik von der Natur im Ganzen entwirft. Zur »Welt« gehören die Gegenstände der Erfahrung, die mit den übrigen Dingen in einer »natürlichen«, das heißt gesetzmäßigen Beziehung stehen. Mathematik und naturwissenschaftliches Experiment lösen die »natürliche Vernunft« der Theologen-Philosophen in ihrer Rolle als der maßgebenden Autorität für die Beurteilung der notorisch unzuverlässigen Alltagserfahrungen ab. Den sinnlichen Phänomenen der Alltagswelt liegen nicht mehr Wesenheiten, sondern die gesetzmäßigen Bewegungen der kausal aufeinander einwirkenden Körper zugrunde.
Mit dem Schritt zum mechanistischen Begriff der Natur scheint das Bild der objektiven Welt von vergegenständlichten Aspekten der Lebenswelt befreit zu sein. Aber welchen Platz nimmt in diesem versachlichten Weltverständnis die Lebenswelt ein? Der von Projektionen entschlackte Weltbegriff ist nicht aus ontologischer, 35sondern zunächst aus erkenntnistheoretischer Sicht eingeführt worden. Er ist das Ergebnis der Reflexion auf die Bedingungen der Möglichkeit zuverlässiger physikalischer Erkenntnis. Deshalb gehört zur objektiven Welt das Gegenüber eines erkennenden Subjekts. Der Lebenswelt lassen die Paarbegriffe des mentalistischen Paradigmas nur die Nische der vorstellenden Subjektivität offen. Dieser Rückzug hinterlässt Spuren sowohl in der aporetischen Gestalt des Mentalen wie im Rumoren praktischer Fragen, für die es nach der Abspaltung der praktischen von der verwissenschaftlichten und nachmetaphysisch ernüchterten theoretischen Vernunft keinen klaren Ort mehr gibt.
(3) Im 17. Jahrhundert entwickelt der Empirismus die Anfänge jenes wissenschaftlichen Weltbildes, gegen das Husserl den Vorwurf des »Objektivismus« erheben wird. Dieses Weltbild entsteht im Paradigma der Bewusstseinsphilosophie und wird daher von deren Problemen heimgesucht. Um das Argument vorzubereiten, dass sich im mentalistischen Paradigma die Lebenswelt hinter der Fassade des subjektiven Geistes verbirgt, erläutere ich zunächst den aporetischen Status des Mentalen (a) und verfolge dann den »moralischen Unglauben« der Empiristen, der Kants transzendentalphilosophische Wende provoziert (b).
(a) Nach der erkenntnistheoretischen Einführung des seither maßgebenden Begriffs der objektiven Welt als Inbegriff aller deskriptiv erfassbaren, letztlich nomologisch erklärbaren Zustände und Ereignisse wird die »Natur des menschlichen Geistes« zum Problem. Denn unter epistemologischen Gesichtspunkten hat das erkennende Subjekt eine gegenüber der Welt im Ganzen externe Stellung bezogen. Als Geist hat sich das Subjekt aus dem Ganzen vorstellbarer Objekte zurückgezogen. Andererseits kann es sich selbst, zusammen mit seinen Vorstellungen, Passionen und Handlungen, als ein in den kausalen Nexus der Welt verflochtenes Objekt in der Welt vorstellen. Daher geht die objektive Welt nicht vollständig in der Gesamtheit der physikalisch erklärbaren Phänomene auf; sie erstreckt sich auch auf das psychologisch zu erklärende Mentale.
Das Mentale lässt sich zwar als Objekt betrachten, aber zugänglich ist es nur im Vollzugsmodus als tätiger und rezipierender Geist. 36Diese der objektiven Welt gegenüberstehende Subjektivität ist das Gegenbild zum in der Welt angetroffenen Mentalen. Den Geist in actu begreift die Erkenntnistheorie als ein empfindendes, vorstellendes und denkendes Bewusstsein und das erkennende Subjekt als ein Selbst, das sich introspektiv von seinem Haben von Vorstellungen von Objekten wiederum Vorstellungen machen kann. Das Bewusstsein verschränkt sich von Haus aus mit Selbstbewusstsein. Die extramundane Stellung dieser verqueren, weil nur performativ im Erleben gegenwärtigen Bewusstseinszustände bleibt ein Stachel für die Konzeption einer versachlichten, alle kausal vernetzten Körper einschließenden Welt. Unter der Beschreibung mentaler Zustände und Ereignisse rückt das Psychische, das ja nur im Vollzug, also aus dem Blickwinkel der ersten Person zugänglich ist, zwar in die begriffliche Perspektive einer vorübergehenden Anomalie. Aber das Mentale behält trotz dieser Anwartschaft auf eine naturwissenschaftliche Erklärung ein Janusgesicht. Erlebnistatsachen machen bis heute auf eine irritierende Unvollständigkeit der objektivierenden Weltbeschreibung aufmerksam.[13]
Im 17. Jahrhundert gibt die Philosophie auf die Frage nach dem Ort eines aus der wissenschaftlich objektivierten Natur gewissermaßen vertriebenen performativen Bewusstseins zunächst noch metaphysische Antworten – eine dualistische Antwort wie Descartes, eine monadologische wie Leibniz oder eine deistische wie Spinoza. Aber aus der Sicht des mentalistischen Paradigmas müssen diese ontologisch ansetzenden Konstruktionen als Rückfall hinter die erkenntnistheoretische Wende erscheinen. Der cartesischen Vergegenständlichung des Geistes zur res cogitans setzt Hobbes die prädikative Auffassung des Mentalen als Tätigkeit oder Leistung, die wir einem Subjekt zuschreiben, entgegen; geistige Fähigkeiten lassen sich dann einem Organismus, also einem körperlichen Ding als Attribut zulegen: »Es könnte also sein, daß das denkende Ding zwar das Subjekt für Geist, Vernunft, Verstand, aber gleichwohl etwas Körperliches wäre; Descartes nimmt das Gegenteil an, aber ohne Beweis.«[14]
37In der Nachfolge von Hobbes scheint der Empirismus von Locke bis Hume die konsequentere Antwort zu geben, wenn er den menschlichen Geist als einen in der Natur selbst befindlichen »Spiegel der Natur« begreift und sich auf die Genese zuverlässigen Wissens konzentriert.[15] Die Natur ruft auf dem Wege der kausalen Einwirkung auf die menschlichen Sinnesorgane im Subjekt Empfindungen und in dessen Urteilen Widerspiegelungen ihrer selbst hervor. Die Gegenseite hat sich freilich von Anfang an nicht so sehr auf den sperrigen ontologischen Status von Erlebnissen berufen; auch Tieren schreiben wir ja die Subjektivität eines bewussten Lebens zu. Aber Einstellungen, die Personen zu Sachverhalten oder zu anderen Personen einnehmen können, sind keine Erlebnisse, die man haben oder nicht haben kann, sondern Akte, die man vollzieht – und die fehlschlagen können. Es ist diese normative Verfasstheit des Geistes, auf die schon Descartes hinweist[16] und die Kant gegen Hume zur Geltung bringt, wenn er den Verstand als ein spontanes Vermögen der Anwendung von Regeln oder Begriffen definiert.
(b) Von einer anderen Konsequenz war Kant noch stärker beunruhigt: Der Empirismus versagt bei der Erklärung der Normativität des Geistes nicht nur im Hinblick auf dessen epistemische, sondern vor allem hinsichtlich seiner moralisch-praktischen Leistungen. Das Bild von der objektiven Welt, das der Verstand aus kontingentem Empfindungsmaterial aufbaut, besteht ausschließlich aus deskriptiven Urteilen, das heißt aus einem wertneutralen Tatsachenwissen. Aus dieser objektivierenden Weltbetrachtung kann die praktische Vernunft keine moralischen Einsichten mehr gewinnen. Evaluative und normative Aussagen lassen sich aus deskriptiven Aussagen nicht begründen. Mit dieser endgültig durch Hume vollzogenen Entkoppelung der praktischen von der theoretischen Vernunft droht die Philosophie überhaupt ihre handlungsorientie38rende Kraft zu verlieren. Gerade dann, wenn sich alle mentalen Vorgänge nach dem Vorbild der Physik erklären ließen, würden sich aus diesen Erkenntnissen keine normativen Orientierungen mehr gewinnen lassen.
Als Personen aus Fleisch und Blut stehen die erkennenden Subjekte der Welt jedoch nicht nur gegenüber. Indem sie miteinander sprechen und zusammen handeln, müssen sie sich im Umgang mit dem, was ihnen in der Welt begegnet, zurechtfinden. Auch die Forschergemeinschaft ist als eine Kooperationsgemeinschaft handelnder Subjekte in den Kontext eines gesellschaftlichen und kulturellen Lebenszusammenhangs eingelassen. Zwar hatte die Philosophie längst keinen eigenen Heilsweg mehr anzubieten. Aber nun nahm auch das normative Wissen der auf Vernunftmoral und Vernunftrecht umgestellten »Ethik« und »Politik« gegenüber dem empirischen, letztlich dem physikalischen Weltwissen nicht nur, wie schon bei Aristoteles, eine inferiore Stellung ein, sondern ihr Wissensstatus war im Kern erschüttert. Auf diese Problemlage, die, wie ich zeigen möchte, durch die mentalistische Verdrängung der Lebenswelt provoziert wird, antwortet Kant, indem er eine revolutionierte Erkenntnistheorie in den Dienst einer nachmetaphysischen Ehrenrettung des kognitiven Anspruchs praktischer Vernunft stellt.
Die Peripetie setzt damit ein, dass Kant den konstruktiven Leistungen des erkennenden Subjekts auf den Grund geht und dessen Kontakt mit der Welt nicht mehr – ausgehend von der Affektion der Sinne – passivisch deutet, sondern transzendental. Dieser Grundgedanke der Konstituierung einer Welt erscheinender Gegenstände verbindet Aspekte der Abhängigkeit mit solchen der Freiheit. Das erkennende Subjekt genießt die Freiheit der kognitiven Gesetzgebung eines endlichen Geistes, der auf die kontingenten Beschränkungen einer unabhängig existierenden Welt reagiert.[17] Zwar operiert auf der Ebene des transzendentalen Bewusstseins der Verstand unter Anleitung der theoretischen Vernunft. Aber mit dem Zugriff auf subjektive Bedingungen möglicher objektiver Erfahrungen gewinnt Kant eine noumenale Ebene, auf der er nicht 39nur das erkennende Subjekt, sondern die spontanen Leistungen der Subjektivität insgesamt einer wissenschaftlichen Objektivierung entziehen kann.
Wie Kant in der Vorrede zur zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft betont, kann die metaphysikkritische Einschränkung des theoretischen Vernunftgebrauchs auf Gegenstände der Erfahrung unter der Prämisse der gesetzgebenden Leistungen eines endlichen Verstandes den »positiven und sehr wichtigen Nutzen haben«, eine transzendentale Ebene der Spontaneität des Geistes freizulegen, auf der auch eine an den praktischen Vernunftgebrauch gebundene Willensfreiheit ihren Platz findet: »Ich mußte also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen, und der Dogmatismus der Metaphysik, d. i. das Vorurteil, in ihr ohne Kritik der reinen Vernunft fortzukommen, ist die wahre Quelle alles der Moralität widerstreitenden Unglaubens, der jederzeit gar sehr dogmatisch ist.«[18] In unserem Zusammenhang ist der Umstand wichtig, dass erst die Residenz des freien Willens im »Reich der Zwecke« ein Phänomen ins Spiel bringt, welches die ganze Sphäre des Noumenalen vor einem naheliegenden Missverständnis bewahren kann.
Mit dem »transzendentalen Faktum« des Sittengesetzes, dem Ankergrund jeder deontologischen Moral, beruft sich Kant nämlich auf ein phänomenologisch überzeugendes Beispiel von Hintergrundwissen. Das merkwürdige Faktum eines Gefühls unbedingter Verpflichtung, das die ganze Beweislast tragen soll, unterscheidet sich nämlich von anderen, deskriptiv erhobenen Tatsachen dadurch, dass es nur im Vollzugsmodus mitthematisiert werden kann. Das Pflichtbewusstsein ist nichts anderes als das im Sprachspiel verantwortlicher Urheberschaft performativ gegenwärtige Wissen, einem vernünftig begründeten moralischen Gebot folgen zu sollen. Wenn man die Lebenswelt als Interpretationsschlüssel für den Status der Freiheit des vernünftigen Willens wählt, verliert die Sphäre des Noumenalen den Anschein einer metaphysisch konstruierten »Hinterwelt« (Nietzsche). Nur im Vollzug kommunikativen Handelns können wir Verpflichtungen, die wir mit sozialen Beziehun40gen eingehen, als solche erfahren. Ohne diese performative Erfahrung wüssten wir nicht, wovon in einer aus der Perspektive einer dritten Person vorgenommenen Beschreibung dieses Sachverhalts die Rede ist. Daher muss der normative Sinn einer moralisch begründeten Verhaltenserwartung am Ursprungsort des Phänomens aufgesucht werden. Die Normativität des Sollens darf weder spekulativ zu einem Gebot der Natur oder zu einem existierenden Wert vergegenständlicht noch psychologisch auf Zustände in der objektiven Welt – auf Lust und Unlust, Belohnung und Strafe – reduziert werden. Die »Idee« der Freiheit ist nur eine unter mehreren Ideen. Kants Ideenlehre beleuchtet allgemein einen performativ gegenwärtigen Hintergrund, der nur dann vergegenständlicht wird, wenn die theoretische Vernunft die Grenzen des legitimen Verstandesgebrauchs überschreitet.[19] In der Unterscheidung zwischen Ideen der praktischen und der theoretischen Vernunft lässt sich schon der Vorgriff auf die Differenz zwischen Lebenswelt und objektiver Welt entdecken. In dieser Lesart bietet Kants Ideenlehre Anschlussstellen für den detranszendentalisierten Begriff einer weltentwerfenden, aber in der kommunikationstheoretisch beschriebenen Lebenswelt situierten Vernunft.[20]
(4) Allerdings mussten die Engpässe des mentalistischen Paradigmas erst überwunden werden, bevor hinter der Fassade des transzendental begriffenen subjektiven Geistes die Lebenswelt entdeckt werden konnte. Zwar weisen schon Humboldts sprachphilosophische Einsichten in die Richtung einer sprachpragmatischen »Aufhebung« der Transzendentalphilosophie.[21] Aber diese von Hegel ausgehende und über Peirce und Dewey sowie über Husserl und Dilthey bis zu Heidegger und Wittgenstein reichende Entfaltung des Gedankens der »Detranszendentalisierung« lässt sich nicht als eine interne, allein von philosophischen Problemen ge41triebene Entwicklung begreifen. Wie sich die Philosophie seit Galilei und Newton mit dem ernüchterten Blick der modernen Naturwissenschaften auf die objektive Welt auseinandersetzen musste, so musste sie seit Hegel mit dem historischen Blick der Geistes- und Sozialwissenschaften auf Kultur und Gesellschaft zurechtkommen. Sowenig die Philosophie seinerzeit der Frage nach dem Status von Bewusstseinstatsachen ausweichen konnte, so wenig kann sie sich nun der Frage entziehen, wie denn dieser den subjektiven Geist offensichtlich überschreitende »objektive« Geist zu begreifen und im Kausalnexus des Weltgeschehens unterzubringen ist.
Erstaunlicherweise finden historische, soziale und kulturelle Tatsachen erst sehr spät ein systematisches wissenschaftliches Interesse. Die historischen Geisteswissenschaften sind aus Kunstlehren hervorgegangen, aus den humanistischen Überlieferungen der Poetik, aus den historischen Darstellungen und den Philologien; in ähnlicher Weise haben sich die neuen Staats- und Sozialwissenschaften aus den klassischen Lehren der Politik und der Ökonomik entwickelt. Diese Kunstlehren hatten mit dem Kanon der – ihrerseits auf die Anfänge der Hochkulturen zurückreichenden – »Freien Künste« die Herkunft aus professionellem Wissen gemeinsam. Wie Grammatik, Rhetorik und Logik, wie Arithmetik, Geometrie und Musik, sogar Astronomie werden Künste und Kunstlehren aus der Reflexion von Teilnehmern auf eine vorgängig beherrschte Praxis entwickelt. Demgegenüber kultivieren die Geistes- und Sozialwissenschaften eine ganz andere Einstellung.
Ihr Interesse richtet sich nicht mehr auf eine Vergewisserung der Regeln einer eingewöhnten Praxis – sei es einer bestimmten Sprache, sei es der bildenden Künste und der Literatur, der Geschichtsschreibung, der Regierungskunst oder der Haushaltsführung. Vielmehr richtet sich jetzt eine methodisch angeleitete