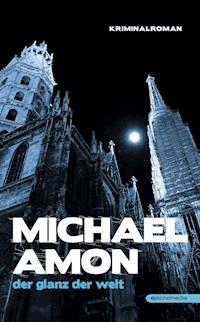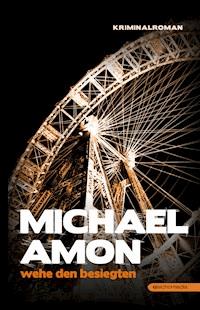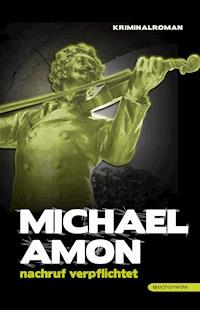
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: echomedia buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Es könnte eine Inszenierung im Stil des Wiener Aktionisten Weinperl sein: eine Nackte auf dem Strauss-Denkmal drapiert, Blut fließt in Strömen. Aber es handelt sich um die offizielle Einweihung des frisch renovierten Denkmals, und die Nackte ist tot, ermordet. Vor Wiener Denkmälern ereignen sich weitere Morde im Stil des Orgientheaters. Wieso sind alle Opfer Mitglieder von Tierschutzorganisationen? Ist Weinperl involviert? Rächt er sich an den Tierschützern, die ihn immer als Tierquäler hingestellt haben? Welche Rolle spielt der geheime Orden „Ritter der Auferstehung”, welche der geheimnisvolle Pater Anselm, der plötzlich in Wien auftaucht? Was steckt hinter den mysteriösen Morden: religiöser oder künstlerischer Wahn? Oder gar gewichtige Geschäftsinteressen rund um einen großen Rüstungsdeal? Die Ermittlungen nehmen ihren Lauf, doch was dann noch so alles ans Licht kommt, damit hat wohl niemand gerechnet … Die in diesem Kriminalroman versteckte Gralssaga verbindet Michael Amon raffiniert mit moderner Gentechnik und deren Möglichkeiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
1. KAPITEL | Ritter der Auferstehung
2. KAPITEL | Ein Denkmal wird enthüllt
3. KAPITEL | Luftgeschäfte
Palermo, Jagd & Sandwichinseln
Brunello, Lamm & Pitralon
4. KAPITEL | Rätsel über Rätsel
Kannibalismus, Markknöderln & Vatikan
Nach der Leiche kein Dessert
5. KAPITEL | Blut ist ein ganz besonderer Saft
Gene, Gral & Hokuspokus
Verschütt’ gehen
6. KAPITEL | Geheimes und weniger Geheimes
Wenn Agenten plaudern
Orgien, Mysterien und das Steuergeheimnis
Eine Mordsüberraschung
7. KAPITEL | Kardinäle, Mafia & Jagdunfälle
Heilige Intrigen
Ein Baron kann sich nicht erinnern
8. KAPITEL | Blut, Tod & Reliquien
Ein seltsames Treffen
Tod, wo ist dein Stachel?
9. KAPITEL | Adel verpflichtet
10. KAPITEL | Ein Mann sieht tot
11. KAPITEL | Nachtrag
Glossar
NACHRUF VERPFLICHTET
Michael Amon
Impressum
Alle Personen dieses Buches sind frei erfunden, ebenso ihre Namen und alle Handlungsstränge. Eventuelle Übereinstimmungen mit lebenden Menschen und wirklichen Ereignissen sind – soweit es sich nicht um belegte geschichtliche Ereignisse handelt – rein zufällig und unbeabsichtigt.
eISBN: 978-3-902900-89-0
E-Book-Ausgabe: 2015
2014 echomedia buchverlag ges.m.b.h.
Media Quarter Marx 3.2
A-1030 Wien, Maria-Jacobi-Gasse 1
Alle Rechte vorbehalten
Produktion: Ilse Helmreich
Layout: Brigitte Lang
Lektorat: Christine Wiesenhofer
Coverfoto: Christian Jobst
E-Book-Produktion: Drusala, s.r.o., Frýdek-Místek
Besuchen Sie uns im Internet:
www.echomedia-buch.at
Tod, wo ist dein Sieg?
Tod, wo ist dein Stachel?
– Paulus, 1. Brief an die Korinther 15,55
… ich befand mich auf der richtigen Seite,
das genügte für meinen Seelenfrieden.
Bei mir wird nicht gesegnet und keine Absolution erteilt.
Es wird ganz einfach
die Rechnung präsentiert: soundsoviel macht es. Die Freiheit ist ein sehr einsamer und erschöpfender
Langlauf. Man ist frei und muss schauen,
wie man sich aus der Affäre zieht.
– Albert Camus, Der Fall
Northern California girls say,
»Baby come home now«
You don’t belong there
Everybody knows this but you
Don’t you miss the ocean?
Don’t you miss the weather?
Don’t you miss me just a little bit?
Northern California girls say,
»Come home from Texas«
– Camper van Beethoven
1. KAPITEL | Ritter der Auferstehung
»Sein Blut komme über uns!«, rief Pater Anselm.
Er stand mit dem Rücken zum Altar und hatte sich mit einer mühsamen Drehung seines Körpers den Anwesenden zugewandt. Das dunkle Kellergewölbe, nur erhellt von flackernden Kerzen, hallte wider von seinen Worten.
Das versammelte Häuflein Menschen, einige Priester in ihren Soutanen, einige Laien in Zivil, antwortete murmelnd im Chor: »Sein Blut komme über uns.«
»Sanguis eius super nos!«, wiederholte Pater Anselm in lateinischer Sprache. Sein alter Körper straffte sich, man sah ihm in diesem Moment sein Lebensalter von mehr als 100 Jahren nicht an, er hob den Kelch und zeigte ihn den Gläubigen: »Das Wort wird erneut Fleisch werden, denn es war bei Gott. Und das Wort war Gott. So hören wir die Worte im Prolog des Evangelisten Johannes. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Licht. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Johannes der Täufer, von Gott gesandt, kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen von Gott, der das Licht ist, das jeden Menschen erleuchtet. Gott war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht.
Wir aber erkennen ihn. Es wird unter uns wohnen, und wir werden seine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, der voll Gnade ist und voll Wahrheit. Im auferstehenden Fleisch ist sein Blut und sein Blut wird auferstehendes Fleisch. In diesem Blut ist sein Leben und unser Leben. Der gesalbte Nazarener, zum Tode verurteilt und hingerichtet als König der Juden, wird erstmals wirklich auferstehen und bleiben von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen!«
Die Menschen waren vor Ehrfurcht so starr wie die sie umgebenden Wände, sie schienen wie verschmolzen mit dem Raum und erwiderten: »Amen!«
Dieses Amen klang mehr wie ein geheimnisvolles Raunen denn wie eine kraftvolle Zustimmung.
Pater Anselm hob beschwörend seine Arme, blickte empor in Richtung Himmel, dorthin, wo er wohl seinen Gott vermutete: »Brüder und Schwestern im Herrn! Wir haben uns hier versammelt zum gemeinsamen Gebet und zur Einnahme des Abendmahls als Feier des Beginns der Apokalypse. Noch nie zuvor in der Geschichte waren wir der wahren Erlösung so nahe, dem Tag des Jüngsten Gerichts. Noch nie waren wir so nahe an der Erfüllung der Prophezeiungen des Johannes, die aus fernen Zeiten überliefert sind. Die Apokalypse steht bevor. Wir sind ihre Diener. Apokalypse heißt Ende und Neubeginn. Heißt Tod und Auferstehung. Vor allem aber: das endgültige Ende des ewigen Kreislaufes von Geburt und Sterben. Es liegt an uns Rittern der Auferstehung, den Messias zurückzuholen, ihn wiederzuerwecken aus jenem Schlaf im Tode, in den er bei seiner Kreuzigung gestürzt worden ist. Noch nie waren wir diesem Ziel so nahe. Wir sind die Werkzeuge der Auferstehung, wir sind ihre treuen Diener. Es liegt an uns, die Menschheit ins ewige Reich Gottes zu führen. Erstmals in der Geschichte haben wir die Mittel dazu, denn Gott hat sie uns gegeben, wir müssen sie nur finden. Dazu ist jedes Mittel recht. Denn wir sind nur Werkzeuge des Allmächtigen.
Noch sind wir auf der Suche, noch haben wir nicht alles gefunden, was wir benötigen, um das Heil zu verwirklichen. Aber wir stehen nur kurz davor, und es wird sein! Wir werden es sehen, und es wird sein wie von Johannes beschrieben. Wir werden die Herrlichkeit Gottes schauen. Verstummen werden die Leugner und Lügner. Die Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und herauskommen werden: Die das Gute getan haben, werden zum Leben auferstehen, die das Böse getan haben, zum Gericht.
Auch wir haben furchtbare Dinge getan. Auf dem Weg zum Heil und der Auferstehung werden wir noch viel Schreckliches auf uns nehmen müssen. Aber wir sind Schuldige im Namen Gottes. Von uns wird man nicht sagen können: Sie liebten das Ansehen bei den Menschen mehr als das Ansehen bei Gott. Zuerst wird der Messias endgültig auferstehen mit unserer Hilfe. Denn seine Auferstehung ist sein Werk und zugleich das unsrige. So hat es Gott gewollt. Und nach dem Messias werden die Märtyrer auferstehen. Mit ihm werden sie tausend Jahre herrschen. Dann erst werden die anderen Toten erweckt, und über sie wird Gericht gehalten. Der Teufel und die von ihm Verführten werden besiegt und in einem See voll Schwefel gequält in alle Ewigkeit. Für die anderen aber wird ewig Jubel sein, ihre Städte kennen keine Nacht und niemand von denen, die verdammt sind, wird in sie hineingelassen werden. Siehe, der Herr kommt bald. Selig, wer an den prophetischen Worten des Johannes festhält. Verdammt sei, wer an seinen Worten zweifelt. Die Zeit des Allmächtigen ist nahe, denn er ist das Alpha und das Omega. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen! Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.«
Die lange Rede hatte Pater Anselm merkbar erschöpft. Er stützte sich am Rednerpult auf und schien ein wenig zu wanken. Erst beim letzten Satz richtete er sich wieder entschlossen auf, seine Stimme wurde erneut fest und laut. Das »Amen« der Anwesenden ebbte durch den Raum. Dann wurde es still. Man hörte nur den schweren Atem von Pater Anselm und die Schritte zweier Messdiener, die auf ihn zutraten, ihn links und rechts unterhakten und mit ihm gemeinsam in langsamen Schritten den Raum verließen. Seine müden Füße schliffen über den Boden, man konnte es bis in die letzte Reihe des kleinen Raumes hören.
Nachdem Pater Anselm und seine beiden Begleiter durch eine Tür neben dem Altar aus dem Raum verschwunden waren, setzte leises, ehrfurchtsvolles Tuscheln ein. Einige bekreuzigten sich ein weiteres Mal. Dann leerte sich nach und nach der Raum. Die meisten verließen ihn schweigend, tief in Gedanken versunken. Einige standen beim Ausgang und wechselten noch ein paar leise Worte. Aus der Nähe konnte man sehen, dass alle Besucher eine kleine, blaue Medaille mit weißem Kruckenkreuz trugen, an deren Rand man eine ebenfalls weiße Inschrift, die Legende, sehen konnte: »Ordo sancti cooperatoris resurrectionis«.
Heiliger Orden der Mitarbeiter der Auferstehung. Was immer das zu bedeuten hatte.
2. KAPITEL | Ein Denkmal wird enthüllt
»Ich hasse Blut«, sagte ich.
»Und Blutlachen erst«, sagte Chiara im selben Moment unbeabsichtigt laut, und ihre linke Hand umklammerte erschrocken meine rechte.
Aber ich greife vor. Erzählen wir lieber der Reihe nach.
Der Tag hatte ganz normal begonnen, es schien einer meiner üblichen, normalen Tage zu werden. Routine und Langeweile hatte ich erwartet, als wir uns auf den Weg zum Stadtpark gemacht hatten.
Wir hatten die Allee neben der Ringstraße verlassen, den Park betreten und ein paar Schritte auf dem Weg hinein in den Park getan, als Chiara mich ansah: »Kannst du mir erklären, warum du mich hierher geschleppt hast?«
»Lass dich überraschen«, ich verlangsamte meine Schritte, »wir sind fast da.« Ich drückte ihre Hand, um sie zu beruhigen.
Hinter uns ertönte knatterndes Motorengeräusch. Motorroller-Motorenlärm und die schrillen Töne einer Trillerpfeife. Zwei-Takter, ein altes Lohner-Sissy-Moped, die österreichische Variante der italienischen Vespa. Der ziemlich dicke Fahrer saß bemerkenswert aufrecht auf dem eher schmächtigen Moped, ignorierte das hier herrschende, absolute Fahrverbot und ratterte – immer wieder kräftig in seine Trillerpfeife blasend – mitten auf dem Gehweg durch den Stadtpark.
»Und was macht dieser Kerl hier mit diesem stinkenden, lärmenden Roller?« Chiara rümpfte die Nase.
»Das weiß ich wirklich nicht, keine Ahnung. Aber der Typ sieht irgendwie aus wie der Weinperl.« Der wallende, weiß-graue Vollbart, das schüttere Haar über den Ohren zerzaust, soweit es nicht unter dem schwarzen Hut mit Binde verschwand, der die Glatze verbarg. Die Ähnlichkeit war verblüffend.
»Der Aktionist?« Chiara neigte zweifelnd den Kopf zu Seite.
»Ja, ich glaube, er ist es wirklich. Das mit der Trillerpfeife ist ganz typisch für ihn, damit dirigiert er seine Aktionen. Aber richtige Aktionen, das war einmal. Nix mehr mit Aktionismus. Jetzt ist er Professor. Ein typisch österreichisches Schicksal«, sagte ich lakonisch und meinte es auch so.
»Ein Schicksal, mit dem man leben kann«, Chiara zuckte gleichgültig mit den Schultern, »vielleicht wäre Italien viel erspart geblieben, wenn man den Berlusconi rechtzeitig zum Professor gemacht hätte.«
»Oder vielleicht noch besser: schon einst in den 1920er-Jahren den Mussolini.« Ich sah Chiara fragend an. Sie zuckte nochmals mit den Achseln: »Was wäre, wenn. Du weißt, dass diese Art von Geschichtsbefragung zu nichts führt, vor allem zu keinen Antworten.«
»Aber Professor Berlusconi, das hätte schon was«, ließ ich nicht locker, »der singt doch, oder?«
»Ja«, Chiara nickte, »ich glaube, der hat tatsächlich als Barsänger begonnen, auf einem Kreuzfahrtschiff. Staubsaugervertreter war er auch.«
»Staubsaugervertreter gehen zu Recht leer aus, aber Sänger aller Sparten bekommen bei uns grundsätzlich den Professorentitel. Spätestens, wenn die Stimme versagt, oder wenn es zum Kammersänger nicht reicht. Aber da ich von Haus aus nicht singen kann …« Ich machte eine wegwerfende Handbewegung, die sowohl Bedauern als auch Gleichgültigkeit bedeuten konnte.
»Vielleicht veranstaltet der Weinperl eine Aktion, eine Spontanaktion. Ist das deine Überraschung für mich?« Chiara konnte sehr hartnäckig sein.
»Wie kommst du auf diese Idee?«
»Immerhin«, sie strich sich die Haare aus dem Gesicht, »besteht hier ein Fahrverbot für alles, was Motor und Räder hat, und der Kerl rattert trotzdem mitten durch den Stadtpark. Gib zu, ich habe es erraten: Wir besuchen eine Aktion vom Weinperl.«
»Nein, sicher nicht«, wehrte ich ab.
»Wirklich nicht?« Chiara war wenig überzeugt von meinen Worten.
»Ehrlich! Nein, das hat überhaupt nichts mit dem Weinperl zu tun. Ich habe keine Ahnung, was den hierher treibt, was der hier zu suchen hat.«
Chiaras Zweifel bestanden fort: »Du schwindelst. Man sieht es dir an. Auf jeden Fall sehe ich es dir an. Überraschung erraten, gib es einfach zu!«
»Da es keine geheimnisvolle Überraschung gibt, kannst du nichts erraten und ich nichts zugeben.«
»Ich glaube dir kein Wort, du hast vorhin gesagt, ich soll mich überraschen lassen.« Chiara hakte sich fester unter.
»Ach«, ich gab mich gleichgültig, »man sagt das so vor sich hin.« Der Geruch des schlecht verbrennenden Zwei-Takter-Treibstoffs, einem Gemisch aus Benzin und Öl, lag in der Luft. Dagegen kam der laue Frühsommerwind nicht an, aber er wehte vom Parkring das Rauschen des Straßenverkehrs in den Park herein. Wir befanden uns noch ziemlich nahe bei jenem Eingang, der sich vis-à-vis des Hotel Marriott befand. Nein, mit Weinperl hatte ich nichts im Sinn. Der ganze Aktionismus war meine Sache nicht.
Unser Stadtparkbesuch hatte wirklich nichts mit Weinperl oder seinen Aktionen zu tun. Ich war schlicht deshalb hier, weil ich sehen wollte, was aus meiner Rede geworden war. Eigentlich schreibe ich keine Reden für Politiker, aber man hatte mich darum ersucht. Das heißt, Otto, ein Jugendfreund und Sekretär des Bürgermeisters hatte die Idee, ich solle als Redenschreiber werken. Wer bin ich, mich zu weigern, wenn der Wiener Bürgermeister Redentexte braucht. Ich hatte zugesagt, ohne mich im Vorhinein schlau darüber zu machen, worum es gehen sollte. Manchmal wird man einfach Opfer der eigenen Eitelkeit. Ich dachte, es wird etwas Politisches sein. Das machen wir schon, auch wenn ich vielleicht eine Meinung vertrat, die sich mit der des Bürgermeisters nicht völlig vertragen sollte. Er ist ein Roter, ich bin ein Roter. Irgendwie bekommt man das schon hin. So genau legen Politiker sich ohnehin nie fest. Da gibt es Spielraum für vage Andeutungen und unklare Formulierungen. Zur Not kann man immer noch sagen: Ist nicht von mir, wurde ohne mein Wissen geändert. Glaubt einem jeder sofort. Ich hatte also zugesagt und eine Weile nichts mehr gehört von der Sache, meine Zusage beinahe schon vergessen.
Dann, ein paar Wochen später, kam plötzlich der Auftrag: Das Strauss-Denkmal werde nach einer Generalrenovierung enthüllt und damit der Öffentlichkeit zurückgegeben, vor allem den Touristen. Das hatte mir gerade noch gefehlt. Der Strauss-Schani und ich.
»Dazu fällt mir nichts ein«, war meine spontane Reaktion gewesen. Die kühle Antwort des Bürgermeister-Sekretärs: »Dem Chef auch net.«
Das saß.
»Der Chef zählt auf dich, du kannst ihn jetzt net hängen lassen.«
Das saß auch. Und ich saß in der Klemme.
Ich konnte nicht einmal Walzer tanzen, schon gar nicht den in Wien beinahe amtlich vorgeschriebenen Linkswalzer. Mit »Links« habe ich kein Problem, aber mit Walzer. Ich habe Tanzschulen stets gemieden. Waren mir zu bürgerlich und zu teuer. Zu bürgerlich sind sie mir noch immer. Die Vorstellung, ein eventuelles Kind von mir könnte davon träumen, auf dem Opernball im Jungdamen- und Jungherrenkomitee die Eröffnung tanzen zu dürfen, löst bei mir heftige Enterbungsreflexe aus. Als ich einst das pubertäre Tanzschulalter erreicht hatte, war für solchen Unsinn zum Glück kein Geld im Haus, und ich hatte überhaupt keine Lust, in einer Tanzschule anzutanzen. Mir reichte die Musik, die ich aus den Fenstern jenes Instituts hörte, an dem ich täglich auf dem Weg zur Schule vorbeikam. Das war keine Musik, das war unmusikalischer Schrott. Jeder Nachttopf scheppert musikalischer.
Ich versuchte nochmals, beim anrufenden Sekretär ein paar Einwände vorzubringen: »Nicht mein Thema, keine Ahnung vom Strauss …«
Der Sekretär war unbarmherzig: »Na, was glaubst denn, dass der Chef davon eine Ahnung hat? Der reißt seinen Servas runter, hält eine launige Rede, die welche du schreiben wirst, zieht dem Schani das verhüllende Tuch vom Denkmal herunter und schaut, dass er bei gutem Wind wegkommt, bevor die heiße Schlacht am kalten Buffet beginnt.«
Das war eine klare Ansage. Eine launige Rede, das auch noch. Unser Bürgermeister ist berüchtigt für seine launigen Reden. Vor allem für seine sorgsam gepflegten Dialektausdrücke, die mitunter durchaus kräftiger ausfallen konnten, als es die Etikette erlaubte. Die sind bei Freund und Feind gleichermaßen gefürchtet.
»Und wie deftig soll, muss die Rede sein?«
»Das ist dein Kaffee. Wunder dich halt nicht, wenn dem Chef ein Sager spontan einfällt. Da ist er hemmungslos. Morgen brauch ich das Machwerk. Meine E-Mail-Adresse hast du ja. Ich verlass mich auf dich!« Er hatte aufgelegt, und ich hatte den Scherm auf. Schöne Arbeitsteilung.
»Spontane Sager vom Chef«, dachte ich, »das auch noch. Dann bin womöglich ich an denen schuld.« Andererseits: Wie oft bekam man schon die Möglichkeit, Reden für den Bürgermeister zu schreiben? Für den Bürgermeister einer Weltstadt. Meiner Heimatstadt. Ein wenig Eitelkeit darf sein. Ich hatte Chiara nichts verraten, es sollte – wie erwähnt – eine Überraschung werden. Ich lächelte, der Weinperl hatte mit unserem kleinen Ausflug in den Stadtpark wirklich überhaupt nichts zu tun.
Während ich so vor mich hin sinnierte, hatten wir das Strauss-Denkmal erreicht. Es war mit breiten Planen verhüllt, ein paar Leute standen herum, vor dem Denkmal blühten Blumen in einem prächtigen Beet, das Stadtgartenamt hatte ganze Arbeit geleistet.
Der kleine Vorplatz begann sich langsam zu füllen. Wo zwei oder mehr Leute in Wien gemeinsam herumstehen, ist zwar nicht der Herr – wie in der Bibel versprochen – mitten unter ihnen, aber zu sehen gibt es allerweil etwas. So zumindest die Volksmeinung. Daher führen selbst kleine Menschenansammlungen in Wien immer zu großen Menschenansammlungen. Die Wiener lieben es individuell, das aber am liebsten in großen Herden. Dadurch kann man sich bei den Nebenstehenden versichern, ob man an der richtigen Stelle gelacht hat oder nicht. Selbst im Theater, insbesondere bei Komödien, schauen die Leute meist nicht unbeirrt nach vorn auf das Bühnengeschehen, sondern werfen bei jeder vermuteten Pointe stets schnell einen prüfenden Blick nach links und rechts auf die nächstsitzenden Personen, um sich zu vergewissern, dass auch die Sitznachbarn von Heiterkeit ergriffen sind. Das erhöht die eigene Lachbefindlichkeit enorm.
Der Vorplatz war jetzt gut gefüllt. Gerade so, dass man sich nicht gegenseitig auf die Zehen trat. Von hinten tippte mir jemand auf die Schulter: »Komm mit mir nach vorn. Du willst ja was hören und sehen vom Bürgermeister.« Es war dessen Sekretär. Chiara sah mich fragend an, ich zuckte mit den Schultern, als ob ich völlig ahnungslos wäre. Otto lotste uns durch die Menge nach vorn zu den Sitzplätzen der Ehrengäste.
Chiara flüsterte mir ins Ohr: »Also doch eine Überraschung.« Ich nickte, weiteres Leugnen war sinnlos.
»Weinperl?« Chiara sah mir tief in die Augen.
»Nein, ehrlich, wirklich, glaub mir.«
»Schwör es!«
Ich hob die rechte Hand zum Schwur, aber nur ein wenig, um nicht zu sehr aufzufallen.
»Wo ist das Hexenkreuz?«
»Kein Hexenkreuz«, beteuerte ich und zeigte meine linke Hand.
»Irgendwo machst du sicher eines«, war Chiara überzeugt.
»Da setzt euch hier in der Mitte her, der Chef hat seinen Platz da gleich neben euch.«
Chiara: »Welcher Chef? Hast du neuerdings einen Chef?«
»Nein, nein«, versicherte ich, »das ist nur der Bürgermeister, der ist eben der Chef hier in der Stadt, und der vom Otto.«
»Otto Bürgermeister«, stellte der sich vor. Es wirkte wie einer der merkwürdigen Späße vom »Chef«, dass sein Sekretär mit dem Familiennamen »Bürgermeister« hieß. Der Bürgermeister liebte es, seinen Sekretär vor anderen Leuten »Bürgermeister« zu rufen oder ihn so anzusprechen. Ich beließ es lieber bei Otto.
Wir nahmen Platz.
»Woher kennst du den?«, wollte Chiara wissen.
»Was weiß ich, wir haben uns mal auf irgendeinem Fest kennengelernt, keine Ahnung mehr, welches. Wahrscheinlich etwas mit Dritter Welt oder so. Dort sind meist die schönsten Frauen, und man tut ihnen, sich und der Welt was Gutes.«
»Alter Macho«, flüsterte Chiara besonders leise.
»Es war ewig lang vor deiner Zeit«, wandte ich ein. Und ich hatte ja nicht gelogen. Legendär die südamerikanischen Feste im Albert-Schweitzer-Haus. Die Frauen waren links, schön und freizügig. Wir waren alle blutjung, trunken und voll der Gier auf Leben. Die Welt war neu und schien noch veränderbar zu sein.
»Ich komme ins Schwärmen«, raunte ich vor mich hin.
»Was hast du gesagt?«, fragte Chiara nach.
»Nichts von Bedeutung«, sagte ich, »nichts von Bedeutung, vergiss es.«
»Und wie lange kennst du ihn schon?«
»Ewig. Beinahe ewig. Wie das so ist. Selbe Jugendorganisation, jedes Jahr trifft man sich auf denselben Festen, und die Jahre vergehen.«
»Und was hat das mit heute und der Sache hier zu tun?«
»Du wirst es schon noch merken«, hielt ich mich bedeckt.
»Spielverderber.«
»Überhaupt nicht, aber du kennst inzwischen den Wiener Spruch: Neugierige Leute sterben bald. Also sei bitte nicht neugierig. Ich will dich noch ein Weilchen an meiner Seite haben.«
Chiara lächelte mich an: »Überleg dir das gut, ich kann ziemlich anstrengend sein.«
»Als ob ich das noch nicht bemerkt hätte«, murmelte ich, gerade so laut, dass sie mich verstehen konnte. Sie boxte mir sanft, aber spürbar in die Seite.
»Auuuuuu!!!«, rief ich aus, voll auf Schmierentheater, griff mit beiden Händen an meine Seite, als ob ich eine schwer blutende Wunde zustopfen müsste, sank ein wenig vornüber und machte auf sterbender Schwan.
»Geh, tu nicht so«, Chiara war einen Moment erschrocken, glaubte wohl, doch zu fest zugelangt zu haben, »du tust nur so. Du simulierst.«
»Niemals«, sagte ich, »ich schwöre.«
»Glatter Meineid!« Chiara entspannte sich wieder. Ein wenig peinlich war mein Auftritt schon, ein paar Spießer warfen böse Blicke auf uns. Was kümmerte es mich!
»Und was wird das hier?«, fragte Chiara mich leise.
»Das Denkmal vom Johann Strauss wird nach der Renovierung wieder enthüllt.«
»Was hat das mit dir zu tun?«
»Offiziell gar nichts«, sagte ich.
»Und inoffiziell?«
»Lass dich überraschen«, grinste ich.
»Du wiederholst dich.« Chiara drohte mir mit der Faust.
»Ich schweige wie ein Grab.«
Die hinter den Sesseln für die Ehrengäste stehende Menschenmenge wurde unruhig. Auch die Ehrengäste, den einen und die andere kannte man aus den Gesellschafts- und Klatschspalten der Boulevardzeitungen, bewegten ihre Köpfe, schauten sich um. Dann hörte man jemanden zischeln: »Da, er kommt.«
Die Stimmen ertönten wirr durcheinander: »Wer?« – »Der Bürgermeister!« – »Wirklich?« – »Na, schlanker wird der aber auch net!« – »Auf die Fotos schaut er jünger aus.« – »Spinnst, älter, viel älter ist er im Fernsehen.« – »Hast recht, wenn man genau hinschaut.« Die Volksmeinung war wankelmütig wie immer.
Da tauchte ER auf. Der Bürgermeister. Lässig eine Hand in der Hosentasche, machtbewusst, fester Schritt, mit der freien Hand dem Volk zuwinkend, die Mundwinkeln deuteten ein leises Lächeln an.
»Heute ist er gut drauf«, flüsterte mir Otto von hinten ins Ohr. Er saß in der zweiten Reihe genau hinter dem noch leeren Sessel des Bürgermeisters. So konnte er alle notwendigen Hilfestellungen leisten, wenn sie denn erforderlich werden sollten.
Das Denkmal war bestens verpackt. Lange, wasserdichte Stoffstreifen bedeckten es völlig, sie reichten bis zum Boden, bedeckten auch das Plateau, auf dem das Denkmal errichtet war, und reichten bis zu dem Blumenbeet, das sich vor der ganzen Vorderseite des Plateaus unterhalb der Stufen hinstreckte.
Neben dem verhüllten Denkmal hatten die Mitglieder eines kleinen Kammermusik-Ensembles ihre Plätze eingenommen. Als sie den Bürgermeister kommen sahen, begannen sie, noch einmal die Stimmung ihrer Instrumente zu überprüfen. Er hatte jetzt die erste Sesselreihe erreicht und bog links ab in Richtung seines Sitzplatzes. Dabei winkte er den Musikern leutselig zu, begleitet von einem leichten Kopfnicken. Er ging an der ersten Reihe vorbei zu seinem Sessel, vor dem er stehen blieb, blickte sich um, rieb sich die Hände und sagte halblaut: »Gemmas an, damit wir schnell zum geselligen Teil der Veranstaltung kommen.« Dann nahm er Platz. Kaum saß er, begannen die Musiker mit dem Donauwalzer. Die Luft flirrte, die Vögel zwitscherten unbeirrt weiter, ein paar Spatzen hüpften fröhlich und sichtbar walzertrunken durch die Sesselreihen, die Leute wippten mit den Füßen im Takt der Musik. Die Musiker spielten voll Gefühl und sehr swingend, extrem rhythmusbewusst, wie man es in der Klassik selten zu hören bekommt. Meist wird der Donauwalzer zu Tode konzertiert, vor allem große Orchester neigen dazu, die Leichtigkeit des Walzers, eine Aufforderung zum Tanz, durch schwerfälliges Spiel in einen Trauermarsch zu verwandeln.
Die Leute summten mit, es war ein Wippen und Surren, selbst die Rabenvögel fielen flügelschlagend in den Dreivierteltakt. Johann Strauss Sohn hätte seine helle Freude gehabt.
Auch der Bürgermeister hatte sich entspannt in dem eher unbequemen, weil zu schmalen Gartensessel zurückgelehnt, hatte die Augen geschlossen, während sein ausgestreckter linker Fuß das kleine Orchester zu dirigieren schien. Seine Schuhspitzen vollführten einen Tanz in der Luft, immer schön im Takt, keep swingin’, old boy, die Augen noch immer geschlossen, und sein leicht gerötetes Gesicht wirkte entspannt. Normalerweise würde man annehmen, dass ein Politiker einen solchen Moment dazu nutzen würde, einen kurzen Schlummer einzulegen zwecks Erholung vom mühsamen Tagesgeschäft mit stets zu wenig nächtlichem Schlaf. Man kennt das schließlich von vielen Übertragungen aus dem Parlament, wenn trotz hitziger Debatte beim einen oder anderen Minister auf der Regierungsbank das Kinn sich bedenklich knapp dem Brustkorb annähert und die Augenlider der Schwerkraft nachgeben, während die gleichmäßigen Auf-und-ab-Bewegungen der Schultern darauf schließen lassen, dass der Minister sich eher in den Armen von Morpheus als in den heiligen Hallen der Volksvertretung wähnt.
Der Chef jedoch machte mir nicht diesen Eindruck. Er schien wirklich vor allem entspannt und mit sich selbst im Reinen zu sein. Wer kann das schon von sich sagen! Und tatsächlich: Als der letzte Takt verklungen war, sprang er, behender als man ihm zugetraut hätte, von seinem Sitz auf, griff in seine Sakko-Innentasche und holte ein paar gefaltete Blätter heraus, während er gemächlich zu dem neben den Musikern aufgestellten Rednerpult schritt. Er entfaltete die Blätter, es konnte sich nur um die von mir geschriebene Rede handeln, nahm hinter dem Pult Aufstellung, legte die Blätter auf und strich sie mit der Hand glatt. Dann begann er mit seiner Rede, die eigentlich meine war. Genaugenommen: Von der ich hoffte und vermutete, dass es die meine war.
Der Bürgermeister räusperte sich, blickte einmal rundum, als ob er die versammelten Köpfe abzählen wollte und begann teils vom Blatt lesend, teils in scheinbar freier Rede mit seiner Ansprache:
»Liebe Wienerinnen und Wiener!«
Okay, das war von mir.
»Guten Morgen die Madln, servas die Buam.«
Äh, das war nicht von mir.
»Wie ein beliebter Wiener Volksschauspieler und Conférencier jede seiner Radio- und Fernsehsendungen einzuleiten pflegte. Die Älteren unter uns werden sich noch an ihn erinnern.«
Auch ich erinnerte mich. Kein Sonntagmorgen ohne Heinz Conrads und seine Radiosendung. Er hatte schon damals sonntags landesweit mehr Zuhörer als die Kirchen Messbesucher.
»Wir haben eine Menge Geld in die Hand genommen, damit der Strauss-Schani wieder in altem Glanz erstrahlt, unser Walzerkönig. Obwohl, ein bisserl bös könnten wir Wiener schon sein auf ihn!«
Okay, diese Stelle kannte ich, die war in etwa von mir.
»Der Hundling ist nämlich 1886 deutscher Staatsbürger geworden, weil es bei uns damals keine Zivilehe gab. Er war aber schon kirchlich getraut und hatte eine neue Liebe. Also ist er mit seiner geplanten neuen Frau ins Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha gegangen, dort konnte man zivil heiraten. Sie sind auch zum evangelischen Glauben übergetreten, aber das ist mir wurscht. Das ist den Katholen ihr Problem. Auf jeden Fall war der echte Wiener Strauss-Schani dann ein unechter Piefke. Unser Walzerkönig ein Deutscher. Was für ein Sakrileg. Aber gut, wir Wiener sind sogar gegenüber den Piefkes tolerant. Vor allem, wenns ein Unsriger ist.«
Gut, die Piefke-Stelle war eher wieder nicht von mir.
»Das ist nicht von mir«, rutsche es mir heraus.
»Wie?« Chiara war irritiert.
Ich flüsterte so leise es ging, möglichst ohne die Lippen zu bewegen: »Die Rede ist von mir geschrieben. Zumindest Fragmente von dem, was er da sagt, habe ich geschrieben. Darum sind wir hier. Aber das mit den Piefke habe ich so nicht geschrieben. Der extemporiert, dass es eine Freude ist.«
Chiara sah mich an: »Du machst Sachen! Das ist wirklich eine Überraschung.«
Der Bürgermeister hatte sich in Fahrt geredet. Hin und wieder ein Blick auf mein Redemanuskript, scheinbar nur mehr als eine Art Wegweiser im Einsatz, so hangelte er sich durch die von mir konzipierte Rede.
»Aber wie gesagt, wir Wiener sind net kleinlich. Alles kann man uns nachsagen, aber das nicht. Und die Geschichte vom Strauss-Schani ist ohnehin recht kurios. Irgendwie sehr österreichisch. Wenn auch aus trüben Zeiten. Sein Urgroßvater war nämlich Jude. Der Strauss-Sohn daher in konsequenter Befolgung des Rassenwahns ein Achteljude. Nach den Bestimmungen der Nürnberger Rassengesetze unterlag die Musik von Strauss damit eigentlich einem Aufführungsverbot, und seine Musik hätt nicht gspielt werden dürfen. Man stelle sich das vor! Wien ohne die Walzer von Strauss! Da steckst echt das Kopferl in Sand. Die Sache war den Nazis unheimlich, also schritt man zur Tat. Ihn zum Ehrenarier zu machen, hätte zu viel Aufsehen erregt, tot war er auch schon, also hat man eine Aktion zur geheimen Arisierung gestartet. Im Stürmer, des war dieses Nazi-Hetzblattl, haben s’ den Strauss 1939 zum deutschen Walzerkönig erklärt. Seine jüdische Stieftochter, die eine große Sammlung mit Strauss-Erinnerungen ghabt hat, haben s’ als jüdische Erbschleicherin denunziert, die Sammlung ist ihr abgepresst worden, die wertvolleren Stücke sind in Verwahrung beim Denkmalschutz gekommen. 1941 wurde dann das Taufregister von St. Stephan nach Berlin ins NS-Reichssippenamt gebracht. Dort hat man die Seite mit dem Eintrag ›getauffter Jud‹ entfernt und durch eine gefälschte Kopie ohne diesen Eintrag ersetzt. Danach haben s’ das Taufregister wieder zurück nach Wien gebracht. Strauss war laut Papierform wieder lupenreiner Arier. Die Beamten des Sippenamts sind zu strengster Geheimhaltung verdonnert worden. Die Reichssender konnten unbesorgt seine Musik ausstrahlen. Insofern ist es nicht ohne Ironie, vielleicht sogar a kleine historische Rache, dass der Strauss jetzt an diesem Ort steht, nicht weit vom Denkmal meines antisemitischen Vorgängers Lueger, nur ein paar hundert Meter von hier, der um 1900 herum Wiener Bürgermeister war. Was mir besonders gfällt: Die Figur von Strauss erstrahlt in hellem Gold, der Lueger steht umtost vom Verkehr in tristem Schwarz auf seinem Podest. Das taugt mir irgendwie.
Jetzt will ich nur noch erwähnen, dass wir, ich will jetzt nicht auf die EU schimpfen, aber die Euro-Banknoten sind wirklich schiach, dass wir früher auf dem Hunderter, Schilling natürlich, ein Bild vom Strauss ghabt haben, enormer Schnurbart inklusive. Dann gabs noch den Tausender als Goldmünze. Auch in Schilling, Schleich, wie man auch zum Schilling gsagt hat. Für die, die sich noch erinnern können. Schleich wie Schleichhandel. Die Wiener Sprache ist da sehr genau und feinfühlig, auch wenn es oft net so klingt. Jetzt kann ich nur mehr sagen: Die Verpackung runter vom Denkmal, wir wollen unseren Walzerkönig wieder sehen.«
Er drehte sich in Richtung des kleinen Orchesters: »Alles Walzer!« Die Musiker begannen zu spielen. Einen Strauss-Walzer, was sonst. Wiener Blut.
Wiener Blut, Wiener Blut!
Eig’ner Saft, voller Kraft, voller Glut.
Wiener Blut, selt’nes Gut,
Du erhebst, du belebst unser’n Mut!
Ich summte mit, der Text lief wie ein Ticker durch meinen Kopf.
Damit sind wir als Kleinkinder aufgewachsen, davon hatten wir mehr intus als von der Muttermilch. Die ersten Takte waren verklungen, zwei Arbeiter machten sich an der Denkmalshülle zu schaffen und rissen sie herunter, eine rechte Plackerei, bis das Denkmal wieder vollständig zu sehen war, aber was man zu sehen bekam, war nicht besonders erfreulich.
Die Musiker stockten einen kurzen Moment und spielten dann beherzt weiter.
»Wiener Blut«, sagte ich, »das passt.«
Wiener Blut, Wiener Blut!
Was die Stadt Schönes hat,
In dir ruht!
Wiener Blut, heiße Flut!
Allerort gilt das Wort:
Wiener Blut!
Der Bürgermeister war erstarrt, hinter mir sprang Otto hoch, hüpfte über die Sessel der ersten Reihe hinweg zu uns nach vorn und trat auf den Bürgermeister zu.
Der hatte einen hochroten Kopf und rief laut: »Sind die wo angrennt? Welcher Koffer ist dafür verantwortlich? Und die sollen was anderes spieln. Wiener Blut, gehts no?«
Er richtete sich auf und schrie laut in Richtung Orchester: »Bitt schön, hörts auf. Spielts was anderes vom Strauss. Oh schöner Mai oder so, nur nix mit Bluat. Oder hörts ganz auf. Na, is auch blöd, spielts weiter.«
Die Musik verstummte, die Musiker tuschelten und begannen dann tatsächlich »Oh schöner Mai« zu spielen.
Etwas konsterniert stand der Bürgermeister da und wandte sich zu Otto: »Lauter Koffer! Hast schon die Polizei verständigt? Schad ums Buffet.«
Otto nickte: »Sonst noch was?«
»Na, danke. Des reicht ma schon. So ein Schmarrn. Welcher Volltrottl hat des wieder vergeigt? Bringts mir sofort den Weinperl. Der muss übergschnappt sein. Her mit dem Falotten. Dem ram i des Wülde oba.« Ich stellte mir insgeheim die Frage, wie tief die Rotfärbung seines Kopfes noch werden konnte, ohne dass den Mann der Schlag traf.
Otto tippte verzweifelt auf seinem Handy herum, der Bürgermeister schnaubte wie ein Pferd: »Jetzt brauch ma ein Vierterl. Die Leute sollen den Weg frei machen. Wo ist die Polizei? Wann kommen die endlich? Und verteilts das Buffet. Muss ja nix überbleiben. Wär schad drum. Und reservierts ein Flascherl. Oder besser zwei.« Dabei blickte er mich und Chiara an.
»Ich hasse Blut«, sagte ich.
»Und Blutlachen erst«, sagte Chiara im selben Moment unbeabsichtigt laut, und ihre linke Hand umklammerte erschrocken meine rechte.
»Ja, grauslich das viele Blut«, sagte der Bürgermeister, »ein paar Schluckerl Wein werden uns jetzt guttun.«
Ich versuchte es mit Small Talk: »Na, ein bisserl hast schon meine Rede verändert, Genosse Bürgermeister.«
»Ach was«, er winkte ab, »war schon noch was drin von dir in der Rede.« Und dann zu Otto: »Wann bekommen wir endlich alle unsere Gläser? Auf den Schreck brauchen wir was Beruhigendes. Und dass du mir ja nicht die Blumen niedertrampelst!« Dann murmelte er zu uns: »Der is so patschert, der ruiniert uns noch die ganze Wiesen.«
»Wie wenn´s jetzt noch auf die Wiesen ankommen tät«, murrte Otto.
»Wennst die schönen Blumerln zerstörst, hast es nicht lustig. Ich hetz dir das Stadtgartenamt an den Hals. Also kümmer dich lieber um die Leut und steh net sinnlos im Weg herum.«
Otto tippte noch immer wild auf seinem Handy: »Aber ich muss doch …«
»Und lass endlich des Handy in Ruh«, sagte der Chef, »die Kieberer werden schon noch auftauchen. Hoffentlich bald und dann brauch ich schnell an Schuldigen. Ich will a Bluat segn.«
»Chef«, Otto wand sich ziemlich, »Chef, glaubst net, dass da schon mehr als gnug Bluat is? Mehr als die Polizei erlaubt?«
»Koffer«, sagte der Bürgermeister, aber es klang verzeihend, »wenn ich sag, ich will Blut sehen, meine ich, da gehört wer verantwortlich gmacht. Da gehören jemandem die Wadln vieregricht. Wenn das der Weinperl war, und nach dem schaut es aus, dann spielts Granada. So wahr ich der Bürgermeister bin.«
Der Bürgermeister blickte Richtung Denkmal, räusperte sich: »Geh, Bürgermeister«, er meinte offensichtlich Otto und nicht sich selbst, »räumts die Schweinshälfte weg und holts endlich die Nackerte vom Denkmal runter, wascht sie ordentlich ab, von mir aus drüben im Teich, und gebts ihr was zum Anziehen, sonst verkühlt sie sich noch. So heiß ist es auch noch nicht, und das Denkmal ist kalt. Räumts die nackerte Dame und das Schwein endlich weg.« Otto zögerte kurz und ging dann zum Denkmal.
Der Anblick war – trotzt nackter Frau – ziemlich grauslich. An den weißen Seitenstreben des Rundbogens rannen viele mehr oder weniger breite rote Ströme hinunter. Wir alle glaubten spontan, dass es sich um Blut und nicht um Farbe handelte. Beim Weinperl wusste man nie. Manchmal war es nur Farbe, aber im Original verwendete er eigentlich immer Blut. Vielleicht gingen wir darum davon aus, dass hier alles nicht farb- sondern blutüberströmt war. Jedenfalls war das frisch renovierte Denkmal total versaut.
Direkt vor dem Denkmal, auf dem die vergoldete Figur von Strauss geigenspielend stand, war ein Kreuz gegen den Sockel gelehnt und zu Füßen des Sockels lag eine blutige Schweinshälfte. Das Holzkreuz ragte so weit hinauf, dass die Statue bis zum halben Oberschenkel bedeckt war. Auf dem Kreuz war eine nackte, sehr junge und sehr schlanke Frau befestigt. Man hatte ihre Hände und Füße ans Kreuz gebunden, sodass sie sich praktisch nicht bewegen konnte. Ihre Augen waren mit einer weißen Stoffschleife verbunden. Das Schamhaar wucherte – entgegen der momentanen Mode – üppig und tiefschwarz. Ihre Beine waren leicht gespreizt, man konnte eine blasse Tätowierung auf der Innenseite des rechten Oberschenkels erkennen. In breiten Strömen rann das rote Zeug, Blut oder Farbe, über ihren Körper, beginnend beim Kopf über das Gesicht und den Hals. Dann weiter in breitem Strom über ihre Brüste. Die Brustwarzen standen aufrecht, ragten weit weg von ihren kleinen Brüsten, wie Klippen in der Brandung standen sie da und teilten die jeweiligen Blutströme, sodass das Zeug links und rechts der Nippel weitergeflossen war. Andere Ströme bahnten sich den Weg zum Boden über den Nabel und dann durchs dichte Schamhaar hindurch. Vom Körper der Nackten rann das Blut auf den Boden des Plateaus, auf dem das Denkmal stand. Unter und neben der Schweinshälfte hatte sich eine große Lacke gebildet, die Flüssigkeit floss über die drei Stufen des Plateaus hinunter ins Blumenbeet und versickerte zwischen den roten Blumen im Erdreich.
Wir waren inzwischen hinter Otto hergeeilt und standen vor dem Blumenbeet, etwa zwei oder drei Meter entfernt von der Nackten am Kreuz. Es roch nicht nach Farbe. Es roch eindeutig nach Blut.
»Mir wird schlecht«, sagte Chiara.
»Geh zurück, setz dich nieder und schau, ob du einen Schluck Wasser bekommen kannst. Keinen Wein, ich bitte dich, da wird dir höchstens noch schlechter.«
Chiara nickte und ging mit tapsigen Schritten zurück zu den Sesselreihen, vor denen noch immer der Bürgermeister etwas ratlos herumstand. Die Besucher standen ebenso verwirrt herum, hielten aber einen gehörigen Respektabstand zum Bürgermeister. Das war ungewöhnlich. Vielleicht der Schock, die Überraschung. Die Wirkung von Weinperls Aktionen war immer ein wenig unkalkulierbar. Und ich war sicher: Hier hatte Weinperl Hand angelegt.
Otto sprach die Nackte, die noch immer regungslos und stumm am Kreuz hing, an: »Gnädige Frau, wir würden Sie jetzt gern losmachen und da herunterholen.« Er war wirklich ein Gentleman. Man griff eine Nackerte nicht einfach an, man fragte um Erlaubnis. Wir Wiener sind eben ein höfliches Völklein. Die Nackte antwortete nicht.
Otto wurde ein wenig ärgerlich: »Wir müssen Sie da aber jetzt herunterholen. Wir können diese Sauerei ja nicht so lassen. Besser, ich hole Sie jetzt sanft herunter, als dann in ein paar Minuten die Polizei auf weniger sanfte Art.«
Die Nackte reagierte nicht. Merkwürdig. Wir sahen einander an. Otto trat zum Kreuz und rüttelte sie an der Schulter. Der Kopf der Nackten fiel vornüber.
»Scheiße«, rief Otto erschrocken aus, »die fühlt sich aber sehr kalt an. Und hart.«