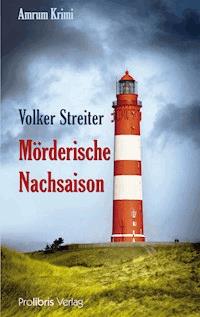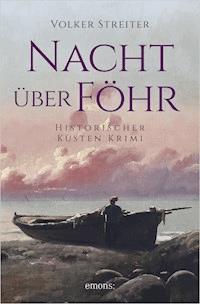
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine atmosphärisch dichte Zeitreise ins Biedermeier am Vorabend des deutsch-dänischen Krieges. Föhr 1845: Der vierzehnjährige Schiffsjunge Ingwer Martens wird ermordet an der Lembecksburg gefunden, die Haut übersät mit eingeritzten Zeichen. Ist Südseeinsulaner Pana der Täter? Reiseschriftsteller Johann Kohl hat seine Zweifel und hilft Postausträgerin Mariane Brodersen, die Panas heimliche Geliebte ist, dessen Unschuld zu beweisen. Ingwers kleine Schwester Laura sucht den Mörder unterdessen im Kreis der wohlhabenden Badegäste. Doch die Föhrer Gesellschaft ist rätselhaft verstrickt. Als Laura plötzlich spurlos verschwindet, überschlagen sich die Ereignisse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volker Streiter, geboren im westfälischen Soest, ließ sich nach seiner Polizeiausbildung in Köln nieder. Als Polizist streifte er durch Trabantenstädte wie Millionärshäuser, war Einsatztrainer und ist Teil der »Stadtteilpolizei«. In der Freizeit lässt er aus Spaß am Schreiben und der Faszination für die Natur in schönen Gegenden morden.
In diesem Roman leben einige historische Figuren wieder auf, deren beschriebenes Wesen jedoch rein fiktiv ist. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen wären rein zufällig. Die Handlung des Romans ist frei erfunden. Im Anhang findet sich ein Personenverzeichnis.
©2018 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: privat Umschlaggestaltung: Nina Schäfer Lektorat: Christine Derrer eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-331-8 Historischer Küsten Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter
Für Chris
Geschichte ist Dichtung, die stattgefunden hat.Dichtung ist Geschichte, die hätte stattfinden können.
André Gide
NEBELSCHWADEN
Klagend zerrte die Frau an ihren nassen Haarsträhnen, ihr grobes Kleid war lehmverschmutzt. Verzweifelt biss sie sich in den Handrücken.
Sie starrte zu dem ringförmigen Erdwall, wo zwei Schatten im taubenblauen Licht mit kräftigen Bewegungen um etwas zu ringen schienen. Feuchte Schwaden flogen über die Kämpfenden hinweg, die weit ausholend aufeinander einschlugen.
Unmöglich, das genaue Hin und Her zu erfassen. Stand jetzt der eine über dem andern? Hatte der Stehende etwas in der Hand und hob seinen Arm wie zum letzten Schlag?
Sie fuhr sich übers Gesicht. Erneut wehte der Wind einen Nebelvorhang vor die Szenerie. Als der sich endlich hob, lag der Erdwall in Stille und menschenleer da. Das aber steigerte nur noch die Unruhe der Frau, ihre dünnen Finger verkrampften sich in den Haaren.
»Aber Mutter, was machst du denn hier?«
Die helle Stimme des Mädchens ließ sie herumfahren. Mit sehniger Hand deutete sie auf den Ringwall, ihre Lippen formten Worte. »Ich habe ihn gesehen«, stammelte sie, »den Wikingergeist. Er ist auferstanden. Ein großer Dämon in blauem Licht. Viele werden kommen, um zu töten. Sie holen uns alle. Laura, versteck dich. Ja wirklich, ich weiß es, der Wikinger hat deinen Vater erschlagen. Krino, oh mein Krino!«
Traurig sah Laura in das müde Gesicht ihrer Mutter und schüttelte den Kopf. Dann nahm sie ihre Hand.
»Ach, das hast du gewiss geträumt. An der Lembecksburg gibt es keine Geister, auf ganz Föhr nicht. Und von der Burg ist allein dieser runde Wall geblieben. Außerdem gehören die Wikinger längst der Ewigkeit, so wie Vater. Den hat die See.«
Sie fasste ihre Mutter am Arm, um sie von der einsamen Weide wegzubekommen.
Entfernt schälte sich in westlicher Richtung ein schlanker Einspänner aus dem Dunst, er würde die Burg über die weit und breit einzige Straße passieren. Erschrocken sog Laura die Luft ein. Der helle Pferdekörper des Falben mit seiner dunklen Mähne war gut zu erkennen, Wagen und Kutscher dagegen gaben nur ihre Umrisse preis.
»Komm schnell«, rief Laura und wollte hastig weiter, was leidlich gelang.
Als sich erste Hausdächer am Horizont zeigten, zog Laura ihre Mutter auf einen verlassenen Weg, der um das vor ihnen liegende Dorf herumführte. »Ich will nicht, dass dich jemand so sieht. Der Pastor hat schon gedroht, dich nach Århus zu schaffen. Aber du sollst nicht in so eine grässliche Anstalt, und ich mag nicht allein bleiben. Dann bestimmen die Männer der Gemeinde, was aus mir wird. Nein, das will ich nicht. Und du bist ja auch nicht immer so. Man darf ihnen überhaupt keinen Grund geben, dich wegzuschicken.«
Stumm und wie in Trance ließ ihre Mutter sich führen. Mit ihrem strähnigen Haar, dem nassen und verdreckten Kleid, ja ihrer ganzen Erscheinung wirkte sie wie eine Delinquentin auf dem Weg zum Schafott.
Prüfend sah Laura in die Dämmerung. Sie war ein Mädchen von dreizehn Jahren, gerade gewachsen und mit blauen Augen. Ihre blonden Zöpfe trug sie derart geflochten, dass sie wie Schaukeln um ihre Ohren hingen. Ihr dünner, kaum erblühter Körper steckte in einer hellen Bluse und einem grauen Rock, ein Schultertuch gab ihr etwas Wärme. Sie lief barfuß, die allzu kalte Zeit sollte erst noch kommen.
Solange ihre Mutter in diesem entrückten Zustand war, wollte sie sie möglichst unauffällig nach Hause bringen. Laura war es unangenehm, sich mit ihr zu zeigen. Wie es schien, hatten die herbstlichen Nebelschwaden und das schwindende Licht dafür gesorgt, dass die Leute längst in ihren Häusern waren. Mit etwas Glück würde niemand sie sehen. So zerrte sie ihre Mutter am Arm vorwärts und lenkte sie vom Erdwall, der Lembecksburg genannt wurde, am Dorf Borgsum vorbei nach Goting. Diese aus niedrigen Katen bestehende Siedlung war ihr Zuhause und lag am südlichen Rand der Insel Föhr.
Kaum waren sie zu Hause angekommen, fasste ihre Mutter sich im dunklen Flur an den Kopf und stöhnte. Laura wusste, was nun kommen würde.
»Was war nur wieder los mit mir?«, klagte ihre Mutter und tastete sich an der Wand entlang. »Kind, dieser Schmerz, er sticht und rast. Ich muss mich setzen. Machst du mir einen Tee? Du weißt ja, welche Kräuter ich brauche.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, ließ sie sich auf einem Lehnstuhl in der Stube nieder. Während sich Laura in der Küche mit dem schweren Wasserkessel abmühte und ihn über die Feuerstelle hängte, schien das Bewusstsein ihrer Mutter klarer zu werden. Doch in ihrem Blick lag eine neue, andere Traurigkeit.
»Wo ist eigentlich dein Bruder?«, rief sie nach einer Weile durch die geöffnete Stubentür. »Sollte der nicht nach den Ziegen sehen? Dass der sich immer rumtreiben muss.«
»Ingwer ist bestimmt noch in Wyk. Wir brauchen das Geld. Bald ist die Badesaison vorüber, und dann gibt ihm keiner mehr eine Stelle als Hausbursche. Die eine feste genügt ja nicht«, antwortete Laura und reichte ihrer Mutter einen Becher dampfenden Tee.
»Ja, fleißig ist er«, murmelte die und pustete gedankenverloren in die heiße Flüssigkeit. »Aber seltsam, kaum ist er aus dem ewigen Eis zurück, ist er auch hier kaum zu Hause. Immer hat er irgendwo zu tun.«
»Mutter, er arbeitet. Sei nicht ungerecht. Wenn er sich nicht bei anderen Leuten verdingt, lernt er in der Rechenschule. Er will ja unbedingt zur See fahren.«
DUNKLER KAI
Johann Georg Kohl trat an den Bug des Zweimasters und schaute in die kalte Nacht. Vor ihm lösten sich eine Handvoll Lichter aus der klammen Schwärze, die ihn umgab. Das Segelschiff glitt lautlos auf die Küste zu. Fröstelnd schloss er seinen Reisemantel, drückte den Zylinder in die Stirn und schlug den Kragen hoch. Er war ein Mann von siebenunddreißig Jahren, dessen leicht nach unten hängender Schnauzbart zu seinem Leidwesen bereits zu ergrauen begann. Bald würde er die Insel Föhr betreten und mit seinem Bericht beginnen. Nach diesem ersten Eiland sollten andere folgen. Neugierig fragte er sich, wie der Badetourismus, dieser Zeitvertreib der besseren Gesellschaft, sich auf die eher einfache Lebensweise der Inselfriesen auswirkte.
»Dass man aber auch zu einer so grässlichen Zeit übersetzen muss«, seufzte eine junge Frau, die sich unbemerkt zu ihm gesellt hatte. Der schwache Schein einer Laterne beleuchtete von der Reling her ihr von einer Haube umrahmtes Gesicht.
Makellos und ein bisschen wächsern, dachte Kohl und legte zum Gruß die Hand an den Rand seines Zylinders. Natürlich war ihm die Dame bereits unter den Passagieren aufgefallen, als man vom Festland aus in See gestochen war. Ihr Haar war gänzlich bedeckt, über ihren Schultern lag ein gestricktes Tuch. Während der Überfahrt hatte sie sich in eine Ecke des Zweimasters zurückgezogen und schien am Treiben auf dem Schiff nicht sonderlich interessiert.
»Ja, nun, meine Dame, man hätte sich auch für eine Kutschfahrt durch das Watt entscheiden können. Die Fahrt soll gar nicht so lange dauern. Aber den Zeitpunkt haben wir wohl verpasst. Leider kann der Mensch sich nicht gegen die Gezeiten stellen«, erklärte er und strich über seinen Oberlippenbart. »Wenn dann die Fluten sich anbieten, uns um zwei Uhr in der Nacht an ein neues Gestade zu spülen, so dürfen wir uns dem nicht verweigern. Luna bestimmt ihr Auf und Ab.« Mit diesen Worten blickte er nach oben und deutete auf die schmale, immer wieder durch Wolken verdeckte Mondsichel.
»Luna und die Gestade«, wiederholte die Dame und lächelte. »So etwas hört man selten auf einer Überfahrt nach Föhr. Selbst die Kurgäste, die das eintönige Leben unserer Insel bereichern, sprechen nicht so romantisch. Fast könnte ich meinen, Sie seien ein Dichter.«
»Reiseschriftsteller«, antwortete Kohl lächelnd und verbeugte sich leicht. »Johann Georg Kohl, zu Ihren Diensten. Ich bereise die Welt und berichte meinen Lesern über Land und Leute. Nach einem ausgiebigen Aufenthalt in den Weiten Sibiriens möchte ich den Menschen die Reize dieser Küste näherbringen. Dazu ist es natürlich unverzichtbar, die Besonderheiten Föhrs zu erwähnen.«
»Heinke Kerstina Emma Kühl, im praktischen Leben kurz Emma Kühl.« Sie hob ihr Kleid eine Handbreit und knickste. »Als stolze Wykerin muss ich Ihnen da recht geben. Föhr ist einzigartig. Wie erfreulich zu hören, dass die Schönheit meiner Insel nun eine weite Verbreitung erfahren wird. Werden Sie länger bleiben? Und wo gedenken Sie zu logieren?«
»Die Kurverwaltung konnte mir eine Herberge vermitteln. Trotz des ausgehenden Sommers scheinen die Möglichkeiten einer adäquaten Unterkunft begrenzt. Der Apotheker in Wyk war so freundlich, mir noch Obdach zu gewähren.«
»Apotheker Leisner? Ja, richtig, er hat eine kleine Wohnung in seinem Haus, die er Gästen zur Verfügung stellt. Wie praktisch für Sie, nicht wahr? Ganz zentral in unserem Städtchen gelegen, nahe bei all denen, die auf der Insel etwas darstellen oder uns in der Saison beehren. Ich wohne mit meiner Mutter nicht weit von der Apotheke entfernt. Große Straße15. Nach dem Tod meines Vaters haben wir leider die Dienstwohnung verloren, er war der Zollverwalter. Und so mussten wir uns in einer kleinen Wohnung unter dem Dach einrichten.«
Einen Moment legte sich ein Hauch von Bedauern auf ihre Miene. Dann fuhr sie munter fort: »Gegenüber hat im letzten Jahr der berühmte Dichter Hans Christian Andersen logiert. Sie werden von ihm gehört haben. König Christian hatte ihn eingeladen, ihm vorzulesen, und so ist er eigens für ein paar Tage zu uns übergesetzt und hat die Hofgesellschaft mit seinen Märchen erfreut. Seine Majestät ist dann auch mit ihm nach Amrum in die Dünen und auf die Halligen gefahren. Für meinen Geschmack war der Dichter etwas zu geziert und zerbrechlich, da scheinen Sie mir ja von ganz anderem Korn. Wer weiß, vielleicht haben Sie ja Lust und die Güte, meiner Mutter und mir bei einem Tee über die weite Welt zu berichten? Es würde uns sehr freuen.«
Kohl nickte der Dame verhalten zu, die ihn unbekannterweise im Dunkel der Nacht auf einem Zweimaster zum Tee einlud. Wie oft hatte er schon erlebt, dass das Wort »Schriftsteller« Türen und Münder öffnete.
»Ich möchte natürlich nicht, dass Sie einen falschen Eindruck von mir bekommen«, setzte Emma Kühl hastig nach und zog das Schultertuch enger. »Selbstverständlich lade ich nicht jeden Überfahrer zum Tee, der sich anheischig macht, unsere Insel zu besuchen. Aber einen Schriftsteller haben wir nun dann doch nicht alle Tage zu Gast.«
»Da habe ich ja Glück.«
»Meine liebe Mutter würde mich schelten, ließe ich die Gelegenheit zu etwas Kulturleben verstreichen. Und wer weiß, vielleicht fällt ja auch das ein oder andere Inselgeheimnis für Sie ab. Aber sehen Sie, die Lichter am Anleger kommen immer näher. Gleich sind wir da.«
Kohl rief sich die Karte Föhrs in Erinnerung. Der Hafenort lag am unteren rechten Rand der runden Insel. Überhaupt schienen sich die meisten Dörfer dieses Eilands in der südlichen Hälfte zu befinden.
Hinter ihnen griffen die Mitreisenden nach ihrem Gepäck und drängten neugierig gegen die Reling. Dabei war bis auf die Schemen wartender Handlanger am Rand des Hafenbeckens nichts weiter zu erkennen. Der Zweimaster legte an, und zwei Matrosen schoben einen mit einem Handlauf versehenen Holzsteg zwischen Schiff und Insel, sodass die Passagiere sicher, wenn auch schwankend, ihr Ziel erreichten. Kaum hatten diese festen Boden betreten, mühten sich die Arbeiter im Schein der blakenden Öllichter mit großen Koffern und Säcken ab, trugen sie per Hand oder luden sie auf Schubkarren. Manches wurde am Kai gestapelt.
Kohl, der darauf wartete, dass sich jemand um seinen schulterhohen Reisekoffer kümmerte, beobachtete das Treiben. Plötzlich gewahrte er eine Silhouette, die sich aus dem Dunkel der Nacht löste. Eine ganz in Schwarz gekleidete Frau schritt langsam auf das Schiff zu, in ihren Bewegungen einer Schlafwandlerin gleich. Den Kopf trug sie mit einer Haube auf eine Weise bedeckt, dass auch Mund und Nase verhüllt waren. Für einen Moment dachte er an die Männer der Tuareg in der Sahara, die sich ähnlich vermummt vor dem Sand schützten. An ihrer Hand baumelte ein fast leerer Leinensack.
Als hätte er die Gestalt erwartet, zeigte sich der Kapitän an Bord und ging ihr mit einem Sack über der Schulter entgegen. Wortlos stellte er ihn auf den Kai und griff nach dem ihren.
»Nachrichten aus Flensburg?«, fragte sie mit gedämpfter Stimme.
»Die ›Louise‹ hat zweitausendsiebenhundert Robben erschlagen und drei Fische«, antwortete der Kapitän in ruhigem Ton, grüßte und ging wieder an Bord.
Die Frau lud den neuen, deutlich volleren Sack auf die Schulter und verschwand gemessenen Schrittes in der Nacht.
Kohl war fasziniert. Was für eine seltsame, ja geheimnisvolle Szene. Eine derart rätselhafte Übergabe von was auch immer war ihm noch nie untergekommen. Sollte er Zeuge geheimer Codeworte geworden sein?
Emma Kühl trat neben ihn und lächelte. »Ich darf also hoffen, dass wir uns bei einem Tee wiedersehen?« In ihrer Hand hielt sie eine Reisetasche aus derbem Stoff, die sie hin und her pendeln ließ.
Kohl, der in Gedanken noch beim Kapitän und der schwarz gewandeten Frau war, meinte: »Große Straße15, das habe ich nicht vergessen. Aber bitte sagen Sie, wer war die Frau gerade? Wohnt sie auf der Insel?«
»Das war die Postfrau, warum? Irgendwie müssen die Briefe ja eingesammelt und transportiert werden. Nun, wie verbleiben wir?«
Langsam richtete er seine Aufmerksamkeit wieder auf Emma Kühl, die ihn erwartungsfroh ansah.
»Wenn ich mich etwas eingerichtet habe, komme ich gern auf eine Schale Tee vorbei«, sagte er mit einem Lächeln. »Heh, du da! Ja, du. Bist du frei? Hier ist ein Koffer zu transportieren.« Während sich der junge Kerl, den er angerufen hatte, lässig auf ihn zubewegte, sah er sich noch einmal nach seiner neuen Bekanntschaft um. Doch die war in die Nacht entschwunden. Kohl schaute auf den Träger, der ihm gegenüberstand, ein kräftiger Junge von vielleicht fünfzehn Jahren. Der nahm seine Kappe ab und fuhr sich durch das wilde dunkle Haar. Seine breite Nase passte für Kohl gut zu der Statur, die an harte Arbeit gewöhnt war, wie es schien.
»Uns Werth, was gibt es zu tun?«, wollte der junge Mann mit ernstem Blick wissen.
Kohl wies auf seinen großen Schrankkoffer, der einsam auf dem Pflaster stand. »Den kleinen hier in der Hand trage ich allein. Aber wie willst du denn das schwere Gepäck bis ins Zentrum schaffen? Der Koffer ist fast so hoch wie du und hat gewiss mehr Gewicht.«
Der Träger zuckte mit den Schultern und sah sich suchend um. Inzwischen waren die meisten Reisenden samt ihrer Fracht von der Anlegestelle verschwunden. Auf einmal legte er zwei Finger auf die Lippen und pfiff durchdringend. Dann winkte er einem seiner Kollegen zu.
»Leih mir deine Schubkarre, ich habe eine Fuhre«, rief er.
Nachdem die beiden Kohls Reisekoffer mit vereinten Kräften auf die Karre gehievt hatten, schob der junge Mann die Ladung vom Wasser weg den sandigen Weg entlang bis ins Zentrum des kleinen Ortes. Häuser und Straßen lagen in stiller Dunkelheit da. Lediglich das bescheidene Mondlicht, das sich auf die getünchten Fassaden legte, gab etwas Orientierung. Inzwischen mochte es drei Uhr morgens sein, und bis auf zwei schreiende Katzen war kein Leben zu sehen.
»Ich bin beim Apotheker Leisner untergekommen. Weißt du, wo das ist?«
Kohl hatte beobachtet, wie der junge Kerl sich mit dem schweren Gepäck abmühte. Immer wieder wechselte der Untergrund ihres Weges zwischen Sand und Pflaster. Das machte es nicht einfacher, und er war besorgt, dass sein Koffer von der schwankenden Karre in den Dreck stürzte.
»Das ist nicht mehr weit, mein Herr, wir sind jetzt mitten in Wyk.«
Bald zeigten sich einige Läden mit niedrigen Schaufenstern. Überhaupt, das schien Kohl bereits sagen zu können, bestand Wyk mehrheitlich aus eingeschossigen Häusern, deren Erscheinungsbild von hohen Dächern aus Reet und Pfannen bestimmt wurde. Noch einmal schwenkte sein Träger um eine Hausecke, dann hielt er an und deutete auf ein Ladenschild, das über ihnen im leichten Wind baumelte. Sie standen vor der Apotheke, die wie der Rest des Ortes stumm dalag.
Der junge Kerl schritt zu der Haustür, die neben dem Geschäft lag, und griff entschlossen nach dem Türklopfer. Laut dröhnte das geschlagene Eisen. Bald zeigte sich ein Licht im Haus, und ein Mann trat heraus. Mit neugierigem Blick hielt er den nächtlichen Besuchern sein flackerndes Öllicht vor die Gesichter, es roch nach brennendem Waltran. Der Lichtschein fiel auch auf seine ausgedehnte Halbglatze, und sein Kopf mit dem dunklen gezwirbelten Schnauzbart wirkte gemessen an der Breite der Schultern übergroß.
Er mag noch keine vierzig Jahre alt sein, bedauerte Kohl sein Gegenüber um das fehlende Haar und war erfreut über das abwesende Misstrauen, das man eigentlich bei einer Störung mitten in der Nacht hätte erwarten dürfen. Schwungvoll zog er seinen Zylinder.
»Sind Sie Herr Kohl? Ich bin Ihr Gastgeber, der Apotheker Martin Leisner. Natürlich habe ich Sie schon erwartet.«
Leisner war noch vollständig bekleidet und trug eine samtene Hausjacke. Er reichte Kohl die Hand und deutete auf den großen Koffer. »Dann wollen wir den mal reinschaffen. Sie scheinen sich ja ordentlich ausstaffiert zu haben.«
Kohl nahm an seinem Gastgeber einen merkwürdigen Geruch wahr. Schwer zu sagen, was genau der Apotheker ausdünstete. Der übergab ihm kommentarlos das Öllicht und machte dem Träger ein Zeichen, mit ihm das Gepäckstück ins Haus zu bugsieren. Kohl folgte und beleuchtete ihnen den Weg in sein vorübergehendes Zuhause, so gut es ging. Ihm schlug eine Wolke aus stechenden Düften entgegen, dabei hatte er sich gerade die lange Fahrt über an den Geruch frischer Seeluft gewöhnt. Der Apotheker schien allerhand Substanzen im Haus zu lagern, deren Ausdünstungen sich auch auf ihn gelegt hatten. Ob er welche in so einem Maß konsumierte, dass seine Haut dadurch getränkt war? Vielleicht würde er ihm einige davon vorstellen, freute sich Kohl, hoffte aber auch darauf, in seinem Zimmer von den Gerüchen verschont zu bleiben.
Sie folgten dem Flur bis zur letzten Tür auf der linken Seite und traten ein. Leisner und der junge Mann ließen den großen Reisekoffer ächzend zu Boden, und Kohl schritt an ihnen vorbei in den Raum. Mit dem Licht in der Hand beleuchtete er eine möblierte Stube, deren einzelne Stücke ganz nach der Mode gefertigt waren. Ja, es gab sogar fein gestreifte Tapeten. Links stand ein Kanapee an der Wand, zu dem ein einbeiniger, runder Tisch und ein bequemer Lehnstuhl gehörten. Geradeaus führte die nächste Tür in einen weiteren Raum, vermutlich die Schlafkammer. Auf der anderen Seite der Stube, gegenüber der Sitzgruppe, fiel der Schein seiner Lampe auf einen Sekretär, der unter dem Fenster stand. Auf der Schreibfläche lag ein seltsamer heller Gegenstand.
Kohl schob den ersten Gedanken beiseite, schüttelte irritiert den Kopf und ging darauf zu. Erschrocken zuckte er zusammen. Tatsächlich, im Lichtschein erkannte er zweifelsfrei eine Skeletthand. Doch nicht nur das. Der Hand folgte ein Arm, der zu einem Skelett gehörte, das neben dem Sekretär im Dunkeln stand.
DIE GRENZE
Kohl tastete aus seinem Bett heraus nach der Taschenuhr auf dem Nachttisch. Acht Uhr. Das Knarzen getretener Holzdielen, das Schlagen eines Schürhakens und das grobe Zuwerfen einer Tür zeigten ihm unmissverständlich, dass die kurze Nacht vorbei war. Aber er hatte ohnehin nicht gut geschlafen, auch wenn er nach seiner Ankunft in der Nacht hundemüde ins Bett gefallen war. Die enge Schlafkammer lag neben der Stube, die ihn mit ihrem skelettierten Bewohner begrüßt hatte. Bei der Erinnerung an den nächtlichen Schrecken musste er lächeln.
Als hätte er selbst nicht verstanden, was er gerade sah, war Apotheker Leisner mit dem Ausdruck des Entsetzens auf das Skelett zugestürzt und hatte es auf seinem rollbaren Ständer unter Verbeugungen und Entschuldigungen murmelnd hinausgeschafft. Währenddessen hatte Kohl den jungen Träger mit einigen Geldmünzen entlohnt. Der hatte sich grinsend an die Mütze getippt und war mit den Worten »Auf dass das Frühstück Ihnen besser bekommt als Ihrem Vorgänger« im dunklen Flur verschwunden.
»Ich hatte der Deern gesagt, sie solle das Schaustück abstauben. Aber dass sie es dann ausgerechnet hierhin verfrachtet hat… ich bin untröstlich.« Leisner stand mit verdrießlicher Miene im Raum. »Was für eine Überraschung zu nächtlicher Stunde. Doch ich bin gewiss, nach einem erquickenden Schlaf wird Sie unsere Insel mit ihrem Seebad wohltuend in die Arme schließen.«
Er wies auf die Schlafstube. »Das Waschwasser ist frisch, und ich hoffe, auch sonst ist alles zu Ihrer Bequemlichkeit gerichtet. Wenn ich Ihnen dann eine gute Nacht wünschen darf, in der Frühe werden wir sicherlich noch Gelegenheit haben, uns näher bekannt zu machen.«
Kohl nickte abwesend und war froh, als Leisner ihn allein ließ. Schnell legte er den Fenstergriff um, denn in seine Unterkunft hatte sich, wenn auch verhalten, ebenfalls der Apothekenduft hereingeschlichen. Nachtluft strömte ins Zimmer.
Nun, am Morgen, trat er barfuß und noch im Nachthemd an das Fenster. Dieses, wie auch das der Stube nebenan, ging hinaus auf einen Garten, der eher einer Bauernwiese glich. Im trüben Licht des Tages sah er zwei angepflockte Ziegen, die dort unweit einiger Bienenstöcke grasten. Astern blühten am Wiesenrand. Das Stück Land war eingerahmt durch einen Zaun, vor dem Johannisbeerbüsche wuchsen. Andere Gärten schlossen sich an und bildeten ihrerseits die Rückseite der Häuserzeile, in der die Apotheke lag. Kohl, weit gereist, wusste, dass viele dieser Landstücke zur Selbstversorgung ihrer Bewohner mit Kartoffeln und allerlei Gemüse genutzt wurden. Den Luxus, oder war es eher die Faulheit, das Land so unbestellt zu lassen, konnten sich die wenigsten leisten.
Es klopfte an der Stubentür, und eine kräftige Frauenstimme fragte, ob er nun sein Frühstück wolle. Für Kohl lag etwas Vorwurfsvolles in ihrem Tonfall. Als ob er den Vormittag verschlafen hätte. Durch die geschlossene Tür erbat er sich eine halbe Stunde und widmete sich der Morgentoilette. Das kalte Wasser auf Gesicht und Oberkörper machte ihn gänzlich wach. In Erinnerung an die ersten Schritte, die er diese Nacht in das Haus gesetzt hatte, sog er konzentriert die Luft ein. Ja, diese merkwürdige Mischung fremder Gerüche lag immer noch in den Räumen. Er schlüpfte in seine Hose und ging zu dem großen Reisekoffer, der verloren in der Stube stand. Mit etwas Rütteln und Schieben gelang es ihm, das Gepäckstück so neben dem Schreibtisch zu platzieren, dass es wie ein Möbelstück wirkte. Auf Reisen hatte er sich angewöhnt, die immer neuen Unterkünfte mit einer ähnlichen Anordnung seiner Sachen zu möblieren und so die Illusion von vertrauter Umgebung zu erzeugen.
Für diesen ersten Tag auf Föhr wählte er ein frisches Hemd und eine rote Seidenschleife anstatt eines Halstuches. Vor dem Spiegel der Waschkommode stehend, gab er mit Haaröl seiner Frisur den letzten Schliff, strich über seinen Schnauzbart und schlüpfte in Strümpfe und Schnürstiefel. Er war versucht, beim Frühstück auf eine Weste zu verzichten, aber er entschied sich anders. Der Form sollte voll Genüge getan werden. Kaum hatte er alle Knöpfe geschlossen, verstaute er seine Taschenuhr und ging zur Flurtür.
»Ich wäre dann so weit«, rief er und trat zurück in den Raum.
Wenige Augenblicke später tischte ihm eine kräftig gewachsene Hausmagd in der Stube das Frühstück auf, nachdem sie ihn mit einem fröhlichen »Moin« begrüßt hatte. Mit ihren dicken geflochtenen Zöpfen, die sie zu Schnecken gelegt hatte, ihren geröteten Wangen und ihrem zupackenden Wesen war sie ihm ein Schaubild des gesunden Landvolks.
»Ich bin nach meinen knapp fünf Stunden Schlaf nicht etwa zu spät aufgestanden?«, wollte er wissen. Seine Mundwinkel deuteten ein Lächeln an.
»Ja nun, gnädiger Herr, wir sind im Haus bereits seit einiger Zeit auf den Beinen. Der erste Morgen ist für die Gäste immer ein bisschen holprig. Aber zu langes Ruhen soll ja auch nicht gesund sein. Und im Badehaus geht es jetzt los. Sie sind natürlich wegen der Kuren hier?«
Kohl wiegte den Kopf, endlich nickte er.
Die Magd brummte zufrieden, dann deutete sie auf den Frühstückstisch. »Die Konfitüre ist selbst gemacht, und der Käse kommt von Osterland«, erklärte sie, während sie das Geschirr zurechtschob und ihm Kaffee eingoss. »Das Brot ist vom Bäcker ein paar Häuser weiter.«
Kohl lächelte, fasste die Tasse und trank einen Schluck. »Und das hier ist echter Bohnenkaffee«, kommentierte er, »und kein Gebräu aus irgendwelchen gerösteten Getreidekörnern. Erklären Sie jedem Ihrer Gäste, wo Ihr leckeres Frühstück herstammt?« Neugierig sah er die Magd an, deren Wangenrot kräftiger wurde.
»Sind Sie nicht ein Gelehrter, jemand, der Bücher schreibt? Da dachte ich, Sie möchten vielleicht wissen, woher die Sachen kommen, die Sie essen. War das nicht recht?«
»Nein, nein, im Gegenteil«, beruhigte er sie. »Das war gut überlegt. Aber wo bitte liegt Osterland? Davon habe ich ja noch nie gehört. Doch nicht bei den Osterinseln?«
»Der Teil Föhrs, auf dem Sie sich nun befinden«, sagte eine männliche Stimme, und hinter dem Rücken der Magd erschien Leisner. Er trug einen weißen Kittel, mit einem Nicken entließ er die Deern. »Die Insel ist von Nord nach Süd geteilt. Osterlandföhr gehört zum Herzogtum Schleswig, Westerlandföhr ist dänisches Mutterland.«
»Ach, wie kurios«, befand Kohl. »Und dieses Herzogtum ist trotzdem Teil des Königreichs Dänemark? Wozu dann diese Grenze?«, wunderte er sich und wies auf den Lehnstuhl an seinem Tisch.
Leisner verbeugte sich und nahm Platz. »Der Grund für derlei staatliche Regelung ist ein gut vierhundert Jahre alter Vertrag«, sagte er und blickte prüfend über den Frühstückstisch. »Beide Inselteile sind voneinander durch eine Staatsgrenze getrennt wie zum Beispiel Preußen von Mecklenburg. Für Osterland ist Wyk das Zentrum, Westerland hat Nieblum.«
»Ich habe schon davon gehört, dass es zwischen dem Herzogtum Schleswig und dem Königreich Dänemark Spannungen gibt.«
»Es gärt unter den Dänen deutscher Zunge und denen, die diesem Wikingervolk von jeher angehörten. Das Parlament in Kopenhagen will gar das Herzogtum ganz dem dänischen Reichskörper einverleiben, viele Schleswiger dagegen sehen ihre Zukunft im deutschen Reich und vereint mit Holstein. Prediger oder Staatsbeamte, die genau dies fordern, werden entlassen. Es ist eine unruhige Zeit.« Leisner seufzte. »Aber eigentlich wollte ich noch einmal bei Ihnen für die nächtliche Unannehmlichkeit um Vergebung bitten und sicherstellen, dass Sie Ihren Tag klaglos beginnen können. Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit?«
Kohl machte in Bezug auf die Entschuldigung eine gönnerhafte Geste und bestrich sich demonstrativ ein Brot mit Butter und Konfitüre.
»Was mir den Morgen natürlich besonders versüßen würde«, erklärte er nach einigem Kauen und Schlucken, »wäre eine Tageszeitung. Und verzeihen Sie, dass ich gerade jetzt daran denke, denn es ist ein eher unpassendes Thema für den Frühstückstisch, aber wo bitte befindet sich Ihr stilles Örtchen? Immerhin, auch diese Dinge müssen geregelt werden, nicht wahr?«
Leisner verzog den Mund zu einem Grinsen. »Den Flur hinaus in den Garten, da steht das Häuschen. Man ist dort gänzlich ungestört. Und was Ihre morgendliche Lektüre betrifft, so kann ich Ihnen die Lauenburgische Zeitung, dass Itzehoer Wochenblatt und die Leipziger Volkszeitung empfehlen.«
Kohl sah ihn fragend an.
»Die Leipziger waren dieses Jahr so freundlich, unserem Kurort einen ausführlichen Artikel zu widmen. Sie sehen also, wir sind hier nicht ganz aus der Welt.«
Kohl nahm einen Schluck Kaffee, stellte dann aber die Tasse abrupt ab. »Entschuldigen Sie, wie unfreundlich von mir. Möchten Sie etwas mittrinken? Ihr Hausmädchen könnte sicher ein Gedeck dazustellen.«
Leisner winkte ab und deutete auf seinen Magen. »Sehr freundlich, aber zu viel davon vertrage ich nicht.« Er lachte kurz auf. »Dabei sollte man meinen, dass ein Apotheker genug Mittelchen kennt, derlei Unwohlsein zu besänftigen. Aber ich war schon immer der Meinung, dass es besser sei, auf seinen Körper zu hören, anstatt ihn mit einem Pülverchen ruhigzustellen.«
»Das ist mal ein spannendes Thema«, begeisterte sich Kohl und richtete seinen etwas eingesunkenen Oberkörper auf. »Bei all der Chemie, über die Sie gewiss treffliche Kenntnisse haben, werden Sie ein wahrer Zauberkünstler darin sein, Ihren Mitbürgern Linderung zu verschaffen.«
»Nun ja–«
»Das ist auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Denn wie wusste bereits Paracelsus: Allein die Dosis macht das Gift!«
Leisner starrte ihn regungslos an, dann nickte er verhalten.
»Aber, lieber Herr Leisner, sagen Sie, gibt es eigentlich so etwas wie das ultimative Todesmittel? Eine Substanz für den perfekten Mord? Darüber habe ich oft nachgedacht.«
Leisner erhob sich, zog seine Taschenuhr und blickte ernst auf das Zifferblatt, dann in das verdutzte Gesicht von Kohl. »Es tut mir wirklich leid, Sie unterbrechen zu müssen, aber da sind noch einige dringende Arzneien zu mischen. Die Pillen werden alsbald abgeholt.«
»Entschuldigung, ich wollte Sie nicht aufhalten«, stammelte Kohl.
»Machen Sie sich doch heute mit Wyk vertraut. Die Promenade, der Strand, die Seebadeanstalt und nicht zu vergessen die reizenden Gassen der Inselmetropole. So lässt sich der erste Tag gut verbringen. Ich wünsche Ihnen also einen wunderbaren Aufenthalt und darf mich nun empfehlen.« Damit verbeugte sich Leisner und ließ Kohl am Frühstückstisch zurück.
War er zu weit gegangen? Dabei sollte ein Apotheker sich an so einer Frage nicht stören, fand er. Nichts lag bei diesem Berufsstand näher, wenn man einmal absah von Liebestränken, Schmerzmitteln und allem, was das Leben verlängerte.
Kohl setzte sich mit der verbliebenen Tasse Kaffee an den Schreibtisch. Das Tintenfass war gefüllt, die Federn gespitzt, und in einer Schublade lag brauchbares Papier. Zufrieden begann er eine Liste der Fakten zu erstellen, die er über die Insel sammeln wollte.
Dabei überhörte er ein leises Klopfen und horchte erst auf, als es kräftiger wurde. »Herein!«, rief er und sah zur Tür.
Die Hausmagd erschien mit einem leeren Tablett unter dem Arm, trat an den Frühstückstisch und räumte ihn schweigend ab. Gedankenverloren sah Kohl ihr zu, legte seine Feder aus der Hand und räusperte sich.
»Sagen Sie, was war das für eine Geschichte mit dem Skelett? Braucht ein Apotheker so einen Knochenmann?«
Die Magd schaute ihn verständnislos an.
»Ja, ich meine das Ding, das Sie abstauben sollten und das mich in der Nacht hier neben dem Schreibtisch frech grinsend erwartet hat.«
Sie schien unsicher, wie ernst er das Ganze nahm, und Kohl ließ sie darüber im Ungewissen.
»Störtebeker ist immer im Weg«, erklärte sie in einem Ton leichter Empörung und füllte weiter das Tablett. »Mal darf er nicht im Geschäft stehen, dann nicht in der guten Stube des Herrn Apothekers, jetzt auch nicht hier. Er wandert durchs Haus wie ein Untoter.«
»Störtebeker? Sie wollen aber nicht behaupten, dass es sich dabei um unseren Nationalpiraten handelt.«
Die Magd lachte auf und machte eine wegwerfende Bewegung. »Aber nein, mein Herr. Wir nennen ihn so, weil er den Kopf lose hat. Vielleicht abgeschlagen, wie bei dem Klaus in Hamburg. Herr Leisner meint, da ist ein Stück am Hals gebrochen.«
»Beim Skelett?«
»Ich verstehe nichts davon. Bloß, wenn ich den unglücklichen Kerl so durchs Haus schiebe, überkommt mich ein so schöner Grusel. Und der Störtebeker, hat der die Beute nicht immer gerecht geteilt und auch an die Armen gedacht? Wenn der es wirklich ist, wer weiß das schon, dann soll er es bei uns gut haben.«
Kohl schüttelte den Kopf. Volkssagen, das wusste er von all seinen Reisen, lebten immer weiter und bewahrten sich ihre Lebendigkeit bis in die Gegenwart.
»Der war Pirat. Das ist der nicht geworden, indem er lieb war. Raub und Totschlag war sein Geschäft. Da bin ich nur froh, dass er jetzt nicht mehr hier im Zimmer ist. Wo ist das Knochengerüst denn jetzt?«
»Ich habe es in die Rezeptur geschoben, da, wo der Herr Apotheker seine Pillen dreht und Tinkturen braut. Bald wird es Herrn Leisner sicher wieder zu eng, und dann schiebe ich es in den Laden, und von dort aus geht es weiter. Immer rum. Wie ich schon sagte.«
»Hauptsache, nicht zu mir!«
»Dabei macht der doch nichts. Er braucht ja nicht mal Brot oder Luft. Es gibt sogar feine Leute, natürlich Badegäste, die sich für das Skelett interessieren.«
»Wirklich?«, meinte Kohl verwundert.
»Herr Leisner weiß aber auch viel, immer hat er irgendwelche Bücher mit Menschenteilen aufgeschlagen, die er studiert. Einmal durfte eine Dame sogar den Schädel ein wenig bewegen und tat ganz ernst dabei. Erst als unser Herr Pastor den Laden betrat, ließ sie ab und sprach hastig über irgendein Mittel zum Einreiben. Und wer musste es dann wieder wegräumen?«
Das war ihr Stichwort, denn nun war das Frühstückstablett gefüllt und die Krümel vom Tisch gefegt. Kohl hatte ihr fasziniert zugehört.
»Wenn ich dann gehen dürfte, im Haus gibt es noch viel zu tun.«
SÜDSEEMANN
Bevor Kohl sich aufmachte, dem Flecken Wyk die Ehre zu geben, suchte er noch das Häuschen im Garten auf. Bei dem anschließenden Gang über die Wiese, vorbei an den Büschen und Blumen, streichelte er die Ziegen, sog die Luft ein und sah prüfend zum Himmel. Wie praktisch, ganz ohne Etikette nach draußen treten zu können, um das Wetter zu erforschen. Das Grau des Morgens verschwand, bauschige Wolken legten sich vor ein vielversprechendes Blau. So wollte er es an diesem Herbsttag allein mit seinem Rock versuchen und ging hinein.
Aus seiner kleineren Reisetasche nahm er ein Notizbuch und einen Bleistift, griff nach seinem Zylinder und trat hinaus auf die breite Gasse. Welch ein Kontrast zur Idylle hinter dem Haus. Modisch gekleidete Paare in Seide und Tweed begegneten einander und grüßten formvollendet. Kräftige Burschen zogen und schoben Karren durch den Sand, in dunkle Stoffe gehüllte Frauen, meist mit einem Korb unter dem Arm, gingen ihren Besorgungen nach. Kohl erinnerte sich grob an die Lage des Hafens und schlug die Gegenrichtung ein, hielt sich ab der nächsten Hausecke links und stieß so auch bald auf die Uferpromenade. Eine Allee junger Ulmen säumte den Weg, der leicht erhöht den Ort von Strand und Meer trennte. Wyk wurde hier durch eine Reihe von Villen und stattlichen Häusern repräsentiert, die bewiesen, dass die Zeiten des einfachen Meerdorfes vorbei waren. Wenige Kinder spielten im Sand, natürlich unter Aufsicht. Die Ebbe hatte längst eingesetzt und den modrig braunen Meeresboden freigegeben.
Kohl schaute kurz auf seine glänzenden Schuhe und verzichtete auf einen Strandgang. Ihn hätte die Aussicht auf heranschäumende Wellen gereizt, aber so folgte er dem Beispiel der anderen Seebadgäste und flanierte unter den Bäumen bis zum Ende der Allee. Dann wandte er sich wieder nach rechts dem Ort zu und schlenderte durch die Gassen. Den prächtigen Häusern, die die Promenade säumten, folgten zum Ortskern hin die niedrigeren Behausungen von Fischern und Seeleuten. Diese ersten Eindrücke waren ihm besonders wichtig. Die andere Geschwindigkeit des Lebens, die Kleidung der Einheimischen, Licht und Landschaft, eigentümliche Gewohnheiten. Wie schnell hatte sich das Auge an so etwas gewöhnt. Dabei war es gerade das, was er seinen Lesern mitzuteilen gedachte.
Plötzlich gewahrte Kohl in einer der beschaulichen Gassen einen Auflauf. Passanten sammelten sich, reckten die Hälse, die getünchten Wände warfen Gemurmel und Rufe zurück. Neugierig trat er hinzu und drängte sich unter Entschuldigungen nach vorne. Inmitten der Leute stand ein Gendarm in Uniform. Sein Gesicht wirkte verkniffen, und sein blauer Rock war mit Schmutz bedeckt, als hätte er sich auf der Erde gewälzt. Die eine Hand lag am Griff seines Säbels, die andere hatte er in das Hemd eines Gefangenen gekrallt. Auch der schien, dem Dreck auf seiner Kleidung nach, am Boden gelegen zu haben. Der Mann war an den Händen in Eisen gelegt und widersetzte sich bockig dem Uniformierten, der ihn weiterziehen wollte.
Kohl sah aufmerksam zu. Das hier war etwas nach seinem Geschmack. Eine energiegeladene Szene auf einer sandigen Gasse zwischen niedrigen, mit Reet gedeckten Häusern. Rohheit und Armut sprachen aus der Szenerie– so also konnten die nordfriesischen Inseln auch sein.
Die hellbraune Haut des Gefesselten zeigte, dass er von sehr weit her gekommen sein musste. Er trug lange Hosen, ein grobes Hemd und darüber eine dunkle Weste. Im Gesicht stand ein dünner Backenbart, und seine schwarzen Haare hatte er straff nach hinten zu einem Knoten gebunden. Von der Unterlippe bis zur Kinnspitze zierte ihn eine Tätowierung, ein aus vier Kringeln bestehendes, abgerundetes Viereck. Verbunden mit dem weit geöffneten Mund und den aufgerissenen Augen mit ihrem leuchtenden Weiß wirkte der Mann auf Kohl exotisch. Er dachte an die kolorierten Kupferstiche aus dicken ethnologischen Folianten und war sich sicher, dass es sich bei dem Kerl um einen Südseeinsulaner handelte, noch keine vierzig Jahre alt. Kohl war elektrisiert. Was um alles in der Welt war hier im beschaulichen Wyk geschehen?
»Der Wilde hat einen Jungen erschlagen, bei der Lembecksburg. Einen Föhrer. Wir haben ihn erwischt, als er fliehen wollte«, rief ein stämmiger Friese, seiner Kleidung nach ein Bauer. »Ich habe genau gesehen, wie er an dem Toten herumgerissen hat, und als er mich dann erkannte, ist er weggelaufen.«
Der Gendarm zerrte seinen Gefangenen von der Gasse weg in einen schmalen Gang zwischen zwei Häusern, gefolgt von dem Bauern, der den Umstehenden weiter berichtete. »Jetzt kommt er hinter Schloss und Riegel. Hat sich jahrelang beim alten Hansen verkrochen, aber ihrer Natur müssen sie trotzdem gehorchen, diese Menschenfresser. Ich habe ihn wohl gestört, wie er sich über den Jungen hermachen wollte.« Verächtlich spuckte er auf den Boden. »Und so was lebt unter uns Christenmenschen, eine Schande ist das. Wir waren gerade auf der Weide und haben einen Graben gesäubert. Aber als er so weggelaufen ist, ganz aufgeregt, sind wir gleich hinterher, ich und mein Knecht. Der Kerl war mir noch nie geheuer.«
Einige der Einheimischen nickten zustimmend.
»Ein Blick auf den Toten und das viele Blut, dann haben wir ihn mit unserem Pferdekarren eingeholt. Im Wäldchen bei der Vogelkoje wollte er sich verstecken, nahe der Grenze. Aber wir haben ihn da rausgescheucht wie einen Fasan. Er ist immer weiter östlich gelaufen, hat Haken geschlagen. Auf den Weiden vor Alkersum hatten wir ihn dann.«
»Ich nicht töten, nur finden! Warum ich das machen?«, rief der Gefangene und bäumte sich ein letztes Mal auf, dann schien ihn alle Kraft zu verlassen, und er gab sich zusammengefallen in die Hände des Uniformierten. »Armer Junge schon tot.«
»Pana, gib auf. Ich habe mich mit dir genug im Dreck gewälzt«, knurrte der Gendarm und schob ihn vor sich her.
In den schmalen Gang konnte ihm die Menge nicht folgen, auch Kohl nicht. Den Äußerungen der Umstehenden entnahm er, dass am Ende des Weges zwischen den Häusern ein kleines Gefängnis auf den Insulaner wartete.
»Der Wilde hat sich an einem Jungen vergangen?«, schrillte unter den Gaffern die Stimme einer Frau durch die Stille. Die Dame schob ihre Haube nach hinten, um kein Detail der Szene zu verpassen.
»Wer ist denn dieser Hansen, kennt den jemand?«, fragte ein Mann, dann redeten alle durcheinander.
»Entsetzlich, in Ketten gelegt wie ein Sklave.– Wir müssen uns um die Kinder sorgen!– Habe immer gewusst, dass man den Heidenvölkern nicht trauen darf.– So jemand auf unserer Insel?– Warum war der Kerl nicht unter Aufsicht?– Pana, was ist das überhaupt für ein Name.«
SCHLIMME NACHRICHT
Vor der niedrigen Kate scharten sich die Frauen des Dorfes um den leeren Einspänner des Doktors. Lautes Weinen und Klagerufe drangen nach außen. Einige Männer kamen von den Weiden hinzu. Flüsternd und murmelnd verbreitete sich die Nachricht.
Jemand hatte einen der Ihrigen erschlagen, Ingwer, den Sohn der Keike Martens. Unter sich nannten sie die Frau »de Spöök«, den Geist. Drüben bei der Lembecksburg habe man den Jungen gefunden, am Schädel eine schlimme Wunde. Pana soll es gewesen sein, der Diener vom alten Kapitän Hansen aus Nieblum. Jetzt habe der Doktor den Leichnam in seiner Praxis, um die Mutter mit dem Anblick nicht noch weiter in den Wahnsinn zu treiben.
Zwei der Dorffrauen betraten schweigend und mit ernster Miene das Trauerhaus. Niemand im Dorf beweinte seinen Verlust allein, dem allgegenwärtigen Tod begegnete man als Volk von Seefahrern gemeinschaftlich.
Die dreizehnjährige Laura, Schwester des Erschlagenen, fanden sie niedergehockt in einer dunklen Ecke neben der Herdstelle. Das Schluchzen des Mädchens wollte kein Ende nehmen, sein Gesicht war rot erhitzt und tränennass. Dass sie nicht zur Schule gegangen war, wunderte niemanden. Die Mutter, Keike, saß in der kargen Stube und raufte sich ohne Unterlass ihre Haare. Der Oberkörper schwankte wie ein Pendel vor und zurück, ihre weit aufgerissenen Augen starrten ins Leere. Immer wieder stieß sie lang gezogene Klagelaute aus. Der Arzt, Dr.Boey, schloss seine Tasche und wandte sich zu den Frauen. Seine leicht gebeugte Haltung und der weiße Spitzbart gaben ihm etwas Väterliches.
»Kein Zweifel, es ist Ingwer. Ich habe es Mutter und Tochter eben mitgeteilt. Eine traurige Aufgabe. Ihr dürft Keike jetzt nicht allein lassen, und der Laura gebt ihr am besten Beschäftigung. Das lenkt sie ab. Lasst sie einen Tee kochen, etwas Beruhigendes. Und das hier soll Keike morgens und abends nehmen. Jeweils eine.«
Er übergab ein mehrfach gefaltetes Stück Papier, in dem sich kleine braune Kügelchen befanden, und verließ die Stube. Als ein weiterer Herr die Kate betrat, schien Dr.Boey die schlanken Umrisse des Besuchers zu erkennen und verbeugte sich.
»Uns Werth, hat Sie die Nachricht also erreicht?«
Der andere nickte. Er sprach mit dänischem Akzent. »Westerlandföhr ist mir anvertraut. Und bei einem Kapitalverbrechen sorgt sich der König besonders. Liegt eines vor?«
Dr.Boey bejahte stumm.
»Und die Familie?«
»Mutter und Tochter sind in den Händen der Dorffrauen. Der Vater, Krino Martens, ist lange auf See verschollen. Der junge Ingwer war die Hoffnung aller. Steuermann hätte er werden sollen.«
Aus der Stube drangen Rufe und Gekreisch.
»Der Wikinger. Ich habe ihn gesehen! Meinen Mann hat er niedergestreckt, und nun hat er auch meinen Sohn geholt!«
Der Herr sah Dr.Boey irritiert an und legte seine hohe Stirn in Falten.
»Der Landvogtei dürfte der Fall bekannt sein«, raunte Dr.Boey. »Partieller Wahnsinn. Bisher eher lästig als gefährlich. Auch Pastor Stedesand von St.Laurentii empfiehlt die Einweisung nach Århus. Dabei gehört Goting ja zum Kirchenspiel von St.Johannis auf Osterlandföhr. In manchen Fällen ist die Staatsgrenze auf unserer Insel wirklich eine Strafe. Jedenfalls besteht Uneinigkeit, aus welcher Kasse die Kosten bezahlt werden sollen.«
Hans Jørgen Trojel, Landvogt von Westerlandföhr, trat in seinen Schnallenschuhen einen Schritt zurück und ließ die Stubentür nicht aus den Augen. Seine dünnen Finger zupften an seinem Backenbart, dann glitten sie unter die Halsbinde, als benötige er etwas Luft.
Unverhofft erschien Laura im lichtarmen Flur. Zaghaft setzte sie ihre bloßen Füße voreinander, als erfordere es Mut, sich dem hochgestellten Herrn zu nähern. Sie schluckte und wischte sich über die Wangen.
»Herr Landvogt, meine Mutter will gestern zwei Männer gesehen haben, die miteinander kämpften. Auf der Lembecksburg. Sie hat von Wikingern gesprochen, so wie gerade. Aber was, wenn da wirklich gekämpft wurde. Hat man Ingwer nicht dort gefunden? Und er war auch die ganze Nacht nicht zu Hause. Wir haben ihn seit dem Abend vermisst. Ich weiß ja, dass meine Mutter im Kopf… dass sie…«
Dr.Boey machte eine beschwichtigende Handbewegung und lächelte ihr gütig zu.
»Aber man muss das doch untersuchen«, fuhr Laura aufgeregt fort. »Und dann ist auch noch ein Gespann den Weg entlanggekommen, gerade als ich meine Mutter von der Burg weggeführt habe. Vielleicht ist das sehr wichtig.«
Trojel sah von Laura zu Dr.Boey und strich über seinen Backenbart. »Gewiss, ein Gespann«, wiederholte er und wirkte in Gedanken abwesend. »Macht es Sinn, wenn ich die Mutter jetzt befrage?«
Dr.Boey gab einen undeutlichen Laut von sich. »Ich fürchte, das führt zu nichts. Die Trauer, ihre Krankheit, und dann habe ich ihr Opiumpillen verabreicht. Ich empfehle, etwas zu warten.«
Trojel nickte, wandte sich zum Ausgang, dann drehte er sich noch einmal zu Laura um. »Wann, sagst du, war deine Mutter dort oben und hatte ihr Gesicht?«
»Am frühen Abend, es wird gegen sechs Uhr gewesen sein«, antwortete sie. »Aber vielleicht war es eben kein Traum oder so etwas. Wo doch genau dort der Ingwer gefunden wurde.«
»Ja, ja«, sprach Trojel matt. »Hatte dein Bruder denn Feinde? Gibt es jemanden, dem du die Tat zutraust?«
Laura schüttelte traurig den Kopf und blickte zu Boden.
Trojel sah kurz auf sie herab, dann bedeutete er Dr.Boey, ihm vor die Tür zu folgen.
»Armes Kind«, sagte er leise, »wenn ihre Mutter in der Anstalt ist, wird sie allein sein. Aber immerhin ist sie bald groß, wie mir scheint.« Er sah zu den Dörflern hinüber. Gebeugt standen sie da, als erwarteten sie ein schlimmes Urteil. »Nun Herr Doktor, was haben wir hier also?«
Dr.Boey sammelte sich einen Moment, bevor er berichtete. »Heute Morgen gegen sieben Uhr hat ein Bauer nahe der Lembecksburg gesehen, wie sich Pana an etwas zu schaffen machte. Sie werden seine Erscheinung kennen. Als er plötzlich weglief, wurden die Landleute misstrauisch und fanden den Leichnam des Ingwer Martens. Er lag vor dem Erdwall. Sie haben den Fliehenden verfolgt, nun ist er in Wyk festgesetzt.«
»Wie das?«, brummte Trojel. »Die Tat geschah bei uns auf Westerlandföhr, das Opfer wohnte auch hier. Und der Täter ist über die Grenze geschafft worden? Das wird Komplikationen geben. Aber ich habe Sie unterbrochen.«
»Nachdem der Bauer den Missetäter nach Wyk transportiert hatte, lief der Knecht gleich zu mir. Ich weiß nicht, warum, vielleicht aus Sorge um die Mutter des Toten. De Spöök, wie sie allgemein genannt wird, ist bekannt und ständiger Gegenstand von Tratsch und Spott.« Dr.Boey atmete tief durch und fuhr fort: »Nun, wie auch immer, ich habe mir sofort den Leichnam vor Ort angesehen. Er lag noch im Graben, auf der Ostseite der Lembecksburg, nicht weit vom Eingang entfernt. Zweifelsfrei handelt es sich um den vierzehn Jahre alten Ingwer Martens, ich kannte ihn gut. Der Junge war nicht groß, aber wohlgewachsen.«
»Was war die Todesursache?«, fragte Trojel.
»Auf seiner linken Schädelseite, eine Handbreit oberhalb des Ohres, zeigte der Schädelknochen über eine Länge von vier Zoll eine klaffende, schmale Wunde. Das muss ein scharfer Gegenstand gewesen sein, mit Wucht geführt. Einen Unfall, Uns Werth, können wir ausschließen.«
Trojel entwich ein Stöhnen, und er legte die Hand vor den Mund.
»Selbstverständlich habe ich noch keine ausführliche Leichenschau durchgeführt. Lediglich an Armen und Beinen fand ich seltsame Ritzspuren, die ich weiter untersuchen muss. In meiner Praxis wartet der Körper auf eine eingehende Examinierung. Immerhin können wir feststellen, dass die Totenstarre bereits eingesetzt hat.«
Trojel sah ihn fragend an.
»Eine ungenaue Wissenschaft«, entschuldigte sich Dr.Boey, »sehr abhängig von den Temperaturen der Umgebung und weiteren Faktoren. Aber in der Regel ist die Starre nach sechs bis zwölf Stunden ausgeprägt und löst sich nach vierundzwanzig bis achtundvierzig Stunden wieder. Eine größere Belastung der Muskeln oder Wärme kurz vor dem Tod beschleunigen ihr Einsetzen.«
»Das heißt in diesem Fall?«
»Uns Werth, der Tod des Jungen ist länger her. Wenn sich die Tat dort ereignete, wo er gefunden wurde, hat der Leichnam die Nacht über draußen in der Kälte gelegen. Ich wage die Prognose, dass die Tat vor weniger als vierundzwanzig Stunden geschehen ist, aber eben auch nicht in diesen Morgenstunden. Das wiederum bedeutet, dass der Südseemann Pana unmöglich heute Morgen die Tat begangen haben kann.«
Nachdenklich presste Trojel die Lippen aufeinander.
»Zu ärgerlich. Und wenn der Unhold zum Ort seiner Tat zurückgekehrt ist? Vielleicht wollte er eine Spur verwischen oder das Mordwerkzeug verschwinden lassen. Immerhin ist er geflohen, das macht den Kerl verdächtig. Ich habe ihn ja nur selten gesehen, obwohl sein Brotherr Hansen in Nieblum wohnt wie Sie und ich. Er schien sich immer versteckt zu halten. Dabei lebt er schon weit über fünfzehn Jahre auf der Insel, oder nicht? Und überhaupt, wo war er denn all die Stunden vor dem Fund?«
Dr.Boey wiegte den Kopf. »Pana lebt schon lange und sehr unauffällig unter uns. Im Grunde genommen wissen wir nichts über den Mann aus der Südsee. Und wie ich heute Morgen von wackeren Nieblumern gehört habe, soll sich der alte Hansen nicht sicher sein, ob Pana die Nacht über im Haus war. Der Kapitän will früh zu Bett gegangen sein, hieß es, er wisse nicht, was Pana des Nachts treibe.«
»Nun, ich werde einen kurzen Blick auf die Lembecksburg werfen und mir dort ein Bild machen. Dann muss ich natürlich mit meinem Amtsbruder in Osterlandföhr verhandeln, wie wir diesen Fall lösen. Denn auch wenn der alte Kapitän Hansen in Nieblum wohnt, so steht sein Haus doch, wie Sie wissen, jenseits der Landstraße und damit auf der anderen Seite der Grenze. Ermittlungen in seinem Haus geschehen also im Ausland. Wir haben Tatort und Opfer, die Osterländer haben den Täter und sein Umfeld. Vertrackt, vertrackt. Und was ist noch von Ihnen zu erwarten?«
»Euer Wohlgeboren, ich begebe mich sogleich an die Leichenschau. Die Hinterbliebenen haben es verdient, möglichst schnell zur Ruhe zu kommen.«
Beide Herren eilten zu ihren Einspännern. Mit knappen Worten teilte Trojel vom Kutschbock herab den harrenden Leuten mit, dass die Landvogtei die Tat unverzüglich und mit aller gebotenen Dringlichkeit untersuchen werde. Für Mutter und Schwester des Toten bat er um christlichen Beistand und nachbarschaftliche Hilfe. Pastor Carstens werde sich gewiss bald um die Seelen seiner Gemeinde sorgen. Dann schlugen die Herren die Zügel und verschwanden in zwei unterschiedliche Richtungen.
Aus dem dunklen Flur trat Laura vor die Tür und sah den Kutschen mit ernstem Gesicht hinterher. Sie hatte gelauscht, das Gehörte dröhnte in ihrem Kopf und mischte sich mit der Trauer um den Bruder.
Wie war Ingwer wirklich gestorben? Musste er Qualen erdulden? Warum war das geschehen? Er hatte für seine Zukunft so fleißig gelernt. Tränen rannen ihre Wangen hinab. Eine lange, schmale Wunde, hatte der Arzt gesagt und von großer Wucht gesprochen. Sie schluckte. Und Pana soll es gewesen sein? Dem Landvogt schien das die beste Lösung, vermutete Laura, aber irgendetwas daran stimmte nicht. Pana hatte nie irgendwelchen Streit mit Ingwer oder einem anderen Jungen gehabt. Er war jedem Ärger aus dem Weg gegangen. Allein weil er fremd aussah und vielleicht eine geheimnisvolle Geschichte hatte, sollte er urplötzlich ein Mörder sein?
ERSTE ZWEIFEL
Der scharfe Wind trieb weiße Wolken über den hohen, grasbewachsenen Wall, vor dem Kohl stand. Er nahm seinen Zylinder vom Kopf und fuhr sich durchs Haar.
»Es ist gut, ich brauche Sie nun nicht mehr«, sprach er zu dem Kutscher und drückte ihm einige Münzen in die Hand. »Für den Rückweg wird sich gewiss eine Gelegenheit finden.«
Der Mann auf dem Bock tippte an seine Mütze und schlug die Zügel. Kohl wartete, bis das Geräusch der Pferdehufe verklungen war, dann schritt er auf die Anhöhe zu. Von außen wirkte das Gebilde wie ein hoher, kreisrunder Deich. Am Fuße der Erhöhung zog sich ein niedriger Graben um den Ringwall, von dem Kohl annahm, dass er einstmals sehr viel tiefer gewesen war. Er erklomm den Wall und blickte über das flache grüne Land. Weit im Westen sah er einen massigen Kirchturm, der zwischen ein paar Bäumen hervorlugte. Im Süden zeigten sich die Hausdächer eines Dorfes, etwas östlich davon sah er einen weiteren Kirchturm, dem anderen sehr ähnlich. Nicht ganz so weit vom Ringwall entfernt erhob sich ein dichtes Wäldchen aus der Ebene. Zur Straßenseite hin, von wo er gekommen war, tat sich eine Lücke auf, wohl der Eingang zu dieser uralten Anlage.
Kohl stieg auf der Innenseite des Walls hinunter. Stille umgab ihn, allein der Wind rauschte und ließ das Gras rascheln. Er trat in die Mitte des Runds und drehte sich einmal um sich selbst. Ja, es schien wirklich ein perfekter Kreis zu sein. Von einem Rand zum anderen schätzte er die Entfernung auf gut dreihundert Fuß und die Höhe des Walls auf vielleicht dreißig.
Hier also soll dieser Junge erschlagen worden sein, dachte er. Wo mochte der Körper gelegen haben? Bestimmt außerhalb der Erhebung, sonst hätte der Bauer diesen Pana gar nicht sehen können. So verließ Kohl das Innere und folgte im Uhrzeigersinn dem äußeren Rand des Walls, die Augen immer auf den Boden gerichtet. In kleinen Schritten setzte er die Füße voreinander auf der Suche nach niedergetretenem Gras, Blutstropfen, aufgeworfener Erde oder irgendetwas anderem, das auf die Tat hätte hinweisen können. Hin und wieder richtete er seinen Blick in die Landschaft. Die menschlichen Behausungen lagen fernab. Sein konzentriertes Schauen und Gehen, das man kaum eine Bewegung nennen konnte, verkrampfte ihn und strengte an. Ab und zu tupfte er sich mit einem Taschentuch über die Stirn.
Mit einem Mal, er hatte gerade die östliche Seite des Walls erreicht, hielt er abrupt inne. Vor sich sah er ein Mädchen, das auf der Erde kniete und weinte. Der Wind trug ihm ihre Schluchzer zu, ihre dünnen Schultern zuckten. Wie im Gebet lagen ihre Hände gefaltet auf dem grauen Rock, dann wischte sie sich mit den Ärmeln der groben Bluse die Augen trocken. Als sie ihn bemerkte, schrak sie zusammen und sprang auf.
Kohl räusperte sich, setzte seinen hohen Hut auf, nur um ihn dann in korrekter Vorstellung vor dem Mädchen zu ziehen. Sie war kein kleines Kind mehr, er schätzte sie auf zwischen zwölf und fünfzehn Jahren. Ihm gefielen die blonden Zöpfe, die sie wie Schaukeln um ihre Ohren geflochten hatte.
Sollte sie der Schule bereits entwachsen sein? Das würde erklären, warum sie sich am frühen Morgen in dieser verlassenen Gegend herumtrieb, vielleicht als Milchmagd oder Schafshüterin. Dann müsste sie mindestens vierzehn Jahre alt sein.
»Junges Fräulein, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich dich erschreckt haben sollte. Ich bin ganz in Gedanken um den Burgwall gegangen, als ich dich gerade weinen sah. Ist etwas passiert? Oder brauchst du Hilfe?«
Er lächelte sie unsicher an und machte einen Schritt auf sie zu. Aber das Mädchen schreckte zurück und schaute sich hastig um. Kohl seufzte. Kinder waren nicht seine Stärke, lieber sprach er mit Erwachsenen.
Hatte dieses Friesenmädchen sein Deutsch nicht verstanden? Immerhin konnte er außerhalb des Fleckens Wyk kaum damit rechnen, waren doch eher Friesisch und Platt die Sprachen der Menschen hier. Da das Mädchen keine Antwort gab, beugte er sich über die Stelle am Boden, wo sie eben noch gekniet hatte. Entsetzt hielt er den Atem an. Rotbräunliche Tropfen und Schlieren klebten an Grashalmen. Blut. In einer großen Lache war es ins Erdreich gesickert. Gut drei Schritte davon entfernt fand er die Grasnarbe aufgebrochen und die Erde zerwühlt, als wäre sie von einem Wildschwein durchfurcht worden. Ein bloßer Kampf jedenfalls bringt so eine Stelle nicht hervor, dachte er. Jetzt erkannte er auch die Furchen von in den Boden gedrückten Wagenrädern, die bis an den Wall heranreichten. Schwer zu sagen, ob diese Spuren von einer oder mehreren Kutschen stammten.
Er schaute in die rot geweinten Augen des Mädchens, das ihn misstrauisch belauerte. Mit ernstem Gesichtsausdruck nickte er, nahm den Zylinder ab und hielt ihn vor sich in den Händen, als stünde er an einem Grab. »Ist es hier geschehen? Hat man hier den jungen Ingwer Martens erschlagen?«
Um sicherzugehen, auch verstanden zu werden, hatte er in Plattdeutsch gesprochen. Selbst in Bremen geboren und an der Küste aufgewachsen, fiel ihm das nicht schwer. Des Friesischen war er nicht mächtig. Aus den Augenwinkeln beobachtete er, wie das Mädchen reagierte. Und wirklich, als er den Namen des Toten ausgesprochen hatte, zuckte es zusammen und begann erneut zu weinen.
»Welch sinnlose, grausame Tat«, sagte Kohl leise. »Die arme Familie. Aber immerhin scheinen sie den Unhold ja gefasst zu haben.«
Laura wischte sich über die Augen. »Woher kennt der Herr den Namen?« Ihre Stimme brach, und sie schluchzte kurz auf.
»Der Herr heißt Johann Georg Kohl und berichtet von den Dingen, die sich auf seinen Reisen zutragen«, stellte er sich vor. »Ich war zugegen, als der Südseemann ins Wyker Gefängnis geworfen wurde. Er habe nichts gemacht, hat er gerufen. Ich frage mich auch, was und wo diese Vogelkoje ist, bei der er gefangen wurde.«
Laura deutete mit dem Finger in östliche Richtung. »Na, dort drüben, bei dem Wäldchen. Oben von der Burg aus kann man es gut erkennen. Da ist ein großer Teich in der Mitte von Büschen, auf dem landen die Enten und geraten in eine Falle. Der Vogelmann macht sie tot, und dann werden sie gekocht und kommen in Dosen. Ich habe gehört, dass man sie sogar bis Amerika schickt.«
Mit einem Mal sank ihre Hand, und sie sah zu Boden. Nachdenklich schüttelte sie den Kopf, dann blickte sie Kohl mit traurigen Augen an. »Pana hat meinen Bruder bestimmt nicht erschlagen. Dazu gibt es überhaupt keinen Grund. Es ist nur, weil manche Leute hier denken, der sei ein Menschenfresser. Dabei haben sich die beiden fast jeden Tag gesehen.«
Kohl schaute sie neugierig an.
»Ingwer ist beim alten Kapitän Hansen in die Rechenschule gegangen. Und Pana war sein Hausdiener.«
»Wie geht es denn deiner Mutter?«, fragte Kohl, den es nach der ersten Überraschung nicht weiter verwunderte, hier am Tatort auf die Schwester des Toten zu treffen. »Die Nachricht wird sie gewiss schwer getroffen haben.«
»Wie soll es ihr gehen? Sie hat mit meinem Bruder den einzigen Sohn verloren. Den Vater hat die See behalten. Nun sind wir allein. Aber warum fragen Sie das, schreiben Sie für eine Zeitung?«
Von der See behalten, wiederholte Kohl in Gedanken, das klassische Ende eines Seefahrerlebens. Dann wandte er sich ganz dem ärmlich gekleideten, barfüßigen Mädchen zu.
»Keine Zeitung, ich ziehe es vor, Bücher zu schreiben, in denen ich über meine Reisen berichte, von der Schönheit der Landschaft und den Menschen, die in ihr wohnen.«
Er sah sie durchdringend an. »Aber hier, im Angesicht der schrecklichen Spuren und deiner Tränen, erfasst mich natürlich zuallererst Mitgefühl. Dem Gendarmen und den Leuten auf der Straße schien es übrigens sehr recht zu sein, dass es diesen Pana gibt. So ist die Tat an deinem Bruder bereits aufgeklärt, und der Lump aus der Südsee kann bestraft werden.«
Laura zog die Augenbrauen zusammen und betrachtete ihn von den Schuhspitzen aufwärts über den modischen Anzug und die rote Seidenschleife bis zu seinem hängenden Schnauzbart und den grauen Augen. Sie schien nachzudenken.
Eine Weile sah sie Kohl mit ernster Miene an, erst dann sagte sie leise: »Ich habe sie belauscht. Dr.Boey hat dem Landvogt gesagt, dass Ingwer nicht diesen Morgen erschlagen wurde. Deshalb kann Pana nicht der Totschläger gewesen sein. Aber der Landvogt denkt schlecht von ihm, weil er weggelaufen ist.«
Kohl strich über seinen Schnauzbart. »Wie es scheint, birgt der Tod deines Bruders noch ein Geheimnis. Aber was bedeutet das, wenn der Kerl es gar nicht war? Das hieße ja, dass der wirkliche Täter noch frei herumläuft.«
»Ja, und das ist schrecklich.« Laura schluckte. »Können Sie nicht helfen, den wahren Mörder zu fassen?«
Kohl schaute sie voller Mitgefühl an. »Ich weiß nicht, ob ich das kann«, sagte er vorsichtig. »Vielleicht dürfte ich in den kommenden Tagen noch einmal bei dir und deiner Mutter vorbeischauen? Ich selbst wohne beim Apotheker Leisner in Wyk. Und du, sagst du mir deinen Namen?«
»Laura aus Goting. Laura Martens. Jeder kennt uns da. Aber ich muss jetzt wieder nach Hause«, sprach sie und sah noch einmal auf das Blut am Boden.
Kohl seufzte. »Ja, wie es aussieht, gibt es hier nicht mehr viel zu ergründen. Also, junges Fräulein, nochmals mein tiefstes Beileid. Wir werden uns bald wiedersehen.«
Zu Füßen der Lembecksburg sah Kohl Laura nach, wie sie durch die Weiden auf die entfernt liegenden Häuser zuging. Überall war es dasselbe, die Armen traf es am härtesten.
Um ein Haar riss ihm eine Windböe den Hut vom Kopf, immerhin blies sie seinen Gedanken fort. Nun gab es für ihn einiges, was er auf dieser Insel untersuchen konnte.