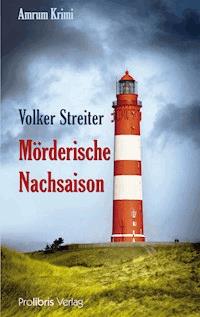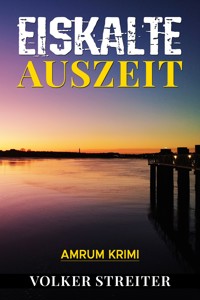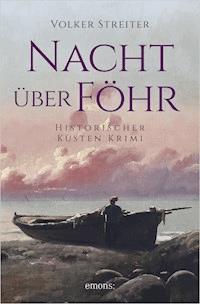2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paris 1855. Heinrich Heine, gelähmt und ein Pflegefall, soll sterben. Seine Durchlaucht Wenceslaus Fürst von Metternich will es so und schickt vier seiner Agenten. Auch der einst mächtigste Literaturkritiker, Wolfgang Menzel, Franzosenhasser und Antisemit, will Heines Tod. Selbst dessen Cousin Carl aus Hamburg, Bankier, will die nicht endenden Zahlungen rufschonend einstellen. Bei einem Fest vereitelt Elise Krinitz, neu angestellte Vorleserin und Heines letzte Liebe, einen Anschlag, und doch ist Heine nicht sicher. Aus seiner nächsten Umgebung droht ihm weitere Gefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Volker Streiter
Pariser Verschwörung
Tödliche Schatten über Heinrich Heine
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Inhalt
Metternichs Plan
Vorstellung
Komplize
Charmante Person
Französische Zustände
Ungute Erinnerungen
Gehorsam
Berufe und Berufungen
Die Weltausstellung
Geheimnisvolles
Geständnisse
La Villette
Bunter Abend
Der Hamburger Cousin
Geänderte Pläne
Vorbereitungen
Letzte Handgriffe
Genuss
Nachwehen
Süßer Montag
Faktenbasierter Epilog
Personen und Namen in der Reihenfolge ihres Erscheinens
Der Autor
Impressum neobooks
Inhalt
Pariser Verschwörung
Tödliche Schatten über Heinrich Heine
Volker Streiter
Mich ruft der Tod – Ich wollt, o Süße,
dass ich dich in einem Wald verließe,
in einem jener Tannenforsten,
wo Wölfe heulen, Geier horsten
und schrecklich grunzt die wilde Sau,
des blonden Ebers Ehefrau.
H.H.
Metternichs Plan
»Herzflimmern sagten Sie, ein kurzzeitiges Schwarz vor Augen und Schwindel?« Doktor Friedrich Jäger von Jaxtthal, Leibarzt seiner Durchlaucht, beugte sich über den blassen Patienten: Klemens Wenzel Lothar Fürst von Metternich, die Nennung all seiner Titel würde uns nur ermüden, ehemals Kanzler eines Riesenreiches und gewesener Lenker des nachnapoleonischen Europas. Der inzwischen eher geduldete Berater am Wiener Hof saß bleich aber aufrecht in einem durchgeschwitzten Nachthemd in seinem Himmelbett, das weiße Haar klebte am Kopf. Sein Schlafgemach hatte schon bessere Zeiten gesehen, den blinden Goldstuck an der Raumdecke brachte auch das Tageslicht nicht mehr zum Glänzen.
Konzentriert, die Finger am gebrechlichen Handgelenk seines Patienten, folgte der Arzt dem Pulsschlag. Der gefiel ihm nicht. Auch die Augen dieses einst mächtigen Mannes machten ihm keine Freude, sie waren unterlaufen, der Blick trübe. »Durchlaucht, haben Sie genug getrunken? Die Sommerhitze setzt gerade auch Menschen zu, die Ihr Alter erreicht haben, halten zu Gnaden.«
»Ach mein guter Jaxtthal, immerhin lassen Sie mich nicht zur Ader, das rechne ich Ihnen hoch an. Ein Mensch meines Alters, sagen Sie, beachtliche 82, und nur das Wasser soll mir fehlen? Herr Doktor, auch eine barmherzige Lüge ist eine Lüge. Doch ich danke Ihnen. Wie also ist Ihre Therapie? Hoffentlich darf es auch etwas Wein sein, natürlich in Maßen.«
»Durchlaucht, ohne Wein werden Sie nicht länger leben, es käme Ihnen nur so vor. Regelmäßige Bewegung, Spaziergänge, frische Luft, viel pflanzliche Kost und wenig Fleisch, kaum Fett. Ihr Herz sollte in Ruhe schlagen, kein Blutstau im Kopf, keine anschwellenden Adern.«
»Jaxtthal, ich bin kein Holzfäller, und mein letzter scharfer Ritt ist Jahrzehnte her, da besteht keine Gefahr, nicht einmal in der Liebe werde ich mich derart aufpeitschend engagieren. Keine Tinkturen diesmal, keine Pulver für mich? Steht es so schlecht?«
Der Arzt wiegte den Kopf. »Nun, etwas Weißdorn könnte das Herz stärken, ich werde mit dem Apotheker sprechen.«
»Na bitte, gibt es ein Mittel, gibt es auch Hoffnung. Sehe ich nicht auch schon besser aus?« Der Arzt musste schmunzeln und verbeugte sich. »Aber da Sie schon einmal hier sind, möchte ich Ihre Meinung hören.« Metternich deutete auf ein Ablagetischchen. »Der zweite Akt von oben, schauen Sie hinein. Haben Sie dazu eine ärztliche Meinung?«
Zögernd folgte der Arzt und überflog die unterschiedlichen Handschriften, teilweise auf vergilbtem Papier und nicht alle auf Deutsch. Seit Beginn der lästigen Causa hatten sie Metternich direkt oder über Umwege erreicht. »Durchlaucht, mein Französisch ist nicht gut genug, um ärztliche Sachverhalte ...«
»Unsinn, die Fachbegriffe sind auf Latein, oder fehlt Ihnen die Aprobatio? Habe ich mein langes Leben einem Jahrmarktsbarbier anvertraut?«
Der Arzt schüttelte heftig den Kopf, dann las er weiter. Ungeduldig trommelte der Fürst mit den Fingern auf der Bettdecke. »Nun, was denken Sie?«
»Schilderungen über Jahre, unterschiedlichste Quellen, teils ungenaue Beobachtungen und Symptome, wenn Durchlaucht da eine Diagnose wünschen, wäre die nicht eindeutig.«
»Ach kommen Sie, Jaxtthal, nun verderben Sie mir nicht den Spaß mit Ihrer Bedenkenträgerei. So viel Material, über Jahrzehnte zusammengetragen, da wird der Fachmann doch etwas extrahieren. Also?«
»Es geht, wie ich aus den Berichten entnehme, um Heine, diesen Dichter.«
»Donnerwetter, welche Erkenntnis.«
»Der ist doch als Syphilitiker bekannt, jedenfalls bei den informierteren Lesern. Diese Rapporte hier sind ...«
»Ach, sind Sie so ein Leser? Ist mein Leibarzt gar ein Freund seiner Ideen und Prosa?« Der Arzt sah unsicher zu seinem Brotherrn, dessen dünner Hals sich erwartungsvoll reckte.
»Der Mann hat Sie über Jahre gequält, Durchlaucht, da muss ich doch wissen, warum. Geist, Körper und Seele sind eine Einheit, ein Missverhältnis macht uns krank. Heine kann schreiben, frech und frisch, soweit gefiel er mir, aber seine Zoten und staatspolitischen Ideen, nein, die gehen zu weit.«
»Sehr richtig. Bordellpoesie, nichts weiter. Was für ein Talent, was für ein deformiertes, zum Schmierigen neigendes Talent. Zersetzende Provokationen gegen Staat, Kirche und Familie, selten etwas, das uns erbaut oder erhöht. Doch zurück zu seinem Zustand. Ich warte.«
»Es ist einiges denkbar bei all den Beschreibungen, es sind kaum Ärzte darunter. Nun, diese neurologischen Symptome können verschiedene Ursachen haben, vieles ist uns bisher unbekannt. Gift ist möglich, aber über all die Zeit? Schon 32 klagte er über eine lahme Hand, wenige Jahre später über Sehstörungen, ja er sah doppelt. Das könnte eine Parese des Nervus opticus sein. Dramatische, radikuläre Neuralgien, Brechanfälle, Ausschläge, rasende Kopfschmerzen, finale Hustenqual. Dies alleine spräche für Tuberkulose. 43 ist er linksseitig paralysiert, 48 versagen die Beine ganz und für immer. Ausgerechnet im Louvre vor der Venus von Milo. Wer soll das glauben, was für eine Inszenierung. So oder so, das Rückenmarkt ist betroffen. Tabes dorsalis.«
»Ein perfider Schreiberling, Sie sagen es, der lügt, wo er will, und doch, was für eine Gabe, auf die Venus muss man erstmal kommen, da hat er das ganze Bildungseuropa auf seiner Seite. Überhaupt, er lebt ja lange schon in Paris, dem Zentralstern europäischer Kultur. Unser Wien hat an Strahlkraft verloren. Aber was ist mit seinem Kopf, seinem Denken, irre ist er nicht geworden.«
»Bisher, ja. Er hat Hirnnervenlähmungen ohne Hinweise auf eine Hirnstammschädigung. Von Nackensteifigkeit ist auch nichts zu lesen. Aber er befindet sich, glaube ich, im meningovaskulären Stadium.«
»Jaxtthal, nicht zu medizinisch, wenn ich bitten darf. Ich bin Diplomat, kein Medicus. Stadium von was?«
»Sehr wohl«, wieder erfolgte eine Verbeugung, »alles weist auf eine Neurosyphilis hin.«
»Also doch! Was für ein Gossenjunge. Er hat wortreich zu Texten gemacht, was ihn sinnlich erschauern ließ. Und die Kulturwelt betet ihn an, widerlich.« Metternich atmete tief durch und sah nachdenklich gegen den Baldachin seines Bettes. »Herr Doktor, wie lange hat der noch?«
Der Arzt zuckte zusammen. »Nicht zu sagen, Durchlaucht, der Krankheitsverlauf ist schwer durchschaubar. Er kann Entzündungen der Blutgefäße im Hirn haben, oder im Rückenmark. Das spricht für die Lähmungen, auch für seine Überempfindlichkeit gegen Licht und Lärm. Andererseits ...«, er blätterte die Briefe durch und hielt einen hoch, »andererseits wird schon von seinem Vater berichtet, der ebenfalls gewisse Nervenschwächen gezeigt haben soll. Dann läge es in der Familie.«
Fürst von Metternich schnaubte und machte eine wegwerfende Geste. »Schlechtes Blut, ich glaub es gerne.«
»Das von mir erwähnte Stadium kann sich über Jahre hinziehen. Mir ist ein Fall aus einem der führenden Häuser der Stadt bekannt, da hat ...«
»Schweigen Sie! Die Blüte unseres Landes erkrankt nicht an derartigem Sumpffieber, unsere Klasse betritt keinen Pfuhl, wir stecken auch nichts hinein.« Der Arzt schluckte, um ein Haar wäre er zu weit gegangen, doch der wache Geist dieses Greises verhinderte das.
»Vergebung! Es kann sich über ein Jahrzehnt hinziehen.«
»Na sehen Sie, das passt doch.«
»Aber 23 Jahre? Das ist außerordentlich. Bald müsste dann das parenchymatöse Stadium eintreten.«
»Jaxtthal!«
»Wahnvorstellungen, Gedächtnisverlust, Wesensveränderungen und endlich eine völlige Schmerzunempfindlichkeit. Wunden und andere Verletzungen werden nicht bemerkt, nicht behandelt. Wird der Kranke nicht gepflegt, dämmert er vor sich hin und verfault bis zur Blutvergiftung.«
»Wie unappetitlich und doch so erfreulich.« Wieder trommelte Metternich mit den Fingern. »Aber wann, Herr Doktor, wann?«
»Absolut unbestimmt, Durchlaucht. Berücksichtigen wir die Möglichkeit vererbter Nervenschwäche und die außerordentlich lange Agonie, könnte es auch etwas Anderes, Unbekanntes sein.«
»Womit wir wieder am Anfang wären. Nun gut, dann besorgen Sie mir meinen Weißdorn, wenigstens das. - Und Gift, Jaxtthal?«
Der Arzt schrak zusammen und sah verstohlen zum Fürsten. »Durchlaucht?«
»Na, die Möglichkeit von Gift, ich spreche nicht von mir. Die haben Sie am Anfang Ihrer verschwurbelten Lateinvorlesung angedeutet. Könnte es das gewesen sein?«
»Eine Option wäre es, auch wenn ich nicht verstünde warum.«
»Und Sie wollen Arzt sein? Wo ist Ihr Blick für die menschlichen Dramen? Enttäuschte Liebe, Habgier, gekränkte Eitelkeit eines Konkurrenten, da gäbe es einiges. Also?«
»Toxische Stoffe gibt es genügend. Zum Beispiel die Pfeilgifte der Indianer oder die Substanzen der alten Ägypter, sehr rätselhafte Kulturen. Aber ja, Nervengifte wären geeignet, das ganze System tödlich zu schädigen. Das Ende kommt dann schnell. Im Normalfall. Schwach und zögerlich dosiert bleibt eine schlagartige Wirkung aus. Vielleicht sind Heines Organe durch einen Anschlag geschädigt, der lange zurückliegt, ausgeführt von einem Stümper.«
Kaum hatte der Arzt den Fürsten verlassen, klingelte der nach seinem Leibdiener. »Karl, reich mir den Morgenmantel. Haben wir heute Termine?«
»Für 11 Uhr hat Minister von Buol-Schauenstein seinen Sekretär angekündigt, um die Einschätzung Eurer Durchlaucht zu den Auswirkungen des Krimkrieges und den Unruhen in der Lombardei zu hören.«
»Der Karl Ferdinand! Schickt er mir einen Laufburschen, der traut sich was. Zu Zeiten eines Fürsten zu Schwarzenberg wurde ich noch auf Augenhöhe konsultiert. Aber ein Hirnschlag riss den Felix fort und nun rührt ein Haufen wirbelloser Ignoranten um den orientierungslosen Kaiser unser Reich zu einer explosiven Suppe an. Meine Einschätzung! Als ob ich noch Gehör fände. Die Regierung gefällt sich darin, mir altem Hofhund einen ausgekochten Knochen hinzuwerfen. – Und wer wollte sonst noch kommen?
»Baronin von Zeißberg.«
»Was, wieder einmal? Gewiss wegen der Apanage, das Thema scheint sich in die Länge zu ziehen. Nein, Karl, ich bin unpässlich, hörst du, bedenke mein Alter. Die Zeißberg soll sich jemanden am Hof suchen, der näher dran ist an der Sonne. Also wirklich, was für grässliche Aussichten. Eine auf den Hund gekommene Baronin und der Laufbursche des Ministers. Sag alles ab, Karl.« Er schritt zum hohen Fenster und sah den Gärtnern zu, wie sie im Innenhof seines Palais zwei Buchsbaumkugeln beschnitten. »Ich darf meine Energie nicht vergeuden, die Zeit rast, Weißdorn oder nicht. Karl, der Archivar des Geheimen Staatsarchivs soll kommen, eilig, aber ohne Aufsehen. Früher wusste ich sogar noch seinen Namen, doch die Hofmaschinerie wird den Mann ausgetauscht haben. Na, du machst das schon. Vorher bestellst du ein großes Frühstück und starken Kaffee, hier herein. Ja schau nicht so streng, ich weiß, dass dich der Jaxtthal instruiert hat. Mäßigung, Ruhe und lauwarmes Leben. Aber ich habe da noch etwas zu erledigen, etwas mit Würze, das mir wieder Kraft gibt. Also auf, ein Dejeuner gegen jeden ärztlichen Rat und den Archivar, aber dalli.« Der Leibdiener schloss hinter sich die Tür. Alleine mit sich dachte der Fürst an sein Herz und an Hirnschläge bei anderen, ja, das große Dunkel konnte sehr plötzlich kommen. Hatte sein Arzt recht? Ein stümperhafter Anschlag, der lange zurücklag, hatte er gesagt. Wenn Heine am Ende nur kein Märtyrer würde. Der Fürst erinnerte sich unscharf. War auf Heine nicht geschossen worden? Da lebte der schon in Paris. Ein Duell war es gewesen, ein Streit um die Ehre. Metternich kam eine präparierte Kugel in den Sinn. Doch präpariert mit was nochmal? Da musste Licht dran. Jedenfalls war es ein Meisterstück, die Kugel in die Pistole des Kontrahenten zu platzieren. Leider traf der miserabel und Heine selbst, weil am rechten Arm gelähmt, schoss mit links und in die Wolken. Grotesk. Der Dichter jedenfalls hatte die Sache überlebt, was Metternich seinen Männern nicht wirklich vorwerfen konnte. Doch jetzt war ein Abschluss nötig, endgültig! War er nicht der letzte Garant für Europas Ordnung? Das hatte er immer gesagt, er konnte durchaus noch etwas bewirken. Doch vor jeder Kampagne lag das Studium der Akten. – Die Zeißberg empfangen? Das wäre ja noch schöner.
Vorstellung
Die Dame blieb vor dem Haus Nummer 3 stehen, blickte die sommerlich leuchtende Avenue Matignon entlang, atmete durch und sah prüfend an sich hinunter. Kühl wehte es von der anderen Straßenseite aus den Büschen und Bäumen der Jardins des Champs-Élysées zu ihr hin. Der angrenzende Boulevard gehörte gerade zu einem der glanzvollsten Orte von Paris, zumal die weiten Flächen der Parkanlage die diesjährige Weltausstellung beherbergten, die Exposition Universelle, die erste in Frankreich überhaupt und die zweite nach London 1851. Unweit stand der Industriepalast, ein futuristisch-leichtes Gebäude mit einem gläsernen Tonnendach. Sie lächelte. Ihr Busen zog die Augen auf sich, die Taille war eng geschnürt und die Füße wirkten zierlich. Ein Schnuppern am Handgelenk, ja, der Duft würde gefallen. Allein das Päckchen in ihrer Hand war deplatziert. »Er ist ein Dichterstern«, hatte Alfred gesagt, »warum sollten wir an seinem Glanz nicht teilhaben.« Wohlan! Sie öffnete die imposante Haustür, durchschritt einen geräumigen, mit ausgesuchtem Stuck verzierten Flur und stieß auch gleich auf die Concierge, die so gar nicht dem unter Parisern oft beschriebenen Bild einer Dogge entsprechen wollte. Lauernd wie eine Muräne kam die hagere Frau in ihrem Arbeitskittel aus ihrem Kabuff, alles an ihr war aschgrau. Das angedeutete Lächeln mit den entblößten Zahnlücken deutete die Dame als einen angedrohten Biss und erstarrte. Zufrieden mit ihrer Wirkung blickte die Concierge sie fragend an und las die Adresse auf dem Päckchen, während sich eine weiße Katze zu ihr gesellte und ihr um die Beine strich.
»In die fünfte Etage, ich werde erwartet.«
Die Muräne deutete nach oben. »Der Name steht an der Tür. Es ist schon einiges Weibspersonal bei ihm, man fragt sich, was das werden soll. Zum Tanz jedenfalls wird er nicht geladen haben.« Wie jede Concierge, eine Pariser Institution, hatte auch diese alles im Blick und kommentierte besonders gerne die Abwesenden, man war geraten, sie nicht zum Feind zu haben. Nun, diese Hürde war genommen.
In einem eleganten Oval schraubte sich die Wendeltreppe hinauf. Ja, wer es hierhergeschafft hatte, in ein so exquisites Viertel, der war weit gekommen und hatte etwas erreicht im Leben. Die meisten Pariser jedenfalls wohnten so nicht.
Diesmal sei er im Vorderhaus abgestiegen, hatte Alfred gesagt, was ihr nur recht war. Die Welt der Pariser Hinterhöfe fiel in Dämmerlicht und Schmutz, nie war sie vor Schauergestalten sicher. Sie lauschte. Deutlich klang das Leben aus den Wohnungen, das Bellen eines Hundes, Türenschlagen, das Greinen eines Kindes und derbe Tritte von Holzschuhen. Natürlich, die Mägde blieben sich wenigstens treu. Was hatte sie erwartet, etwa eine gedankenschwere Schriftstelleraura, die sich über das ganze Haus legte? Aber sicher nicht in dieser Stadt.
Die fünfte Etage, da blitzte dann in der Eleganz doch die Sparsamkeit auf. Immerhin, viele Schriftsteller und Künstler wohnten unter dem Dach, oft die siebte oder achte Etage, brütend im Sommer, bibbernd im Winter. Bei dem täglichen Auf und Ab in den Häusern zählte jedes Stockwerk, jeder Gang wollte überlegt sein. In diszipliniertem Takt schritt sie hinauf und atmete am Ziel doch schwer, für ihr Alter war sie nicht gut zu Fuß.
Aus der Wohnung kam kein Laut, sollte der Dichter doch alleine sein? Wie Paris wusste, war er bettlägerig. Sie zog an der Glocke und trat zurück.
Schritte näherten sich nicht gerade eilig, dann öffnete sich die Wohnungstür und eine kräftige Frau, gleich einer Melkerin vom Lande, sah sie erwartungslos aber doch ungehalten an, als störe sie den präzisen Ablauf des Käsemachens. Auch wenn man sich allerhand in Paris über sie erzählte, das konnte nicht seine Frau sein in dieser braunen Kittelschürze, darunter eine aufgekrempelte Bluse und ein über der Brust gekreuztes Schultertuch. Auch die schwarze Haube, die das Haar bändigte, sah sehr nach Hausarbeit aus. Plötzlich zerriss ein hoher, kreischender Ton die Stille und sie zuckte zusammen. Kam das aus der Wohnung?
»Aufspießen und mit Armagnac servieren!« Die Stimme eines Mannes, durch Türen gedämpft. »Oder wie die Römer: Die Zunge als Vorspeise, ganz genau, die Zunge macht es aus!«
Die Magd, ja es konnte nur die Magd sein, schien sich am Kreischen und an den Rufen nicht zu stören und sah sie weiter an. Ein seltsamer Haushalt war das.
»Guten Morgen, ich habe ein Päckchen abzugeben.« Sie überreichte eine Visitenkarte. Als die Magd auch nach der Sendung fasste, zog sie die energisch zurück. »Persönlich!« Schulterzuckend warf die Magd, ein Musterbild ihrer Zunft, die Tür zu, nur um die Dame wenige Augenblicke später doch hereinzulassen. Schlendernd führte sie Mademoiselle Krinitz, denn um die handelte es sich bei dieser Besucherin, durch den Flur, vorbei an geschlossenen Türen zu einer schmalen Kammer.
Das verriegelte Fenster zur sonnigen Parkseite hin war verhängt, zusätzlich schirmte ein Paravent den Kranken auf seinem niedrigen Lager ab, er lag im Dämmerlicht. Die abgestandene Luft, die ihr entgegenschlug, ein Gemisch aus Kampfer und Kloake, süßlich und ätzend, nahm ihr den Atem. Wachsfarben im Gesicht, ja beinahe durchsichtig, lag er da, die Wangen eingefallen, mit einem schlecht gestutzten Bart, eingehüllt in eine dünne Decke. Heinrich Heine. Von dem einst prächtigen germanisch-hellbraunen Haarschopf, den die Pariserinnen so gemocht hatten, waren nur noch stumpfe Strähnen geblieben wie bei einem Bund Flachs. Ohnehin nicht von großer Statur, wirkte er, soweit sich das unter der Decke erahnen ließ, runtergehungert, dürr, ein Haufen Knochen. Den berühmten Mann, beinahe doppelt so alt wie sie, hatte der Schmerz zerfressen. Was hatte sie sich auch vorgestellt? Seit Jahren war er bettlägerig.
Mühsam entzifferte er die Visitenkarte mit dem rechten Auge, das linke blieb geschlossen, und murmelte dabei: »Cocotte, was für ein grässlicher Name, wie lange wird er mich noch begleiten.«
Auf einem Nachttischchen lagen große, leere Papierbögen und eine Handvoll angespitzter Bleistifte, am Boden stand ein Korb. Ein gerahmter Stich an der Wand, darunter stapelten sich Bücher, zeigte einen Ochsenkarren voll fröhlicher Landleute, begleitet von ährentragenden Frauen und tanzenden Musikern, die Menschen versprühten Lebensfreude und Energie. Was mochte Heine darin sehen, Ansporn durchzuhalten, Erinnerung an alte Sinnesfreuden oder beißender Spott auf ihn selbst? Daneben zeigte eine Lithographie einen laufenden Zeitungsjungen voll Elan, seiner ganzen Abgerissenheit zum Trotz. War das eine von Daumier?
Ein Schreibtisch am Fenster mit Feder und Tintenfass wirkte unbenutzt und seltsam einsam, wie ein vergessenes Waisenkind. Wann hatte der Dichter dort das letzte Mal geschrieben? Zwei Stühle und ein großer Ohrensessel standen neben einem Schrank mit schmalen und hohen Fächern und Schubladen, teilweise beschriftet. Gegenüber führte eine Tür in einen Raum, vermutlich den Salon.
Heines Blick glitt unter dem nur halb geöffneten Augenlid über sie hinweg, dann stützte er sich auf seine Ellenbogen und lächelte. »Mademoiselle Krinitz? Sehr erfreut. Sie vergeben mir, dass ich mich nicht erhebe, dergleichen Höflichkeiten sind auf meinem Planeten seit längerem aus der Mode, ich kann mich nicht aufrecht halten. Sie erwischen mich leider auch nicht am heitersten meiner Tage. Immerhin sendet der Postminister seine schönste Botin, ja, ja, keine Widerrede, so muss es sein. Nur der Minister verfügt über die edelsten und geheimsten Boten, wie großherzig von ihm, ich muss ihn loben. Selbst die niederträchtigste Rechnung empfange ich da mit einem Hosianna.« Er versuchte, sich aufzusetzen. »Wenn Sie mir behilflich sein könnten.« Sie legte ihm ihr Päckchen in den Schoß und richtete das Kissen in seinem Rücken, so dass er sich aufrecht gegen die Wand setzen konnte. Eine Halsbinde fiel ihr auf, im Nacken dünnblutig befleckt, von seinem schweißigen Geruch nicht zu reden. Heine dagegen sog verstohlen ihren Moschusduft ein, würdigte ihr Dekolletee und die helle Haut an Hals und Wangen. So nah war er schon lange keiner fremden, schönen Frau mehr gekommen. »Vielleicht wollen Sie dem Postminister eine Abfuhr erteilen und dauerhaft mein Kissen richten? Schauen Sie, der ganze Raum strahlt durch Sie, erleuchtet wie durch das geheimnisvoll-blaue Licht einer Meeresgrotte. Doch nein, immerzu darf ich Sie dafür nicht in Anspruch nehmen, denn das hieße, Sie auch mit der Verabreichung von Medizin und Tinkturen zu behelligen, dem Leeren von Töpfen und dergleichen Irdischem. Außerdem sollte ich nicht zu viele von Evas Töchtern an mich heranlassen, Madame Heine hat da genaue Vorstellungen. Im Übrigen wäre es auch zu kostspielig, das Geld bringt sie viel angenehmer durch.«
Elise Krinitz hatte inzwischen ihre Schute abgelegt und blickte mit einem freundlichen Gesicht auf den blassen Mann hinunter. »Die Sendung ist von Monsieur Vesque von Püttlingen, er bittet Sie untertänigst, einen Blick auf seine Noten zu werfen.« Unwillig nestelte Heine an dem Packpapier, mit der Erwähnung dieses Komponisten holte sie ihn aus viel wohligeren Gedanken. »Von Johann? Sie sind mit ihm bekannt? Ja die Vertonung der Heimkehr, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Und die soll ich jetzt durchsehen? Da dürften Tage vergehen, Musik will nicht mehr so recht in mir aufsteigen, schon gar nicht solche aus Papier und Tinte. Ich lese nur noch unter Schwierigkeiten, am besten wäre es doch, jemand spielte mir die Töne vor, zu schade.« Verschmitzt lächelnd legte er die Noten unter den Stapel mit leerem Papier, dann widmete er sich versonnen ihrem Blick. Solch große, kastanienbraune Augen, mit einem feinen Glanz und verheißungsvoller Wärme mochte er sehr. Seine Mathilde sah so in die Welt, wie auch Amalie, seine Hamburger Cousine, die ihm das Herz zerschnitten hatte und die unfassbar schöne Principessa Belgiojoso. Ja, solche Augen versprachen ein süßes Ziehen in der Brust, war es auch kaum zu etwas nutze.
Erstaunt nahm er die Anzeige und betrachtete es wie ein längst verloren geglaubtes Artefakt. »Meine Börse hat ewigen Hunger, sie frisst sich selbst leer. Glieder und Augen machen nie, was sie sollen. Immer noch verfolgen mich die Zensoren und Geheimpolizisten der deutschen Länder, verspotten und verhöhnen mich Männer der Feder, die sich selbst Schriftsteller nennen. Und da sendet mir das Universum Sie, eine pianokundige Sekretärin mit samtweicher Vorlesestimme. Doch der schwarze Kasten mit seinen Elfenbeinzähnen soll das Maul heute nicht auftun und schweigen, heute ist Ruhe die erste Bürgerpflicht. Elise, welch ein Name, schon Beethoven hat er inspiriert, der Schwerenöter wusste die Kraft der Sehnsucht zu nutzen. Nun, das ist Jahre her, aber ein Vorbild bleibt er doch. Elise.« Er zerknüllte das Papier und warf es in den Korb. »Wie könnte ich da Nein sagen, ja ich darf es nicht. Aber, das muss klar gesagt werden, es geht nur stundenweise und, meine Zunge blutet bei den Worten, nicht einmal täglich.« Plötzlich stöhnte er auf und fasste sich, das Gesicht verzerrt, an den Kopf, Schweiß stand auf der Stirn. »Ein bisschen weiblicher Zauber und schon beißt der schwarze Geier wieder zu«, zischte er durch die Zähne und deutete in eine Ecke der Kammer. »Da hockt der Vogel, brennende Mühlräder als Augen und grünen Geifer am Schnabel, nur ich kann ihn sehen. Dann, so wie jetzt, stürzt er sich auf mich, hackt zu und zerrt an meinen Organen. Ich ...«, er stöhnte laut auf und beugte sich jammernd vornüber, »danke für Ihr Erscheinen und die Post, Herr Zychlinski wird sich um weiteres kümmern. Doch nun«, den Körper ergriff ein Zittern und seine Worte presste er durch die zusammengebissenen Zähne, »muss ich Sie bitten diese Moderstätte zu verlassen. Wenn Sie draußen der Frau Sorge ...« Er fasste den silbernen Knauf eines Gehstocks, der rechts neben ihm in den Falten seiner Decke verborgen lag und schlug damit gegen die Wand. Es war wohl die immergleiche Stelle, denn die zeigte schwarze Striemen und abgebröckelten Putz.
Seine Pflegerin, natürlich, sie war eben doch keine Melkerin, wartete bereits in der Tür, blickte Elise Krinitz vorwurfsvoll an und schob sie dann aber überraschend sanft hinaus.
»Kommen Sie wieder, ich bitte Sie!«, rief Heine ihr nach, »und erzählen Sie von Ihrem schaurigen Schicksal. Ihren ergebensten Zuhörer dürfen Sie nicht verhungern lassen, hören Sie!«
Etwas ratlos stand sie im Flur. Maler, Dichter, stets hatten diese Leute einen Hang zum Drama. Wie würde es jetzt weitergehen, wie hieß der Mensch gleich, der sich um die Details kümmern sollte? Eine hohe, durchdringende Frauenstimme und das Geklapper von Porzellan lenkten Sie ab. Eine dünne Frau in einer Kochschürze trat, während sie in einer Schüssel rührte, hinaus auf den Flur und betrachtete sie abschätzig. Dünn, auch das konnte nicht die Hausherrin sein, die Beschreibungen waren da eindeutig. Ihr folgte eine zweite, sehr füllige, deren ausladendes Hinterteil das etwas aus der Mode gefallene Hauskleid spannte. In der Hand balancierte sie eine Tasse auf der Untertasse. Das dürfte schon eher die Hausfrau sein. Beide Frauen sahen Elise so missbilligend an, als wäre man sich soeben auf dem Boulevard begegnet und die hätte laut einen zotigen Satz in die Menge geröhrt. Nach diesem kurzen Blick verschwanden sie in der Küche, wobei die Dralle hell zwitschernd schimpfte wie ein Spatz.
Hinter Elise machte sich jemand am Schloss der Wohnungstür zu schaffen, die Tür wurde aufgestoßen und schwungvoll trat ein Herr ein, der wie selbstverständlich grüßte und sich schneidig verbeugte, den Rücken tadellos gerade. Seinen blonden Tituskopf hatte er à la mode frisiert und der Oberlippenbart glänzte gewachst, die Brillengläser blitzten. Hatte er sich in der Wohnung vertan?
»Richard von Zychlinski, Monsieur Heines Sekretär, zu Diensten. Wurden Sie schon vorgelassen?« Er sprach Französisch, doch sein Akzent war unverkennbar. So blieb sie bei Deutsch.
»Mademoiselle Elise Krinitz, sehr angenehm, ich hatte bereits die Ehre. Im Moment ist seine Pflegerin bei ihm, und er bat mich hinaus. Ich werde die annoncierte Stelle einer Sekretärin und Vorleserin übernehmen. Ihren Namen hat er erwähnt, Sie möchten die weiteren Details meiner Mitarbeit klären.«
»Oh, von einer weiblichen Kraft war in der Anzeige nicht die Rede, das könnte die Dame des Hauses in Unruhe versetzen. Dergleichen schiefer Haussegen tut Herrn Heine nicht gut, da sei Gott vor. Vor Jahren mögen ihn diese Vulkanausbrüche belebt haben, aber das ist vorbei.« Nachdem er sich vergewissert hatte, im Salon niemanden zu stören, lenkte er sie dort hinein. »Kommen Sie, hier spricht es sich besser als im dämmrigen Flur.« Er deutete auf einen Sessel, bespannt mit stumpfem, ausgeblichenem Samt und verziert mit Metallbeschlägen aus angelaufenem Blech. Der Geschmack einer vergangenen Generation, damals selbstverständlich glänzend und neu, hoffentlich saß man wenigstens bequem.
Erneut ließ sie ein hoher, krächzender Schrei zusammenzucken, diesmal kam er aus der Ecke beim Fenster. Ein großer Käfig hing dort an einem Ständer und hinter dem Gitter knabberte ein grün schillernder Papagei an den Stäben. Neugierig ging sein Kopf hin und her, dann trippelte er auf seiner Stange von einem Ende zum anderen, als wollte er den Zuschauern seine Wohnung zeigen.
»Darf ich bekanntmachen: Cocotte, Madames Herzenstier. Sie liebt Tiere über alles und dieser Vogel ist ihr ein wahrer Lebensbegleiter. Doch mit seinem Geschrei ist er für Herrn Heine eine Zumutung, der Krach hat ihn schon immer gequält.«
»Und zu Kochrezepten inspiriert, da bin ich sicher. Kann der Vogel sprechen? Nicht, dass er Intimitäten ausplaudert, das wäre doch zu peinlich.«
»Hier und da ein Wort, aber weder ein Gespräch noch einen ganzen Satz. Und, da er Madames Liebling ist, übernimmt er von dort das Vokabular, nichts also, was uns interessieren könnte.«
Sie nahm im verblichenen Sessel Platz, während Zychlinski an eines der hohen Fenster trat und hinaus auf die Baumwipfel des Parks sah. »Es ist kein einfaches Arbeiten, müssen Sie wissen.« Er sprach leise, mit dem Rücken zu ihr, »Herr Heine leidet unsägliche Qualen, doch sein Geist ist ungebrochen. Scharfzüngig, wenn er will, boshaft oder liebevoll. Hin und wieder verzweifelt er, kann das Leben in seinem geliebten Paris nicht mehr feiern, sieht wenig Zukunft. Aber!«, Zychlinski drehte sich ihr zu, »er empfängt Gäste, so gut es geht, darunter deutsche Exilanten und Verehrer, die ihr Idol sehen wollen, von den Größen der französischen Kultur nicht zu reden. Alle kamen, jetzt sind es wenige. Madame Heine ist, nun, Sie werden sie kennenlernen, durchaus sprunghaft und launisch, das sei gesagt. Allen Dingen, die seine Arbeit betreffen, belasten ihren Kopf nicht, ihre Hauptsorge gilt allein den stetigen Einkünften. Die Pflegerin, Catherine, ist nach ihr die wichtigste Person, wenn es um seine Gesundheit geht, und die überlagert alles. Herr Reinhard, sein zweiter Sekretär, hat uns vor kurzem verlassen. Er war für alles Französische zuständig, ich dagegen erledige die deutsche Korrespondenz. Neben den Beinen leidet Herr Heine an Lähmungen in den Fingern, teilweise auch an den Augenlidern, der Mann kann also kaum mehr Schreiben und Lesen, das machen wir für ihn.« Prüfend blickte er seine neue Kollegin an. War sie dem gewachsen? »Wir nehmen die Diktate auf, in diesem«, er atmete tief durch, »in dieser Kammer, seinem Zimmer, bei gutem Wetter Gott sei Dank bei geöffnetem Fenster, doch die Reinschriften und alle Feinarbeiten erledigen wir woanders. Wo es Ihnen beliebt, zuhause, in einer Bibliothek, wo auch immer. Trödeln Sie nicht mit den Arbeiten, so krank er auch sein mag, wie gesagt, sein Geist ist wach. Und noch etwas: Diskretion! Unabdingbar in diesem Metier. Seine Projekte, seine politischen Besucher, sein Werk! Diskretion! Herr Heine ist gläserner als jede Majestät. Welcher König verspürt schon den Drang, jedem Gast seine Gedanken und noch so intime Details mitzuteilen. Vielleicht ist das eine Marotte der Dichter, jedenfalls wird so Wort für Wort in Briefen und gewiss auch in Geheimberichten irgendwelcher Spione weitergetragen. Ein ausgeleuchtetes Leben, dem sollten wir etwas entgegensetzen, müssen ihn vor sich selbst schützen. Da ich gerade von Spionen spreche,« seine Haltung wie auch seine Stimme wurden zackiger, geradezu militärisch, »in den Zeiten vor 48, in seinen ersten Pariser Jahren, sah Herr Heine sich umstellt von preußischen Spitzeln und solchen des Fürsten Metternichs. Er konnte nie sicher sein, dass nicht doch einer der befreundeten Schriftsteller und Freiheitskämpfer, ja auch solche, die hier im Exil lebten, für die Gegenseite arbeiteten. Doch das hat stark nachgelassen, sein Ruhm bietet etwas Schutz, auch wenn Preußen immer noch mittels Haftbefehls die Finger nach ihm ausstreckt. Ja, Mademoiselle, sie arbeiten für einen gesuchten Staatsfeind!«
Unruhig rutschte Elise Krinitz auf ihrem Sessel hin und her und beugte sich wie zum Sprung bereit vor. »Herr Zychlinski, natürlich bin ich hier, weil ich das Werk Herrn Heines unendlich schätze, und damit meine ich nicht nur seine Gedichte, sondern auch die Reiseberichte und seinen Kampf um mehr bürgerliche Rechte. Ich war schon immer von dieser Stimme berührt, auch wenn ich mir nicht anmaße, jeden Zeitungsartikel und jedes Buch von ihm gelesen zu haben. Aber, dass er sich für republikanische Freiheiten diesseits und jenseits des Rheins einsetzt und immer eingesetzt hat und sich dabei gerade in Deutschland mächtige Feinde schuf, ist mir bekannt.« Sie erhob sich, trat neben ihn und blickte aus dem Fenster. »Sollten Sie seine Korrespondenz in irgendeiner Art und Weise geordnet haben, so werden Sie einen Brief von mir finden, vor wenigen Tagen geschrieben, in dem ich meine Verehrung ausdrücke und ihn darum bitte, mir zu schreiben.«
»Ihr Name ist mir nicht geläufig, Mademoiselle, vielleicht sind ihre Zeilen im Wust all der anderen Eingänge untergegangen. Aber wie schön, mit Ihnen eine Freundin seines Schaffens zu haben.«
»Schauen Sie im Fach für berührte Frauenstimmen nach oder wie sie es sonst nennen mögen, oder alphabetisch unter M.B. für Margareth Bellgier, Poste restante. Blicken Sie nicht so irritiert, den Namen hatte ich angenommen. Mein Mann, ein Franzose, bestand darauf. Diese Ehe wurde zur schmerzvollen Erfahrung, denn als wir nach der Hochzeit gemeinsam nach London reisten hat er mich ..., nun, die Verbindung wurde gelöst, mehr muss ich Ihnen nicht erzählen. Der Brief ist unterzeichnet mit Margareth, schauen Sie nach.« Damit war für sie offensichtlich das Einstellungsgespräch beendet, denn sie wandte ihre Aufmerksamkeit dem Salon zu, machte ein paar Schritte über den abgelaufenen Teppich, der sich an den Rändern auflöste, strich über den Beistelltisch aus Mahagoniimitat, und nahm vom Kaminsims aus falschem Marmor eine der beiden leeren Porzellanvasen in die Hand. Aus namenloser Produktion, natürlich, waren sie mit grellen, fahrig dahingekleksten Blumen verziert. Etwas an die Wand gerückt wartete der schmuckloser Speisetisch mit sechs Stühlen darauf, bei einer Gesellschaft besser platziert zu werden. Neben der Tür zum Flur stand der von Heine zur Stille verdonnerte schwarze Kasten, das Piano. An der Papiertapete, die vorgab aus Seide zu sein, blieb sie vor zwei Lithographien stehen. Feiste Juristen selbstverliebt im Gerichtssaal, ein Pariser Paar, das lieber à la mode feiern ging als die liederliche Dachkammer herzurichten. »Karikaturen von Daumier, eindeutig, wie die im Schlafraum, das ist mal was Echtes. Arbeitete der Mann nicht auch für Balzac?«
»Hier ist so gut wie alles gemietet, Madame ists zufrieden. Frühere Wohnungen waren bescheidener eingerichtet. Die Lithographien sind ein Geschenk Herrn Balzacs, er war bis zu seinem Tod ein aufrichtiger Freund Herrn Heines. Viele sind ihm nicht geblieben. Dumas ist noch einer seiner berühmtesten hier im Land.«
»Der schwarze Dumas, Sklavenblut, wie exotisch. Immerhin ein bekannter Schriftsteller, aber ist er auch gute Gesellschaft? Nun, wollen wir noch einmal rübergehen zu unserem Brotherrn? Ich wüsste gern, wie genau sich meine Arbeit gestaltet.«
»Normalerweise schickt er ein Billett für den entsprechenden Tag, so sagt er aber auch ab, wenn sein Zustand ihn zu sehr quält. Und die Lage ist durchaus ernst.«
»Ich habe schon zweimal aus der Zeitung von seinem Tod erfahren, schrecklich. Was für entsetzliche Fehler.«
»Mademoiselle«, die Pflegerin Catherine stand in der Tür, »ich soll Ihnen sagen, dass er sich freut, dass Sie noch da sind, aber heute kann er Sie wirklich nicht mehr empfangen, sein Zustand. Er bittet Sie, auf Nachricht von ihm zu warten.«
»So schlimm? Nun denn.« Entschlossen setzte Elise Krinitz ihre Schute auf und band sie im Hinausgehen fest. Vor der Wohnungstür wandte sie sich noch einmal an Zychlinski. »Dann ist die Sache also besprochen und Sie werden unserem Herrn berichten. Schauen Sie nach, M.B. ...«
»Margareth Bellgier, Poste restante, ich habe es nicht vergessen. Und wo erreichen Sie unsere Nachrichten?«
»Genau so, daran hat sich nichts geändert.« Zychlinski hob die Augenbraue, ein Postfach mit Pseudonym. Wie überspannt. »Bis auf bald dann.«
Leise folgte er der Pflegerin in die stickige Kammer. Sie tupfte gerade den Speichel aus dem Mundwinkel des Kranken und hatte besänftigend eine Hand auf seinen Kopf gelegt. Ungeduldig schob der ihre Hände beiseite. »Unkontrollierbarer Speichelfluss, Koliken, Krämpfe, was denken Sie, wird sie das abschrecken?« Richard Zychlinski war an den Schrank neben dem Stehpult getreten, nahm lächelnd aus einem hohen Fach einen Stapel Briefe und blätterte ihn durch. Das Fach war beschriftet:Entflammte Frauenherzen. Damit hatte Elise Krinitz also gar nicht so verkehrt gelegen, genauso wie mit der Annahme, dass er ihren Brief finden würde:
Seit Jahren, Monsieur, seit dem Tag, an dem ich zum ersten Mal eines Ihrer Werke las, habe ich immer gedacht, dass wir früher oder später Freunde werden würden. - Von diesem Moment an habe ich Ihnen eine wahre Freundschaft geweiht, von der ich Ihnen, um Sie zu erheitern, eines Tages Zeugnis geben werde, falls Sie wollen, ein Zeugnis, das sicherlich erst mit meinem Leben endet. Sie schrieb, dass ihre Seele die seine verstanden habe, bittet ihn um eine Antwort, verabschiedet sich mit -adieu- lieber Poet und unterzeichnet mit Margareth.
»Fräulein Krinitz, oder auch Margareth Bellgier, ist vielleicht etwas geheimnisvoll und undurchsichtig, scheint aber eine Anhängerin zu sein. Ob sie wirklich Krinitz heißt, wissen wir auch nicht, eine Visitenkarte ist kein Personaldokument. Jedenfalls, auf diesen Brief hier hat sie mich aufmerksam gemacht wie auf ein Empfehlungsschreiben und für den geänderten Namen hatte sie eine Erklärung.« Er legte den Brief in Heines geöffnete Hände. »Vielleicht hat die Dame Spaß an Maskerade und Drama, das machte sie zu einer Expertin im theatralischen Fach, ob sie allerdings eine gute Sekretärin ist, müssen Sie entscheiden.«
Komplize
Das Café, das Elise Krinitz betrat, lag gegenüber der Oper und war mäßig besucht. Noch war es für die Flaneure und Geschäftsleute zu früh, den Ausgang ihres Tages zu zelebrieren, und die Schriftsteller und Maler, dieses ganze Künstlervolk, zog es in andere Arrondissements. Alfred Meißner, ihr Alfred, saß an einem Tisch abseits der Fenster, ins Gespräch vertieft mit einem ihr unbekannten Herrn. Als sie nähertrat, erhoben sich beide Männer wie auf Kommando, und der Fremde verbeugte sich.
»Liebe Elise, wenn ich Ihnen vorstellen darf: der Comte de Gobineau. Comte, Mademoiselle Krinitz.«
»Enchanté, wie reizend, Ihre Bekanntschaft zu machen.« Er deutete einen Handkuss an, warf einen genießerischen Blick auf ihr glänzendes Haar und verlor sich einen zu langen Moment in ihren braunen Augen. »Ihr Name klingt deutsch, doch wenn man Sie so ansieht, denkt man gleich: Italien.« Alfred Meißner schob ihr den Stuhl zurecht.
»Sie haben ein gutes Auge, Comte. Ich bin in Venedig aufgewachsen, in einem der alten Adelspaläste. Die aufblitzenden Wellen im Canale Grande begleiteten meine Kindheit, die Glocken von San Marco, die weit schallenden Rufe der Gondolieri. Immer wieder gab es unruhige Nächte, wenn meine Eltern die Intarsien der Marmorböden durch ihre fröhlichen Gäste polieren ließen, die bis in die Morgendämmerung durch die Salons tanzten. Das Licht der vielen Kerzen brach sich in den Kristallspiegeln, ihr Duft zog hoch bis in meine Kammer. An Schlaf war nicht zu denken, so saß ich heimlich im Treppenhaus, eine verträumte Zeugin der alten Pracht Venedigs.«
»Aber Ihr Name, Mademoiselle, das macht mich neugierig, so heißt kein venezianischer Adel. Ich hoffe, Sie verzeihen mir.«
»Ich wurde adoptiert, dem Leben gefiel es, mich umherzuwerfen wie ein Schicksalsopfer aus einem englischen Roman. Wer weiß, was es noch für mich bereithält, damals jedenfalls endete mein erstes Glück. Adieu Brokat, Seide, pandel Doge und fritelliallacrema. Doch das ist eine andere Geschichte, die nicht in dieses Café gehört.«
»Ja, nicht wahr, das Gebäck der Kindheit liegt einem ein Leben lang auf der Zunge.«
Alfred Meißner sah Elise an, als entdecke er etwas Neues an ihr. Adoptiert, ja das hatte sie schon erzählt, doch eine Vergangenheit am Canale Grande, das war ihm neu. Er räusperte sich. »Gerade sprach ich mit dem Comte über die sich verändernde Literatur und das Sterben der Romantik, wie passend, dass Sie da zu uns stoßen. Sie müssen wissen, verehrter Comte, Mademoiselle war bei Heine.«
»Oh!« Gedankenverloren schob de Gobineau seine Kaffeetasse hin und her. »Mademoiselle, was darf ich Ihnen bringen lassen?« Er winkte nach dem Ober. »Vom morbiden Venedig zur sterbenden Romantik, wie passend. Apropos Heine, man hört über ihn wenig Erfreuliches, die Gesundheit. Seinerzeit habe ich sein Wintermärchen lobend rezensiert. Überhaupt, er arbeitet sich wacker ab an den rückwärtsgewandten Preußen, was für eine starrsinnige Nation. Bringen Sie uns gute Nachrichten?«
»Bedaure, sein Zustand ist erbärmlich, die Lähmung fortgeschritten, der ganze Haushalt liederlich. – Eine Zitronenlimonade bitte. - Und dann auch das noch: Seine von ihm vergötterte Gattin scheint sich nicht für ihn zu interessieren.«
»Seine Pflegerin soll ihn in der Wohnung herumtragen, hat mir Dumas erzählt, vom Bett in den Sessel, von dort in den Salon und zurück.«
»Leicht genug wird er sein, so dünn und schwach wie er aussieht.«
»Er ist eben weder Gallier noch Germane, hat sich der Unbill unserer Breitengrade von jeher nie stellen müssen. Sein Volk stammt aus der Wüste, braucht Hitze und trockene Luft. Damit können wir selbst im Sommer nicht dienen, kein Wunder, dass er nicht zu Kräften kommt. Heine und seine Leute sollten nicht hier sein, er könnte uns auch von Jaffa aus oder Jerusalem mit seinem Esprit erfreuen, so jedenfalls bringt der seine Kunst in Gefahr.« Entschieden leerte der Comte seine Tasse, dann erhob er sich. »Mademoiselle, Monsieur, es war mir eine Ehre, aber nun ruft mein Amt, zu lange darf ich nicht pausieren.« Er grüßte, legte Münzen auf den Tisch und verschwand durch die Tür.
»Heine stammt aus der Wüste, sollte aus Jerusalem schreiben? So ein Quatsch.«
»Der Mann ist Diplomat und hat vielerlei Interessen«, Meißner rückte näher an Elise heran und sprach nun leiser, »und er hat seine Theorien über die Verschiedenheit der Rassen und die Unmöglichkeit des Zusammenlebens. Heine ist doch Jude. De Gobineau schätzt sein Werk, besonders wenn es gegen Preußen geht, aber nicht zwangsläufig seine Person, alles hat Grenzen. Er hält eine Koexistenz mit Juden und anderen Spielarten menschlicher Existenz für nicht realisierbar, jedenfalls nicht auf Dauer und nicht in Europa. Aber nun zu Ihrer Mission, Elise, waren wir erfolgreich?«
»Er möchte mich als Vorleserin und Sekretärin, auch wenn es da diesen Herrn Zychlinski gibt, der ihm schon dient. Aber ich denke, ich werde für ihn arbeiten. Das wird sicher ganz herrlich, einem so lichten Geist und seiner großen Seele nahe zu sein. Auch wenn die Umstände erbärmlich sind und zu Tränen rühren.«
»Nun, wir wollen doch nicht den Kopf verlieren. Ich weiß nicht, ob ich Heine noch einmal in diesem elenden Zustand sehen möchte, lieber erinnere ich mich an das Zusammentreffen im Seebad, wo der kleine, aufgekratzte Mann sich erholte. Schon damals empfindlich gegen Lärm und Licht, sprühte er doch vor Witz und genoss den Anblick der jungen Damen am Strand. Sehr viel später dann saß ich bei ihm am Bett und wir diskutierten lebhaft unsere Werke. Er war mir immer gewogen und unser Kontakt riss nie ab, egal ob ich in Prag war, Gmunden oder Bad Schwalbach. Jahre ist das her. Sie, meine liebe Elise, werden, so Gott will, die verbleibende Zeit mit ihm verbringen, dieses Privileg müssen Sie nutzen.«
»Alfred, Sie wissen, dass ich lieber mit Ihnen wäre, so sehr ich Heine verehre. In Ihrer Gegenwart ist das Leben echt und greifbar, eher Tweet als Tüll. Lassen Sie uns doch noch etwas gemeinsam flanieren, wer weiß, wie bald mich der Meister rufen wird.«
»Das sind offene Worte, nicht gerade damenhaft. Aber genau das ist es, was ich an Ihnen schätze, Sie atmen eine ungezogene Unabhängigkeit. Wollen wir dann?«
Sie schlenderten den Boulevard de Capucines mit seinen vielen Bäumen entlang, die den Verkehrslärm aus ratternden Kutschen und Pferdehufen etwas dämpften.
»Wir kennen uns nun schon beinahe zehn Jahre, nicht wahr, Elise? War es nicht 47 in Le Havre? Das flatternde, bunte Band an ihrem Strohhütchen, der kecke Blick auf die Strandbesucher, das sonnenhelle Leinen, das ihren Körper umspielte, ja, ich sehe es noch ganz klar.«
»Und meine Mutter neben mir, erinnern Sie sich? Auf jeden meiner Schritte bedacht, jeden meiner Blicke kommentierend und mit einer zum Lächeln gefrorenen Maske, doch das war nur ein Blinzeln gegen die Sonne.«
»Wo war eigentlich Ihr Vater?«
»Auf Handelsreisen in der Neuen Welt. Von Amerika hatte er sich viel versprochen, doch am Ende blieben Schulden.«
»Stets hatten Sie ein Buch in der Hand, romantische Gedichte und Reisebeschreibungen.«
»Wie gerne hätte ich damals mit Ihnen die Nacht hindurch über Literatur gesprochen, nachdem ich erfahren hatte, dass Sie Schriftsteller und Dichter sind. Mein Gott, nie war ich so einem Herrn nahe gewesen. Sie hatten Neue Sklaven geschrieben:
Der ist ein Sklave wohl,
Der in dem Kind, das ihm
sein blasses Weib gebäret,
Die Bürde hassen muss,
Die seine Sorge mehret.
Ein Schrei gegen das Massenelend der Arbeiter, so knapp, so auf den Punkt, es schmeckt wie Heines Weber. Ich muss dabei auch an die Kanalarbeiter denken, die Straßenkehrer und Lumpensammler hier in der Stadt. Noch vor Morgengrauen strömen sie wie eine Armee von Untoten aus der Vorstadt ins Zentrum. Hohlwangig und abgerissen ziehen Männer, Frauen und Kinder durch die Straßen, zerpflücken den Abfall der Häuser nach Brauchbarem, kehren das Pflaster, dienstbare Geister aus dem Höllenschlund. Man muss früh auf den Beinen sein, um sie zu sehen.«
»Es war ein grauenhafter Hungerwinter, als ich die Zeilen schrieb, Hoffnungslosigkeit quoll aus allen Ritzen. Meine Verse waren Sprengstoff, deswegen musste ich raus aus Österreich. 48 war ein gefährliches Jahr für den Kaiser aber auch für die Kritiker dieses ganzen verrotteten Systems. Kurzfristig gewann der Stärkere, aber die Geschichte ist noch nicht vorbei. Heine hat es selbstverständlich schon eher hinausgespült, er ist mir voraus.«
»Sie sind ja auch deutlich jünger. Nun, mein Wunsch nach Nähe ist geblieben, doch ich bin heute abgeklärter, weniger aufgeregt. Aber gedacht habe ich an Sie die ganze Zeit.«
»Dass sich unsere Wege nach den heiteren Tagen am Meer trennten, war natürlich unvermeidlich: Die Macht des Lebens! Doch stets waren Sie mir eine gute Freundin und haben meinen Werdegang mit Zuneigung verfolgt, das weiß ich. Sicher, so berühmt wie Heine bin ich nicht und werde es nie sein, doch ich wage zu behaupten, dass auch ich eine große Leserschaft habe. Sie wissen, dass ich mir ein Urteil über meine Stellung in der literarischen Welt erlauben kann, immerhin gehöre ich zum Umfeld Heines und kenne all die Sternschnuppen, Fixsterne und Planeten, die sein Sonnensystem ausmachen. Sogar mit Madame Heine und ihrer engen Freundin konnte ich mich auf einer gewissen Ebene anfreunden. Mit modischen Gesellschaftsromanen brauchte ich den Damen natürlich nicht zu kommen, ihre freundliche Duldung erkaufte ich mir durch bunte Tücher und feine Schokolade. Die Rechnung war ja ganz einfach: Je weniger ich Madame gegen mich hatte, desto länger durfte ich bei Heine bleiben.«
»Sein Schaffen zu erleben, als er noch besser zurecht war, teilzuhaben an diesem nimmermüden Quell aus Ironie und Hellsichtigkeit, wie beneidenswert.«
»Ach, auch Heine spricht nicht druckreif, das dürfen Sie nicht vergessen. Er weiß sich auszudrücken, keine Frage, doch auch er muss hin und wieder in sich gehen und in seinen Briefen gibt es Streichungen. Natürlich, er traut sich was, das hat er immer und es hat ihm stets den größten Ärger bereitet. Seine Frechheiten muss man sich leisten können. Doch am Ende ist dieser Gott der Worte ein Mensch, von dem wir lernen können.«
»Wie schön, dass wir uns wiedergetroffen haben, gleich war die alte Anziehung wieder da, so lebendig, Alfred. Und nun, dank Ihrer Idee, werde ich für Heine arbeiten, nie hätte ich mir so etwas vorgestellt.«
»Wie erreicht er Sie, Sie leben doch bei Ihrer Mutter?«
»Bei meiner alten Zofe, um genau zu sein. Meine lieben Eltern, verarmt und vergessen, hat das Schicksal in den Abgrund gestoßen, der auf uns alle wartet. Die Zofe, einzige Erinnerung an die glücklichen Zeiten auf der Rialtobrücke, zog mich groß und später mit mir hierher, so ist immer jemand zuhause. Heines Nachrichten werden hinterlegt, die Post schickt mir umgehend einen Botenjungen, so ist es vereinbart. Ich benutze dort ein Pseudonym, ein guter Schutz gegen unseriöse Männer, die mir nachstellen. Unverheiratet und geschieden wie ich bin, lebe ich karg von Übersetzungen und vom Klavierunterricht. Die Prosa und die Musik, mein Brot. Da sehen einige Kater in mir eine leichte Beute für ihre schmutzige Tatze. Poste restante ist dagegen ein passender Riegel.«
Sie hielten an, Meißner nahm seinen Zylinder ab und fuhr sich durchs Haar.
»Ich schreibe Sie ja als Madame van Belgern an, warum? Sie heißen doch Krinitz.«
»Vor fünf Jahren heiratete ich einen Franzosen, der Name tut nichts zur Sache, wir zogen nach England und dort erlitt ich das denkbar größte Martyrium. Heute und hier, da die Sonne durch die Bäume glitzert, mag ich über die dunkle Zeit nicht sprechen. Nur soviel, es war wie in einem dieser düsteren englischen Schauerromane, die jetzt in Mode sind. Ich zog zurück nach Paris. Doch, um nicht zu sehr als verspätetes Mädchen und übriggebliebenes Heiratsgut zu gelten, nutze ich dieses Pseudonym. Nehmen Sie es als Ausdruck meiner Selbstständigkeit.«
»Heine scheibt also auch an Madame van Belgern?«
»Es reicht, wenn Sie das tun. Er nutzt ein anderes Pseudonym, aber das sollte Sie nicht beunruhigen. Wichtig ist doch nur, dass wir weiter in Kontakt bleiben, den ich meinerseits gerne intensivieren würde.«
»Unsere Gefühle, Elise, müssen leider warten. Erst einmal gehen Heinrich Heine und seine Arbeit vor, das ist das Wichtigste.« Er winkte nach einem Fiaker. »Lassen Sie bald von sich hören, alles über ihn hat Bedeutung. Sie finden mich beinahe täglich im Café Procope zwischen spätem Nachmittag und der Abenddämmerung, das Café hier war eine Ausnahme. Übrigens, die Straßenkehrer und Lumpensammler, von denen Sie eben sprachen, sollen ja alle aus Hessen stammen, Zehntausende. Dorfgemeinschaften kommen her, um sich einige Jahre zu verdingen. Wie erbärmlich muss daheim ihr Leben sein, das ganze Familien dazu zwingt, im Abfall von Paris zu wühlen und in feuchten, verrauchten Löchern zu vegetieren. Glanz und Elend einer Stadt.«
Charmante Person
Unsicher fuhren die Kinderfinger über die Elfenbeintasten, stockten selbst beim einfachen Auf und Ab der Tonleiter. Elise, die mit strengem Blick neben dem Schüler saß, drückte den Rücken durch und sah zur Uhr. Die Nachmittagsstunde wollte nicht vergehen. Hatte jemals eines dieser Kinder Talent bewiesen? Auch die Mädchen, häuslicher und zur Duldsamkeit erzogen, zeigten weder Freude noch Können. Die Musikerziehung gehörte in den bürgerlichen Kreisen zur Grundausstattung dessen, was Eltern, die etwas auf sich hielten, ihrem Nachwuchs mitgaben. So sie es sich leisten konnten. Pianos gab es günstig zu leihen, doch ohne Unterricht fehlten die Resultate, Freunde und Verwandte zu beeindrucken. Sie seufzte. Wie lange würde sie sich noch mit den Pariser Kindern abgeben müssen, denen Glasmurmeln in den ungewaschenen Händen und abgegriffene Puppen so am Herzen lagen, wie ihnen Musiknoten und abgekaute Fingernägel egal waren.
Es schellte, ihr Blick flog zur Tür und der Junge am Piano hörte augenblicklich auf, das Instrument zu traktieren. Ihre Mutter trat ein, einen Brief in der Hand.
»Der Botenjunge.«
Elise sprang auf, hielt inne und blickte auf das Kind. »Für heute ist es genug.« Kaum gesagt, ließ der Schüler den Deckel fallen und stürmte hinaus. Sie griff nach dem Schreiben, der Absender fehlte, brach mit fliegenden Fingern das Siegel und stieß einen freudigen Laut aus: Die Zeilen waren von Heine.
Sehr liebenswürdige und charmante Person!
Ich bedauere sehr, dass ich Sie letzthin nur wenige Augenblicke sehen konnte. Sie haben einen äußerst vorteilhaften Eindruck hinterlassen, und ich sehne mich nach dem Vergnügen, Sie recht bald wiederzusehen. – Wenn es Ihnen möglich ist, kommen Sie schon morgen, in jedem Fall, sobald es Ihnen Ihre Zeit erlaubt, Sie kündigen sich an wie letzthin. Den ganzen Tag bin ich zu jeder Stunde bereit Sie zu empfangen. Die liebste Zeit wär‘ mir von 4 Uhr bis so spät Sie wollen. – Trotz meiner Augenleiden schreibe ich eigenhändig, weil ich jetzt keinen vertrauten Sekretair besitze. – Ich habe viel Peinliches um die Ohren und bin sehr leidend noch immer. Ich weiß nicht, warum Ihre liebreiche Teilnahme mir so wohl tut, und ich abergläubischer Mensch mir einbilden will, eine gute Fee besuche mich in trüber Stunde. Sie war die rechte Stunde. – Oder sind Sie eine böse Fee? Ich muss das bald wissen.
Ihr Heinrich Heine.
Sie las den Brief gleich ein zweites Mal. Er sehnte sich, oh wie wunderbar. Seltsam nur, dass ihm ein vertrauter Sekretär fehlte, was war denn mit diesem Zychlinski? Misstraute Heine ihm und beschäftigte ihn trotzdem weiter? Merkwürdig, warum sollte er das tun? Ratlos blickte sie auf und in das bleiche, von einer schwarzen Haube umrahmten Gesicht ihrer Mama, die wie eine düstere Säule streng und misstrauisch im Raum stand.
»Was schreibt er, der Brief ist doch von diesem Heine? Dass du dich mit einem so frechen, unmoralischen Mann einlässt, ist mir nicht lieb, Elise, das sag ich dir.«
»Er sehnt sich danach, mich zu sehen und leidet Schmerzen. Mama, ich glaube, ich habe dort eine echte Aufgabe, ich werde ihm bei seinem Werk helfen.«
»Werk! Gottloses Zeug, faselt von der Freiheit des Fleisches, sonst treibt ihn nichts um.« Die blutleeren Lippen vor Abscheu verzogen ging Madame Krinitz kopfschüttelnd hinaus. Dass Elise die Kurtisane dieses Schreibers wurde, dafür hatte sie ihre Tochter nicht kostspielig erzogen, wie gut, dass ihr Mann das nicht mehr erleben musste.
Gleich setzte Elise sich an ihren Sekretär und berichtete Alfred Meißner in knappen Zeilen von ihrem Erfolg. Das Schreiben verschloss sie, indem sie ihren Petschaft, eine schön gearbeitete Fliege, in Siegelwachs drückte.
Nachdem Heine so eindringlich um ein Wiedersehen gebeten hatte, war Elise Krinitz dem Wunsch gleich am nächsten Tag gefolgt. Gegen halb fünf am Nachmittag stieg sie wieder, vorbei an der Concierge, die ihr nicht einmal mehr nachsah, hinauf auf den Olymp, den aber anderes umwehte als Zimt- und Rosenduft. Wieder öffnete Catherine und ließ sie gleich mit dem Dichter alleine. Der saß, vorzeigbarer zurechtgemacht, das Haar gekämmt und in einem frischen Hemd, gegen die Wand gelehnt auf seinem Lager und strahlte sie an. Einem Hauch von Patschuli und Sandelholz gelang es anfänglich, die Gerüche des Krankenzimmers zu überdecken.
»Meine liebe Freundin, da sind Sie ja! Auch, wenn mein Zustand sich grundsätzlich nicht verbessert hat, spüre ich doch durch Ihre Anwesenheit die belebend-würzige Brise einer Meeresküste. Ziehen Sie sich einen Stuhl heran, ich möchte Ihre gesunde Nähe fühlen und Sie sollen mich hören können.« Lächelnd goutierte er ihre Emsigkeit, mit der sie schnell bei ihm saß und reichte ihr Papier und einen Bleistift. »Wir schreiben einen kleinen Gruß an Grillparzer, Tinte ist nicht nötig.«
Gleich nach dem Diktat kontrollierte er, ob Elise alles richtig geschrieben hatte, auch wenn ihm das Lesen sehr schwerfiel. »Aber was sind das denn für Großbuchstaben, so geht das nicht, die müssen in Zukunft leserlicher werden. Missgünstige Fehlinterpretationen gibt es schon genug, Missverständnisse durch schlechte Schrift aber sind vermeidbar. Niemand möchte doch erklären müssen, was er denn tatsächlich meinte, wäre sein Brief nur lesbar gewesen.« Er schloss die Augen und seufzte. »Doch nun zum eigentlichen Thema.« Er übergab ihr einige Buchbögen. »Diese Zeit wollen wir nutzen, um meine Texte zu putzen, da ein reißender Schmerz mein Hirn nicht zerstückelt, und meine Glieder nicht vor Krämpfen schüttelt. - Nein, diesen Quatschvers schreiben wir jetzt nicht auf. Die Bögen sind ein Probedruck aus dem Buch Lazarus. Können Sie den berichtigen? Mein Französisch ist nicht, wie es sein sollte. Es hat stets gereicht für den Salon der George Sand oder ein Dîner im Grand Vefour, doch die Kinder Voltaires verlangen eine bekömmlichere Speise.«
Eine herausfordernde Aufgabe, denn Heines Texte waren gespickt mit Provokationen, ungehörigen Ausdrücken und dazu im Französischen gepaart mit sprachlichem Unvermögen. Hier das Gewollte vom Nichtgekonnten zu trennen war harte Arbeit, das erkannte Elise gleich, auch wenn sie meinte, in Heines Denken zu schwimmen. Doch sie kam nicht dazu konzentriert am Text zu arbeiten.
»Ob ich die liebe Bisamkatze bitten darf, mir etwas vorzulesen? Ein Absatz auf Französisch bitte und einen auf Deutsch. Ich habe den Eindruck, das könnte einen großen Unterschied machen.« So lag er dann da mit geschlossenen Augen und tastete zielstrebig, wenn auch jederzeit auf Rückzug gefasst, nach ihrer freien Hand. Entspannt atmete er, als würde er schlafen, doch ihm entgingkein Räuspern und keine Silbe. Nach den beiden Absätzen blickte sie ihn erwartungsvoll an und er zog sein gelähmtes Augenlid hoch.
»Balsam. Zum eigentlichen Text will ich nichts mehr sagen, der ist ja von mir. Aber Klang und Aussprache aus Ihrem Mund sind gerade auf Deutsch für mich eine Wohltat. Sie haben die schönste und klangvollste der Welt. Der Absatz auf Französisch klingt eher trocken als elegant, als besäße diese Sprache keinen Ausdruck für die feinen, zarten Pulsschläge der Poesie.« Er zog ihre Hand an seine spröden Lippen und küsste sie. »Diese lieben Bisampfoten werden mir noch gute Dienste leisten.« Plötzlich, als entwiche Luft aus einem Schlauch, erschlaffte sein Griff und seine Stimme wurde dünn. »Wollen wir eine Pause machen, nur eine kleine«, er klopfte gegen seinen Kopf, »diese Kiste mit gesunden Apfelsinen ist gerade ganz leer.«