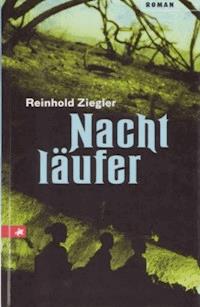
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
In einer Welt ohne Sonne und frische Luft leben die Brüder Tom und Urs. Sie hausen in einer Kolonie unter der Erde und wenn sie ins Freie wollen, müssen sie sich wie die geheimnisvollen Nachtläufer gegen den ewigen Sturm schützen. Die beiden Jungen wollen leben, Spaß haben und nicht wie die Alten ihrer Kolonie nur auf den Tod warten. Auf einer ihrer Touren an die Oberfläche finden sie das Mädchen Eo und ihre brüderliche Einigkeit droht zu zerbrechen. Aber Eo drängt die beiden zu einem lebensgefährlichen Abenteuer. Der ekz-Bibliotheken-Informationsdienst schreibt: "Ein gelungenes Buch in dem der Autor nicht nur äußerst spannend die Auswirkungen einer Klimakatastrophe beschreibt, sondern auch die Themen Freundschaft und Liebe gekonnt einbringt. ... Empfehlenswert!"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Urs fragte mich: "Tom, warum schreibst du immer? Und was überhaupt?"
Jedem anderen würde ich antworten, "ich schreibe nicht, ich kritzle nur Linien auf Papier", oder einen ähnlichen Unsinn und hoffen, dass er nicht lesen kann. Aber Urs ist mein Bruder, mein Leben, meine zweite Hälfte. Urs kann lesen. Und so hält mich seine Frage wach.
Also – warum schreibe ich dieses Tagebuch?
Kurz gesagt, um zu überleben. Weil ich nicht beten kann, weil ich nicht jammern will, weil klagen mich nicht weiter bringt, weil ich glaube, dass die Zeit alles heilt und deswegen einen Kalender unserer Tage unter der Erde führe. Weil ich eine Pflanze zu gießen habe, die Hoffnung heißt.
Pflanzen, so las ich, musste man gießen.
Wasser und Sonnenlicht nährte die Pflanzen, wie Worte und Gedanken meine Hoffnung nähren. Meine Hoffnung ist kein zartes Pflänzchen, sie ist ein starker Baum.
Ja, ich gehöre zur Generation der Nacht, aber ich habe Homer gelesen, Goethe, Camus und Stephen King –– ich weiß, dass es immer noch etwas anderes gibt, irgendetwas anderes, vielleicht Hoffnung.
Meine Hoffnung ist ein starker Baum.
Es wird wieder Licht!
Irgendwann.
Die beiden Jungen lagen bäuchlings nebeneinander auf dem Boden, vor sich zwei große Bildbände, über deren Fotos sie sich aufgeregt unterhielten.
"Hier, schau dir das an, Tom!", sagte Urs. "Der steht auf seinem Surfbrett, als wenn er nie irgendwo anders gestanden hätte. Und die Welle ist bestimmt viermal so hoch wie er selbst!"
"Meinst du, der hat überhaupt gemerkt, dass da so eine Welle hinter ihm her ist?", fragte Tom. "'Denn interessant wäre echt ein Bild vom nächsten Augenblick. Wahrscheinlich hat es ihn granatenmäßig ins Wasser gehauen!"
"Und wenn!" Urs‘ Backen glühten vor Begeisterung. "Das gehört doch zum Surfen dazu. Und wenn ich tausendmal von solchen Wellen verschluckt werde. Die spucken mich schon wieder aus! Ich werde irgendwann surfen in Hawaii, ich schwöre es dir." Er blätterte den abgegriffenen Bildband Surfparadies Hawaii andächtig weiter.
"… ich schwöre es dir", sagte er noch einmal leise.
"Weißt du, was dein Problem ist, Urs? Um zu surfen, musst du erst einmal schwimmen lernen. Aber schau hier!“ Und damit lenkte Tom die Aufmerksamkeit seines Bruders auf sein Lieblingsbuch Unser Planet und wir.
"Sobald es wieder hell ist, kann ich hier überall hin, denn laufen kann ich schon. Schau hier die Berge, das Meer, oder hier diese Schlucht. Ich werde das sehen, alles!"
Er blätterte zu einem seiner liebsten Bilder um.
"Siehst du das, Urs? Diese Massen von Menschen, von Autos. Diese Häuser, höher als die Wolken! 'Rushhour in Manhattan!'", er brauchte die Bildzeile nicht zu lesen, er kannte sie auswendig.
"Wir werden zwischen all diesen lebendigen Menschen dort laufen, Sonne im Gesicht, eine kühle Brise vom Meer auf der Haut …"
"Und wenn wir nicht mehr laufen können, dann fahren wir eben, was!"
"Logisch, einen Mercedes haben wir ja schon!"
Offensichtlich war an dieser Feststellung irgendetwas furchtbar lustig, denn die beiden bekamen sich beim Wort 'Mercedes' vor Lachen fast nicht mehr ein.
"Weißt du eigentlich, Tom, dass Mercedes ein Mädchenname ist?", fragte der Größere, als er sich wieder einigermaßen beruhigt hatte.
Tom schüttelte den Kopf: "Echt?"
"Echt! Hab ich gelesen! Das erste Mercedesauto war sogar nach einem Mädchen benannt!"
Er drehte sich auf den Rücken und starrte versonnen an die Decke. "Muss lange her sein. Das war bestimmt irgendeine süße kleine Maus, stelle ich mir vor."
Auch Tom drehte sich jetzt auf den Rücken und starrte neben ihm nach oben.
"Mer-ce-des …", sagte er langsam. "Klingt eigentlich toll, oder? … bestimmt süß. Mit kleinen, blonden Löckchen und wasserblauen Augen. Ganz zarte Haut, und so. Dazu Rüschenkleidchen, wie sie in dem einen Buch drin sind, du weißt schon."
Urs nickte versonnen.
Tom sprach nun mit verstellter hoher zarter Stimme: "Hallo ihr beiden, ich heiße Mercedes! Und wer seid ihr?"
Der siebzehnjährige Urs antwortete mit seiner tiefen Stimme, die schon nach Mann klang: "Ich bin Urs, der Bär. Ein bisschen groß und schwer, das schon, aber dafür auch unheimlich stark."
"Und lieb!", sagte Tom. "Dieser Bär ist wirklich harmlos und lieb. Nicht so lieb wie ich natürlich. Ich bin Tom, der Bücherwurm. Nicht ganz so groß wie der da und auch ein bisschen jünger, aber dafür unheimlich schlau und belesen. Du musst wissen, liebe Mercedes, dass die Größe der Birne nichts aussagt über die Schlauheit. Wie man an meinem etwas zurückgebliebenen Riesenbruder leicht sehen kann!"
"Das war dein Todesurteil!", lachte Urs und stürzte sich auf ihn. Aber statt ernsthaft zu ringen, hielt er Tom mit der einen Pranke fest, mit der anderen kitzelte er ihn, bis Tom winselnd um Gnade schrie.
Dann lagen sie wieder nebeneinander, eng und vertraut.
"Mädchen …", sagte Urs.
"Mädchen fehlen einfach! Alles andere ist irgendwie auszuhalten, aber Mädchen fehlen, was?"
"In Hawaii gibt es Mädchen, oder?"
"Und in Manhattan, garantiert! Jede Menge, möchte ich wetten!", meinte Tom.
"Eine würde schon genügen!"
"Sagen wir zwei: Eine für dich, eine für mich."
Urs nickte.
Dann schwiegen sie und jeder versank in seinen eigenen Gedanken, die ihn irgendwo hintrugen auf diese Welt. Irgendwohin, bloß nicht dorthin, wo sie gerade waren.
Eoda drehte sich zur Wand und tat, als ob sie schliefe. Aus der Ecke, in der Liz lag, hörte sie die Geräusche, die Liz und Odys machten, wenn sie zusammen waren.
Sie hasste Odys. Sie hasste seine laute Stimme, sein falsches Beten, seine Muskeln, die er sich jeden Abend, grinsend vor Eitelkeit, mit Öl einrieb. Sie hasste seine zweideutigen Blicke. Sie hasste, wie er mit ihrer Mutter Liz umging.
Sie hatte überlegt, ihm ein Messer in den Rücken zu stoßen, aber es gab immer wieder einen Odys, der seine Stelle einnehmen würde, davon war sie überzeugt.
Eoda hörte Odys keuchen, Liz wimmerte.
"Ich tue es, weil es mich glücklich macht!", hatte Liz sich einmal gerechtfertigt. Es klang nicht so.
"… weil es mich glücklich macht!", war Liz' Begründung für alles.
"Ich bete, weil es mich glücklich macht!"
"Ich trinke, weil es mich glücklich macht!"
"Ich nehme Psi, weil es mich glücklich macht!"
Dabei lachte ihre Mutter nie, allenfalls kreischend vor Psi, laut, betrunken, falsch. Es klang nicht nach Glück, nie.
Eoda presste ein Ohr auf den Boden und steckte sich einen Finger in das andere. So hörte sie nur das Grummeln der Erde, sie liebte dieses Geräusch. Es klang wie tot sein. Früher hatte sie oft gedacht, dieses Grummeln käme aus ihrem Kopf, entspringe ihrer Einbildung. Aber der Doc hatte ihr erklärt, es sei der Sturm. Dinge, die hin und her schlugen, Dinge, die auf den Boden geworfen wurden, Dinge, die in sich zusammenstürzten. Der Boden würde diese Geräusche als Schwingungen sammeln und über weite Entfernungen tragen. Sie hörte die Stimmen des Sturmes nur, wenn sie ein Ohr fest auf den Boden presste und sich das andere zuhielt.
Ihre Mutter Liz behauptete, es seien die Stimmen der Hölle. Obwohl sie selbst sie nicht hörte, angeblich. Nicht hören wollte.
Nein, es waren sicher nicht die Stimmen der Hölle.
Vorsichtig nahm Eoda den Finger wieder aus dem Ohr. Da drüben waren sie jetzt fertig. Odys hatte begonnen auf Liz einzureden, wie er es immer tat. Eoda konnte sich Liz' Gesicht dabei vorstellen. Leere Augen, ab und zu ein Nicken. Wenn er sagte "Verstehst du!", musste sie nicken. Wenn sie nicht schnell genug nickte, schlug er ihr ins Gesicht – um sie zu wecken. Für Gott zu wecken, wie er sagte.
Eoda wollte ihm nicht zuhören. Aber sie musste. Er predigte laut. Von seinem Auftrag die Welt zu retten. Die Menschen durch die lange Nacht zu führen. Dazwischen trank er. Er war mächtig und reich. Er war früher als Nachtläufer unterwegs gewesen, daher kam sein Reichtum. Er hatte immer Alkohol und anderes für sich und Liz. Manchmal auch für Eoda. Manchmal trank sie mit.
Aber trinken machte sie nicht glücklich. Nur noch einsamer, wenn das überhaupt möglich war.
"Wie brauchen mehr Raum!", sagte Odys. "Ein Feldzug für uns und für Gott. Die anderen haben mehr als wir, aber wir haben Schusswaffen. Wir werden Gerechtigkeit schaffen. Es gibt noch ein paar Kolonien in der Nähe, ich weiß es von früher. Und ich bin sicher, ich kann sie mit Gottes Hilfe wieder finden. Wir werden es dorthin schaffen und sehen, was sie haben. Wir werden es ihnen abnehmen. Gott hat uns nicht auserwählt, damit wir verhungern. Aber behalte es für dich, Liz, klar! Ich selbst sage es den anderen, wenn es soweit ist."
Eoda musste husten. Der Drang wütete in ihrem Hals, sie wusste, sie konnte nicht lange dagegen ankämpfen. Dann brach es aus ihr heraus.
"Ah!", schrie Odys. "Unsere kleine Ratte ist wach!"
Er sprang auf, kam ein paar Schritte zu ihr herüber und trat ein wenig mit dem Fuß nach ihr.
"Stellt sich schlafend und horcht uns aus, was?"
Eoda hielt die Augen geschlossen. Sie hustete keuchend und spürte seine Tritte. Wenn nur dieser verdammte Husten aufhörte.
Endlich war der Schleim draußen, der Reiz ließ nach, ihr Hals gab wieder Ruhe. Sie hörte wie Odys sich abwandte und zu Liz zurück ging.
"Bestimmt hat sie nur im Schlaf gehustet", sagte Liz vorsichtig.
"Hab ich dich gefragt?", fuhr er sie an.
"Ich werde sie mir bei Gelegenheit mal wieder vornehmen", sagt er jetzt so laut, dass Eoda es hören sollte.
"Ein Chick in dem Alter braucht einen Typ, dann vergehen ihr die Flausen, wirst sehen. Freu' mich schon!"
"Bitte Odys, lass sie doch!", flehte Liz.
"Hab ich dich gefragt?", fauchte er wieder, und dann hörte Eoda das Aufschlagen seiner Hand auf dem Gesicht ihrer Mutter.
Sie spürte, dass sie zitterte. Er will mir nur Angst machen, beschwor sie sich selbst. Er redet extra laut, damit ich es höre. Er will Liz Angst machen. Er wird mich in Ruhe lassen.
Das dachte sie immer wieder. Aber sie wusste, dass es nicht stimmte.
Nach endlos langer Zeit waren die beiden eingeschlafen. Eoda hörte Odys laut schnarchen. Sie zitterte noch immer.
Tot sein wäre eine Möglichkeit, dachte sie. Vielleicht die einzige. Sie ließ den Gedanken nicht mehr los.
Schließlich stand sie leise auf. Im Dämmerlicht des einen flackernden Öllichtes draußen im Gang suchte sie nach Odys‘ Mantel. Er ging manchmal nach draußen um die Nachtläufer zu treffen und mit ihnen Tauschhandel zu treiben, denn er traute ihnen nicht. Er wollte nicht, dass sie seine Kolonie betraten.
Wenn Eoda seinen Mantel hatte, hatte sie eine Chance da draußen. Und er würde ihr nicht gleich folgen können.
Sie fand das Stück aus schwerem, stinkendem Leder, trug es leise auf den Gang und um die nächste Ecke.
Ich stehle ihm seinen heiligen Mantel, dachte sie voller Stolz und legte ihn um. Er zog an ihren schmalen Schultern wie eine schwere Last.
Leise huschte sie durch das Labyrinth der düsteren Gänge. Als sie an der Schlafnische vom Doc vorbeikam, blieb sie stehen und starrte hinein. Erst nachdem sich ihre Augen an das noch schwärzere Dunkel in seiner Kammer gewöhnt hatten, konnte sie seine Konturen auf dem Boden ausmachen. Sie trat einen Schritt hinein. Er lag mitten zwischen umgeworfenen Flaschen, neben seinem Kopf Erbrochenes. Er schnarchte röchelnd.
"Doc?", fragte sie leise.
Sie wusste nicht, was sie von ihm wollte. Ihn mitnehmen? Er konnte kaum laufen, geschweige denn dort draußen überleben. Aber man geht nicht, ohne seinem einzigen Freund eine Chance zu geben.
"Doktor Detrebius?", fragte sie jetzt lauter, aber nur ein Röcheln war die Antwort. Wie so oft ließ er sich nicht ins Leben holen. Sie gab auf.
"Leb wohl, Doc!" flüsterte sie. Dann huschte sie zurück in den Gang, weiter an Nischen, Vorhängen, Türen vorbei, hinter denen die anderen unruhig schliefen, dösten, ihren Räuschen nachhingen, beteten, tranken, stritten.
Schließlich stieg sie die Stufen nach oben, der schweren Eisentür entgegen. Sie war erst einmal in ihrem Leben draußen gewesen. Mit Liz. Danach hatte sie tagelang gehustet.
In der Manteltasche fand sie ein Tuch, das nach Odys stank. Sie wickelte es sich ein paarmal um Mund, Ohren und Nase, wie sie es bei Odys gesehen hatte. Vor den Augen ließ sie kleine Schlitze. Dann drehte sie die Riegel zur Seite und zog die schwere Tür auf.
In der Schleuse konnte man den Wind deutlich hören. Er heulte und jaulte und schrie nach ihr.
Sie schloss die Tür hinter sich und drehte ohne zu zögern an der Entriegelung der zweiten Tür. Warum auch zögern, es gab kein Zurück.
Der Druck des Sturmes knackte in ihren Ohren, mühsam schob sie die Tür zur Seite. Mit einem Schritt trat sie ins Dunkle und schob die Tür hinter sich wieder zu.
Wie ein letztes Zucken des Lebenslichtes verschwand der fahle Schein des Öllämpchens in der Schleuse. Ich hätte auch seine Lampe stehlen sollen, dachte sie. Aber zum Sterben braucht es kein Licht.
Eoda schob das Tuch über ihren Augen zusammen, sehen konnte sie jetzt sowieso nichts mehr. Der Wind drückte sie gegen eine Wand neben der Tür. Noch könnte sie zurück, noch würde sie die Tür finden.
Es muss noch etwas anderes geben, dachte sie. Etwas anderes. Irgendetwas anderes.
Sie stemmte sich gegen den Wind und begann sich vorsichtig vorwärts zu tasten. Sie stieß auf Stufen, eine Treppe vielleicht, und begann sie nach oben zu steigen. Die Hände nach vorne gestreckt, kämpfte sie sich weiter. Manchmal schob sie das Tuch ein wenig zur Seite, in der Hoffnung, etwas zu sehen. Irgendetwas, ein Licht, einen Schimmer. Aber um sie herum war Nacht.
Nur Nacht. Nur stürmische schwarze Nacht.
Inmitten seiner Bücher fühlte Tom sich wohl. Diese Bücher, dazu Urs, sein Bruder, ihre Kammer in ihrem Tunnel, das alles war seine Welt, und mochte auch vieles darin fehlen – Tom fühlte sich meistens glücklich, dass es wenigstens so war, wie es war.
Selbst Frank, sein Vater, der in den letzten beiden Jahren mehr und mehr verfiel, wie diese Adelshäuser aus alten englischen Liebesromanen, die verlassen und von Efeu und Blauregen überwuchert langsam in sich zusammenbrachen, selbst Frank gehörte zu dieser absurden Welt, für die zu leben es sich trotz allem lohnte. Mit Wänden aus bis zur Decke gestapelten Büchern hatten sie in ihrem Raum Plätze für jeden von sich abgetrennt. Bei Urs und bei Tom stand jeweils neben der Matratze ein kleiner Tisch mit Stuhl, dazu hatte jeder eine Öllampe, die Urs, sobald das mit dem Strom klappte, durch eine Glühbirne ersetzen wollte.
Urs‘ Tisch war mit Basteleien übersät, kleinen mechanischen Dingen, wie Schrauben, Stangen, Röhrchen, Blechen, aus denen er alles mögliche anfertigte. Dazu eingetauschte und gesammelte Gegenstände der Elektrik, von denen Urs behauptete, er wisse, wofür sie taugten. Auf seiner Seite der Bücherwände hatte er Schachteln gestapelt, in denen er tausende von Dingen verwahrte, die sie gefunden oder organisiert hatten.
Und wie Tom in der Lage war, in den Wänden von Büchern jeden Titel zu finden, den er suchte, so kannte Urs den Inhalt all seiner Schachteln und Kisten bis zur letzten Schraube auswendig. Manchmal, wenn sie auf ihren Matratzen lagen und noch nicht schlafen konnten, machten sie ein Spiel daraus.
"Urs, wo sind die kleinen Ventile, von denen du behauptest, sie wären für Fahrräder?", rief Tom dann herüber.
Urs überlegte kurz und dann gab er zurück: "Hier auf der linken Seite, unter dem Propeller in der kleinen grünen Bonbon-Schachtel – wofür brauchst du eines?"
"War nur ein Test!", rief Tom, "wollte nur sehen, ob du schon verblödest!"
"Keine Sorge, da bist du vorher dran. Oder weißt du, wo Oliver Twist gerade steckt?"
"Nicht schwierig! Der ist direkt hier neben dem Durchgang, Höhe Bauchnabel!"
Urs lachte: "Mein Bauchnabel oder deiner?"
"Meiner natürlich. Sonst hätte ich Augenhöhe gesagt."
Urs war riesig. Hoch wie breit. Vielleicht waren Toms Augen nicht wirklich in Höhe von dessen Nabel, aber manchmal kam es Tom so vor. In ihrem Platz im Tunnel hatten sie im letzten Jahr den Boden extra ein wenig tiefer gegraben, damit Urs sich nicht dauernd bücken musste. Zum Glück war er jetzt schon siebzehn, weiter würde er wohl nicht mehr wachsen. Tom war ein Jahr jünger und hoffte, vielleicht doch noch ein paar Zentimeter zuzulegen.
Auch wenn es unbestritten praktisch war, in den Tunnels klein zu sein. Aber genauso unbestritten hatte auch Urs‘ mächtige Größe ihre Vorteile. Seit er ausgewachsen war, traute sich Piran, ihr Tunnelwart, kaum mehr in ihre Nähe. Wenn der versuchte, ihnen irgendwelche Anweisungen zu geben oder, wie er es gerne tat, ihren Vater Frank zu traktieren, brauchte Urs sich nur zu voller Größe aufzufalten, schon war neuerdings Ruhe.
Tom saß an seinem Schreibtisch und las. Ab und an machte er sich Notizen in ein dickes Heft, das er vorne mit „21“ nummeriert hatte. Sie hatten einen ganzen Stapel davon für eine große Tüte Aluminium eingetauscht, vor Jahren schon. Es war fast das erste gewesen, was sie sich für ihr Alu angeschafft hatten. Und zwanzig Hefte hatte er schon vollgeschrieben. Voll mit Erinnerungen, Beobachtungen, Tagebucheinträgen, Gedanken und Gedichten, selbstgemachten und solchen, die er gefunden hatte und niemals mehr vergessen wollte.
In der Bücherwand, die ihre Bereiche voneinander trennte, hatten sie zwischen ihren Plätzen am Tisch ein Loch gelassen, gerade groß genug, um den anderen an seinem Tisch sitzen zu sehen.
Urs hatte ebenfalls eines der Schreibhefte vor sich liegen und zeichnete konzentriert an etwas.
"Was wird das?", fragte Tom durch ihr Guckloch, als er einmal sein Lesen unterbrach und den Freund dort sitzen sah.
"Ach, noch immer die Stromsache."
"Und du meinst, du kriegst das wirklich hin?"
"Wenn nicht ich, wer sonst?", fragte Urs lachend.
"Und du hast alles, was du brauchst?"
"Eben nicht! Der Generator fehlt noch. Ich hab den Propeller, ich hab Kabel, ich hab den Regler, ich hab die Stütze und Wind haben wir sowieso genug, oder? Nur der Generator fehlt."
"Kannst du ihn nicht selber machen?"
Urs lachte wieder. "Das ist nicht ganz so einfach wie mit deinen Geschichten. Worte kann man selber machen, Generatoren nicht so leicht."
"Irgendeine Idee?"
"Tausend! Ich bin nur am Checken, welche die beste ist."
"Wenn du mich brauchst …!", bot Tom an, aber eigentlich war er schon wieder in seiner Geschichte verschwunden, die ihn in ein kleines Häuschen an der Küste von Maine im fernen Land Amerika führte, wo die Sonne schien und eine milde Brise vom Meer für angenehme Kühlung sorgte.
Frank, Toms Vater, der nur eine Wand weiter lag, hörte oft, wie die beiden Jungs sich unterhielten, aber es drängte ihn nie, etwas dazu zu sagen. Fünfzehn Jahre lang, seit die Nacht herrschte, hatte er sie allein großgezogen. Seinen Tom, und diesen Riesen Urs, den ihnen der Wind und das Schicksal sozusagen vor die Füße geweht hatte. Als Michaela noch da gewesen war, waren sie so etwas wie eine Familie gewesen. Als es noch hieß, der Sturm, der Staub, die Nacht, das alles sei nur eine Sache von ein paar Tagen, Wochen vielleicht – später in Monate umgedeutet. Als es Jahre zu werden begannen, hatte sich Schweigen ausgebreitet. Schweigen und Hoffnungslosigkeit. Und mit der Hoffnungslosigkeit waren die Tyrannen gekommen. Die Tunnelwarte und selbsternannten Fürsten und Kings. Die, die immer einen Weg finden, stärker und mächtiger zu sein und andere zu unterdrücken und für sich arbeiten zu lassen. Aber da war Micha schon tot. Erstickt an der vergifteten Luft, die manchen mehr ausmachte als anderen. Er war erwacht, da lag sie mit blauem Gesicht neben ihm, die Augen weit geöffnet, die Stirn, die Hände schon kalt. Hatte ihn zurückgelassen mit den beiden Jungs.
Seine Jungs – ihr Überleben war sein einziger Lebenssinn geworden. Nahrung zu beschaffen für die beiden und für sich, ihnen Schutz zu geben vor Menschen wie Piran und ihnen so viel wie möglich beizubringen.
Nun waren sie erwachsen. Sie brauchten ihn nicht mehr und er fühlte, dass mit ihrem Erwachsenwerden der Sinn seiner Existenz versickerte.
Nun waren sie es, die das Essen organisierten und sich um die paar anderen Sachen kümmerten, die das Überleben erforderte und manchmal las Tom jetzt sogar ihm aus Büchern vor, wie er selbst es für die beiden jahrelang getan hatte.
Frank schloss oft die Augen, dachte an Micha, an ihre Wohnung in der Burggasse, an Licht, das durch ein Fenster auf ihren Kühlschrank schien, an einen hellblauen Kinderwagen, den sie durch die Straßen geschoben hatten. Er dachte an Micha, hielt die Augen geschlossen und wollte sie nie mehr öffnen. Und wenn er es doch musste, dann griff er zur Flasche, trank, spülte ein bisschen Psi mit Mengen von Alkohol herunter, bis er wohltuend alles durcheinander brachte, Micha mit blauem Gesicht und mit hellem Lachen, den kleinen und den großen Tom, die Küche mit dem Fenster und eine Matratze in einem fensterlosen Tunnel. Oder er gönnte sich ein wenig mehr vom kostbaren Psi, bis die zusammengekniffenen Augen andere Farben sahen als nur grau und schwarz.
Manchmal kamen die Erinnerungen an sonnige Tage wie eine schwere Walze, die über ihn rollte und das Leben aus ihm herausquetschte. Dann weinte er. Still, mit weit offenen Augen, längst ohne Tränen.
Wie lebten die Jungs, wie überlebten sie? Woran hielten sie sich? Er hatte keine Ahnung. Wenn er sie reden hörte, raufen, scherzen, schimpfen, lachen, flachsen, keimte manchmal in ihm eine Ahnung, dass er vielleicht doch vieles richtig gemacht hatte. Aber diese Ahnung reichte nicht, um die Walze zu stoppen.
Lass uns rausgehen!", rief Urs. "Ich brauch mal frische Luft!"
Tom lachte. "Du hast recht, richtig schöne, frische Luft dort draußen. Aber es ist noch stockdunkel. Vielleicht sollten wir lieber warten, bis es hell wird!"
"Ja, so zehn, fünfzehn Jahre ungefähr!"
Frank wühlte den Kopf aus seiner Decke, um sie besser zu hören. Woher nahmen sie das? Wie konnten sie darüber lachen, dass die Luft dort draußen so verdreckt war, dass man es nur ein paar Stunden aushalten konnte? Wie konnten sie Scherze machen über die Nacht, die ewige, die nun schon fünfzehn Jahre dauerte, fast ihr ganzes Leben lang?
Früher hatten die Älteren manchmal offen über die Sonne geredet, bis von den Tyrannen die Order gekommen war, aus Sicherheitsgründen nicht mehr von der hellen Zeit zu sprechen.
Aber Urs konnte sich selbst gut erinnern, Tom nur andeutungsweise.
"Sie war warm, man hat sie auf der Haut gespürt, oder?"
"Man musste die Augen zusammenkneifen und konnte nicht hineinsehen, das weiß ich noch", hatte Urs erzählt, "und man konnte ganz weit gucken!"
"Wie ganz weit, Urs?"
"Ganz weit eben. Bis es nicht mehr weiterging. Bis zum Horizont, oder bis zu den Sternen. Es gab keine Grenze im Gucken!"
Und sie hatten sich Bücher geholt, die Frank schon angefangen hatte einzusammeln, als die Jungs noch klein waren. Sie hatten nach Bildern gesucht. Bilder vom Meer, Bilder von der Wüste, Bilder von Städten und Bergen, Bilder von Sonne, Mond und Sternen. Und geglaubt, die Nacht würde irgendwann enden. In ein paar Monaten vielleicht, oder längstens einem Jahr.
Damals, als es noch Radio gab, Musik und Nachrichten und etwas Ähnliches wie eine Regierung. Vor den Tyrannen, vor den Nachtläufern, vor den Tunnelwarten, vor dem großen Sterben.
"Also, was ist?", drängte Urs. "Wagen wir uns hinaus in den Kampf? Legen wir die Rüstung an, Ritter Tom?"
"So sei es denn!", antwortete Tom. Ihm gefiel es, ein angehender Nachtläufer zu sein, auch wenn er eigentlich dafür zu schmächtig war. Vielleicht würde er später auch etwas anderes machen, Nachtläufer war eher was für Urs, der die Kraft dafür hatte. Aber Urs hatte noch nie vorgeschlagen allein zu gehen. Bisher taten sie alles gemeinsam.
Ihre Höhle hatte einen Vorraum, bevor sie in den allgemeinen Gang der Kolonie mündete. Hier lagerten die drei, was sie zum Leben brauchten. Hier waren auch die beiden Rüstungen, die Urs aus Lederjacken, Lederhosen und Blechen zusammengenietet hatte. Sie halfen sich gegenseitig, in die schweren Ungetüme hineinzuschlüpfen. Es dauerte, bis der letzte Knopf geschlossen war.

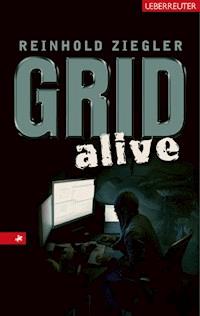

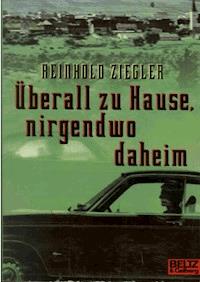
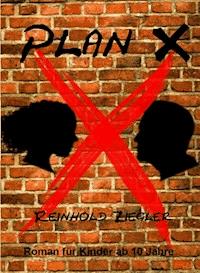














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









