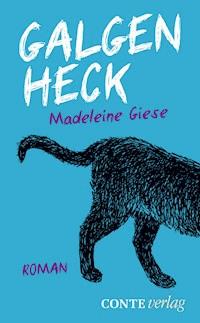Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Tod à la Michelangelo.
Ein Serienmörder beschäftigt Gregor Büchner vom LKA Saarbrücken. Immer wieder tauchen Leichen mit Bauchverletzungen auf. Die Polizei tappt im Dunkeln. Nur eines ist klar: Der Täter muss Erfahrungen im Nahkampf haben. Dann erhält Büchner von seinem ehemaligen Partner Bogner einen Hinweis aus dem Kunstmilieu: Dort ist eine Figur Michelangelos verschwunden, die darstellt, wie sie ihrem Gegner die Eingeweide herausreißt ...
Ein packender Kriminalroman mit viel Lokalkolorit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 335
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über Madeleine Giese
Madeleine Giese hat darstellende Kunst studiert und wirkte u. a. an den Bühnen von Saarbrücken, Bamberg und Regensburg. Sie hat bereits mehrere Kriminalromane veröffentlicht und lebt in Kaiserslautern. Als Aufbau Taschenbuch ist von ihr der Kriminalroman »Der kleine Tod« erschienen.
Informationen zum Buch
Tod à la Michelangelo
Ein Serienmörder beschäftigt Gregor Büchner vom LKA Saarbrücken. Immer wieder tauchen Leichen mit Bauchverletzungen auf. Die Polizei tappt im Dunkeln. Nur eines ist klar: Der Täter muss Erfahrungen im Nahkampf haben. Dann erhält Büchner von seinem ehemaligen Partner Bogner einen Hinweis aus dem Kunstmilieu: Dort ist eine Figur Michelangelos verschwunden, die darstellt, wie sie ihrem Gegner die Eingeweide herausreißt.
Ein packender Kriminalroman mit viel Lokalkolorit.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Madeleine Giese
Nachtvogelflug
Kriminalroman
Inhaltsübersicht
Über Madeleine Giese
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Eine Art Nachwort
Impressum
»Laßt plauderhafte Träum’ uns nicht erschrecken;
Gewissen ist ein Wort für Feige nur,
Zum Einhalt für den Starken erst erdacht:
Uns ist die Wehr Gewissen, Schwert Gesetz.
Rückt vor! Dringt ein! Recht in des Wirrwarrs Völle!
Wo nicht zum Himmel, Hand in Hand zur Hölle!«
Shakespeare, König Richard der Dritte
Prolog
Jedes Mal, wenn er nicht achtgab, sich nicht im Griff hatte, kamen sie zurück. Drei Männer in zwei Jahren.
Nachts war es am schlimmsten. Auch wenn er, wie jetzt, kurz die Augen schloss, waren sie da. Junge Männer mit aufgedunsenen, blau verfärbten Gesichtern. Perfekt getötet, kein Lärm, kein Blut, nur eine kleine Drahtschlinge um den Hals. Männer, die er ausgesucht und in den Tod geschickt hatte.
Die Frau neben ihm in der Schlange rempelte ihn an.
»Scusi.«
Verwirrt sah er ihr Gesicht, das zurückgekämmte Haar, die breite Stirn, die ausgeprägte Nase. Sah, ohne zu sehen. Sein Blick dauerte zu lange. Irritiert wandte sie sich ab. Sein nachgeschobenes »Non fa niente« ließ sie zurückweichen.
Er räusperte sich, blickte gerade aus.
Die Menge schob sich ein Stück weiter. Viele Römer um ihn herum. Natürlich, der letzte Sonntag im Monat, der Eintritt war frei. Neben disziplinierten Japanern und schwitzenden Deutschen drängelten sich heute gruppenweise Italiener. Sie tauschten Rufe und Begrüßungen mit den später Kommenden, Familienmitgliedern oder Freunden, denen sie einen Platz vorne frei gehalten hatten.
Er stand inmitten obligatorischer Sonnenbrillenträger, dieses Jahr das übergroße Modell. Ameisengewimmel. Insekten in Etuikleidern, die in winzigen Handtaschen kramten, sich gegenseitig Kaugummi anboten, den die Kiefer im Gleichklang mahlten. Insekten in weißen T-Shirts, die Muskeln im Fitness-Center gestählt, die Zigaretten lässig in der hohlen Hand.
Er wandte den Kopf. Da war die Mauer, die ganze Via Leone entlang. Aus unregelmäßigen, roh behauenen Quadern, mächtig und unbeeindruckt. Sie schützte das kostbare Innere, bildete einen Wall gegen die Herandrängenden. Im unteren Teil war ihr Stein schwarz, wurde heller, je mehr sich die Mauer aus ihrem eigenen Schatten hob, wechselte von Anthrazit zu Grau.
Jeder der zahllosen Steine hatte ein eigenes Gesicht. Für ihn individueller, unterscheidbarer als die Ameisengesichter, die ihn umdrängten.
Er erkannte die Spuren der Scalpellini, die den Stein behauen hatten, und Spuren des Bergmassivs, aus dem er stammte. Wellenlinien, eingegraben von Hitze und Frost, Löcher und Kerben, die Wunden der menschlichen Werkzeuge.
Sein Blick verlor sich in den Steinen. Er blendete die Stimmen aus, die Menschen, die Hitze der Julisonne. Im Schatten der Mauer schob er sich vorwärts, nahm nichts mehr wahr außer den Atem der Steine.
Ab und an zwang ihn einer der beinlosen Bettler oder eine vermummte Alte, die, murmelnd, eng gepresst an der Mauer saß, ihren Schutz zu verlassen. Für Sekundenbruchteile registrierte er die Menschen, die Sonne, die benzingeschwängerte Luft. Dann tauchte er wieder in die Steine.
Der Zug der Ameisen bog nach links, war jetzt in der Via Vaticano vor dem monumentalen Haupteingang. Sie kamen schneller voran. Kein Anstehen an den Kassen.
Er durchquerte die Eingangshalle, ließ sich vom Strom zum Pio Clemente und den Galerien treiben. Im Cortile Ottagono, dem kleinen Innenhof, war kein Gedränge. Das Ziel der Masse war immer zuerst die Sixtinische Kapelle und die Stanzen des Raffael.
Die Skulpturen empfingen ihn. Altbekannte, düstere Freunde. In Grauen gefangen blickte Laokoon auf ihn herab, der muskulöse Priester mit seinen Zwillingssöhnen, ihre Körper von Seeschlangen tödlich verkettet. Umgeben von Ungeheuern, machtlos, zum Verlieren verdammt, erwartete Laokoon nicht nur den eigenen Tod, sondern auch den Tod seiner Kinder.
Schon seit Jahren besuchte er Laokoon. Anfangs allein, dann mit den Toten, die ihn begleiteten. Und während er selbst mit den Jahren versteinerte, wurde der Mann aus Stein immer lebendiger. Tu etwas, forderte er stumm. Kämpf, auch wenn es aussichtslos ist. Kämpf, auch wenn du nichts hast als die bloßen Hände.
Aber seine Hände waren nutzlos.
Er senkte den Kopf, ließ sich weitertreiben.
In der Galleria dei Candelabri stockte der Besucherstrom. Für einen Moment ging es weder vor noch zurück. Misstrauische Museumswärter fixierten die Menge, traten nervös von einem Bein auf das andere. Zu viele Menschen, zu viele Gefahren.
Trotz seiner Größe musste er sich recken, um über die Köpfe zu sehen, konnte jedoch den Grund des Staus nicht ausmachen. Er atmete durch, sah unter seinen Füßen den Marmorboden, rechts und links die Miniaturskulpturen. Er war umfangen von tröstendem Stein.
Stein. Das dauerhafteste Material der Welt. Aus ihm entstanden Häuser, Brücken, Kirchen, Städte. Aber selbst er konnte sterben, wenn man ihn mit Gewalt zertrümmerte, seine Eigenheit nicht achtete. Dann wurde das warme, atmende Material farblos und trübe.
Weit entfernt hörte er den Klang seiner Kindheit: eins, zwei, drei, vier. Der Rhythmus der Schläge gegen den Stein, mit dem Stein. Die Sätze seines Vaters, die sich dem Rhythmus anpassten. Jeder Satz war mit dem vierten Schlag beendet oder wurde nicht gesagt, Worte, an der Länge eines Schlages gemessen.
Sein Blick streifte die Menge, die Wände, den Boden. Blieb an einer Skulptur aus weißem Marmor hängen.
Marmor, schimmernder Stein, das Herz des Universums, der reinste von Gott geschaffene Stoff.
Die Skulptur war so hoch wie sein Unterarm. Zwei Kämpfer, die sich nackt gegenüberstanden, Knöchel und Finger mit Riemen umwickelt, um die Wucht der Schläge zu verstärken.
Er hatte sie oft betrachtet, er kannte sie. Kreugas und Damoxenes, zwei attische Faustkämpfer. Niemals waren sie ihm gewalttätiger erschienen als heute. Beide Körper in Bewegung, die kraftstrotzenden Schenkel, die gewölbten Brust- und Rückenmuskeln pantherhaft geschmeidig. Jeder Muskelstrang trat aus dem polierten Marmor, als sei er lebendig, als pulsiere Blut durch den weißen Stein. Zwei Kampfmaschinen, zur Zerstörung bereit. In den sich zugewandten Gesichtern spiegelte sich die Angst, eingefangen im Moment der Entscheidung, der keinem von beiden den Sieg bringen würde.
Die Menge um ihn bewegte sich weiter, er stand.
Sie rempelten ihn an beim Versuch, ihn weiterzuziehen, weiterzuschieben. Er stand. Böse Blicke trafen ihn. Er merkte es nicht. Wie ein Fels, ein Stein, stand er in der Menge, die sich vor ihm teilte und sich hinter ihm wieder schloss.
Eine Ahnung, der Anfang eines Plans, formte sich. Angenommen, er würde den Kampf anders führen als bisher? Er kannte das, was seine Gegner am Leben hielt, ihre Blutbahn. Er hatte versucht, sie zu verstopfen, unbrauchbar zu machen. Was, wenn er sie durchtrennte, zerschnitt? Das Herz zum Stillstand brächte?
Seine Hände waren nicht immer nutzlos gewesen, früher hatten sie Dinge getan, die er gern vergessen hätte. Was, wenn er sich wieder erinnerte?
Unwillkürlich streckte er die Hand aus, wollte den Marmor spüren, mit den Fingerspitzen die entschlossenen Züge der Athleten nachfahren.
»Attenzione!« Die Stimme des Museumswärters klang scharf. Er zog die ausgestreckte Hand zurück, straffte sich, lächelte entschuldigend.
Er wusste, was er zu tun hatte. Er würde ihn beginnen, den Kampf ohne Sieg. Mit bloßen Händen.
1.
Vorsichtig stieß Gregor Büchner seine Gabel in das Ding auf dem Teller. Mit leisem Quietschen protestierte die Kohlroulade gegen die Behandlung. Eine Attrappe folgerte der Kommissar. Gummi, mit künstlichen Farb- und Aromastoffen aufgepäppelt.
»Ich hab dir gesagt: Nimm die Erbsensuppe«, erinnerte ihn Kollege Schiele von der Kriminaltechnik und biss herzhaft in sein Brötchen. »Mmpfh …« Schmerzlich verzog Schiele sein Wieselgesicht.
»Ich hab dir gesagt: Hände weg vom Brötchenmausoleum«, konterte Büchner.
»Verdammt!«, mümmelte Schiele und fummelte sich etwas aus dem Mund.
Fasziniert beobachtete Büchner die unappetitliche Aktion.
»Mein Inlay«, stöhnte sein Gegenüber und hielt ihm auf dem Zeigefinger ein undefinierbares, mit zerkauten Krumen bedecktes Etwas entgegen: »Weißt du, wie teuer das war? So ein Mist, mein Inlay.«
Köhler von der Sitte trat zu ihnen. Sofort streckte ihm Schiele den Zeigefinger hin: »Sieh dir das an!«
»Was stellt das dar?«, und auf Schieles bösen Blick fuhr er fort: »Entschuldige, aber du bist der Kriminaltechniker von uns beiden.«
»Mein neues Inlay, dreihundert Euro hat mich das gekostet. Eigenanteil!«
»Wer war der Täter?«, erkundigte sich Köhler und beugte sich interessiert über das Opfer.
Mit einem Nicken wies Schiele zur Glasvitrine auf der Kantinentheke. Dort lagerten, wahrscheinlich seit Jahrhunderten, immer dieselben Brötchen. Ob sie jemals ausgetauscht wurden, entzog sich der Kenntnis der Kommissare. Feststand, dass nur Neulinge der Polizei sich der Vitrine näherten.
»Wie lange arbeitest du für den Laden?«, fragte Köhler, erntete aber statt einer Antwort nur unwilliges Grummeln. Damit war alles gesagt, und der Mann von der Sitte wandte sich an Büchner: »Der Chef sucht dich.«
Froh, der Roulade zu entkommen, warf Büchner seine Serviette neben den unangerührten Teller und stand auf.
»Nur keine Hast«, meinte der Kollege, während Peter Schiele weiterjammerte: »Das ist Körperverletzung, vorsätzliche!«
Ungerührt verließ Büchner den Tisch.
»Dein Essen …«, rief Köhler ihm nach.
»Überlass ich dir«, antwortete er über die Schulter. »Aber Vorsicht! Das Ding lebt noch.«
»Nicht mehr lange.« Der Mann von der Sitte hatte sich bereits auf Büchners Platz gesetzt und schwenkte das Messer.
Umhüllt von Essensdüften, die ihm beharrlich folgten, ging Büchner nach draußen.
Die kalte Januarluft blies ihm um die ungeschützten Ohren und kroch in seinen Mantelkragen. Mit langen Schritten passierte Büchner die Mainzer Straße auf dem Weg zum Landeskriminalamt. Der Wind griff von vorne an, er senkte den Kopf und versuchte, schneller zu werden, ohne zu rennen. Blöde Idee, durch die halbe Stadt zu hasten, um festzustellen, dass das Essen in der Polizeikantine auch im neuen Jahr ungenießbar war. Oder wurde er selber immer ungenießbarer? Mit zunehmendem Alter und abnehmendem Verstand – wo hatte er das neulich gelesen? Traf auf ihn wie die Faust aufs Auge. Oder litt er an der berühmten Jahresendzeitdepression, die ihn tapfer ins neue Jahr begleitete?
Frierend betrat er das Landeskriminalamt. Uniformierte Kollegen von der Bereitschaft hasteten durch die Gänge, Sekretärinnen schleppten Aktenstapel von A nach B, Kommissare blätterten im Laufschritt in irgendwelchen Unterlagen.
Die erste Arbeitswoche im neuen Jahr fing so stressig an, wie die letzte im alten Jahr zu Ende gegangen war. Immer wieder öffneten sich Zimmertüren, und für Sekunden drangen Gesprächsfetzen, Telefonklingeln und das Klappern von Tastaturen auf den Gang.
Büchner mochte den Wirbel. Er war heilfroh, die Feiertage hinter sich zu haben. Weihnachten bei seinen Tanten war nicht gerade Friede auf Erden. Die beiden hatte das Alter weder milder noch gelassener gestimmt. Und ihn hatten sie als Sorgenkind auserkoren, während sein Bruder Klaus verschont blieb, aber der hatte ja auch Familie und einen »anständigen« Beruf.
Wie hatte Tante Christa an Heiligabend treffend bemerkt? »Gott, Annchen, erinnerst du dich, wie wir früher skandierten: Haut die Bullen platt wie Stullen! Und jetzt sitzt einer von denen unter unsrem Weihnachtsbaum.«
Bei der Erinnerung musste er lächeln, an Heiligabend hatte er es nicht ganz so witzig gefunden.
Vor der Tür des Dezernatsleiters zog er sein Jackett gerade und klopfte.
»Ja!«, kam es von innen.
Büchner kannte Rainer Liebs mittlerweile gut genug, um den Grad seiner schlechte Laune an diesem »Ja« abzulesen.
»Gutes Neues«, wünschte er trotzdem.
»Gut! Gut! Was soll daran gut sein?«, knurrte es ihm vom Schreibtisch entgegen.
»Ärger?«
»Gar kein Ausdruck. Ich habe eine Anfrage aus Luxemburg, Amtshilfeanforderung.«
Interessiert zog sich Büchner einen Stuhl näher. Luxemburg. Das letzte Mal, als sie dort ermittelt hatten, ging das Rechtshilfeersuchen vom Saarland aus. Das war der Museumsdiebstahl vor einem Jahr gewesen. Er mochte die Luxemburger, sie waren entgegenkommend, und die meisten sprachen neben Französisch und Lëtzebuergesch auch hervorragend Deutsch.
»Die Kollegen haben direkt an der Grenze, in Remich, einen Mordfall. Ein zerfleischter Immobilienmakler, scheußliche Geschichte. Das Opfer hat Geschäftsverbindungen ins Saarland.«
»Mord?«, fragte Büchner mit hochgezogenen Augenbrauen.
Nicht sein Fach, Diebstahl und Waffenkriminalität waren sein Aufgabengebiet.
»Die Kontaktdienststelle West hat den Luxemburgern einen Verbindungsbeamten zugesagt. Ausgerechnet jetzt. Du weißt, wie viel los ist.« Sorgenvoll legte Liebs die Stirn in Falten.
»Wie kommst du auf mich?«, fragte Büchner.
»Wir haben seit 96 eine Vereinbarung mit dem Justizminister und dem Minister der öffentlichen Macht des Großherzogtums Luxemburg über polizeiliche Zusammenarbeit im Grenzgebiet …«
»Schengener Abkommen, weiß ich«, unterbrach Büchner. »Meine Frage: warum ich? Du weißt, dass wir an den Autoschiebern dran sind.«
»Die Kollegen machen ohne dich weiter.«
»Mord. Nicht mein Fachgebiet.«
»Ich schicke dir die Akten rüber, brutale Geschichte. Morgen früh erwarten sie dich in Remich. Deine laufende Ermittlungsarbeit übergibst du dem Kollegen Rehn. Der kann sich gleich einarbeiten.« Als wäre der Vorgang damit erledigt, beugte sich der Chef wieder über seinen Schreibtisch.
Büchner blieb angenagelt sitzen. Seine Gedanken fuhren Karussell. Aus einer laufenden Ermittlung abgerufen? Dazu ein Mordfall? Was lief da? Es war absolut nicht die Art vom Chef, seine Beamten hin und her zu schieben.
Rainer Liebs hob den Kopf: »Noch was?«
Büchner holte tief Luft. »Ich möchte gerne wissen, was läuft.«
Eine Sekunde lang musterten sich die beiden Männer.
Schließlich lehnte sich Liebs im Stuhl zurück und fuhr sich müde über die Augen: »Ich will dich einfach eine Zeitlang rausziehen.«
»Rausziehn?«
Rainer Liebs sprang unvermittelt von seinem Stuhl: »Hör auf, den Papagei zu spielen. Du weißt, was los ist!«
Büchner setzte sich aufrecht. »Entschuldige Rainer, aber das weiß ich nicht. Wo willst du mich ›rausziehn‹? Und warum?«
Liebs wandte sich zum Fenster. »Es war ein Fehler, dich nach Bogers Weggang mit Hamm zusammenzuspannen. Unter uns: Der Kerl ist ein Stänkerer und geht mir gewaltig auf den Sack.«
»Das kann ich nachvollziehen, aber was hat das mit mir zu tun?«
»Willst du mich verarschen, Gregor?«, schnauzte der Chef und drehte sich abrupt um. »Auf meinem Schreibtisch liegen allein vom Dezember drei schriftliche Beschwerden über dich.«
»Von Hamm?«
»Das geht von mangelnder Kooperationsbereitschaft über Informationsverweigerung bis zu absichtlicher Fehlinformation.«
»Was? Aber …« Büchner fehlten die Worte. Damit hatte er nicht gerechnet.
»Aber, aber«, äffte Liebs ihn nach. »Das ist nicht alles. Du weißt, dass wir einen Beauftragten für Mobbing haben. Bei dem war er auch schon. Mobbing! Ist das hier ein Kindergarten oder was?«
Büchner atmete durch. »Wir haben Schwierigkeiten, das ist wahr. Aber von Informationsverweigerung oder Fehlinformation kann keine Rede sein.«
Seufzend ging Rainer Liebs zum Schreibtisch zurück und ließ sich schwer auf seinen Stuhl sinken: »Und was ist mit der Kooperation? Ich kapiere nicht, dass ausgerechnet du solche Schwierigkeiten hast.«
Büchner schwieg.
»Ich habe gedacht, du kommst mit jedem aus.«
Klang das nicht geradezu vorwurfsvoll? Büchner, der Allesversteher, Büchner, der brave Sohn. Das war sein Part. Man musste die Kollegen nicht lieben, geschweige denn heiraten, um mit ihnen zu arbeiten. Aber bei Hamm stieß er an seine Grenzen. Das musste er sich ehrlicherweise eingestehen.
»Sogar den Dicken hast du weggesteckt«, setzte Liebs nach.
Der Dicke, sein Freund Manfred Boger. Manfred war der Stachel in Hamms Fleisch, das wusste Büchner. Als Manfred die interne Untersuchung über seine scheinbar zu enge Zusammenarbeit mit Kriminellen am Hals hatte, war Hamm zu jeder Vorverurteilung bereit gewesen. Als Manfred nicht aus dem Dienst entfernt, sondern nur in ihr Dezernat versetzt wurde, fing Hamm erst recht an zu stänkern. Und selbst jetzt, da Manfred Boger aus dem Polizeidienst ausgeschieden war, verzieh er Büchner dessen Freundschaft mit dem vermeintlichen Grenzgänger nicht.
Fairerweise musste Büchner sich eingestehen, dass es ihm jedes Mal einen Stich versetzte, wenn er Hamms dämliches Gesicht auf Manfreds Platz sah. Das war die Krux. Aber das konnte er Liebs nicht erklären, der Chef würde das nicht verstehen, zumal Manfred Boger auch für ihn ein rotes Tuch gewesen war. Außerdem war Manfred nicht dick, massig vielleicht, aber nicht dick.
»Ich habe mich nie unkorrekt verhalten«, sagte er statt einer Erklärung.
»Gregor, du bist einer meiner besten Männer. Aber ich kann Hamm nicht schon wieder versetzen.«
»Also Luxemburg?«
»Also Luxemburg!«
2.
Als Büchner in sein Büro zurückkam, sah er, dass aus dem Graupelgeriesel von morgens anständiger Schnee geworden war. Betäubt ließ er sich auf seinem Stuhl nieder und starrte aus dem Fenster.
Aus milchgrauem Himmel segelten dicke Flocken. Sobald es schneite, noch dazu einen solchen Bilderbuch-Schnee, wurde das Leben leiser, langsamer. Normalerweise glänzte sein Büroblick nicht durch Attraktivität. Eine graue Straße, graue Bürgersteige, graue Häuser. Jetzt bedeckte die Straße eine weiße Schneeschicht, von vorsichtigen Reifenspuren dunkel durchzogen, geometrische Muster, die den Blick fingen. Auf dem Bürgersteig, nur schwach ausgebildet, waren Fußspuren, zarte Vertiefungen, Mahnmale an längst Vorübergegangene. Die jämmerlichen Stadtbirken, Gerippe, die verzweifelt gegen den Erstickungstod kämpften und auch so aussahen, schmückten weiße Mäntel, und sogar die grauen Hausdächer mit Rauchfahnen aus schmutzigen Schornsteinen wirkten, als würden sie endlich ihrer Aufgabe nachkommen: Bedachen, beschützen, ein Wall gegen Kälte und Frost.
Und über allem, wie ein oszillierender Vorhang, das beständige Geriesel.
Lautlos formten seine Lippen das Wort »rieseln«. Es gefiel ihm. Regen platschte, schüttete, fiel oder goss. Schnee rieselte. Ein angemessenes Wort.
Hinter ihm öffnete sich die Tür. Er drehte sich nicht um.
»So ein Scheißwetter«, tönte es in seinem Rücken.
Er reagierte nicht.
Unter Prusten und Schnauben zog Walter Hamm den Mantel aus, hängte ihn an den Kleiderständer, kramte einen klirrenden Schlüsselbund vor, ließ ihn fallen, hob ihn fluchend auf und setzte sich endlich, wobei er es fertigbrachte, den Stuhl ächzen und knirschen zu lassen.
Auch eine Eigenheit von Hamm, dieser ständige Lärm. Selbst die einfachsten Tätigkeiten waren mit einem immensen Geräuschpegel verbunden. Manchmal konnte Büchner ihn sogar denken hören. Ein leises Sirren, unterbrochen von einem Knacksen und Knurpsen, wie wenn ein Tier an Knochen nagt. Wahrscheinlich der Versuch von Hamms Synapsen, eingegangene Informationen weiterzuleiten und zu verarbeiten.
»Stumm geworden?«, kam es aggressiv von gegenüber.
Mühsam riss Büchner seinen Blick vom Fenster.
Mit vorgerecktem Kinn, die Arme über der Brust gekreuzt, starrte Hamm ihn an, während seine Füße unter dem Schreibtisch auf und nieder tippten.
»Rehn wird meinen Part in der laufenden Ermittlung übernehmen.«
Das Fußgetippe verstummte. »Du machst dich dünne? Wieso das denn?«
Büchner zog die Augenbrauen hoch.
»Es gab Beschwerden über mich«, erzählte er dem verständnislosen Gesicht gegenüber. Irrte er sich oder biss sich Hamm unter seinem dämlichen Dreitagebart auf die Lippen? Der Blick wich aus, und die Füße begannen wieder ihr nerviges Gelärme.
In diesem Moment wurde die Tür aufgerissen. »Norbert Mayer, Kontaktdienststelle West. Der Kollege Büchner?«
Verwundert betrachtete Büchner das junge Gesicht, auf dem sich nicht einmal der erste Flaum zeigte. Kontaktdienststelle? Gott, der Typ war höchstens sechzehn. Holten die ihre Beamten jetzt aus der Wiege? Durch ein Nicken gab er sich zu erkennen.
»Hier die Akte von der Police Grand-Ducale. Mit dem BCCP ist alles abgeklärt.«
Der Junge warf einen dünnen schwarzen Schnellhefter auf Büchners Schreibtisch.
»BCCP?«
»Bureau Commun de Coopération Policière«, kam es wie aus der Pistole geschossen.
»Aha.«
Der Sechzehnjährige grinste und ließ sich ohne Umstände auf Büchners Schreibtischkante nieder: »Grenzüberschreitende Polizeiarbeit Deutschland, Belgien, Luxemburg. Sie arbeiten allerdings mit der SPJ.«
Von nahem sah er nicht mehr ganz so jung aus, eher achtzehn. Sein Lächeln hatte etwas Gütiges, als er erklärte: »Service de Police Judicaire, Kriminalpolizei, fast wie bei uns. Zuständig für Schwerverbrechen, Bekämpfung der organisierten Kriminalität, Wirtschaftskriminalität, Suchtgiftkriminalität und so weiter. Spurensicherung und Erkennungsdienst sind Teil der SPJ.«
»Soweit klar.«
»Sie melden sich aber erst mal bei der SREC.«
Büchners Seufzen quittierte Mayer mit breitem Grinsen.»Service de Recherche et d’Enquête Criminelle.«
»Okay, okay«, fuhr Büchner auf. »Geben Sie mir eine Adresse, einen Namen. Oder muss ich die Struktur der Luxemburger Polizei auswendig lernen?«
»Nicht Luxemburger Polizei – großherzogliche Polizei! Police Grand-Ducale. Hab ich doch eben gesagt.« Ein leichter Tadel lag in der Stimme. Offensichtlich hielt er Büchner für extrem begriffsstutzig.
»Ein Name?«
»Einfach in Remich bei Commissaire Henri Michaux melden. Adresse liegt bei. Nicht vergessen: Unbedingt tanken in Luxemburg, ist billiger als bei uns. Und Hände weg von den Obstschnäpsen! Der Kirsch dort stammt aus der Chemiefabrik, der hat nie eine lebende Kirsche gesehen.«
Der Kleine durfte schon trinken? Dann musste er mindestens einundzwanzig sein.
Unbeeindruckt von Büchners Erschütterung hüpfte Mayer vom Schreibtisch und wandte sich zur Tür. »Alles klar?«
Bevor Büchner noch überlegen konnte, hörte er sich fragen: »Wie alt sind Sie?
Diesmal hatte er es geschafft, Norbert Mayer zu verblüffen.
»Sechsunddreißig, wieso?«
Als keine Antwort kam, wandte sich der Junge kopfschüttelnd zum Gehen.
Erschüttert von so viel Jugendlichkeit, Effizienz und Dynamik starrte Büchner ihm nach.
»Interessanter Fall?«, kam es lauernd von Hamm.
Büchner zuckte die Achseln und öffnete den Schnellhefter. Ein Gewirr von herausgerissenen Därmen, gelblichem Unterfettgewebe, Blut und Hämatomen sprang ihn an. Verstört überblätterte er die ersten Fotos und kam zu den Porträtaufnahmen des toten Gesichts. Auch nicht besser. Mit einem Ruck klappte er das Ding wieder zu.
Genau deshalb wollte er nichts mit Mord zu tun haben. Gewalt, das war einfach nichts für ihn. Verdammt, er war dafür nicht gebaut, auch nicht nach zwanzig Jahren Polizeidienst.
Er würde zu Liebs gehen und ihm den Ordner vor die Füße schmeißen, sich weigern. Genau. Niemand konnte ihn zwingen, sich damit zu beschäftigen.
»Ist wohl nix für die zarte Seele?«
Irritiert hob er den Blick von dem schwarzen Schnellhefter. Hamms Grinsen konnte man nur hämisch nennen.
»Du kannst ja zum Chef rennen, Büchner. Der wird dafür sorgen, dass du dir dein Kaschmirmäntelchen nicht versauen musst. Ist nicht nett, die Realität.«
War das Hamms Bild von ihm? Der personifizierte Kaschmirmantel, der bei unliebsamen Aufträgen zum Chef rannte?
Gut, er trug einen, er legte Wert auf gute Kleidung. Bestimmt ein befremdlicher Aspekt in der Welt der Jeans- und Lederjacken-Typen, der harten Kerle. Dabei war das Harte-Jungs-Getue auch nur ein Abwehrmechanismus gegen Bilder wie die zwischen den Schnellhefterdeckeln.
Es gab beim Diebstahl Gewalttaten, natürlich hatte Büchner Tote gesehen. Aber seine persönlichen Abwehrmechanismen waren eben nicht besonders gut entwickelt, trugen wahrscheinlich kleine Kaschmirmäntelchen und sahen lieber weg, als wegzustecken. Na und? Sein erster Impuls war tatsächlich, Liebs den Ordner vor die Füße zu schmeißen, zum Chef zu rennen.
Abrupt stand er auf, zog den geschmähten Mantel über und klemmte sich den grausigen Ordner unter den Arm.
»Hey, wo willst du hin?«
»Nach Hause.«
Genau, er würde nach Hause gehen, den Tag beenden, sich ein Bad einlaufen lassen, ins Schneetreiben schauen, einen Wein trinken. Und irgendwann den verdammten Ordner wieder öffnen.
»Du kannst nicht einfach … Hey, Büchner! Was ist mit Rehn? Redest du mal mit mir, du Mistkerl? Büchner …«
Selbst auf dem Gang war Hamm noch zu hören.
3.
Prüfend hob Marie Weller die Nase und sog die Schneeluft ein. War da nicht etwas? Eine Spur? Ein Hauch?
Enttäuscht senkte sie den Kopf. Kein Frühling.
Manchmal konnte man ihn schon riechen, ein zarter Geruch, eine Ahnung von jungem Grün und hellen Himmeln.
Aber da war nichts. Nur Schnee.
Blödes altes Weib! Schon im Januar diese unstillbare Sehnsucht nach dem Mai.
Vielleicht war da doch etwas? Vielleicht kapitulierte ihre Nase vor dem Alter? Wo hatte sie das gelesen mit der nachlassenden Riechfähigkeit? Himmel, hoffentlich war es noch nicht so weit.
Sie schob die kalten Hände in die Anorakjacke und schlenderte über die schneebedeckten Platten zum Apfelbaum.
Der Baum empfing sie mit einem Lächeln. In den kahlen Zweigen, die er gegen den Himmel streckte, war vielleicht doch ein leichter Grünschleier zu erkennen?
Sie stellte sich vor, dass das Chlorophyll spätestens ab Januar in die toten Äste wanderte und den Stamm durchzog. Wie Blut, das unter der Hautoberfläche pulsiert.
Aber da war nichts, kein grüner Schimmer.
Lächerlich, Weihnachten und Silvester waren gerade erst vorbei. Je älter sie wurde, desto größer die Angst, den Frühling nicht mehr zu erleben. Im Winter starben die Leute.
»Huhu, Frau Weller«, dröhnte es in ihrem Rücken.
Marie erstarrte. Eine Sekunde lang überlegte sie, sich nicht umzudrehen, den schrecklichen Ruf zu ignorieren. Aber das hatte wenig Sinn, Ilse Blum gab nicht auf. Nie.
Mit einem Seufzer drehte sie sich zur Gartenmauer.
Den halslosen Oberkörper in Pelz gehüllt, die Locken mit einem neckischen Käppchen geschmückt, den Froschmund in die Breite gezogen, lauerte das Verhängnis auf der Leiter.
Marie wünschte ihrer Nachbarin nichts Schlimmes. Aber ein kleiner Sturz? Die Leiter, von der aus Ilse Blum den Wellerschen Garten überwachte, war sicher glatt? Es musste kein Knochenbruch sein, eine nette Verstauchung, die sie eine Zeit lang von Kletterpartien abhalten würde, vielleicht?
»Man hat richtig Sehnsucht nach Wärme«, säuselte die Blum von oben.
Marie knurrte Undefinierbares.
»Ach! Bald heben die Schneeglöcklein wieder die Köpfchen und dann kommen die Narzisschen und Kroküsschen wieder«, plapperte das Verhängnis.
Entgeistert starrte Marie in das freundliche Gesicht. Narzisschen, Kroküsschen? Der Blumsche Hang zur Verniedlichung ging entschieden zu weit.
»Ist alles in Ordnung?«
Marie nickte stumm, was ihrer Nachbarin nicht zu gefallen schien. »Also mit Ihnen zu plaudern wird immer öder«, kam es gereizt von oben, und die ondulierten Locken tauchten ab.
Es dauerte ein paar Sekunden, bis Marie sich von den Konversationsversuchen erholte. Offensichtlich hatte der Frosch auf ein paar Wellersche Bösartigkeiten gelauert. Na gut, damit konnte sie momentan nicht dienen. Der Winter dauerte zu lange, sie war eingefroren. Musste die Blum halt auf Tauwetter warten.
Ratlos sah sich Marie in ihrem Wintergarten um. Der erste richtige Schnee in diesem Jahr hatte alles verhext. Weiß umhüllte er die Konturen der Zweige, hatte sich als Zuckerguss auf die immergrünen Hecken gelegt und den Rasen mit einer Glitzerschicht überzogen, unberührt und unberührbar.
Sie könnte einen Schnee-Engel machen. Sich auf die weiße Fläche legen, die Arme und Beine über den Boden reiben und so einen Abdruck wie von Engelsflügen hinterlassen.
Einen winzigen Moment war sie in Versuchung. Aber wahrscheinlich käme sie nicht mehr hoch, würde wie ein Käfer auf dem Rücken zappeln. Und die Blum, die bestimmt noch irgendwo lauerte, würde der Schlag treffen. Das wäre es allerdings wert. Sie kicherte.
Ein Feuer. Genau, sie würde ein Feuer anzünden, um den Frühling zu locken. Den Winter verbrennen – warum nicht? Die Bewegung war gut für eingerostete Knochen und zu tun gab es eh nichts im Garten.
Sie krempelte die Anorakärmel hoch und ging zur Holzstelle. Den Tannenbaum von Weihnachten musste sie verbrennen. Und das, was an Gartenabfällen vom Herbst übrig war.
Entschlossen packte sie das Oberteil des zersägten Weihnachtsbaumes und schleppte es von der Gartenmauer zur Feuerstelle. Die Steine, die die Stelle markierten, waren umgefallen oder verschoben. Mit gebücktem Kreuz richtete sie alle und zerrte den Baum in die Mitte.
»Was wird das?«, kam es neugierig von der Mauer.
Ohne hochzusehen, packte sie den zweiten Teil des Baumtorsos und zog ihn zum magischen Kreis.
»Frau Weller, Sie werden doch jetzt kein stinkendes Feuer anzünden!«
»Genau das werde ich.« Mit diesen Worten lud sie sich die Arme voll abgeschnittener Äste und wandte sich strahlend zur Blumschen Mauer. »Sie sollten sich besser verziehen, der Qualm wird genau zu Ihnen treiben.«
»Sie – Sie sind schrecklich«, kreischte Ilse, aber Marie hätte schwören können, dass sich beim Abtauchen ein Grienen um den Mund ihrer Nachbarin breitmachte.
Eine Sekunde hielt sie in ihrer Betriebsamkeit inne. Diese Blum! Machte sich Sorgen um den Gemütszustand ihrer schrulligen Nachbarin. Irgendwie rührend. Aber anstrengend.
Jetzt erst mal das Feuer! Im Schuppen war Brennholz, warum nicht Kartoffeln rösten?
Ohne auf die rutschigen Platten zu achten, lief Marie hinter das Haus in den windschiefen Gartenschuppen. Eine Wand war mit gestapeltem Holz für ihren Kaminofen bedeckt. Sie lud sich beide Arme voll und ging zur Feuerstelle zurück. Papier in die Zwischenräume des Holzstapels, ein Streichholz, und schon züngelte eine kleine Flamme über den Boden des Scheiterhaufens.
»Marie?«
Erstaunt drehte sie sich um und hätte vor Überraschung fast aufgeschrien. »Vito! Das darf doch nicht wahr sein …«
»Marie. So eine Freude.«
Mit ausgestreckten Armen kam der stattliche ältere Herr auf sie zu.
Giacomo, der Chauffeur, der in einigem Abstand stand, sah verblüfft, wie Dottore Miotti diese merkwürdige Alte mit der aufgelösten Frisur in die Arme schloss. Durch die langen Dienstjahre gelang ihm eine unbeteiligte Miene. Schon den ganzen Tag musste er sich darum bemühen, ab dem Zeitpunkt, als der Dottore beschlossen hatte, von Paris aus nicht nach Hause, sondern in das merkwürdige Dorf am Ende der Welt zu fahren, jetzt stand er da und hielt die ungepflegte Frau umklammert, als gelte es sein Leben. Und wenn sich Giacomo nicht sehr täuschte, lugte über die Gartenmauer eine weitere Chimäre mit ondulierten Locken. Aber nein, da war nichts, außer der vom Feuer bewegten Luft.
Endlich lösten sich die beiden voneinander, und der Chef erinnerte sich an ihn. »Giacomo, mi farebbe il favore di cercarsi una trattoria. Starò per alcune ore dalla mia vecchia amica Marie.«
»Du schickst ihn weg?«, unterbrach ihn die Alte. Wenn sie sich die Haare aus dem Gesicht strich, sah sie nett aus. Früher war sie bestimmt hübsch gewesen. Sieh einer an, der alte Miotti, der Schwerenöter.
»Dein Chauffeur kann hier bleiben, ich mache euch etwas zu essen, oder …«
Über ihren Kopf hinweg machte der Dottore ein Zeichen, und Giacomo verstand. Mit einem Lächeln entfernte er sich.
Marie sah ihm nach. »Wie immer die Menschen im Griff.«
»Wie immer«, bestätigte ihr Gast. »Lass dich ansehn.« Er drehte sie zu sich und sah ihr aufmerksam ins Gesicht, das sich, trotz seiner Größe, fast auf gleicher Höhe befand.
Auch Marie musterte ihren alten Freund. Das Haar schlohweiß, die Gesichtszüge schärfer als bei ihrem letzten Treffen, die braunen Augen lebendig, um den Mund neue Falten, die ihn abgehärmter aussehen ließen.
»Du siehst aus, als hättest du Sorgen.«
Statt einer Antwort lachte er leise.
»Willst du ins Haus?«
Er schüttelte den Kopf. »Es ist schön hier in deinem Wintergarten. Hast du etwas zum Sitzen?«
»Dort hinten der Hackklotz. Packst du den?«
»Also bitte«, sagte er beleidigt.
»Als Direktor der vatikanischen Museen trägst du wahrscheinlich kaum ein Blatt Papier.«
»Ich trage die Verantwortung, dagegen ist dein Holzklotz ein Federchen.«
Aha, da lag der Hund begraben.
»Weißt du, während du es uns gemütlich machst, hole ich Kartoffeln für das Feuer, ja?«
»Und einen deiner wunderbaren Schnäpse?«
»Einen Chartreuse!« Ohne seine Zustimmung abzuwarten, lief sie zum Haus.
Er sah ihr nach. In manchen Momenten sah sie aus wie das junge Mädchen, die kleine Studentin in Paris, als die er sie kennengelernt hatte. Ein wenig zu groß, ein wenig schlaksig und immer in Bewegung. Und obwohl er schon damals wusste, dass seine Träume nicht den Mädchen galten, hatte er sie geliebt. Auf seine Art. Manche Dinge blieben.
Mit einem Seufzer schob er die Mantelärmel nach oben, wischte mit der Hand die Schneemütze vom Holzklotz und versuchte, ihn von der Gartenmauer zum Feuer zu schieben. Hochheben ließ sich das Ding nicht, aber mit Zerren und Drücken gelang es, den Klotz zu bewegen. Ab und an hielt er inne und wischte sich den Schweiß ab. Gott, obwohl er versuchte, fit zu bleiben, war er ein lahmer, zahnloser Schreibtischtiger.
Ein letzter Ruck, dann lag der Klotz da, wo er sollte. Aufatmend ließ er sich darauf nieder, ein Lächeln stahl sich in seine Mundwinkel. Gut, dass ihm niemand zugesehen hatte. Der ehrwürdige Doktor Vittorio Miotti, der einen Holzklotz durch den Garten zerrt.
Die kleine Flamme vom Anfang war gewachsen, hatte sich ausgedehnt, fraß sich, groß und von strahlendem Goldgelb, hungrig am trockenen Holz in die Höhe. Tanzend sprang sie über die Äste, die sich wie dürre Knöchelchen in ihr aufbäumten und zerfielen. Das Feuer hatte den Schnee geschmolzen und einen Ring brauner Erde freigelegt. Sein Gesicht, den Flammen zugewandt, wurde warm.
»Schön, so ein Winterfeuer«, sagte Marie und nahm aus den Taschen ihres Anoraks eine Flasche und zwei silberne Becherchen. Sie stellte alles auf die Erde, kauerte sich ans Feuer und zog aus den unergründlichen Taschentiefen in Alufolie gewickelte Kartoffeln, die sie vorsichtig in die Glut schob.
»Auffallend«, sagte Miotti und hielt die silbernen Schnapsbecher, dass die Flammen sich darin spiegelten.
»Reines Art déco. Habe ich in Gent gefunden«, beantwortete Marie seine unausgesprochene Frage.
Freude an schönen Dingen, darin waren sie immer Verbündete gewesen.
»Chartreuse braucht eigentlich Glas«, gab sie zu bedenken. »Das grüne Feuer – sieht man so gar nicht.«
Er senkte die Nase in sein Schnapsglas und sog den von Kräutern durchtränkten schweren Alkoholgeruch ein. »Du bist der einzige Mensch, mit dem ich das Zeug trinke«, murmelte er.
Beide sahen ins Feuer, dachten an das letzte Mal, als sie bei einem Chartreuse zusammensaßen. Das war in Maries Küche gewesen, direkt nach Theos Beerdigung. Seltsam verspätet hatten sie den alten Freund zu Grabe getragen, als die Rechtsmedizin endlich den toten Heimatforscher und Museumsdirektor freigegeben hatte.
Vor vielen, vielen Jahren in Paris waren sie unzertrennlich gewesen. Odette, Marie, Vito und Theo. Ihr Quartett war ein Markenzeichen gewesen. Und dann, eine gefühlte Sekunde später, saßen sie zu dritt, plötzlich alt und verbraucht, in Maries Küche. Odette, Marie und Vito. Jeder mit seinem Leben und dem, was er daraus gemacht hatte.
»Denkst du auch an das letzte Mal?«, fragte sie leise.
»Ach, Marie. Was ist aus uns geworden?«
»Du wirst jetzt nicht kitschig?«, fragte sie mit einem schrägen Seitenblick.
Er lachte.
»Wir haben alle das getan, was wir tun wollten. Theo hat seinen Beruf geliebt, das ist ein gutes Leben. Odette ist immer noch eine hervorragende Geschäftsfrau, wenn auch in einem, nun ja …«
»Einem ungewöhnlichen Metier?«, hakte er nach.
Marie nickte. Sie war nicht prüde, aber dass ihre alte Studienkollegin Odette ein »Haus« führte, verursachte ihr ein merkwürdiges Gefühl in der Magengrube.
»Ich bin damals nicht gerne ins Saarland zurückgegangen. Aber im Endeffekt war es das Beste. Ich hatte meinen Antiquitätenladen, mein Haus und später sogar Theo.« Sie schluckte kurz. Er rückte ein Stück näher an seine alte Freundin heran.
»Aber du! Du hast wirklich Karriere gemacht. Direktor der vatikanischen Museen – hättest du dir das als kleiner Student träumen lassen?«
Er streckte seine langen Beine dem Feuer entgegen. »Natürlich.«
Natürlich. Sie war die Kitschnudel. Vittorio war immer der Ehrgeizigste gewesen, derjenige, der schon damals fünf Sprachen akzentfrei beherrschte, als Erster promovierte, immer mit den Mächtigen paktierte … Stopp. Nicht paktierte, das Licht der Macht suchte. So hatten sie es damals genannt.
»Bist du glücklich?«
Er runzelte die Stirn. »Eine angemessene Frage an diesem späten Nachmittag in diesem Garten. Bist du es?«
»Nein. Nicht besonders.« Sie griff einen langen Ast und stocherte im Feuer. »Eine blöde Frage. Als gäbe es ein Anrecht oder eine Verpflichtung zum Glück. Als wäre das der Gradmesser des Lebens.«
»Vielleicht ist er das. Um deine Frage zu beantworten: Ich mag mein Leben.«
Sie warf ihm einen Seitenblick zu. »Du hast Sorgen. Sonst wärst du nicht gekommen.«
»Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Bekomme ich noch ein Gläschen?«
Sorgsam goss sie ihm nach.
»Direktor der vatikanischen Museen. Mein Lebenstraum. Hat nicht einmal ein kluger Mann gesagt, wen Gott liebt, dem verweigert er die Erfüllung seiner Träume?«
»Wen Gott liebt, den nimmt er jung zu sich.« Auch sich selbst goss sie nach. »Aber du bist der Spezialist für Gottessprüche, du arbeitest für den Verein.«
Er lächelte zurück. »Auch das habe ich mir leichter vorgestellt. Hohe Würdenträger sind eine eigene Spezies, glaub mir.«
»Und das Museum?«
»Ein Traum.«
Sie rutschte näher an ihn heran: »Vito, einen Chartreuse, wenn du mir ein Geheimnis anvertraust!«
Als Antwort hielt er ihr seinen silbernen Becher entgegen.
»Die Sixtinische Kapelle …«
Er lachte, beugte sich vertraulich zu ihr und flüsterte: »Manchmal schleiche ich mich vor der Öffnung herein. Dort sitze ich dann ganz allein und atme.«
»Das will ich hoffen. Das mit dem Atmen, meine ich.«
»Es ist unglaublich, Marie. Ein Privileg. Ich, der kleine Vittorio, sitze in der Hauskapelle der Päpste, im größten Kunstwerk aller Zeiten. Inmitten der wunderbarsten Malereien der Menschheit. Ich kann dir nicht beschreiben, wie sich das anfühlt. Dafür lohnt sich einiges.«
Marie seufzte und starrte in die Flammen. Früher war das einer ihrer großen Träume gewesen: einmal alleine und mit viel Zeit die Sixtinische Kapelle ansehen. Ohne die Touristenmassen, ohne Gedränge und die ständige Aufforderung, weiterzugehen. Ach ja, die Träume.
»Was lohnt sich dafür nicht?«
»Wir haben Diebstähle im Museum. Einer davon ist mehr als schmerzlich.«
Alarmiert setzte sie sich aufrecht. »In der Zeitung stand nichts.«
»Das will ich hoffen! Eine der Hauptanforderungen an den Direktor der Vatikanischen ist, das Haus skandalfrei zu führen.«
»Kunstraub. Kein gutes Aushängeschild für ein Museum«, gab sie zu.
»Zu oft kommen im Zuge der Ermittlungen katastrophale Zustände ans Licht. Denk nur an den gestohlenen Salzstreuer in Wien, der das ganze Museum blamiert hat.«
»Salz! Holst du die Kartoffeln raus?« Unvermittelt sprang sie auf und lief zum Haus.
Mit einem Holzstab scharrte er in der Glut, um die inzwischen dunkel gebrannten Alu-Päckchen zu fischen. Mit spitzen Fingern legte er sie zu einem Häufchen zusammen. Sein Gesicht, das den Flammen immer näher kam, glühte. Mitten in der Bewegung hielt er inne.
Ein Déjà-vu: Ein kleiner Junge vor einem Feuer klaubt Kartoffeln aus der Asche. Von vorne wird er geröstet, von hinten greift ihm kalter Wind unter den Pullover. Er ist ganz vertieft in seine Tätigkeit, und – ja, er ist glücklich. Eins mit sich, mit der Welt.
Dottore Vittorio Miotti richtete sich auf und sah in die Flammen. Eine Kugel, so hatte er sich damals gefühlt, wie eine Kugel. Rund und zufrieden, ohne einen Zweifel.
Die Bewegungsabläufe, der Geruch nach Feuer und gebratenen Kartoffeln, das Zusammenspiel von heiß und kalt, all das hatte ihn in seine Kindheit zurückversetzt. Damals war er dem Glück nah gewesen. Das Glück, nach dem Marie gefragt hatte, lag vielleicht nur in diesem Rundsein, im Einssein mit der Welt.
»Kunstraub«, sagte Marie, die mit Servietten und einem Salzstreuer bewaffnet zurückkam und sich vor das Feuer kauerte. »Einen Museumseinbruch hatten wir hier vor kurzem. Ich habe einen Experten von der Polizei kennengelernt.«
Mit halbem Ohr hörte er zu. »Hast du eine Gabel?«
»Na komm. Mit den Fingern macht das viel mehr Spaß. Eine Gabel! So was Blödes.«
Sie saß auf dem Boden, den Rücken an den Hackklotz gelehnt, eine Kartoffel auf den Knien und zog vorsichtig die Alufolie auseinander. Ein Teil der Schale blieb daran hängen. Gelb schimmernd und dampfend lag die Frucht vor ihr.
Er setzte sich neben sie und griff sich ein Kartoffelpäckchen.
»So weit ich weiß wollte Hauser, so hieß der Spezialist, sich mit einer Detektei selbstständig machen.«
Er horchte auf. »Eine Detektei?«
»Für gestohlene Kunstschätze. Aber der Vatikan hat doch eine eigene Polizei?«
»Sicher, die Corpo della Gendarmeria«, antwortete er nachdenklich. »Dieser Hauser … Du kennst ihn?«
»Er hat versucht, ein Netzwerk mit allen Antiquitätenhändlern aufzubauen. Gestohlene Kunst wird uns öfters angeboten. Die Museumsdiebe hat er jedenfalls geschnappt.«
Er streckte die Hand aus, sie reichte ihm den Salzstreuer.
»Ist er diskret?«
Sie zuckte die Achseln. »Muss er. Sonst bleibt er nicht im Geschäft.«
Immer noch gedankenschwer schüttelte er den Streuer über seine Kartoffel, bis Marie an seinem Ärmel zupfte.
»Vito, es schadet nicht, wenn du die Kartoffel vor dem Essen auspackst.«
Von seinem Alu-Päckchen sah er direkt in Maries lachende Augen.
»Hör mal«, begann er zögernd. »Ich glaube, ich brauche deine Hilfe.«
4.
»Nach der Auflösung des stabilen Hochs, das uns die letzten Tage unser wunderbares Winterwetter gebracht hat, dringen nun die Tiefdruckgebiete von Westen her weiter vor. In den Morgenstunden sind örtliche Wolkenlücken möglich …«
Der Fahrer vor ihm bremste scharf, als die Straße steil abfiel. Büchner bremste ebenfalls, sein Wagen rutschte mit den Hinterrädern nach links. Automatisch steuerte er gegen, der Wagen fing sich, Adrenalin stürmte seine Blutbahnen.
»… weht ein starker und recht böiger Wind. Die derzeitige Wetterlage sorgt bei vielen Menschen für eine Verschlechterung des Allgemeinbefindens und …«