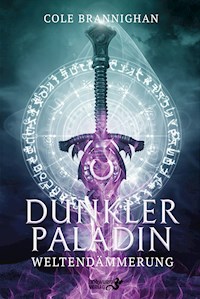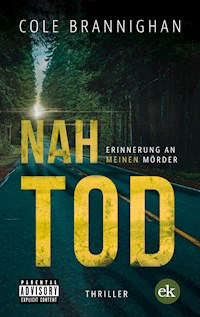
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag edition krimi
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Psychologin Anna Caffrey wird aus der Bahn geworfen. Beziehung kaputt. Wohnung weg. Kein Geld. Als sie ein schwieriges Projekt in der Kleinstadt Killarney erhält, bei dem es um Patienten mit Nahtoderfahrungen geht, hat sie keine andere Wahl, als zuzugreifen. Im Rahmen ihrer Arbeit, die sich in der opulenten McMurrough Villa abspielt, wird sie mit den traumatischen Erlebnissen ihrer eigenen Kindheit konfrontiert. Als dann auch noch eine Patientin schildert, dass sie sich an den Mord an sich selbst erinnere, beginnt eine blutige Jagd nach der Rekonstruktion der Vergangenheit. Ein Psychologie-Thriller der Meisterklasse
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cole Brannighan
Nahtod
Irland-Thriller
Kacar, Ali: Nahtod. Irland-Thriller. Hamburg, edition krimi 2022
Originalausgabe
EPUB-ISBN: 978-3-948972-68-4
PDF-ISBN: 978-3-948972-69-1
Dieses Buch ist auch als Print erhältlich und kann über den Handel oder den Verlag bezogen werden.
Print-ISBN: 978-3-948972-67-7
Lektorat: Robien Schmidt-Jansen, Bergheim; Bianca Weirauch, Weida
Umschlaggestaltung: © Annelie Lamers, Hamburg
Umschlagmotiv: © Brett Sayles/pexels.com; Struktur Schrift
© pixabay.com
Mehr zum Autor auf Instagram unter »cole_brannighan« und auf seiner Webseite unter »www.cole-brannighan.de«.
Danke an Susanne Däbritz.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.
Die edition krimi ist ein Imprint der Bedey & Thoms Media GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
_______________________________
© edition krimi, Hamburg 2022
Alle Rechte vorbehalten.
https://www.edition-krimi.de
»Für das Land, in dem meine Seele zur Welt kam.«
Inhalt
„1 McMurrough Villa“
„2 So läuft das hier“
„3 Begegnung mit der Angst“
„4 Rechtsmedizin“
„5 Wildhound 83“
„6 Hass ist besser als Schmerz“
„7 Im Angesicht der Flinte“
„8 Doug’s Harp“
„9 Muckross Abbey“
„10 Lebendig“
„11 Das Tagebuchphänomen“
„12 Und was, wenn doch?“
„12 Und was, wenn doch?“
„13 Rücklichter“
„14 Muskat und Butter“
„15 Moderne Zeiten“
„16 Inspiration“
„17 Vertrauen“
„18 Blutregen“
„19 Sieben Fuß tief“
„20 Der Kopf der Schlange“
„Epilog“
„Psychologische Begriffe“
„Personenregister“
1 McMurrough Villa
Anna Caffrey
Aschgraue Wolken krochen über den Himmel und hauchten eine dünne Schicht aus Nieselregen auf die Scheibe des rostigen, zitronengelben VW Käfers. Die Motorhaube, die sich hinten befand, war notdürftig mit Kabelbinder an der Karosserie befestigt und klapperte unter den arrhythmischen Schlägen, die den in die Jahre gekommenen Antrieb hin und wieder durchschüttelten.
Anna Caffrey schob sich eine haselnussbraune Haarsträhne hinters Ohr, nahm die schwarze Hornbrille ab und wischte sich die Tränen mit dem Ärmel ihrer Langstrickjacke weg. Danach setzte sie sich ihre Brille wieder auf und blinzelte ein paarmal, um den Schleier vor den Augen aufzulösen. Über die Billiglautsprecher kratzte der Popsong Everybody Hurts von R.E.M., in dem der Sänger flehentlich einen Schmerz besang, in dessen Klang die Bruchstücke ihres eigenen zerrissenen Herzens vibrierten.
Anna schob die Akten auf dem Beifahrersitz beiseite, kramte zwischen Papieren und einer ganzen Armada geklauter Werbekugelschreiber eine Tüte mit Schokokaramellbonbons hervor und stopfte sich eine Handvoll davon in den Mund. Als die Süßigkeiten auf ihrer Zunge zu schmelzen begannen, wischte sie sich mit dem Handrücken den Rotz von der Nase ab und schluckte hastig, nur um den Refrain mitzusingen. »Everybody Hurts … sometimes.«
Vor ihrem geistigen Auge flimmerten die tonlosen Bilder ihrer kaputten Beziehung wie eine Filmrolle durch einen alten Vorführprojektor. Sie hatte sich trotz besseren Wissens in den Macho verliebt, der ihr nicht guttun würde. Und nach eineinhalb Jahren Auf und Ab war einfach so Schluss. »Du bist besessen von deiner Karriere, bist Mitte dreißig und willst noch immer keine Kinder. Ich kann so nicht weitermachen. Alles, was du von meinem Geld gekauft hast, behalte ich, den Rest kannst du zurückhaben«, hatte er geschrieben. Der Brief war mit der Post auf dem kleinen Schreibtisch gelandet, den sie sich mit einer Praktikantin in einem abgelegenen Teil der Unibibliothek teilte. Der Schock nach dem Lesen des Briefs, der nicht mehr als eine Kurzbotschaft gewesen war, hatte sie ihren gesamten Heimweg über begleitet. Und es war nicht besser geworden, als sie festgestellt hatte, dass er die Schlösser seiner Eigentumswohnung ausgewechselt und ihre Wäsche, ihr Glätteisen und ihre Schminksachen in den Flur des Mehrfamilienhauses gestellt hatte. Mehr als einen Wäschekorb füllte das Ganze nicht. Wenn man von einer gestörten Beziehung in die andere hineinvagabundierte, verlor man mit dem Vertrauen in den Silberstreif am Beziehungshorizont auch die ein oder andere Habseligkeit, bis alles, was man besaß, mehr oder weniger in einen Koffer passte.
Kein klärendes Gespräch; keine Message auf dem Handy; keine Abschiedsworte.
Was war schiefgelaufen? Ging es wirklich um Zukunftspläne oder gab es da eine andere Frau? Dieses Schwein hatte sie abserviert, als wäre sie der Festtagsbraten, den man nach Weihnachten einfach in die Mülltonne kippte. Natürlich wollte sie auch Kinder, doch wenn sie jetzt schwanger wurde, dann würde sie die Promotion nie schaffen. Verstanden Männer denn nicht, wie schwer Frauen der Spagat zwischen Karriere und Familie fiel? Es waren doch höchstens noch ein oder zwei Jahre, ein Zeitraum, der überschaubar war. Oder war sie wirklich besessen und selbst das Schwein?
Nein, nein und nochmals nein.
So einfach war das nicht. Sie hatte öfter beobachtet, wie er anderen Frauen hinterhergeschaut hatte. Da er in seiner Lederjacke und mit dem kantigen Kinn zum Anbeißen aussah, war es nicht immer leicht gewesen, ihn vor den Blicken anderer Frauen abzuschirmen. Auch das war ein Kampf, den Männer nicht verstanden. Obwohl sie die Vierzig erst in fünf Jahren erreichen würde, merkte sie, dass sie nicht mehr den Körper einer Zwanzigjährigen besaß. Eine Tatsache, die sich wie ein Fallbeil in Zeitlupe durch ihr Leben schnitt. Männer blieben noch lange knackig und reiften sogar mit dem Alter. Aber von Frauen wurde ewige Schönheit erwartet, ein Idealzustand, den die Schwerkraft mit der Unerbittlichkeit eines Mühlsteins zermalmte. Sie hatte sich lange mit Genderstudien beschäftigt, wobei es um soziale Unterschiede zwischen Mann und Frau, Emanzipation und Feminismus ging, doch die wahre Natur der Dinge weigerte sich, Tinte auf einer wissenschaftlichen Arbeit zu werden. Schließlich gab es nur die eine Wahrheit, und zwar, dass Männer Schweine waren und sich ungerechterweise dabei auch noch wohlfühlten.
Sie zog die Nase hoch und schluckte die letzten Karamellreste hinunter. Schon wieder hatte sie ein Ereignis aus der Bahn geworfen und sie an der Weggabelung ihres Lebens auf einen Umweg getrieben.
Auf dem letzten Schild, am Rand der Überlandstraße, hatte sie gelesen, dass es bis nach Killarney noch fünf Kilometer waren. Doch entlang der grünbraunen Büsche und vereinzelter Bäume auf der Herbstwiese wirkte alles gleich, sodass sie nicht abschätzen konnte, wie viel Strecke sie bereits gefahren war. Nicht einmal Schafhirten waren unterwegs. Die saßen bestimmt gemütlich hinter ihren Breitbildfernsehern und wetteten auf das Fußballspiel der Galway United gegen die Finn Harps. Bisher hatte sie nicht einmal eine Mannschaft aus der irischen Liga gekannt, doch nach einem Gespräch mit dem Tankwart, nach dessen Sportmonolog sie ernsthaft überlegt hatte, sich die Pulsadern aufzuschlitzen, hatten sich einige Informationen unabänderlich in ihr Gehirn gebrannt.
Sie wartete noch einen Moment, bis die Scheibe kaum noch Sicht auf die Straße bot, dann schaltete sie den Wischer ein. Die Gummiblätter waren so abgenutzt, dass sie Schlieren zogen und die Sicht nur wenig verbesserten. Beim nächsten Hügel schaltete sie einen Gang herunter und ließ den Motor in höherer Drehzahl arbeiten. Mit einer etwas heftigeren Zuckung des Antriebs schwappte ein Schluck Kaffee aus ihrem Becher in der Ablage auf das rissige Leder des Schaltsacks. Sie suchte die Hosentaschen ihrer Jeans vergeblich nach einem Taschentuch ab. Danach griff sie unbeholfen nach hinten und tastete über den Wäschekorb mit ihren Habseligkeiten, schnappte sich ein Kleidungsstück und wischte die Flüssigkeit auf. Bei genauerem Hinsehen war es die pinkfarbene Unterhose mit Spitze, die sie zum Geburtstag ihres Freundes gekauft hatte. Kurzerhand kurbelte sie das Fenster herunter und warf sie hinaus. Kalte Luft strömte in den Innenraum und Regentropfen benetzten ihren Oberschenkel. Das Nieseln hatte sich zu einem leichten Tröpfeln gesteigert. Sie kurbelte das Fenster wieder hoch und drehte die Heizlüftung an. Sofort roch der Innenraum nach dem süßen Aroma, das ein ananasförmiger Lufterfrischer am Lüftungsgitter verströmte.
Als der Käfer sich die letzten Meter zum Scheitelpunkt der Kuppe hochgeröchelt hatte, erblickte Anna das durch den Wind aufgewühlte Wasser des mitternachtsblauen Lough Leane. Wegen des Regens konnte sie nicht über den gesamten Killarney-Nationalpark blicken, geschweige denn bis zum anderen Ufer, wo sich die Stadt befand. Anna schaltete den Scheibenwischer auf Dauerbetrieb und bog an einem Schild mit der Aufschrift McMurrough Villa ab. Der schmale Weg schlängelte sich durch ein kleines Waldstück und führte zum Wendehammer an einem mit Efeu überwucherten Gebäude. Tupfenweise lugten rostrote Backsteine aus dem Bewuchs hervor und standen in Kontrast zu den weißen Sprossenfenstern, die der Fassade sowie dem vom Alter ergrauten Satteldach eine strenge Schärfe verliehen. Einzig die runde, turmartige Ausbuchtung auf der rechten Seite schien den Bau etwas aufzulockern, da auch das Gesindehaus mit den Stallungen, das nebenan stand, dem strengen Stil des Haupthauses treu war.
Anna fuhr über den Kies der Auffahrt und parkte an der Seite eines olivgrünen Land Rovers. Neben dem dunklen Geländewagen kam sie sich in ihrem Käfer so klein vor.
Mit einem letzten Zuckeln des Motors stellte sie ihn ab und schaute zum Hauseingang, der auf seinen zwei Flügeln einen geschnitzten Schild mit einem stilisierten Wildschwein trug. Fast übergangslos peitschte der Regen zu einem Prasseln auf.
Anna lächelte schief. Jetzt, da sie aussteigen musste, ging das bescheidene Wetter erst richtig los. Andererseits passte es zu ihrem Leben – von der Traufe in den Regen und vom Regen in die Traufe. Vielleicht würde das Prasseln wieder nachlassen? Sie nahm sich eine Akte mit der Aufschrift Flooding – Bedeutung für die kognitive Verhaltenstherapie vom Beifahrersitz und überflog kurz das Projekt, das auf dem Stapel ungeliebter Themen der Forschung für eine Dissertation auf dem altehrwürdigen Mahagonitisch ihres Doktorvaters gelegen hatte. Ungeliebt, verachtet und ins Abseits gedrängt, hatte es letztlich den Weg zu Anna-Bad-Luck-Caffrey gefunden. Schon als Professor Kent die Akte unter seinem Kaffeebecher hervorgezogen hatte, wäre es nichts als gesunder Menschenverstand gewesen, wenn sie kategorisch abgelehnt hätte. Anna war keine Frau für die Praxis, sondern eher für die Theorie im sicheren Büro. Doch als frisch gebackene Obdachlose war die Macht des Wortes Nein geschmolzen, als man ihr vorgelesen hatte, dass ihr während des gesamten Projekts gratis Kost und Logis zustehen würden. Natürlich war ihr der kapitale Haken aufgefallen, mit dem Kapitän Ahab seinen Moby Dick zweifelsohne gleich am Anfang des Romans hätte erlegen und sich nicht über etliche Seiten durch sein maritimes Martyrium durchquälen müssen. Doch wie immer musste es noch ein Umweg sein, eine Verlängerung, ein großer Bogen, der sie mit dem Lächeln eines Männerschweins angrinste. Manchmal gab es einfach nicht genug Eiscreme, um sich all den Frust hinunterzufressen.
Sie überflog kurz die Informationen über die drei Patienten, die aus unterschiedlichen Teilen Irlands stammten. Der erste war Declan Shannahan, ein Schüler, achtzehn Jahre alt, kurz vor seinem Abschluss, der unter einer wachsenden Sozialphobie und Ängstlichkeit litt. Der zweite war Mick Brennan, einundzwanzig, ein narzisstischer Kleinkrimineller, den ein Richter namens Farlane auf Bewährung gesetzt hatte. Und eine Frau, vierundzwanzig, Kay McLennan, arrogant, mit autoaggressiven Tendenzen, die nach einer Drogenkarriere versuchte, ihren Sohn aus der Obhut des Jugendamts zu befreien. Sie hatte mit 135 den höchsten IQ von den dreien. Alle von ihnen hatten Nahtoderfahrungen hinter sich und litten unter wahnhaften Störungen mit Angstattacken, die sie nachts in Form von Albträumen plagten. Außerdem befanden sie sich seit über zwei Jahren in Therapie, jedoch ohne Erfolg. Ihre behandelnden Psychologen hatten sie bei dem Projekt angemeldet.
Anna blätterte weiter, entdeckte mehrere Blätter mit einem groben Ablaufplan des Projekts und einer Beschreibung. Darin stand, dass jeder Patient jeweils einen wiederkehrenden Traum beschreibe, in dem ein bestimmter Ort vorkäme. Da es in Killarney gleich drei Plätze gäbe, die der Schilderung sehr nahekämen, sei die Kleinstadt zur Durchführung der Therapie ausgesucht worden. Beim Flooding sollen die Patienten mit dem auslösenden Reiz überflutet werden, um die Angst zu überwinden. Doch dabei hatte sie ein flaues Gefühl im Magen, da solche Experimente außerhalb der kontrollierbaren Umgebung von Kliniken zu viele Risiken bargen, insbesondere wenn ein Betroffener Gefahr lief, einen Zusammenbruch zu erleiden. Eine Wahnvorstellung war immerhin der Versuch der menschlichen Psyche, auf eine extreme Situation mit einer Notlösung zu reagieren. Außerdem stellte die Psychological Daily, der Auftraggeber, keine Medikamente zur Verfügung und die Gruppe war zu klein, um solide Ergebnisse zu erzielen, die nicht von anderen Fachleuten auseinandergenommen werden konnten. Auch wenn es Nordpolforscher reizte, einzigartige Phänomene zu beobachten, während sie die Eisschicht auf ihrem Kaffee mit dem Löffel durchstoßen mussten, wollte Anna Caffrey nichts lieber als eine klinische Studie mit Blindtests, Vergleichsgruppen und einer möglichst hohen Wiederholungsrate. Sie hatte schon einmal erlebt, wie eine Kollegin von der Fachwelt zerrissen worden war, da ihren Ergebnissen die wissenschaftliche Nachvollziehbarkeit gefehlt hatte. Nach einem Jahr war sie dann an der Kasse einer Burgerbude gelandet, da ihr Name zu nichts mehr taugte, als das Schildchen einer verschwitzten Uniform zu zieren, die nur knapp mehr Charme besaß als die von einem Clown.
Auf allen Seiten war der Briefkopf mit dem Logo vom Wissenschaftsmagazin Psychological Dailyzu sehen, zwei rote Dreiecke, die wie eine Sanduhr mit den Spitzen aufeinander zeigten. In der Fachwelt der Psychologie richteten sich viele Leute nach den Expertisen dieses Magazins und außerdem erhielt ihre Uni diverse Stiftungsgelder über die Zusammenarbeit mit ihm.
Auf der letzten Seite gab es einen kurzen Abriss über das Setting. Die McMurrough Villa stand im Besitz von Lady Marla McMurrough – der letzten Erbin einer Familiendynastie – und wurde regelmäßig für Seminare, Workshops und Tagungen vermietet. Der Zeitraum der Anmietung für dieses Projekt betrug einen Monat und umfasste ein Sonderbudget, das auf einer beigefügten blauen Kreditkarte für alle Ausgaben im Rahmen der Forschung zur Verfügung stand.
Anna steckte die Karte ein und warf einen Blick in den Rückspiegel. Ihr Eyeliner war völlig verlaufen und ihre Augen sahen verquollen aus. Sie holte aus ihrer Designerhandtasche, die sie auf dem Grabbeltisch eines Discounters erstanden hatte, ihr Schminkset und reparierte ihr Make-up. Schon nach den ersten Ausbesserungen entspannte sie sich, legte alles beiseite und lehnte sich zurück.
Das Prasseln des Regens hämmerte wie Trommelfeuer auf das Blech ihres Wagens, den sie von ihrer verstorbenen Oma geerbt hatte. Auch wenn sie beide eher eine stiefmütterliche Beziehung gehabt hatten, fühlte sie sich sicher und geborgen in diesem Auto, das sie seit Beginn ihres Studiums und nun auch auf ihrem Weg zum Doktortitel begleitete. »Sieh zu, dass dich ein reicher Mann heiratet, sonst wird nix aus dir«, hatte Oma immer gesagt, wenn sie Anna von oben bis unten gemustert und für nicht gut genug befunden hatte. Noch heute dachte sie mit Unbehagen an die Frau, die ihre Enkeltochter nach dem Unfalltod ihrer Eltern großgezogen hatte.
Langsam wurden ihre Lider schwer, der Lärm fallender Tropfen verdichtete sich zu einem Rauschen, das sich wie eine dicke Decke um ihre Sinne legte und sie von der Welt isolierte.
* * *
Anna erwachte fröstelnd. Im Käfer war es kalt geworden, während der Regen nachgelassen hatte und der Abend gedämmert war. Lichter strahlten aus den Fenstern der Villa und warfen Lichtkegel auf die Veilchenbeete davor.
Anna packte ihre Akten zusammen, steckte sie in die Tasche mit dem Notebook und stieg aus dem Auto. Die Tür quietschte blechern in ihren Angeln.
Als sie in eine Pfütze trat, biss sie sich beim Anblick der eingesauten Stiefeletten auf die Unterlippe. »Echt jetzt? Das auch noch?«, zischte sie und lief zum Eingang, wo sie mit dem Türklopfer in Form eines Eberkopfs anklopfte.
Es dauerte eine Weile, bis jemand aufmachte.
»Guten Abend, Lady Caffrey«, begrüßte sie ein Mann Mitte fünfzig in kariertem Tweedanzug, der so felsgrau wie der Schieber war, den er auf dem Kopf trug. Er hatte grau melierte Bartstoppeln und trug eine erdbraune Fliege. Er kniff kurz die Augen mit den Krähenfüßen an den Seiten zusammen und schenkte ihr dann ein gemessenes Lächeln, das zu seiner steifen Körperhaltung passte.
»Sie kennen meinen Namen?«, fragte Anna.
»Sehr wohl, Mylady. Sie sind der letzte Gast auf der Liste. Die anderen sind bereits auf ihren Zimmern. Ich bin Vernan, der Alltagsmanager von Lady McMurrough, und heiße Sie herzlich willkommen.« Er ließ sie eintreten und schloss die Tür hinter ihr.
Anna staunte nicht schlecht, als sie unter einen ausladenden Kristallkronleuchter trat und eine breite Treppe mit geschwungenen Geländern betrachtete, die in den ersten Stock hinaufführte. Holzvertäfelungen reichten an allen Wänden brusthoch, darüber war der Putz mintgrün gestrichen und mit Gemälden behangen, die Menschen mit aristokratischen Gesichtszügen in opulenter Bekleidung abbildeten.
»Möchten Sie einen Whiskey am Kamin, Mylady?«
Ein ganzes Fass davon und eine Tonne Eiscreme, dachte Anna und rang sich zu einer moderaten Antwort durch. »Ja, das wäre nett.«
Vernan brachte sie in einen Raum, der nach gegerbten Tierhäuten und Möbelpolitur roch. Es war ein Jagdzimmer, mit Sofas im Chesterfield-Stil. Das rotbraune Leder war mit vielen Knöpfen zu einzelnen, gewölbten Quadraten abgesetzt. Farblich passten sie zu den unzähligen Jagdtrophäen an den Wänden. Ausgestopfte Fasane, blanke Rehbockschädel und etliche kleine Vögel zierten die Wände ringsherum. Die größte Trophäe, der Kopf eines mitternachtsschwarzen Ebers mit dolchlangen Hauern, hing über dem Kamin. Mit seinen Glasaugen wirkte er fast, als stecke noch die unbändige Wut des Waldes in ihm. Er war so gewaltig, dass sich Anna fragte, wie man solch ein Tier überhaupt erlegen konnte. Die Frage wurde ihr durch eine Sammlung von Flinten und Pistolen beantwortet, die stumm hinter dem Glas eines mahagonifarbenen Wandschranks ruhten.
»Bevorzugt Mylady einen speziellen Whiskey?«
»Nein, äh, überraschen Sie mich.«
Vernan nickte und verließ sie.
Anna stand im Raum und blickte sich um. Obwohl es hier eine außerordentlich große Zurschaustellung des Todes gab, würde sich diese Örtlichkeit gut für die Therapie eignen. Die Sessel sahen bequem aus und würden auch bei längeren Sitzungen keine Haltungsschmerzen auslösen. Außerdem liebte sie Kamine, auch wenn sie nie den Luxus hatte genießen dürfen, einen eigenen zu besitzen.
Sie stellte sich ans Feuer und genoss die Wärme, die davon abstrahlte, während das Holz knackte und einzelne Funken nach oben stoben. Anna schaute zur Tür, danach schlüpfte sie aus ihren Stiefeletten, zog sich die Socken ab und glitt mit den Füßen wieder in die nassen Schuhe. Da vor dem Kamin eine Hitzeschürze stand, drapierte sie die Socken so dahinter, dass diese nicht auffallen würden. Sie wusste nicht, ob sie in ihrem Wäschekorb, der die Habseligkeiten ihres gesamten Lebens barg, ein weiteres Paar dabeihatte, doch zumindest wollte sie heute Abend wieder trockene Füße haben.
Anna zog ihr Handy aus der Tasche und prüfte ihre Nachrichten. Außer den Mitteilungen von der Uni gab es sonst nichts. Ihr Freund hatte sich nicht gemeldet, ihr keine reuige Nachricht geschickt und klargestellt, dass er einen Fehler gemacht hatte.
Vernan kam zurück. »Mylady«, sagte er trocken und stellte auf dem niedrigen Couchtisch aus Wurzelholz einen Silberteller mit einem eckigen Kristallglas und einer Flasche Whiskey ab. »Ich habe mir erlaubt, Ihnen den Wildhound 83 Single Malt zu servieren. Er stammt aus der örtlichen Destillerie, deren Besitzer ihn persönlich und regelmäßig zur McMurrough Villa liefert.« Er goss einen Schluck ein. »Ich hoffe, er mundet Ihnen.«
Anna wusste nicht, ob ihre Entscheidung, einen Whiskey zu sich zu nehmen, gut war, da sie eher Wein bevorzugte. Dennoch nahm sie das Glas entgegen und roch. Es lag eine malzige Note über dem Gesöff und das erste Nippen war weit weniger grauenvoll, als sie es sich ausgemalt hatte.
Vernan schnappte sich einen Schürhaken von der Wand und spießte ihre Socken hinter der Hitzeschürze auf.
Obwohl Anna das wohlige Brennen des Alkohols in ihrer Kehle und anschließend im Magen genoss, wuchs das Gefühl, bei einer Peinlichkeit ertappt worden zu sein. Sie hoffte, dass er die Schamesröte in ihrem Gesicht aufgrund des Feuerscheins nicht so leicht erkennen würde.
»Mylady, bei Strümpfen mit hohem Polyesteranteil rate ich zu mehr Abstand vom Kamin«, bemerkte er und steckte den Haken am Griff in eine Fuge zwischen der Kamineinmauerung. »Mit diesem Abstand kann ihre Bekleidung besser trocknen und gerät nicht in Gefahr, zu verbrennen.«
Anna wusste nicht, was sie davon halten sollte. War das eine herablassende Bemerkung oder wollte er ihr tatsächlich dabei helfen, trockene Füße zu bekommen? »Danke, Vernan, das ist nett von Ihnen«, sagte sie unsicher.
»Sehr gerne. Für die Schuhe würde ich zunächst das Ausstopfen mit Zeitungspapier und für die Restfeuchtigkeit einen Schuhspanner empfehlen. Das Trocknen an der Feuerstelle würde das Leder zäh und brüchig werden lassen. Wenn Sie möchten, stellen Sie später Ihre Schuhe einfach vor Ihre Zimmertür, das Hausmädchen wird sich darum kümmern.«
Langsam verstand Anna, dass der Mann es ernst meinte und sie nicht auf den Arm nahm. »Das wäre sehr nett. Ach, ist es möglich, dass ich diesen Raum für meine Arbeit nutzen kann?«
»Natürlich, Mylady. Ihnen steht jeder Raum samt Reitstall und Gesindehaus zur Verfügung, alles, bis auf das Gemach von Lady McMurrough. Außerdem gibt es Verpflegung. Die Hausdame, Isabella, stellt Ihnen im Esszimmer Mahlzeiten bereit, Frühstück um 9:00 Uhr, Abendessen um 20:00 Uhr. Getränke können Sie jederzeit ordern und die Zimmer werden jeden Tag gesaugt und gereinigt.«
Anna fühlte sich wie im Luxusurlaub, den sie nie gehabt hatte. Getränke inklusive, Housekeeping und eine Ausstattung wie im Four Seasons Hotel. Es war zwar keine Klinik, doch es war eine Atmosphäre, in der sich zumindest entspannt arbeiten lassen würde.
»Lady Caffrey, haben Sie Gepäck im Wagen?«
»Ja.«
»Ich kann es für Sie holen.«
Wieder so ein Luxusangebot, allerdings musste sie ablehnen, da ihr der Wäschekorb irgendwie peinlich war. »Danke, das mache ich morgen früh selbst. Können Sie meinen Patienten bitte Bescheid geben, dass ich sie alle drei hier in einer Stunde zum Kennenlernen erwarte?«
»Sehr gerne, Mylady«, erwiderte Vernan und verschwand.
Anna holte ihr Notebook heraus, legte es zusammen mit den Akten auf den Tisch und fuhr das Programm hoch. In den Sekunden, die es brauchte, checkte sie noch einmal ihre Nachrichten auf dem Handy. Noch immer gab es nichts Neues von ihrem Freund.
Als ihr Computer bereit war, öffnete sie ein Fenster und gab die Grunddaten des Projekts in die Eingabefelder ein.
Nach einer Weile hatte sie für jeden der drei eine digitale Akte angelegt und las die E-Mail ihres Doktorvaters:
Hallo Anna,
ich hoffe, Sie sind gut angekommen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Projekt. In dem Universitätszimmer, wo Ihr Schreibtisch steht, gab es einen Wasserschaden, eine Leitung in der Wand ist geplatzt. Ihre Tischnachbarin hat all Ihre Sachen in Sicherheit gebracht. Die drei Kartonboxen stehen jetzt bei mir, hinter dem Bücherregal.
Also, bis bald.
Anna ließ die Schultern hängen. Ein Wäschekorb und drei Kartonboxen – zu mehr hatte sie es bislang nicht gebracht. Sie wollte antworten, als sie das Knarzen von Treppenstufen vernahm.
Sie richtete sich die weiße Bluse, bis sie den Duft nach nassem Hund wahrnahm. Sie stand schnell auf und ließ die Socken vom Schürhaken in ihrer Strickjackentasche verschwinden. Keine Sekunde zu früh.
»Hi«, sagte ein schlaksiger, junger Mann, dem der erste Oberlippenbart spross. Er zog sich die Kapuze vom Parka und dann die von seinem Hoodie herunter und wischte sich das lockige Haar aus der Stirn.
Anna ging zu ihm, lächelte und gab ihm die Hand. »Ich bin Anna Caffrey, Psychotherapeutin, und als Doktorandin an der Dublin University tätig, Genderstudies. Schön, dass Sie hier sind und an diesem Projekt teilnehmen.«
Der Junge musterte sie kurz. »Ich bin Declan Shannahan, Schüler der Abschlussklasse.«
Als er sich an der Wange kratzte, erkannte Anna, dass alle seine Fingernägel abgekaut waren. Sie mutmaßte, dass er unter hoher Anspannung stand, die wahrscheinlich mit seinen Angstzuständen zusammenhing, die in der Akte erwähnt wurden.
»Denken Sie, dass Sie mir helfen können?«, wollte er wissen.
»Ja, deswegen bin ich hier. Nehmen Sie ruhig Platz. Da Sie der Erste sind, können Sie sich einen beliebigen aussuchen.«
Declan sah sich um und setzte sich auf die Couch gegenüber dem Eingang, sodass er die Wand hinter sich hatte.
Anna hatte das erwartet. Declan schien jemand zu sein, der alles im Blick haben und niemanden hinter sich wissen wollte. Er schien ein klassischer Einzelgänger zu sein. »Gut, dann …« Bevor sie weiterreden konnte, kam eine junge Frau herein und ließ sich auf die Couch gegenüber von Declan sacken. Mit ihrem Mantel, dem Top und der Lederhose, die so wie ihr Make-up und ihre Haare rabenschwarz waren, wirkte sie wie ein vampirisches Chamäleon auf dem dunklen Möbelstück. Einzig ihre blasse Haut und die eine giftgrün gefärbte Haarsträhne stachen aus der Dunkelheit ihrer Erscheinung hervor. Die silbernen Totenkopfringe auf ihren Fingern glänzten, als sie ihren Bobschnitt richtete.
Mit einem Gesicht, dem jegliche Emotion fehlte, nickte sie kurz zur Begrüßung. Nicht mit dem Kopf nach unten, sondern nach oben, wie es jene taten, die ihr Haupt vor niemandem beugten.
»Ich bin Anna Caffrey, Psychotherapeutin, und als Doktorandin an der Dublin University tätig. Schön, dass Sie hier sind und an diesem Projekt teilnehmen. Es ist für Sie kostenlos, da die Psychological Daily für alles aufkommt. Und Sie sind …?«
»Hier.« Die Antwort war flapsig.
»Sie sind Kay McLennan, nehme ich an?«
»Und ich nehme an, dass Sie eine Versagerin sind.«
Anna war wie vor den Kopf gestoßen, dennoch hatte sie gelernt, sich nie vor Patienten Blöße zu geben und jede Äußerung zu nutzen, um hinter die Beweggründe jeglicher Bemerkung zu gelangen. »Wie kommen Sie darauf?«
»Da vorne liegt ein Stapel mit Akten, in denen wahrscheinlich alles über mich drinsteht, was Sie wissen müssen. Dennoch wollen Sie von mir erfahren, wer ich bin – erstens. Zweitens, Sie sind in den Dreißigern und tragen keinen Ehering. Drittens, aus Ihrer Tasche schaut ein Paar Socken hervor, die wahrscheinlich so nass wie Ihre billigen Schuhe sind, und viertens, Sie sind nun die sechste beschissene Psychologin, die versucht, mich zu therapieren, wobei das Ausbildungslevel mit der Wahrscheinlichkeit der Behandelbarkeit meiner Sache gesunken ist. Lassen Sie mich raten: Niemand an der Uni hat sich um die Arbeit mit uns dreien gerissen, oder?«
Anna schluckte innerlich. Dieses junge Ding hätte gut und gerne die zynische Schwester von Sherlock Holmes sein können. Natürlich versuchte Kay, nur ihre Grenzen auszuloten und die Intelligenz ihres Gegenübers abzuschätzen, doch sie hatte gleich mehrere wunde Punkte getroffen und das nur nach ein paar Sekunden der Beobachtung. Anna ließ sich nicht darauf ein, stattdessen erwiderte sie den Angriff mit dem, womit die Patientin nichts anfangen konnte: Gleichmut.
»Danke, Miss McLennan, schön, dass auch Sie Platz genommen haben.«
»Bitte schön«, ätzte sie zurück. »Spielen wir jetzt Vertrauensspiele wie Eisscholle, fallen lassen und aufgefangen werden oder so?«
»Nein, wir warten noch auf …«
»Mick Brennan, hübsche Frau«, vollendete der eintretende junge Mann ihren Satz. Er sah aus wie das Produkt einer unheiligen Ehe zwischen einem Seemann und einem Hipster. Er war wahrscheinlich der einzige Mensch, der eine marineblaue Strickmütze mit einem anthrazitfarbenen Sakko kombinierte. Es hätte lächerlich gewirkt ohne seinen kräftigen Körperbau und sein Lächeln, das wie die Sonne durch seinen feuerroten, gestutzten Vollbart strahlte. Er war das lebende Beispiel dafür, dass nicht Kleider Leute, sondern Leute Kleider ausmachten. Er musterte sie mit einem unverhohlenen Fahrstuhlblick. »Wenn ich gewusst hätte, dass Psychologie so schön sein kann, hätte ich meinen Berufswunsch überdacht.«
Kay lachte auf. »Beruf? Du arbeitest bei deinem Vater im Pub als Barmann und fährst mit gestohlenen Autos in Blumenläden hinein. Da kann man kaum von Beruf sprechen, oder?«
»Vampirella ist wieder mal high, was? Die Welt ist gar nicht mehr so lustig, wenn man sich die Nadel aus dem Arm zieht«, erwiderte er.
»Ich bin eine Goth, du Prolet!«
Anna hob beschwichtigend die Hände. »Wir werden noch genug Zeit haben, um all das zu besprechen. Kennen Sie sich bereits?«
Declan zog sich die Kapuze über den Kopf und roch kurz an dem Whiskey, um ihn gleich darauf wieder abzustellen. »Wir drei sind seit gestern hier, dabei sind wir uns ein paarmal über den Weg gelaufen.«
Anna wollte sich setzen, als sie merkte, dass Mick Brennan sich auf ihren Sessel pflanzen wollte. Das musste sie gleich unterbinden, da dies eine typische Reaktion eines Alphas war, der damit seine Stellung in der Gruppe unterstreichen wollte. »Mr Brennan, würde es Ihnen etwas ausmachen, sich gegenüber dem Tisch zu setzen?« Sie hatte ihre Bitte als Aufforderung betont.
Er hielt inne, drehte sich zu ihr um und verbeugte sich. »God save the Queen.« Dabei schenkte er ihr ein Lächeln, das selbst einen Schelm zurück zur Narrenausbildung an den Hof schicken würde.
Anna nahm wieder in ihrem Sessel Platz, wartete, bis Mr Brennan saß, und schätzte kurz die Dynamik der Gruppe ab. Anscheinend hatten zwei Drittel ihrer Patienten ein Problem mit Autoritäten. Vielleicht war es besser, einen alternativen Weg einzuschlagen und nicht in die ausgewetzte Kerbe zu schlagen, mit der ihre Standeskollegen den Baum nicht hatten fällen können. »Wenn Sie einverstanden sind, nutzen wir das Sie mit unseren Vornamen.«
Keiner erwiderte etwas.
»Gut«, begann Anna. »Wie Kay bereits erkannt hat, habe ich Ihre Akten gelesen. Anscheinend konnte Ihnen nicht einer meiner Kollegen helfen, Ihre Störungen zu überwinden. Ich bin nicht meine Kollegen und Ihnen bietet sich hier eine einmalige Gelegenheit, sich selbst mit meiner fachlichen Unterstützung zu erforschen.«
»Ich erforsche mich auch gerne … und andere«, grätschte Mick dazwischen.
»Wie schön, dass Sie uns das mitgeteilt haben, Mick. Also, zurück zu unserem Projekt, bei dem wir die Technik des Flooding einsetzen werden. Dabei werden Sie dem größten Auslöser Ihrer Angst direkt ausgesetzt, was zu einer Reizüberflutung führen und ihre Sinne so überladen soll, dass Sie so etwas wie einen Reset erleben. Und ich muss Sie auch gleich darauf hinweisen, dass dies nicht so einfach abläuft wie die Gesprächstherapie, die sie alle bereits kennen. Ich möchte, dass wir uns jeden Abend hier treffen, eine Stunde vor dem Essen. Dabei werden wir unsere Sitzungen als Gruppe führen. Je nach Fortschritt, werden wir das Ganze mit Ausflügen zu besonderen Orten ergänzen, wo sie das Flooding erleben sollen, um somit das Besondere …«
»Besonders? Was wollen Sie damit andeuten, dass wir nicht normal sind? Wollen Sie jetzt auch das Wort wahnhaft verwenden, das mir gerne angehängt wird?«, fragte Kay gereizt.
»Sie alle stammen von unterschiedlichen Orten aus Irland. Sie werden von Albträumen und Schlaflosigkeit geplagt und haben in ihren vorherigen Therapiesitzungen beschrieben, dass sie nachts Bilder von bestimmten Begebenheiten quälen. In Killarney gibt es Plätze, die ihren Schilderungen sehr nahekommen, weshalb das Ganze hier stattfindet. Es ist nicht mein Job, zu prüfen, ob Ihre Schilderungen der Realität entsprechen oder wahnhaft sind. Es geht nur um die Konfrontation. Außerdem ist Wahn per Definition nichts anderes als eine irrige Annahme, der man zu viel Bedeutung bemisst.« Sie nahm sich drei Bögen aus der Akte und schob jedem einen über den Tisch zu. »Bitte lesen Sie sich in Ruhe noch einmal alles durch, danach unterschreiben Sie. Da die Konfrontationstherapie nicht ungefährlich ist, geht es um den Haftungsausschluss.«
»Ein Freibrief zur Körperverletzung, total praktisch«, bemerkte Mick. »Wenn ich das nächste Mal jemandem eine verpasse, lasse ich ihn so ein Ding ausfüllen. Hatte ich so was nicht schon bei meinem Psychodoc unterschrieben?«
»Ja, das stimmt. Sie haben eingewilligt, dass Ihr jeweiliger Psychologe für Sie nach einer anderen Maßnahme suchen darf, einer, die einen anderen Ansatz verfolgt. Allerdings müssen Sie sich noch einmal gesondert mit unserem Vorhaben hier einverstanden erklären.«
Alle drei unterzeichneten das Dokument.
»Nun gut, meine Dame, meine Herren, wir starten morgen Abend mit der ersten Sitzung. Kommen Sie um 18:00 Uhr hier in dieses Zimmer. Bis dahin können Sie sich frei beschäftigen.«
Declan war der Erste, der aufstand. Er zog sich die Kapuze an den Schnürsenkeln so weit zu, dass nur noch ein Loch für sein Gesicht blieb, und dampfte ab. Mick hing sich an ihn dran, legte ihm die Hand auf die Schulter und flüsterte ihm etwas zu, während sie fortgingen.
»Dieser Mick ist ein Arsch!«, bemerkte Kay und starrte ihm Speere in den Rücken. »Wie lange müssen wir das hier durchziehen?«
»Einen Monat, das geht schnell vorbei.«
Kay schüttelte den Kopf und rauschte ab.
Vernan schritt an ihr vorbei und kam herein. »Lady Caffrey, Ihr Zimmer ist bereit, soll ich es Ihnen zeigen?«
»Ja, bitte«, sagte Anna und begleitete Vernan die Treppe hoch. Ihr Füße schmatzten geräuschvoll in den nassen Stiefeletten.
Am Ende eines langen Flurs schloss Vernan eine Tür auf, schaltete das Licht ein und übergab ihr den Schlüssel. »Die Handtücher und die Seifen sind frisch. Einen schönen Abend, Mylady.« Er verneigte sich und ließ sie allein.
Anna machte die Tür zu und freute sich über den Anblick des Himmelbetts, das unter einer verzierten Stuckdecke stand. Schwere Brokatvorhänge, die links und rechts an der Wand gerafft waren, säumten das Fenster, vor dem ein kleiner Schreibtisch mit Stuhl stand. Die Tapeten an den Wänden zeigten florale Muster in Frühlingsfarben auf grünem Untergrund. Sogar die Tür zum Bad war tapeziert.
Sie legte ihr Notebook und die Akten auf dem Tisch ab und öffnete die Tür zum Badezimmer, dessen Anblick ihre wildesten Fantasien bestätigte. Alle Armaturen waren golden und die Wanne stand frei, mitten im cremefarben gekachelten Raum. Obwohl sie noch etwas an der Dokumentation arbeiten wollte, drehte sie das Wasser auf, fand ihre Wunschtemperatur und goss etwas von der Badelotion hinein, die am Waschbecken stand. Es duftete herrlich nach Rosenessenz.
Sie setzte sich an den Rand der Wanne und schaute auf ihrem Handy nach der Uhrzeit. Es war 22:30 Uhr. Fast unwillentlich glitt ihr Zeigefinger auf den Nachrichtenchat mit ihrem Freund … oder Ex? Es fiel ihr schwer, in diesen Kategorien zu denken, da der Bruch zu schnell und abrupt gekommen war.
Sie begann zu tippen. »Hi Jeff, ich wollte nur«, dann verwarf sie die Nachricht und begann erneut. »Wollen wir nicht über alles reden?« Sie verwarf den Text erneut. Was konnte man schreiben, wenn man Antworten auf so viele Fragen suchte, sich aber nicht kleinmachen wollte?
Sie legte das Handy zur Seite und wollte sich ausziehen. Dabei fiel ihr ein, dass das Hausmädchen ihre Schuhe mit Zeitung trocknen würde. Sie zog sie aus und stellte sie vor die Zimmertür. Danach entkleidete sie sich und stieg in die Wanne, die noch nicht einmal zur Hälfte voll war. Die Wärme des Wassers fühlte sich unendlich gut an. Sie nahm sich einen Waschlappen von der Ablage, tauchte ihn ins Wasser und legte ihn sich aufs Gesicht. Egal, was dieses Projekt bringen würde, wenn ihre Abende so ausklingen konnten, war es gar nicht schlecht.
»In meiner gesamten Dienstzeit bei den McMurroughs bin ich stets allen Gästen mit Höflichkeit begegnet. Außer einem, der es wagte, Eiswürfel in einen Single Malt Whiskey zu geben.«
Vernan Doyle, einziger Satz seiner Rede zu seinem zwanzigsten Dienstjubiläum
2 So läuft das hier
Anna Caffrey
Anna rieb sich noch den Schlaf aus den Augen, als sie in den lichtdurchfluteten Speisesaal trat, der nach Kaffee roch. Es war ein Wintergarten, in dem mehrere Bistrotische mit weißer Decke und Holzstühlen standen. Jeder Platz war mit glänzendem Besteck und feinen Porzellantellern mit Goldrand eingedeckt. Auf der anderen Seite stand eine lange Anrichte mit Frühstücksspeisen. Dampf drang aus silbernen Warmhalteschalen, die neben Brotkörben mit Toast, einem Arrangement aus Teebeuteln und Marmeladen sowie mehreren Kannen Kaffee standen.
Anna nahm sich einen Teller und klappte die Deckel der Schalen auf. Sie bediente sich an den Bohnen und Würstchen darin, griff sich zwei Stücke goldbraunen Toast und schenkte sich Kaffee ein. Mit ihrem Frühstück setzte sie sich ans Fenster und blickte aus den Glaskacheln der großen Sprossenfenster. Draußen, auf der Terrasse, standen schmiedeeiserne Stühle und Tische auf dem gepflasterten Boden. Dahinter schloss eine grüne Wiese an, die einen Hügel zu Bäumen und Büschen hinaufführte. Anna vermutete, dass dahinter der Lough Leane lag, an dessen Ufer die Ausläufer der Stadt Killarney grenzten.
Sie nahm einen Schluck Kaffee, der zwar etwas stark war, sich aber dennoch schwarz trinken ließ. Danach belegte sie ihren Toast mit Bohnen und biss ab. Während sie kaute, füllte allein der dumpfe Klang des Pendels einer antiken Standuhr, die auf der anderen Seite stand, den Raum. Wahrscheinlich war es sonst nicht so ruhig hier, wenn auch andere Gäste da waren. Die Menge an Frühstück, die die Hausdame aufgetischt hatte, reichte für zwanzig Personen. Vielleicht war sie es gar nicht gewohnt, für weniger zu kochen. Andererseits wusste Anna nicht, wie viel Personal hier im Haus arbeitete, was sich ebenfalls bediente. Wie auch immer es sein mochte, sie genoss den Luxus, für einen Moment alles für sich allein zu haben.
»Guten Morgen«, grüßte eine alte Dame, die den Speisesaal betrat. Sie trug ein eisblaues Kleid mit einem dazu passenden Hut mit Netz und einer Rosennachbildung auf der geschwungenen Krempe. Mit ihren weißen Haarsträhnen, die darunter hervorlugten, und ihrer vornehmen Haltung ähnelte sie der englischen Königin. Sie nahm sich einen Kaffee von der Anrichte und setzte sich ohne ein weiteres Wort an Annas Tisch.
»Sie sind gestern angereist, nicht wahr, meine Verehrteste?«, fragte sie vornehm.
Anna fand die ungebetene Nähe etwas dreist, gab sich aber locker. »Ja, gestern Abend. Ich bin Anna Caffrey und komme aus Dublin.«
»Dublin? Dort lebt ein Onkel von mir. Ich bin gerne zu Besuch bei ihm. Sagen Sie, mein Kindchen, sind die Menschen dort noch immer so schrecklich ungepflegt und rüpelhaft?«
Anna überlegte, welch Greis der Onkel sein musste, wenn schon die Nichte nicht mehr taufrisch war. Vielleicht hatte sie ihn schon länger nicht mehr besucht. »Nein, Dublin ist jetzt größer und es kommen Menschen aus aller Welt dorthin.«
»Sogar aus Wales?«
»Ja, Waliser sind auch dort. Aber ich meine noch weiter entfernte Orte.«
»Das alles verändert sich so schnell. Wissen Sie, Kindchen, ich war schon auf der Welt, als Ihr Vater noch klein war.«
»Sind Sie Lady McMurrough?«
»Ach, wo sind meine Manieren? Ja, ich bin Marla und lebe seit meiner Geburt hier vor den Toren von Killarney, das damals nicht mehr als eine Ansammlung von kleinen Häuschen war. Mein Mann ist öfter dort und organisiert Treiber für seine Jagden.«
»Leben Ihre Kinder auch hier?«
»Ach Kindchen, nicht jedem Paar sind Kinder vergönnt. Mein Mann hatte drei Frauen vor mir, doch nicht eine konnte ihm Nachkommen schenken. Ich denke, dass es an ihm selbst liegt. Aber wir haben einen Zögling, unseren Jagdhund Bran, er ist unser Ein und Alles. Wie sieht es bei Ihnen aus, wo leben Sie mit Ihrer Familie?«
Anna hielt ihre rechte Hand hoch und zeigte ihr den nackten Ringfinger. »Ich bin … ledig.« Sie wusste nicht, wieso sie so viel Intimes preisgab, aber die Dame war ihr irgendwie sympathisch.
»Das tut mir leid.«
»Ja, mir auch. Sagen Sie, wie haben Sie beide es geschafft, über so viele Jahrzehnte zusammenzubleiben?«
»Man muss sich Freiräume lassen und einander überraschen können.«
»Überraschen? Das hat mein Ex auch mit mir gemacht, es kam tatsächlich unerwartet. Und das nur, weil ich noch etwas Zeit brauche. Hatten Sie nie den Wunsch, etwas zu werden, mehr aus sich zu machen?«
»Wer in der Grafschaft Kerry in die McMurroughs eingeheiratet hat, steht bereits ganz oben. Ich wüsste nicht, wie ich noch mehr aus meiner Stellung machen sollte.«
Anna schaute die Frau eine Weile an. Die Dame hatte einen alten Kopf, ein altes Denken und noch eine antiquierte Vorstellung von der Welt. Dennoch war sie beneidenswert, da sie auf ihre Art Karriere gemacht und eine Stellung erreicht hatte, die mit Heirat, Familie und Position vereinbar war. Andererseits war sie von ihrem Mann und dessen Wohlwollen abhängig und musste sich immer fügen. Oder war es Anna, die alles falsch sah? Jeder Mensch lebte in seiner eigenen Welt und hatte eigene Wunschvorstellungen von dem, was er im Leben erreichen wollte.
»Kindchen, warten Sie nicht zu lange. Und wenn Sie einen Rat brauchen, können Sie sich gerne an mich wenden. So, ich muss mich jetzt um Bran kümmern, der müsste hier irgendwo faulenzen. Sie haben ihn nicht zufällig gesehen?«
»Nein, ich habe Ihren Hund nicht gesehen.«
Die Dame trank aus. »Einen schönen Tag«, sagte sie und verließ den Speisesaal.
Als Anna aus dem Fenster blickte, sah sie Kay, die mit dem Handy draußen auf und ab lief. Sie sah zornig aus und machte wilde Gesten, während sie telefonierte.
Anna schmunzelte. Jeder Mensch trug sein eigenes Päckchen mit sich herum. Möglich, dass sie diesem Mädchen helfen konnte, vielleicht aber auch nicht. Dabei fiel ihr ein, dass sie langsam ihren Käfer ausräumen musste, da sie das Gefühl frischer Unterwäsche vermisste. Doch vorher wollte sie sich noch ordentlich den Bauch vollschlagen. Im Moment war das Wichtigste der Autotank, dafür musste es einfach reichen. Allerdings gab es auch noch die Kreditkarte der Psychological Daily … Vielleicht war es besser, den Bogen nicht zu überspannen.
* * *
Das Orange der Dämmerung drang durch die Lücken der Wolkenrudel, die über den Himmel zogen. Mit dem niedrigen Sonnenstand dehnten sich die Schatten des Haupthauses über das Gesindehaus und die Stallungen.
Vernan stand an der Seite eines braunen Pferdes und bürstete seine Flanke. Er hielt es mit der Linken am Zügel und arbeitete in ruhigen, gezielten Bewegungen jeden Zoll des muskulösen Körpers ab.
Anna saß in ihrem Käfer und bewunderte Vernan dafür, wie er sich seiner Aufgabe hingab. Sein Handeln strahlte eine Ruhe und Zufriedenheit aus, die alles, was er tat, ganz natürlich wirken ließ, als habe es seine eigene Ordnung. Ganz im Gegensatz zu Anna-Bad-Luck-Caffrey. Auf ihrem Schoß lag das Notebook, auf dem sie ein Konzept für die heutige Sitzung entworfen hatte. Allerdings wollte sie eine Sicherheitskopie auf einem anderen Datenträger erstellen. Schließlich war die Dokumentation das Herzstück eines jeden Projekts.
Sie suchte die Ablagefächer und das Handschuhfach ab. Außer Strafzetteln und einer alten Schachtel mit Zigaretten konnte sie nichts finden. Erst als sie den Beifahrerfußboden absuchte, entdeckte sie zwischen zerknüllten Burgerverpackungen endlich ihren USB-Stick. Sie steckte ihn in die Buchse und legte mehrere Ordner an. Zwischendurch schaltete sie das Radio ein und lauschte den Klängen des Klassiksenders.
Plötzlich fiel ihr ein, dass sie auf diese Weise schon einmal die Batterie des Wagens ruiniert hatte. Ohne laufenden Motor würde sie sich wieder entladen. Sie drehte den Schlüssel im Zündschloss und wollte das Auto starten, doch außer einem Röcheln passierte nicht viel. Auch der zweite und dritte Versuch gingen in die Hose. Anna schaltete das Radio aus, legte das Notebook beiseite und nahm sich eine Kartonbox mit Werkzeug aus dem Kofferraum, der sich bei ihrem Käfer vorne befand. Eine Tatsache, an die sie sich erst hatte gewöhnen müssen. Mit einem Seitenschneider schnitt sie den Kabelbinder an der hinteren Klappe los und öffnete die Motorhaube. »Das bisschen Motor kann sogar eine Frau«, hatte der Mechaniker herablassend gesagt und ihr kurzerhand die Schwachstellen gezeigt, die regelmäßig gewartet werden mussten, damit es nicht wieder zu Startproblemen kam. Sie hatte sich nicht einmal ein Viertel davon gemerkt, doch sie wusste, dass der eine Schlauch vom Filter mit dem Motor verbunden werden musste. Das Strumpfband, das bereits in Fetzen hing, hatte sich gelöst und war in ein bewegliches Teil geraten.
Anna suchte in der Box zwischen Schraubendrehern, Zangen und Schrauben ein Tapetenmesser heraus und schnitt damit die verhedderten Nylonfasern durch, um sie entfernen zu können. Danach startete sie den Anlasser und ging wieder nach hinten zum Motor. Das Teil wackelte in seiner Einfassung und machte Geräusche, die sogar ein mechanischer Laie als untypisch einstufen würde.
»Kein gesunder Sound, Anna. Sie sollten sich ’n neuen anschaffen«, bemerkte Mick, der wie aus dem Nichts neben ihr stand.
»Was? Äh, ja, der ist schon älter. Ich mag Oldtimer«, log sie. In Wahrheit konnte sie sich nichts Besseres leisten und war auf ihren liebens- und hassenswerten Schrotthaufen angewiesen.
»Gut, dass wir uns hier treffen, Anna. Ich muss heute Abend nach Killarney, hab übers Internet ’n Date klargemacht. Man muss den Ort abchecken und so. Daher kann ich heute nich’ kommen.«
Anna fand das gar nicht gut. Sie beugte sich über den Fahrersitz, stellte den Motor ab und lehnte sich gegen den Kotflügel. Sofort kehrte wieder Stille ein, als sei das Wehklagen des Käfers ein Fremdkörper in der Idylle der klanglosen Welt des Anwesens gewesen.
»Mick, Sie sollten das verschieben. Schließlich müssen sich die anderen auch an die Vereinbarungen halten.«
»Die andern können Sie in der Pfeife rauchen, ein verklemmter Schüchterling und eine Drogensüchtige. Ich hab gerade erst meine Sozialstunden abgeleistet und brauch jetzt meine Freiheit, verstehen Sie?«, fragte er und strahlte sie schelmisch an.
»Ich denke, es läuft besser, wenn wir unser Programm durchziehen.«
Ein Schatten glitt über Micks heitere Miene. Er trat dicht an sie heran und blickte auf sie herab, da er größer war. »Nein, ich sage Ihnen jetzt, wie das hier läuft!«, begann er mit erhöhter Stimme. »Ich gehe heute zu meinem Date und Sie tragen schön brav ein, dass ich teilgenommen hab und Sie mir total dabei geholfen haben, ein besserer Mensch zu werden, kapiert?«
Anna wagte kein Wort zu erwidern. In klinischen Projekten hätte es einen kräftigen Pfleger gegeben, der jetzt aufgestanden und die Situation entschärft hätte, doch hier war sie auf sich allein gestellt. Sie schluckte und drehte sich zur Seite, als sie ein Wiehern vernahm.
Vernan hatte beim Bürsten innegehalten und blickte zu ihnen rüber, danach machte er weiter.
Mick schaute zu ihm, dann auf Anna und strahlte wieder, als wäre nur eine Wolke über den heiteren Himmel gezogen.
»Danke, dass Sie mich decken, Anna. Ich komme am Abend oder morgen früh wieder, je nachdem, ob das Foto der Tussi im Internet echt is’.«
Als er über die Auffahrt nach der ersten Kurve hinter den Bäumen verschwunden war, wagte Anna wieder einzuatmen. Erst jetzt merkte sie, dass ihr Herz raste. Es war heftig gewesen, wie er von heiter auf psycho gewechselt hatte. Obwohl sie aus seiner Akte wusste, dass der Richter ihn zu Sozialstunden und einer anschließenden Therapie verurteilt hatte, war sie geschockt von der Art, wie er sich durchgesetzt hatte. Seine Bewährung schien ihn dabei überhaupt nicht zu kümmern.
Es passierte schon wieder – man sagte ihr, wie es zu laufen hatte, und es gab keine Chance, das zu ändern. Es war ihr peinlich, so vorgeführt worden zu sein.
Aus dem Augenwinkel nahm sie wahr, wie Vernan das Pferd in den Stall zurückführte. Zu ihrem Glück hatte seine Gegenwart ausgereicht, um die Situation zu entschärfen.
Sie setzte sich ins Auto und schloss die Tür. Legte die Stirn gegen das Lenkrad und atmete eine Weile durch. Dann richtete sie sich wieder auf, nahm sich die Zigarettenschachtel aus dem Handschuhfach, öffnete die Tür einen Spalt und zündete sich eine davon an. Nicht rauchen, ein Jahr lang, dann ist die Sucht vorbei. Zumindest war das ihr Plan gewesen. Wozu gab es Pläne, wenn das Leben seine eigenen hatte? Es war eine Niederlage, aber eine, die die Sucht etwas dämpfte. Der heiße Qualm strömte in ihre Lungen und linderte den Schmerz ihrer gekränkten Selbstsicherheit.
Ihr Telefon klingelte.
»Anna Caffrey, hallo?«
»Hallo Anna, wie geht es Ihnen?«, begrüßte sie die Stimme auf der anderen Seite der Leitung. »Hier ist Professor Kent. Sind Sie schon in Killarney angekommen?«
»Ja und ich konnte bereits die Patienten kennenlernen.«
»Ah, wunderbar. Wie gefällt Ihnen die Villa?«
»Ist wie im Hotel, ein bisschen ungewohnt. Dr. Kent, denken Sie, ich könnte das Projekt in eine klinische Umgebung verlegen?«
»Nein, Psychological Daily hat das Ganze klar umrissen. Außerdem gibt es weder in Killarney noch in der Nähe eine entsprechende Einrichtung.«
»Könnte ich dann vielleicht einen Pfleger hierher bestellen oder einen Kollegen?«
»Anna, Sie schaffen das auch allein. Ich glaube an Sie.«
»Aber …«
»Ich glaube an Sie«, unterbrach er Anna. »Ich werde Ihre Fortschritte mitlesen, schicken Sie mir diese einfach so oft Sie können. Also, machen Sie’s gut.« Er legte auf.
Anna schüttelte den Kopf. Es war immer dasselbe mit dem Mann. Er besaß die Gabe, jedes Problem so lange zu ignorieren, bis es sich von selbst auflöste. Es war einfach nicht möglich, ein Gespräch mit ihm zu führen, bei dem man der Sache auf den Grund gehen konnte. Obwohl er ihr Doktorvater war, ließ er sie im Stich.
Sie aschte das Türmchen auf ihrer Zigarette ab, nahm noch ein paar Züge und schnickte den Stummel auf den Schotter. Danach legte sie den Stick und die Zigarettenschachtel auf das Notebook und stieg damit aus. Ein kurzer Blick auf ihre Armbanduhr verriet ihr, dass sie nur noch fünf Minuten bis zum Beginn der ersten Therapie hatte.
Anna eilte ins Haus und betrat das Jagdzimmer.
Außer ihr war niemand da.
Sie legte ihre Sachen auf dem Tisch ab und ging ins erste Stockwerk. Dabei begegnete sie Declan, der eine selbst gedrehte Zigarette im Mund hatte. Unter seinen Augen hingen dunkle Ringe und sein Gesicht wirkte zerknautscht.
»Hallo Declan, Sie sehen müde aus, alles in Ordnung?«
Declan fuhr sich durch die Haare, die wie ein Fransenschleier vor seinen Augen hingen. Er nahm die Zigarette in die Hand und machte eine ausholende Geste. »Ich weiß nicht, seit ich hier bin, schlafe ich noch schlechter.«
»Machen Sie sich keine Sorgen, die Therapie wird Ihnen helfen. Sie können hinuntergehen, ich komme gleich nach.«
Während Declan die Treppe hinunterlief, überlegte Anna, in welchem der Zimmer sich Kay befinden mochte. Als sie zurücklief, fand sie zufällig ein umgekehrtes Kreuz, das jemand in den Lack des Türrahmens eingeritzt hatte. Es war kein Kunststück, zu erraten, wer hier sein Domizil bezogen hatte.
Sie klopfte an. »Kay, kommen Sie bitte ins Jagdzimmer.«
Keine Antwort.
Sie klopfte erneut.
Vernan kam die Treppe hoch. Er balancierte ein kleines Teeservice auf seinem Silbertablett und nickte ihr zu. »Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit, Lady Caffrey?«
»Ja, alles gut. Wissen Sie zufällig, wo Miss McLennan ist?«
»Sie hat ihr Zimmer heute noch nicht verlassen«, antwortete er und lief an ihr vorbei zu einem der anderen Zimmer.
Anna donnerte mit der Faust gegen die Tür. »Kay?«
»Ja, was ist denn!?«, drang Kays Stimme nach außen.
»Wollen Sie nicht herunterkommen?«
»Wenn Sie mich so fragen, dann nein.«
»Declan ist auch schon da, wir warten auf Sie.«
»Und Mick?«
»Der ist für heute entschuldigt.«
»Aha, ist doch Quatsch! Der macht, was er will, so sieht es aus, Sie haben versagt.«
Anna biss sich auf die Unterlippe und verkniff sich ein kindisches stimmt doch gar nicht. Wie sollte eine Gruppenbehandlung funktionieren, wenn nur eine Person daran teilnahm? Während sie mit ihren Nägeln an dem Kreuz auf dem Türrahmen herumkratzte, überlegte sie sich einen anderen Ansatz. »Seit wann sind Gothic-Leute Satanisten?«
»Was?«
»Hier auf dem Türrahmen ist ein umgekehrtes Kreuz eingeritzt. Ich denke nicht, dass Lady McMurrough mit diesem Vandalismus einverstanden sein wird und …«
Bevor sie aussprechen konnte, riss Kay die Tür auf, suchte den Rahmen ab und presste die Lippen zu einem Schlitz aufeinander. »Dieser bekloppte Mick, was glaubt der, wer er ist?«
»Die Schnitzerei ist von ihm?«, wollte Anna wissen.
»Von wem denn sonst?«
»Also?«
»Also was?«
»Kommen Sie jetzt hinunter?«
»Das Jugendamt ruft mich gleich zurück, die wollen mir meinen Sohn nicht zurückgeben und haben den bescheuerten Richter auf ihrer Seite. Und das alles nur, weil mein Ex behauptet, ich hätte einen Rückfall! Ich habe jetzt keinen Kopf für so Psychosachen.«
Anna wollte etwas erwidern, doch die Worte blieben ihr im Hals stecken, als die Tür so dicht vor ihrer Nase zuknallte, dass sie diese mit ausgestreckter Zunge hätte berühren können.
»Lassen Sie mich in Ruhe!«, schallte es von drinnen.
Anna machte einen Schritt zurück und fasste sich an die Nase, nur um sicherzugehen, dass sie nicht gebrochen war. Langsam lernte sie dieses Projekt zu hassen. Die Patienten waren keine jungen Erwachsenen, sondern Kinder, die tobten und rebellierten. Keine andere Psychologin würde sich ganz allein solch einer Aufgabe stellen, da es nichts anderes als lebensgefährlich war. Das passte mal wieder zu ihrem Bad Luck, zu ihrem Pech, das wie Teer an ihr klebte, egal was sie dagegen tat. Ihre Lungen verlangten nach einer Zigarette, nein, nach zwei und einer für zwischendurch. Obwohl sie einen Monat Zeit hatte, wurde ihr klar, dass sie den gesamten Ablauf des Projekts ändern musste. Zumindest hatte sie Declan, der wahrscheinlich unten wartete. Solange sich die anderen verwehrten, würde sie eine Einzeltherapie mit ihm machen und die Fortschritte dann später unter den Gruppensitzungen subsummieren.
Anna stieg die Treppe hinunter und betrat das Jagdzimmer.
Von Declan keine Spur.
Auf der Suche nach ihm ging sie in den Speisesaal. Die Tische waren bereits für das Abendessen eingedeckt.
Durch das Fenster konnte sie Declan sehen, wie er draußen auf der Terrasse saß und rauchte. Die Art und Weise, wie er den Qualm einsog und die Zigarette hielt, verriet ihr, dass es kein Tabak war, den er so leidenschaftlich rauchte. Mit bekifften Menschen ließen sich keine Sitzungen abhalten, daher war die Sache für heute gelaufen.
Sie ging zu ihm nach draußen und setzte sich ihm gegenüber auf einen schmiedeeisernen Stuhl. Die Beine kreischten unter ihrem Gewicht, als sie ihn mit ihrem Hintern zurechtschob.
Declan machte große Augen und hielt den Joint hinter seine Rückenlehne.
»Ist schon gut, Declan, früher habe ich das Zeug auch geraucht.«
»Echt?«, fragte er verwundert und atmete erleichtert Rauch aus.
»Ja, das ist heute keine große Sache mehr.«
»Machen wir noch die Sitzung?«
»Nein, die fällt heute ins Wasser.« Sie zündete sich eine Zigarette an und nahm einen tiefen Zug. Sofort beruhigten sich ihre Nerven. Die Psychologin in ihr bewarf sie mit lateinischen Fachbegriffen für ihr Verlangen, tobte sich in den triebgesteuerten Theorien von Sigmund Freud aus, wurde dann aber brachial von ihrem inneren, kleinen Kind von hinten erschlagen.
Sucht war brutal angenehm.
»Das Marihuana tut mir gut, gegen die Albträume. Ich will mal probieren, ob ich das verschrieben bekomme«, sagte Declan. Mit Zeigefinger und Daumen hielt er den Joint, wie mit einer Pinzette, während die Spitze unter seinem Zug aufglühte. Declan inhalierte tief, blies langsam aus und aschte ab. »Ich hasse Irland. Grüne Wiesen, so weit das Auge reicht. Auf einer Butterpackung sieht das toll aus, das war’s aber auch schon. Es gibt keine Sandstrände. Stattdessen Regen, Regen und bei gutem Wetter Graupelschauer. Und dieser Himmel … eine Marmorplatte auf meinem Grab. Nachts, wenn ich wach bin, denke ich, wie es wäre, wenn ich am Strand liegen würde, eine kühle Brise über meine Haut streicht und die Hitze des Tages fortträgt. Und das Beste daran wäre, dass ich ohne Angst die Augen schließen und so tief schlafen würde, dass ich am nächsten Mittag in meiner Liege aufwachen, mich umdrehen und weiterschlafen würde. Keine Ahnung, ob andere Menschen verstehen, was für ein Luxus der Schlaf ist. Und wie es sich anfühlt, sich davor zu fürchten, wieder eine Nacht im Schlaf-Wach-Kampf verbringen zu müssen.« Er aschte wieder ab.
Anna betrachtete Declan. Seine Augen waren gerötet und er redete mehr, als er wahrscheinlich wollte. Er war high. Doch vielleicht war dies die einzige Möglichkeit, die Therapie zu beginnen. Schließlich oblag ihr das Verfassen des Berichts und sie würde hinterher den Zustand ihres Patienten als bewusstseinsklar beschreiben.
»Erzählen Sie mir von Ihren Träumen«, forderte sie.
Declan reichte ihr den Joint.
Anna lehnte ab.
Doch Declan ließ nicht ab und bot ihr weiterhin an, mitzurauchen. »Ist mehr Tabak drin als Marihuana, das knallt nicht so sehr, wie Sie denken, keine Sorge.«
Anna ahnte, dass sie als ehemalige Kifferin seinen Respekt erhalten hatte. Jetzt abzulehnen, würde ihren kleinen Erfolg zunichtemachen. Wieder ließ sie sich überreden, umstimmen und zu etwas bewegen, was sie eigentlich nicht wollte.
Sie trat ihre Zigarette auf dem Boden aus, griff nach dem Joint und nahm einen Zug. Den filterlosen Tabakrauch war sie nicht mehr gewohnt, es kratzte in ihrem Hals, doch nach einem kurzen Huster ging es wieder. Sie gab wieder an Declan ab und spürte die erste Wirkung. Ihr Körper fühlte sich schwerer an, aber auch lockerer.
Declan atmete durch, bevor er sprach. »Ich war schon immer ein Sonderling, ein Außenseiter. Meine Mitschüler haben mich immer gequält, weil ich so ein Loser bin. Eines Tages haben sie mich nach dem Schwimmunterricht im Becken abgepasst. Der Lehrer war mit anderen Schülern im Umkleidebereich. Zwei Jungs kamen zu mir ins Wasser und versuchten, mich hinunterzudrücken. Ein Dritter stand am Beckenrand und trat mir auf die Hand, mit der ich mich festgekrallt hatte. Sie lachten und ahmten meine Hilfeschreie mit Babystimme nach. Als mich die Kraft verließ, wurde ich unter Wasser gedrückt, so lange, bis ich das Bewusstsein verlor.« Declan erzählte mit tonloser Stimme, als wäre diese Episode ein Film auf einer alten VHS-Kassette, die er so oft gesehen hatte, dass die Ränder bereits fleckig waren.
Anna stutzte. »Waren Sie tot?«
»Keiner weiß, wie lange das war, aber ja.«
»Und dann, Declan, was ist dann passiert?«
»Ich wachte auf und blickte auf den bärtigen Schwimmlehrer, der mit panischem Gesichtsausdruck über mir kniete. Er schlug mir ein paarmal auf die Wange und kreischte immer wieder meinen Namen. Die anderen Vierzehnjährigen standen alle im Kreis um mich herum, als wären sie Eisskulpturen. Unter mir fühlte ich den harten Fliesenboden, nass und kalt.« Declan inhalierte noch einmal und warf den Stummel auf den Boden. »Danach wurde ich nie wieder fertiggemacht, was noch schlimmer war. Alle haben einen Bogen um mich herum gemacht, als wäre ich ein Alien oder so. Ich war tot und doch lebte ich wieder. Der Zombie, so nannten sie mich.«
»Was haben Sie erlebt, als Sie tot waren?« Annas Zunge fühlte sich träge und dick an.
»Es … es war so unfassbar. Ich war in einem Tunnel und lief auf dieses Strahlen zu, das warm und gut war. Kein Schmerz, keine Kälte, keine Sorgen; alles war von mir abgefallen, als sei es nur ein Gedanke an eine schlechte Welt gewesen, ein Echo aus der Ferne, das verhallte. Aber da war noch mehr, die Kälte kam zurück, schluckte mich, klatschte wie Wasser über meinem Kopf zusammen. Als ich auftauchte, stand ich vor einem Ufer, das mit Schilf bewachsen war. Der Himmel über mir war grau und leblos und vor mir stand dieser Turm am Wasser, der wie der abgebrochene Zahn eines Riesen aussah.«
Ob wahnhaft oder nicht, war es wirklich eine gute Idee, Declan mit einem ähnlichen Gebäude zu konfrontieren? Man konnte nicht abschätzen, was mit seiner Psyche und seinem körperlichen Befinden passieren konnte, wenn die Begegnung stattfand. Sie wollte sich Notizen dazu machen, ihr Notebook holen und einen Sitzungsbericht schreiben, doch ihr Gehirn fühlte sich bereits wie eine Murmel an, die in ihrem Kopf voll zähflüssigem Honig bei jeder Bewegung träge hin und her rollte.
Anna ließ sich in ihren Stuhl sinken und legte den Kopf an die Rückenlehne. Sie hatte Hunger, wollte etwas Süßes, träumte von Pancakes und Zimtschnecken vom Bäcker. Sie beschloss, sich noch etwas vom Abendessen, das das Hausmädchen bereits klappernd hinter ihr im Speisesaal vorbereitete, mit aufs Zimmer zu nehmen und den Tag genüsslich mit einem Vollbad enden zu lassen.
»Mein Mann war stets begehrt unter Frauen. Er hatte Charme und einen knackigen Po. Eines Tages hat ihm meine Freundin schöne Augen gemacht. Ich habe ihr zehn Sekunden Vorsprung gegeben, bevor ich die Flinte geholt und sie zum Teufel gejagt habe.«
Lady McMurrough, Memoiren einer Dynastie, Kapitel 6, »Edelfrauen schlafen nicht – sie wachen«
3 Begegnung mit der Angst
Anna Caffrey
Anna eilte die Treppe hinunter zum Speisesaal. Nach dem Drogenerlebnis von gestern Abend hatte sie so tief geschlafen, dass sie nun fast zu spät zum Frühstück kam.
Als sie den Saal erreichte, erblickte sie die Hausdame Isabella an der Anrichte. Sie wischte sich die Hände an der weißen Schürze sauber, die sie über ihrem geblümten, erdbraunen Kleid trug. Eine Strähne ihres silbrig blonden Haars hatte sich unter der Kopfhaube gelöst und hing über ihre mit Sommersprossen bedeckte Stirn, während sie die Stecker der Warmhalteboxen aus der Wand herauszog.
»Guten Morgen, bin ich zu spät für das Frühstück?«, fragte Anna mit einem entschuldigenden Gesichtsausdruck.
Isabella warf ihr einen scharfen Blick zu, den nicht einmal die Grübchen ihrer pausbackigen Wangen abmildern konnten. Es war ihr anzumerken, dass sie diesen Satz nicht das erste Mal hörte. »Machen schnell bedienen«, antwortete sie mit russischem Akzent. »Ich abräumen dann später.« Sie ließ von dem Gerät ab und lief aus dem Saal.
Anna war erleichtert, da ihr Magen knurrte und sie unbedingt die Gratisverpflegung nutzen wollte. Als sie sich kurz umschaute, sah sie auch Declan, der über einem Teller Rührei mit Speck saß. Hinter ihm, draußen auf der Terrasse, lief Kay auf und ab, während sie aufgeregt in ihr Handy plärrte.
Zwei von drei, dachte Anna und nahm sich Toast, Butter und Kaffee. Sie wollte einen Platz zum Sitzen suchen, als ihr Declan den Sitz an seinem Tisch anbot.
»Hier ist noch frei, Anna.«
Sie war froh über sein Angebot, da sie nun wusste, dass sie einen Zugang zu ihm aufgebaut hatte, der hoffentlich auch ohne Marihuana halten würde.
Declan