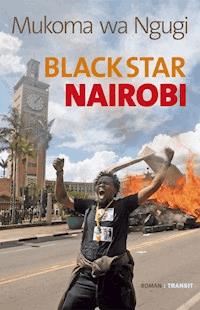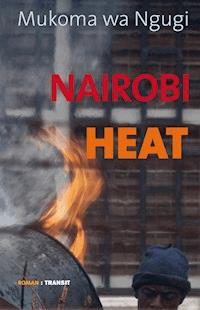
17,99 €
Mehr erfahren.
In einem reichen, weißen Vorort von Madison/Wisconsin wird eine junge blonde Frau tot aufgefunden. Das Haus, vor dem die Tote liegt, gehört einem afrikanischen Professor, der für seine Rettungstaten während des Völkermords in Ruanda weltweit als Held verehrt wird. Der schwarze Detective, der in dem Fall ermittelt, fliegt aufgrund eines mysteriösen Anrufs nach Nairobi, Kenia, wo er zusammen mit seinem afrikanischen Kollegen der Vergangenheit des Professors auf die Spur kommen will. Schnell wird klar, dass es hier um viel mehr geht als den Tod eines weißen Mädchens. Es entwickelt sich eine heiße Jagd in einem Sumpf von Korruption, Intrigen und Gewalt. Gleichzeitig ist es auch die Konfrontation des Detectives aus den reichen USA mit Afrika, seiner Geschichte und Kultur, und nicht zuletzt mit der eigenen Identität…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
© Mukoma wa Ngugi, 2008© für die deutsche Ausgabe 2014 by Transit Buchverlag Postfach 121111 | 10605 Berlin www.transit-verlag.de
Originaltitel: Nairobi Heat Melville, New York 2008
Layout und Umschlaggestaltung unter Verwendungeines Fotos von ato2dp, Gudrun Fröba, BerlinFoto des Autors: © Africanwriter.comeISBN 978 3 88747 303 7
Mukoma wa Ngugi
NAIROBI HEAT
Vom Autor von Black Star Nairobi
Aus dem amerikanischen Englisch von Rainer Nitsche
INHALT
EINE SCHÖNE BLONDE WAR TOT
WO TRÄUME STERBEN
LORD THOMPSON
EHER WÜRDE ICH SCHMUTZIGES WASSER TRINKEN
WAS IST EIN SCHLECHTES GEWISSEN WERT?
DER WEG ZUR HÖLLE UND ENTHÜLLUNGEN
NEBELWÄNDE UND ANDERE VERBRECHEN
LASS DIE TOTEN DIE TOTEN BEGRABEN
THE AFRICAN CONNECTION
Anmerkungen
EINE SCHÖNE BLONDE IST TOT
Eine schöne Blonde war tot, und der Verdächtige, mein Verdächtiger, war ein Afrikaner. Ich war auf dem Weg nach Afrika auf der Suche nach seiner Vergangenheit. Je nachdem, was ich rausfand, wäre er geliefert oder ein freier Mann. Wie Sie sich denken können, war die Sache ziemlich dringend.
Wie oft hatte ich über Afrika nachgedacht? Nicht sehr oft, fürchte ich. Ja, ich wusste was von Afrika. Schließlich war es das Land meiner Vorfahren; ein Land, nach dem ich mich irgendwie sehnte, ohne wirklich dahin gehören zu wollen. Ich könnte es auch so sagen: Die amerikanische Seite in mir hielt es für das Land der Kriege, des Hungers, der Krankheiten und des Drecks, auf der anderen Seite war es meine schwarze Haut, die mich dorthin zog. Wie oft also hatte ich an Afrika gedacht? Nicht oft, nicht wirklich.
Trotzdem war es eigenartig, dass ich mich jetzt, im Flugzeug auf dem Weg nach Afrika, von Weißen geradezu umzingelt fühlte: die Passagiere, die Kabinencrew, die Piloten. Es war Anfang Mai, und, wie ich aus Gesprächen um mich herum mitbekam, waren meine Mitreisenden Geschäftsleute, Touristen und Jäger aus Texas. Das Übliche, vermutete ich.
Ich schaute nach draußen, sah den Vollmond auf der Spitze der Tragfläche schweben, und mit kindlicher Phantasie konnte man sich vorstellen, er hätte sich gerade einen Freiflug besorgt. Wir flogen so, mit dem Mond auf dem Flügel, eine ganze Weile, bis uns der Pilot in jenem einwandfreien englischen Akzent, den wir alle mit absoluter Effizienz verbinden, die bevorstehende Landung ankündigte.
Der Mond hüpfte in den Himmel zurück, als wir die Wolken durchstießen, und unten erblickte ich eine Insel voller Lichter, umgeben von absoluter Dunkelheit. Dann landeten wir und alle klatschten. Ich war müde und leicht angetrunken von dem zweiten Budweiser, das die Crew mir angeboten hatte, und so, ein bisschen beschwipst, betrat ich zum ersten Mal Afrika.
Am Zoll zeigte ich kurz meinen Pass und den Dienstausweis. Der Beamte schenkte nicht einmal meinem Waffenschein einen zweiten Blick, schüttelte nur seinen Kopf und sagte: »Ihr Amerikaner, ihr seid vernarrt in eure Waffen, eh?« Dann winkte er mich durch.
Ich hatte nichts dabei außer dem Handgepäck, und so fand ich mich sehr schnell außerhalb des Flughafens auf einer Art Markt wieder – einem schreienden, hektischen Pulk von Menschen, die Zeitungen, Telefonkarten und sogar gekochte Eier verkauften. Mit einem Mal war ich von Schwarzen umzingelt, und gerade aus dem Flugzeug voller Weißer gestiegen, fühlte ich gleichzeitig Erleichterung und Panik – als ob ich in einem Tarnanzug steckte, allerdings einem sehr schlechten Tarnanzug, denn mit meinen ein Meter zweiundneunzig und zweihundert Pfund überragte ich alle wie ein Turm.
Die Leute hier waren klein und schlank, und ich fühlte mich maßlos schwer, als hätte ich einige Körperteile zuviel. Doch es waren nicht die Menschen, die mich wie angewurzelt stehen ließen, es war die Hitze. Eine Hitze, die einen heißen Sommertag in New Orleans wie einen milden Frühlingstag aussehen ließ. Feucht, schwer und salzig, eben die Nairobi-Hitze.
Ein Taxifahrer in dreckigen weißen Hosen griff nach meinem Rucksack und kreischte: »Mzunga, mzunga, guter Tarif für Touristen«, aber ich hielt meine Sachen eisern fest.
Ich konnte kaum Kiswahili, aber aus dem Reiseführer, in dem ich während des Flugs geblättert hatte, wusste ich, dass er mich Weißer Mann genannt hatte. Eine merkwürdige Ironie, dass ich, ein afrikanischer Amerikaner, ein schwarzer Amerikaner, in Afrika Weißer Mann gerufen wurde, aber ich machte mir nichts draus, lachte bloß und schob ihn höflich zur Seite. Ich hätte ihm sagen sollen, dass ich nicht hier war, um Löwen oder Giraffen zu sehen, dachte ich noch, als ich mich durch die Menge kämpfte und alle möglichen Versuche abwehrte, mich in dieses oder jenes Taxi zu locken, bis ich eine tiefe Stimme meinen Namen rufen hörte: »Ishmael!«
Als ich mich suchend nach der Stimme umdrehte, stand ich dicht vor dem schwärzesten Menschen, den ich je gesehen hatte. Ich meine, ich bin ja auch schwarz, aber dieser Bruder hier war so schwarz, dass er blau aussah. Etwa einsachtzig groß, gehörte er, wie alle anderen, zu den Schlanken, aber anders als alle andern war er trotz der Hitze korrekt angezogen: braune Lederjacke, schwarze Cordhosen und robust aussehende, lederne Safari-Stiefel.
»Ishmael, nehme ich an«, sagte mein kenianisches Pendant von der Kriminalpolizei, deutete eine Verbeugung an und grinste: »Sagte Stanley zu Livingstone… Die großen Afrikaforscher… Man sagt, sie hätten uns entdeckt…«
»Ja«, sagte ich, so langsam seine ironische Anspielung begreifend – ein schwarzer Amerikaner und ein Afrikaner spielen weiße Entdecker nach.
»Mein Name ist David, David Odhiambo«, fuhr er fort und streckte mir die Hand entgegen. »Meine Freunde und Feinde nennen mich O.«
Als ich Os Hand schüttelte, merkte ich, dass ich dabei nichts empfand. Normalerweise lösen Menschen in mir etwas aus, irgendein Gefühl: Furcht, Sympathie, Wärme – O aber nicht. Er war bloß ein flüchtiger Bekannter. Das Einzige, was mir mein Gefühl sagte, war, dass sich unter dem Duft eines zweifellos teuren Rasierwassers der scharfe Geruch von Marihuana bemerkbar machte, was auch seine geröteten Augen erklärte.
»Komm, lassen wir diesen Wahnsinn hinter uns… Bist du gepackt?«, fragte er und griff nach meinem Rucksack.
Ich sah ihn irritiert an.
Er öffnete seine Jacke und ließ eine dieser alten 45er sehen – produziert in einer Zeit, als wir beide noch nicht auf der Welt waren.
»Wenn du meinst, ob ich eine Knarre hab, hier…«, sagte ich und öffnete kurz mein Jackett, so dass er meine Glock 17 sehen konnte – leicht, einfach zu bedienen, aber trotzdem tödlich.
»Gut, sonst hätte ich dir eines dieser bad babies besorgen müssen«, sagte er und lachte wieder. Ich war mir nicht sicher, ob er wie ein Amerikaner klingen wollte oder nicht.
»Gibt’s hier was in der Nähe, wo wir ein Bier trinken und reden können?«, fragte ich.
»Endlich verstehen wir uns, ich weiß genau das Richtige für dich«, sagte O, als wir uns auf den Weg zum Parkplatz machten und in einen verbeulten Land Rover stiegen.
Wir fuhren eine Weile, ohne ein Wort zu sagen. Ich war müde und aufgekratzt zugleich, aber trotz der Millionen kleiner Fragezeichen, die durch meinen Kopf schwirrten, fiel mir keine einzige Frage ein, und so hörte ich O zu, der einen Song von Kenny Rogers – The Gambler – vor sich hin brummte, dann und wann unterbrochen von Flüchen, wenn wir wieder in eines der Schlaglöcher rumsten, mit denen der Weg reichlich gesegnet war.
Bald konnte ich vor uns die Stadt sehen. »Nairobi?«, frage ich, nur um wenigstens etwas zu sagen.
»Nairobbery«, antwortete O lachend. »So heißt sie bei uns. Aber keine Bange, solange wir hier drin sind«, er klopfte auf das Armaturenbrett, »sind die Gauner clever genug, sich nicht mit uns anzulegen.«
Eine Zeitlang sah ich die vielen Lichter der Stadt noch vor mir. Plötzlich bog O von der Hauptstraße auf einen Feldweg ab, und die Stadt war nicht mehr zu sehen. Wir fuhren weiter, die Scheinwerfer bohrten sich durch die Dunkelheit, die Lichtkegel streiften hohes, trockenes Gras, niedriges Gestrüpp und wilde Sisalpflanzen. Wir fuhren an einer Ananas-Plantage vorbei und nahmen dann eine schmale, staubige Straße, die durch zwei Reihen schlampig gebauter Holzhäuser führte. Schließlich, kurz nach einem windschiefen Schild mit den aufgesprühten Worten: Sie verlassen jetzt Ananas-Stadt, wären wir fast in eine heruntergekommene Bar hinein gebrettert, die den stolzen Namen The Hilton Hotel trug.
»Morgen bringe ich dich zum wirklichen Hilton Hotel«, sagte O, als wir aus dem Land Rover stiegen und zu der Holzhütte gingen, »aber hier bekommst du einen Geschmack vom wirklichen Afrika.«
Innen war die Bar mit Kerosin-Lampen beleuchtet, die einen Geruch von Benzin und kokelnden Klamotten verströmten. In dem dämmrigen Licht sah ich an den Wänden jede Menge ausgeblichener Werbeplakate für alles Mögliche – Marlboro, Camel Light, Esso, McDonalds. Auch Gäste waren zu erkennen, aber schnell begriff ich, dass das Hilton voll mit lebenden Toten war – einige hingen bewusstlos am Tresen, andere waren so betrunken, dass sie kaum hörbar vor sich hinbrabbelten.
O und ich fanden einen Tisch, über den noch kein Betrunkener hing, und die Barfrau – eine junge Frau in einer regenbogenfarbenen Kanga – kam, um unsere Bestellung aufzunehmen.
»Hast du Hunger?«, fragte O.
Ich nickte und beobachtete ihn, wie er Bier und zwei Kilo gegrilltes Fleisch bestellte. Ich begriff, was ein Kenianer, außer dem Leben selbst, am meisten liebte: sein Tusker Bier und gegrilltes Fleisch, nyama choma. Tusker moto (warmes Tusker) und nyama choma, beides zusammen das beste Mittel, um an Informationen zu kommen, Danke zu sagen, ein Geschäft zu besprechen und zu besiegeln, Freundschaft oder Frieden zu schließen.
»Ishmael, willkommen in Afrika«, sagte O, als unser Bier kam. Er hob sein Tusker, nippte daran und lehnte sich in seinen Stuhl zurück. »So, und jetzt verrat mir, was ich für dich tun kann.«
Ich erzählte ihm meine Story.
Eine junge, blonde Frau war vor der Tür eines Schwarzen, eines Afrikaners, ermordet aufgefunden worden. Natürlich die Story des Jahres.
Wenn ich schwarzen Kriminellen einen Rat geben sollte, dann den: Begeht niemals ein Verbrechen gegen Weiße, denn der Staat wird keine Ruhe geben, bis er euch geschnappt hat. Ich meine, wenn ein Verbrechen nicht innerhalb von achtundvierzig Stunden aufgeklärt ist, dann wird es normalerweise zu den Akten gelegt. Aber ein Verbrechen Schwarz gegen Weiß wird niemals zu den Akten gelegt. Ein schönes blondes Mädchen ist tot – und eine Woche später jage ich Gespenstern in Afrika hinterher. Wäre das Opfer schwarz gewesen, wäre ich jetzt bestimmt nicht in Nairobi und müsste Überstunden machen.
Der Anruf kam um zwei Uhr morgens. Ich sprang aus dem Bett, wunderte mich nur über die Adresse – 2010 Spaight Avenue, Maple Bluff –, und fünf Minuten später war ich unterwegs, in schwarzen Hosen, weißem Hemd und einem flotten schwarzen Jackett. Ich kämmte mein Haar während der Fahrt – mit heulender Sirene und 90 Meilen. Man fährt nicht nach Maple Bluff, als wäre man gerade aus dem Bett gefallen.
Als ich am Tatort eintraf, waren die Rettungssanitäter und Polizisten des Maple Bluff Police Departments schon da. Die Bewohner dieses kleinen Steuerparadieses hatten zwar ihre eigene Polizei und ihre eigene Feuerwehr, aber keine Detectives – und deswegen war ich geholt worden, vermutlich auf Leihbasis. Meine Abteilung verdient dabei Tausende – und ich kann froh sein, wenn ich meine Überstunden bezahlt kriege.
Die Uniformierten standen einfach rum und sahen den Rettungssanitätern zu – die hatten gerade ihre Wiederbelebungsversuche an dem Mädchen aufgegeben –, wie sie ihre Geräte in den Rettungswagen zurückschleppten. Auch die Nachbarn, sehr weiß und in sehr teuren, glänzenden Pyjamas, guckten zu. Ich bat sie, wieder in ihre Häuser zurückzugehen, wir würden noch früh genug an ihren Türen klopfen.
Das Mädchen lag auf der Treppe; ihr langes, blondes Haar fiel wie zufällig quer über ihr Gesicht, das helle Licht der Veranda beleuchtete sie, als sei sie auf einer Bühne. Sie sah aus wie Achtzehn oder Zwanzig. Ihre weiße Bluse war aufgerissen – von den Sanitätern, wie ich später erfuhr – und zeigte eine volle Brust ohne BH. Sie trug einen kurzen Faltenrock, so wie sie Cheerleader tragen, knielange weiße Strümpfe und weiße Tennisschuhe.
Mein erster Gedanke war, wie schön sie aussah – der Nagellack glänzte makellos rot, ihr Haar, obwohl wild durcheinander nach den heftigen Versuchen der Sanitäter, sie ins Leben zurückzuholen, hatte immer noch etwas blond Glitzerndes; ihre Augen waren geschlossen, ihr Gesicht wirkte friedlich. Sie sah überhaupt nicht leblos aus, und ich dachte, sie könnte jeden Moment aufspringen und sich ihren verdienten Schlussapplaus abholen.
Ich trat einen Schritt zurück und fragte die Uniformierten, wo der Hausbesitzer sei, und sie zeigten nach drinnen. Ich hätte erwartet, dass er oder sie draußen herumirrten, um irgendwie zu helfen, oder vor der Tür hockten, außer sich vor Entsetzen, aber wem immer das Haus gehörte, er reagierte offenbar ganz anders.
Ich ging an dem Mädchen vorbei und betrat die kleine Veranda. Wo mein Herz ist, bin ich zu Hause, las ich auf der Fußmatte, als ich meine Schuhe abstreifte und an die Tür klopfte. Niemand reagierte, und weil die Tür nicht abgeschlossen war, ging ich einfach hinein.
Der Korridor wurde spärlich von außen durch das Blaulicht der Rettungswagen und der Polizeiautos beleuchtet. Mein Instinkt befahl mir, die Pistole zu ziehen, ich nahm die Taschenlampe in die linke Hand und ging über einen langen Gang bis ins Wohnzimmer.
»Ich sage denen, Mädchen ist tot«, machte sich eine tiefe Stimme in der Dunkelheit bemerkbar.
Ich drehte mich schnell herum und richtete die Taschenlampe dahin, wo die Stimme herkam.
»Warum die misshandeln ihren Körper?«
Da saß ein Mann auf einem doppelsitzigen Ledersofa, drehte geistesabwesend den Stiel eines leeren Weinglases, und als ich ihn ansah, langte er zu einer Tischlampe neben sich und knipste sie an. In dem plötzlich hellen Licht sah ich, dass er tadellos gekleidet war – ein schwarz-weiß gestreifter Anzug und ein schmaler, roter Schlips, teure Lacklederschuhe – aber ohne Socken.
»Sie haben sie gefunden?«, fragte ich, aber es war eher eine Feststellung.
»Ja, ich finden sie so. Ich war aus mit Freunden, Cocktails trinken … Sammy’s Lounge.«
Als ich meine Pistole wegsteckte, stand der Mann auf – er war schwarz, groß, viel größer als ich, und so dünn, dass sein Kopf direkt auf den Schultern zu stecken schien. Er streckte mir seine knochige Hand entgegen, die aus dem Anzug hervorzuwachsen schien, und drückte meine mit festem Griff.
»Die Namen?«
Er nannte vier Namen – ich könnte sie in der Universität finden, sagte er. Sie würden sich für ihn verbürgen. Er wirkte sehr gelassen, keine geschwollene Halsschlagader, kein verschlagener Blick oder verschwitzte Handflächen. Keine verräterischen Symptome, nach denen wir routinemäßig suchen.
»Und wann haben Sie Sammy’s Lounge verlassen?«
»Um ungefähr zwölf Uhr dreißig. Ich lief zu Fuß, ich mag zu Fuß … Whiskey aus meinem Blut waschen. Eine halbe Stunde. Vielleicht mehr, vielleicht weniger, dann kam ich hier. Ich wählen neun eins eins, als ich sie finden.«
»Haben Sie Ihr Handy benutzt?«
Er gab es mir. Er hatte die Polizei nachts um ein Uhr dreiunddreißig angerufen. Ich zeigte es ihm, aber er zuckte bloß mit den Schultern.
»Ihr Akzent … wo kommen Sie her?«, fragte ich.
»Mein Freund, jeder hat Akzent … meiner kommt davon, ich spreche zwei Sprachen, Französisch und Kinyarwanda, Ich bin aus Ruanda … und Kenia. Ich heiße Joshua Hakizimana. Und Sie, Detective?«
»Sie können mich Ishmael nennen … geboren und aufgewachsen hier in Madison, Wisconsin«, antwortete ich, und fühlte mich dabei wie ein Dorftrottel vor seiner Schulklasse.
»Das tut mir sehr, sehr leid«, sagte er mit einem kurzen Lachen und deutete auf einen Sessel. »Ich unterrichte an der Universität, über Völkermord und dessen Aufarbeitung. Sie wissen, was passieren in…?«
»War sie eine Ihrer Studentinnen?«, unterbrach ich ihn. Ich brauchte keine Geschichtsstunde.
»Nein, nie gesehen. Nicht von dem Typ, die kommen in meine Kurse.« Das klang abfällig.
»Welcher Typ wäre das?«
»Bohemiens oder Peace Corps-Typen… Also, wie ihr Amerikaner sagt: Trust Fund Babies, jung und stinkreich.« Er lachte kurz auf.
Abgesehen von seiner beunruhigenden Gelassenheit gab es nichts Verdächtiges. Wenn es Hinweise gab, konnten sie nur bei dem Mädchen gefunden werden. Nur eine Autopsie würde uns etwas über ihre letzten Stunden verraten. Und danach müssten wir die Nachbarn interviewen, die Bars in der Gegend nach irgendjemandem abfischen, der sich eventuell an sie erinnert, die Immatrikulationslisten der Universität für die letzten sechs oder mehr Jahre und die Akten über Vermisstenfälle durchforsten und dann auf einen Glückstreffer hoffen.
Ich fragte Joshua, ob ich mich ein wenig umschauen dürfte, und er nickte. Ich ließ ihn dort sitzen, machte mich auf die Suche und knipste überall Licht an. Das Haus war riesig, aber es war das Schlafzimmer, was mich wirklich interessierte. Vielleicht lief diese ganze Bescherung bloß auf einen Beziehungsstreit hinaus, der eskaliert war – manchmal liegen die Dinge so einfach. Sie war seine Studentin und wollte die Affäre beenden. Oder er wollte Schluss machen, und sie hatte damit gedroht, ihn bei der Universitätsleitung anzuzeigen. Schließlich fand ich es. Es bestand bloß aus einem großen Bett, tadellos hergerichtet, und einem Nachttisch, auf dem nichts weiter zu sehen war als eine Lampe. Ich öffnete den Wandschrank und sah Anzug neben Anzug, jeder mit einem schwarzen Hemd dazu und darunter die passenden Schuhe.
Im Badezimmer daneben lag auf dem Waschbecken eine einzige Zahnbürste neben einer Tube Bio-Zahnpasta. Das Medizinschränkchen war leer. Es sah nicht so aus, als könnte ich irgendwas Brauchbares finden, also ging ich wieder die Treppe hinunter; er saß genauso da wie vorher, bloß dass das Glas jetzt halb voll war.
Ich zeigte auf seine Schuhe und fragte wegen der Socken.
»Manchmal bin ich etwas durcheinander. Zerstreuter Professor, oder?«, sagte er mit gespielter Traurigkeit, als er sich erhob, um mich zur Haustür zu bringen.
»Woher haben Sie gewusst, dass das Mädchen tot ist?«, fragte ich noch, als ich ihm meine Visitenkarte gab.
»Detective, da, wo ich herkomme, der Tod ist ein Begleiter, wie Geliebte oder guter Freund. Immer dabei«, antwortete er, und ich ging.
Die haben wir da drüben gefunden«, sagte ein Polizist von der Maple Bluff-Truppe, als ich wieder vor der Veranda stand, und zeigte Richtung Zaun. Es war eine Spritze, halbvoll mit etwas, was nur Heroin sein konnte.
Ich sah mir die Arme des Mädchens genau an und fand ziemlich schnell eine leicht blutige Einstichstelle. So gesehen könnte es eine Überdosis oder ein Selbstmord sein, aber kein Mord. Wie sich das eben für Maple Bluff gehörte – eine Katze oben auf dem Baum, gestohlene Stoppschilder, eine manchmal betrunkene und renitente Großmutter zu Besuch aus der tiefsten Provinz, aber doch kein Mord…
Es gab in dieser Nacht nichts mehr für mich zu tun, also ging ich nach Hause, um meinen Bericht zu schreiben. Gott sei gepriesen für die Technik – ich konnte alles online erledigen bei einem kalten Bier und einem Stück Pizza. In früheren Zeiten würde ich jetzt bis zum Hals in Papierkram stecken.
Während ich tippte, begannen mich Kleinigkeiten zu stören. Die Wände im Haus, zum Beispiel, waren kahl gewesen, keine Bilder, keine Fotos. Wie in einem Hotelzimmer, unpersönlich, wenn auch bewohnt. Wie konnte er so wohnen, ohne jede persönliche Note? Aber das war noch kein Verbrechen, sagte ich mir. Und vielleicht war das Haus auch nicht sein wirkliches Zuhause, vielleicht gab es irgendwo in Afrika ein Haus voller Fotos mit einer lächelnden Ehefrau, mit Kindern und einem Hund namens Simba, der nur Krokodilfleisch fraß. Aber selbst wenn das so war, wie konnte sich ein College-Professor ein Haus in Maple-Bluff leisten? Allein die Abgaben reichten aus, um eine sechsköpfige Familie zu ernähren und einzukleiden. Irgendwas stimmte hier nicht – ein schönes blondes Mädchen vor der Tür eines afrikanischen Professors. Selbstmord oder Zufall: die Überdosis auf der Veranda eines Unbekannten? Nein, es war zuviel Zufall für einen Zufall. Und ich hab schon so manchen verdammten Scheiß erlebt. So wie diesen Kerl, der einen Mann tötete, der sich gerade sein morgendliches Wisconsin State Journal holte, und dann einen Zettel bei ihm hinterließ: Ein Fremder tötet einen Fremden. Einmal. Ihr werdet mich nie kriegen. Gezeichnet: Zufall. Wenn es auch nur den geringsten Kontakt zwischen Opfer und Täter gab, dann kriegen wir dank der heutigen Kriminaltechnik so einen Mistkerl hundertprozentig, früher oder später. Aber bei dem Zufalls-Killer lag das anders – Opfer und Täter kannten sich nicht; in Beziehung brachte sie nur eine Idee, die wir nicht begriffen.
Um es kurz zu machen: Der Mörder machte einen fatalen Fehler – er hatte auf dem Zettel seinen Daumenabdruck hinterlassen. Fünf Jahre später gab es einen Brand im Erdgeschoss eines Hotels, der ohne großen Schaden abging. Aber weil wir Brandstiftung vermuteten, hatten wir von allen Gästen und Angestellten Fingerabdrücke genommen und verglichen diese mit unseren gespeicherten Daten. Den Brandstifter fanden wir nicht, aber es stellte sich heraus, dass sich unser Zufalls-Killer mit einer Nutte ins Hotel verzogen und vergnügt hatte. Über ihn nur noch soviel: Er war ein ortsansässiger Apotheker mit einer lieben Frau und Kindern.
Als er mir vorgeführt wurde, schaute ich ihm lange in die Augen und sagte, dass er alles versaut hätte. Ein perfektes Verbrechen hat kein Motiv. Und wo kein Motiv ist, gibt es also auch kein Verbrechen? Aber er guckte mich nur mitleidig an. »Sie sind ein Idiot«, sagte er. »Ist Ihnen nicht aufgefallen, Detective, dass ich zu beweisen versuchte, dass es keinen Zufall gibt?«
Ich wusste nicht, was zur Hölle er damit meinte, und er weigerte sich, noch irgendein Wort zu sagen – zu mir, seinen Anwälten, seinen Kindern und seiner Frau –, aber das jedenfalls wusste ich jetzt: Es musste eine Verbindung geben zwischen dem weißen Mädchen und dem afrikanischen Professor. Wenn ich die herausfand, dann könnte man besser begreifen, was geschehen war. Es musste eine Verbindung geben, aber welche?
Ich war hundemüde, stand aber früh auf, um mit dem Pathologen zu sprechen, einem seltsamen Vogel.
»Immer dicht dran an den hübschen Dingern, sind wir doch oder Ishmael?«, sagte Bill Quella – abgekürzt BQ –, als er das Mädchen aus dem Kühllager hervorzog; sein Südstaatenslang, sein Sing-Sang, etwas zu hoch für einen Mann, hallte vom gefliesten Boden zurück.
»Unglücklich im Leben, glücklich im Tod, schätze ich«, antwortete ich.
BQ lachte sein nervös quiekendes Lachen. Wie jeder andere, mit dem ich zusammenarbeitete, wusste er, dass meine Frau sich von mir getrennt hatte. Was sie aber nicht wussten: Sie hatte sich von mir getrennt, weil ich ein schwarzer Cop war. So jedenfalls erklärte sie es. Ich verstand das nicht. Wieso verriet ich meine Rasse, wenn ich sie beschützte? Aber es gab damals noch mehr Dinge, die ich nicht verstand, zum Beispiel, wie man einen Mann vor die Wahl stellen konnte zwischen seinem Beruf und seiner Liebe.
»Wollen Sie wissen, was sie gefuttert hat, bevor sie ihrem vorzeitigen Tod begegnete?«, fragte BQ und zog das Laken von ihrem Körper.
Das Leuchten, das sie noch im Tode zeigte, war jetzt erloschen. Mit den zugenähten Einschnitten auf der Brust, über ihrem Bauch und unterhalb ihres Haaransatzes – die Stellen, an denen BQ sie aufgebrochen hatte – sah sie aus wie eine weiße, lederne Schaufensterpuppe. Wenn BQ seine Arbeit getan hatte, sahen die Toten immer wie Tote aus.
»Ersparen Sie mir Details«, brummte ich, »kommen Sie gleich zur Sache.«
»Also gut, Detective Ishmael, es wird Ihnen bestimmt gefallen. Es war Mord unter Vortäuschung einer Überdosis.«
BQ machte eine theatralische Pause, aber ich spielte nicht mit. »Woher wissen Sie das?«, fragte ich und achtete darauf, nicht sonderlich überrascht zu klingen.
»Ganz einfach… Zunächst einmal wurde das Heroin in ihren Arm injiziert, als sie schon tot war. Beweisstück A: keine Spur davon in ihrem Blut. Und B: Sehen Sie …«, er wies auf ihren Arm, »das ist die einzige Einstichstelle auf ihrem ganzen kostbaren Körper. Sie war also nicht süchtig.«
Mehr Fragen als Antworten. »Woran starb sie dann?«
»Sie wurde erstickt. Ich schätze mit einem Kissen über den Kopf…«, sagte er. »Sie starb an Sauerstoffmangel. Das arme Ding wurde ermordet.«
»Welche Uhrzeit?«
»Was ich schätze? Irgendwas zwischen elf Uhr abends und ein Uhr morgens«, BQ machte eine Pause. »Sehen Sie, Detective. Vielleicht bin ich jetzt etwas vorschnell, aber wer immer sie umbrachte, er wollte sie nicht äußerlich verletzen. Ich schätze, es war jemand, der sie gut kannte, jemand, der sie vielleicht sogar geliebt hat…«
Ich schaffte es, so gegen neun in der Madison Policestation zu sein, und dort herrschte pures Chaos. Jemand hatte die Presse informiert – immer informiert irgendjemand die Presse –, und sie hatten zusammen mit Dutzenden von Schaulustigen ihr Lager auf der Treppe aufgeschlagen, alle wollten genau wissen, was los war. Wir hätten besser vorbereitet sein sollen. Wir hätten eine Art Medienstrategie haben sollen. Stattdessen sah ich, als ich mich durch die Menge kämpfte, wie der Polizeichef, Jackson Jordan, in der Mitte des Getümmels stand und versuchte, die Leute zu beruhigen. So gelassen wie möglich verkündete er der drängelnden Meute, dass er gemeinsam mit dem Bürgermeister eine Pressekonferenz abhalten würde, sobald sie genauere Informationen hätten.
Glücklicherweise wusste die Presse nicht, dass ich die Ermittlungen leitete, und so schaffte ich es relativ unbehelligt ins Chefbüro. Keuchend und schnaufend kam er wenig später und belegte die Presse mit allen erdenklichen Schimpfwörtern. Ich wusste, was sein Problem war. Jackson Jordan war der schwarze Polizeichef einer überwiegend weißen Polizeieinheit in einer überwiegend weißen Stadt. Das Opfer war eine junge weiße Frau und der Hauptverdächtige, wenn auch noch nicht offiziell, war ein Schwarzer, ein Afrikaner. In dem Fall würde es also nicht nur um Fakten, sondern auch um Politik gehen, und das ist immer eine ungute Mischung. Keiner von uns sprach es aus, wir wussten es einfach.
Jackson Jordan war gewählt worden, weil er gegen Kriminalität hart durchgriff. Genauer gesagt, gegen schwarze Kriminalität. Ich respektierte den Chef genug, um unter ihm zu arbeiten, aber es war nicht immer leicht. Er neigte zu politischen Zugeständnissen, während ich nur den beweisbaren Spuren folgte, egal wohin sie mich führten – zu den zwei Nutten, die an der Schnapsbude an der Ecke Drogen verticken, zum Bürgermeister oder sogar zum Gouverneur. Aber, wie ich schon sagte, ich arbeitete gern unter ihm, und letzten Endes hatten wir eine Art trotzigen Respekt vor ihm.
»Chef, diesen Fall bearbeite ich alleine«, sagte ich.
Mein Partner, ein weißer Kollege, war gerade pensioniert worden, und ich wusste, worauf das hinauslief – wieder einen weißen Partner für den Nigger-Cop, damit sich jeder sicher fühlen konnte. Aber genau das wollte ich nicht. Wenn ich einen Partner kriegen sollte, dann aus einem vernünftigen Grund und nicht bloß wegen der Rassen-Arithmetik.
»Wer ist das Mädchen?«, fragte der Chef, ohne auf meine Äußerung einzugehen.
Weil ich das nicht wusste, gab ich ihm stattdessen den Bericht von BQ. Er sank in seinen Sessel zurück und strich sich mit der Hand über seinen kahler werdenden Kopf.
Mit seinen fünfzig Jahren war der Chef so rundlich wie Polizisten eben sind, wenn sie zu viel Zeit hinterm Schreibtisch verbringen – nicht richtig fett, aber mit so einer trägen Körperfülle, die sich für einen Polizeibeamten eigentlich nicht gehört.
»Erzähl mir was über den Afrikaner…«, sagte der Chef.
Außer den dürftigen Fakten war da nicht viel zu erzählen. Joshua hatte mir gesagt, dass er sie tot vor der Haustür gefunden habe. Er hatte ein Alibi, und weder inner- noch außerhalb seines Hauses wies etwas auf einen Kampf hin. Es gab keine sichtbaren Kratzer oder Spuren auf seiner Haut. Und er hatte sich nicht mit den üblichen Ausreden verdächtig gemacht. Die Leiche schien ihm buchstäblich vor die Tür gefallen zu sein.
»Hast du die Bude auseinander genommen?«, fragte der Chef.
Hatte ich nicht. Mein Gefühl sagte mir gleich, dass, was immer passiert war, es nicht in Joshuas Haus passiert war. Davon war ich überzeugt, und der Todeszeitpunkt, wie ihn BQ eingeschätzt hatte, bestärkte meine Annahme. Ich wollte das weiter ausführen, aber der Chef sagte, er würde sowieso alles noch kriminaltechnisch untersuchen lassen. »Ein Scheißmord«, presste er zwischen den Zähnen hervor. »Genau das, was ich brauche…« Er machte eine Pause. »Weißt du, dein Afrikaner ist so eine Art Held da drüben in seinem Land.«
Er reichte mir eine Mappe von seinem Tisch. Sie enthielt Zeitungs- und Zeitschriftenartikel über den Afrikaner aus dem Internet. Tatsächlich, er war ein Held. Es gab Fotos von ihm mit Bill Clinton, Nelson Mandela und sogar mit dem Dalai Lama. Und dann wurde er noch von Bill Gates für humanitäre Verdienste ausgezeichnet. Es gab viele Artikel über ihn, wo er von Kindern umringt riesengroße Schecks über viele Tausend Dollar hochhielt, ausgestellt auf eine sogenannte Never Again Foundation. Ich hatte schon davon gehört, Hollywood-Typen tauchten regelmäßig im Fernsehen auf und warben für Spenden und beendeten ihre Litanei mit dem inzwischen schon populären Slogan: Nicht vor meinen Augen!
Aus den Presseberichten ging nicht hervor, in welchem Verhältnis Joshua zu der Stiftung stand – in einigen wurde er als Gründer, in anderen als früherer Vorsitzender bezeichnet, aber egal, der Mann schien immer im Mittelpunkt jeder guten Tat zu stehen. Und jeder andere Wohltäter wollte unbedingt mit ihm aufs Foto.
Zuerst stieß mir das sauer auf – jeden Tag sterben Polizisten, ohne dass von denen da oben mehr als ein Kopfnicken zu erwarten war – aber als ich weiter las, wurde mir klar, dass er diese Anerkennung wirklich verdient hatte. Als früherer Schulleiter hatte er seine, zur Zeit des Völkermords in Ruanda, leere Schule zu einem sicheren Zufluchtsort gemacht. Von den Killern, die früher seine Schüler waren, verehrt, hatte er sie davon überzeugt, die Schule, die sie früher besucht hatten, in Ruhe zu lassen. Eine Insel der Vernunft in einem Meer von Blut, lautete eine Schlagzeile. Er bot Tausenden Schutz, die er auf die eine oder andere Weise über die Grenze schmuggelte. Aber auf dem Höhepunkt des Völkermords wurde die Schule von seinen ehemaligen Schülern umzingelt und sie befahlen ihm: »Keiner mehr rein; keiner mehr raus!« Diejenigen, die es trotzdem wagten, wurden massakriert.
Ab diesem Zeitpunkt wurde die Geschichte noch außergewöhnlicher. Während der Belagerung durfte er die Sperren jeweils nur mit einem Fahrer und einem Bodyguard passieren, aber nicht mal das stellte ein Hindernis für ihn dar. Er brachte jedes Mal zwei Flüchtlinge raus, einen als seinen Fahrer und den anderen als seinen Bodyguard, und schmuggelte sie über die Grenze in Camps nach Tansania oder Kenia. Auf dem Weg zurück nahm er dann jeweils zwei von denen mit, die vor der Gewalt fliehen wollten, wieder verkleidet als Fahrer oder Bodyguard.
Was für eine Story!
Jetzt begriff ich, wie er angesichts des toten weißen Mädchens so gelassen bleiben konnte. Er musste Nerven wie Stahl haben, wenn er diesen Trick wieder und wieder durchzog und dabei nicht nur sein eigenes, sondern auch das Leben derjenigen riskierte, die sich in der Schule aufhielten. Er hatte nicht übertrieben. Er hatte mit dem Tod gelebt, und eine tote weiße Frau vor seiner Tür war eben nur noch eine weitere Tote neben einer Million anderer. Nur Lebende würden einen Mann wie ihn interessieren.
»Du kannst den ganzen Kram auch online kriegen, aber nimm die Mappe ruhig mit«, sagte der Chef, als wir uns erhoben. »Ishmael, wir sind ja schon eine ganze Weile im Geschäft, was sagt dein Bauch?«
In unserer Welt ist das keine leichte Frage. Oberflächlich gesehen bedeutete sie, dass wir nichts in der Hand hatten, unterschwellig aber, dass er bereit war, auf meine Einschätzung hin Kopf und Kragen zu riskieren. Also eine selten gestellte Frage.
»Kann ja sein, dass er irgendwo in Afrika ein Held ist, aber hier steckt er ziemlich in der Scheiße«, sagte ich und erinnerte mich, warum ich meine Pistole gezogen hatte – das war mein Bauchgefühl. »Ganz einfach, Chef, wann ist dir das letzte Mal ein Toter aus dem Nichts vor die Tür gefallen?«
»Wir müssen den Mistkerl erwischen, der das getan hat. Hörst du?«, sagte er in scharfem Ton. »Hier geht es um mehr als um den Ruf unserer Abteilung.«
Ich verstand ihn. Wenn es uns gelang, diesen spektakulären Fall zu lösen, dann bekämen Schwarze wieder mehr Chancen bei der Polizei. Und wenn wir ihn vergeigten, dann wären die Türen erstmal dicht. Das machte die Sache wirklich nicht einfacher.
Ich hatte das Chefbüro gerade verlassen, als das Handy klingelte. Es war meine Kontaktperson in der Madison Times, einem kleinen, bunten Käseblatt, das jeder las. Meistens gehen Polizisten, wenn sie was durchsickern lassen wollen, zu den großen Zeitungen, aber nach jahrelanger Erfahrung wusste ich, dass Gangster, ihre Komplizen und diejenigen, die ihnen an den Kragen wollen, das Wisconsin State Journal nicht lesen und die New York Times erst recht nicht. Wenn man also über eine gezielte Indiskretion etwas erreichen will, dann muss man zu den kleinen Zeitungen gehen – jeder liest sie. Ich war also froh darüber, dass ich Monique Shantell, oder Mo, wie sie genannt werden wollte, am Telefon hatte.
»Hey, Ishmael, hast du was für mich?« Ihre Stimme klang sehr sexy.
»Bist du nicht da, wo sie jetzt alle sind?«, fragte ich.
»Du kennst mich, Baby, ich schwimm nicht mit den Haien. Du brauchst jetzt ein Frühstück. Wir treffen uns an der bekannten Stelle.«
Die Presseleute sahen zu mir hoch, als ich die Treppen herunterkam, stürzten sich auf mich, merkten, dass ich nicht der Chef war, und setzten ihr Geschnatter fort. Für sie gab es hier auf der Polizeistation nur zwei Sorten Schwarze – die in Handschellen und den Chef.
Ich traf Mo in meinem Lieblingscafé, ein paar Blöcke von unserer Station entfernt. Ich war Stammkunde, weil sie den besten Kaffee machten, den man in Madison kriegen konnte: Milch, Kaffee, Wasser und Zucker stundenlang zusammen aufgekocht. Mo war attraktiv, und sie wusste es. Sie würde aber nie mit mir ausgehen, und zwar aus demselben Grund, aus dem meine Frau mich verlassen hatte – ich war ein schwarzer Polizist und ich verhaftete manchmal auch Schwarze. Verriet meine Rasse. Jedenfalls hatte ich mir das so eingeredet. An die andere Möglichkeit, dass sie mich nicht so attraktiv fand, wollte ich gar nicht erst denken.
»Da ist aber die Kacke am Dampfen«, sagte Mo, als ich ihr das Polaroid-Foto von dem Mädchen und einen Ausschnitt aus der Mappe zeigte, die mir der Chef mitgegeben hatte.
»Ja, aber dir macht es ja nichts aus, drin rumzuwühlen. Vergiss bloß die Gummistiefel nicht«, zog ich sie ein bisschen auf.
»Weißt du was? Es kann gut sein, dass er sie umgebracht hat und dann genau da liegen ließ«, sagte sie voller Überzeugung.
»Warum?«, fragte ich. Sie hatte mich neugierig gemacht.
»Du bist der Detective, du erklärst es mir«, sagte sie und lachte.
»Los, Babe, Story aufschreiben und Pulitzer Preis gewinnen.« Sie stand auf, beugte sich vor und küsste mich leicht auf den Mund. So nährte sie meine Hoffnungen. Ich hatte nichts dagegen.
Ich starrte in meinen Kaffee und dachte an die Puzzle-Arbeit, die vor mir lag. Jesus, ich hasste das, aber, wie man so sagt: Der Teufel steckt im Detail.
Ich lief also zur Universität und sprach mit denen, die Joshua als Alibi genannt hatte. Sie hatten sich zwischen halb zwölf und ein Uhr getrennt. Die Polizisten, die das Melderegister durchforsteten, fanden nichts. Die Nachbarn hatten nichts bemerkt. Nein, da war nichts Auffälliges an ihm. Ich fuhr zu den Motels in der Umgebung von Madison: nichts. Vermisstenakten: nichts.