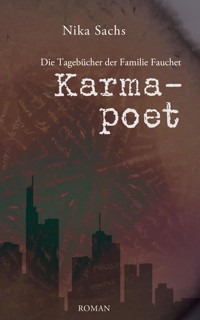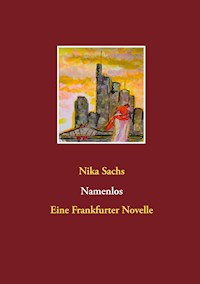
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Namen sind Schall und Rauch. Das denkt sich auch die junge Frau, die den Unbekannten am Nachbartisch anspricht. Sich gegenseitig vorstellen, interessant finden, verabreden, ausgehen und am Ende intim werden? Ein alter Hut. Wie lernt man sich am besten kennen? Rückwärts, findet sie. So bestehen die unkonventionellen Dates der beiden Protagonisten aus schwarzhumorigen und tiefsinnigen Gesprächen über Literatur, Arbeit, Liebe und dem magischen Moment der Zweisamkeit mit einem unbekannten Menschen. Vor allem aber beinhalten sie eines nicht: die Frage nach dem Namen. Wie so oft folgen Leben und Liebe aber ihren ganz eigenen Gesetzen und komplizieren das Vorhaben mit der möglichst späten Auflösung des Geheimnisses.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 91
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Sandra »Business« Wagner
∞
Wir alle haben unsere geheimen Geschichten
Über die Autorin
Nika Sachs ist 1987 in Frankfurt am Main geboren und lebt mit ihrer Familie unweit ihres Geburtsortes. Bereits in der Kindheit und Jugend zeichnete, sang und schrieb die vielseitig kreative Synästhetikerin. Neben Erzählungen und Bilderbüchern für Kinder schreibt sie leidenschaftlich gerne über das Komische und Unkonventionelle des Alltags.
Zu diesem Buch
Dies ist eine fiktive Geschichte. Jedoch nimmt sie Bezug auf real existente Künstler, Filme und lokalspezifische Gegebenheiten. Auf Fußnoten wird hierbei verzichtet. Im Anhang befinden sich dafür einige Anmerkungen zum Nachlesen.
Inhaltsverzeichnis
Ypsilon
Fischvogel
Pantoffeltierchen
Goethe
Sperrmüll
Wertpapiere
Schall und Rauch
Ypsilon
Schwarz wie die Nacht, der Toast-Tod am Morgen. Verkohlt, zu spät, das Beste draus machen, denkt er sich. Abkratzen. Zumindest das Acrylamid, das sich durch den chemisch-physikalischen Prozess am Brot festgesetzt hat.
Abkratzen ist nicht verkehrt, es steckt so viel dahinter: Flüchtlingsboote, Eis an der Windschutzscheibe, der Commerzbank-Tower, der an den Wolken kratzt. Abgekratzt ist sowohl die Beziehung als auch der Protagonist des Buches, das er gerade liest. Jörg Immendorff hieß er und war ein zeitgenössischer Künstler, Freigeist und Anhänger des berühmtberüchtigten Beuys. Abgekratzt deshalb, weil er an der unheilbaren amyotrophen Lateralsklerose verendet ist, wenn man das so sagen kann. Gerade hat der namenlose Schreiberling, das Beobachtungsobjekt dieser Geschichte, irgendetwas zum Thema Tod gelesen. Ob es einen guten Tod gibt. Gibt es den?
Vielleicht.
Das Resultat ist aber auch wurst, findet er.
Namenlose Gedanken brauchen auch keinen benannten Verfasser, ist die Devise der letzten Wochen. Oder Verfasserin, natürlich. Wochen geht das schon. Zum Handlungszeitraum des nicht so arg dicken, aber dennoch liebevoll-boshaften Buches, das er liest, war noch lange keine Rede von Ice Bucket Challenge und schon gar nicht von Massendatenspeicherungen und Wikileaks. 2007. Da war Facebook gerade erst auf dem Weg in die Köpfe der Bevölkerung, die auch noch nicht mit Smartphones breitbandversorgt war.
Die Wohnung auf der Berger ist unendlich laut. Dafür zentral und das Leben inspiriert ihn meist beim aus dem Fenster sehen. Heute nicht. Wie auch schon die ganzen anderen Tage zuvor nicht. Sonntagvormittag und der Kopf, der Gott sei Dank festgewachsen ist, damit es nicht reinregnet, ist leer. Aber es regnet nicht und die Wände der Wohnung erdrücken die Synapsen, die in der Leere des kleinen Universums umherflirren.
Seit drei Stunden läuft der Song auf Dauerschleife, der Loop seiner Stimmung, und doch vermag aus der trüben Hoffnung auf einen Gedanken aus dem Flow heraus keine Idee zünden. Gold, so heißt der Song von Chet Faker und hat den Rhythmus des Tages zum Programm. So eine rollschuhfahrende Muse wie im Musikvideo könnte ihm jetzt auch mal am Fenster vorbeifahren.
Die Wohnung ist schon länger fast leer, nur die Matratze auf dem Zehn-Euro-Rollrost, die Klamotten in zwei Kisten, der Schreibtisch und die weiße Wand dahinter. Und die weiße Wand davor. Eigentlich sind die Wände überall weiß, zum Glück muss man ja, wenn man es richtig anstellt, immer nur eine ansehen. Somit hält sich das Trauerspiel in Grenzen und ihr Auszug ist erträglich.
Die Frau, die hier mit ihm gewohnt hat, sie hat im Gegensatz zu ihm einen Namen. Miriam heißt sie und wäre in zwei Monaten Miriam mit dem neuen Nachnamen geworden, hat es sich aber bereits vor einem halben Jahr anders überlegt. Der Nachname vom Vornamenlosen hat ihr wohl nicht so gut gefallen, wie es scheint. Komisch, dass ihr das so nach viereinhalb Jahren Beziehung aufgefallen ist. Tatsächlich war das ihre doch mehr als dürftige Begründung, die sie auf dem kleinen Zettel auf dem Schreibtisch hinterlassen hat. Weil sie nicht raucht, hatte es auch keinen Sinn für sie gehabt, mal eben schnell Zigaretten kaufen zu gehen und davon nie wieder zurückzukommen.
Nein, sie hat ihn verlassen und ist wieder vergeben, denkt er sich. An einen Gesellschaftskämpfer, genau wie sie. Sympathisch und gut aussehend. Gebildet auch. Miriam wollte schon immer nach Afrika, hat da ihr Freiwilliges Soziales Jahr gemacht, die Kultur ist ihr nicht fremd, sie hat sich in sie verliebt. Ob das Liebe oder Idealismus war und ist, möchte die Geschichte noch nicht preisgeben. Soll sie mal, ist sie doch so oder so ihres eigenen Peches Koch, die Federn dazu hat der Namenlose schon gelassen. Drei Monate lang, wenn man es genau nimmt. Hungerstreik und nahender Alkoholismus. Koks kann er sich leider nicht leisten, was aber seiner Denkblockade nicht so einen Aufwind gegeben hätte wie der Alkohol. Dafür dem Gottkomplex, den das Zeug so mit sich bringt. Den bemerkt er vor allem oft in der Chefetage. Die Denk- und Schreibblockade ist jetzt das Resultat aus dem Absturz, dem Verlust des Bezugs zu sich selbst und dem bodenlosen Fass, der Zuber, in dem der Namenlose sitzt. Dreckwasser, voll mit verunreinigten Gedanken und Erinnerungen an diese Frau, die seinen Namen nicht haben will. Die einzige Beziehung zu einer weiblichen Stimme hat er im Moment zu Siri. Traurig, irgendwie.
»Des muss emal e End habbe, mit Ihne!«, sagt die Nachbarin auf dem Hausflur, den der Namenlose gerade betritt. Sie ist eine Nachbarschafts-Stalkerin, die Bornheimer Stasi, wenn man das so sagen kann. Die gute Durchschnittsbürgerin mit dem brutalen Frankfurter Dialekt und dem krusseligen Dutt. Sie ist halt nett und hat diesen Tante-Emma-Touch. Neugierig ist sie so oder so, sorgt sich aber um ihre Opfer, die sie mit liebevoller Mütterlichkeit am Fenster beobachtet. Dabei schaut ihr Yorkshire zu, der zum Glück kein Schleifchen auf dem Kopf hat. Aber sie lebt ja auch alleine, der Onkel zur Tante ist schon ewig tot, bestimmt zehn Jahre. Sie ist mindestens Mitte sechzig, wenn man das anhand ihrer Furchen im Gesicht so beurteilen kann. Quasi die Dreifaltigkeit auf der Stirn. Dass er sich das auch so manches Mal schon gedacht hat, antwortet er und schenkt ihr ein gequältes Lächeln. Sie nickt das nur ab und atmet tief durch, ehe sie wieder den Wischmopp hin- und herschiebt.
Das ekelhafte, flappende Geräusch verhallt im Hausflur, als er die Treppen zur Haustür hinunterläuft. Raus, atmen, noch mehr Luft in den leeren Kopf lassen und hoffen, dass dazwischen irgendwo ein Gedanke, eine Idee, ein Hauch einer Ahnung umherfliegt. In quantenphysikalischen Größenordnungen, versteht sich. Aber in Zeiten wie diesen muss man nehmen, was kommt. Unterzuckerung, wieder hat er zu wenig gegessen und getrunken eigentlich auch – zumindest frei von Umdrehung.
*
Halb elf durch, das Ypsilon hat auf jeden Fall offen und vielleicht einen Tisch frei. Scheiße kalt ist es geworden, jetzt, wo es fast Winter ist. Aber die Kälte, die von innen herauskommt, ist noch massiv unangenehmer und vor allem unberechenbarer. Mittlerweile ist der nicht einmal fünf Minuten lange Weg von der Wohnung zum Café schon im Blindflug einprogrammiert. Alle paar Tage macht er das in der Hoffnung auf Inspiration.
Die Geräuschkulisse ist wie immer angenehm wirr, ein bisschen leer für einen Sonntagvormittag, findet der namenlose Schreiber mit der Blockade. Dafür ist der Platz in der Ecke neben dem Fenster noch frei. Perfekt, um sich vor der Welt zu verstecken und diese doch aufmerksam zu beobachten. Die Geschichte wird wieder lebendig und das Buch liegt aufgeschlagen vor ihm auf dem Tisch. Aber heute läuft es andersherum, denn obwohl der Schreiber den Immendorff bei seinen letzten Atemzügen begleitet, wird ihm dieser intime Moment mit dem Künstler nicht vergönnt. Den Blick kann er förmlich auf sich liegen fühlen. Unangenehm starr und fragend. Fast schon mit vulgärer Intensität sieht ihn diese Frau an, die zwei Tische weiter sitzt und das Gesicht in die Hand gestützt hat.
Weil das schon eine Weile so geht, beschließt der Schreiber, ohne einen weiteren Impuls von ihr, doch mal eben aufzusehen. Noch immer liegt ihr Blick ruhig auf ihm, trifft für einen kurzen Moment auf das schwarze und luftige Nichts hinter seinem Seelenfenster und wird dann unmerklich weicher.
»Haben Sie mal was von ihr gesehen?«, fragt die Fremde ohne Vorwarnung. Dass sie die Frau von Immendorff meinen muss, ist ihm klar, so viele Frauen kommen in dem Buch ja nicht vor, die etwas schaffen, das man sich ansehen könnte.
Weil er ihre Frage nicht mit einem Ja beantworten kann, schüttelt er nur langsam den Kopf und wartet auf einen weiteren Kommentar von der Frau, die er bei genauerem Betrachten schon einmal hier gesehen hat. Eigentlich sogar oft schon. Weil er aber nicht nach Gesprächen, sondern nach Ideen sucht, ist sie ihm als Teil des Café-Versums auch nicht großartig aufgefallen. Mit dem Inventar verschmolzen. Sie ist vielleicht in seinem Alter, Ende zwanzig, Anfang dreißig und eigentlich auch nicht unansehnlich. Im Gegenteil, aus rein objektiver Sicht macht sie was her, hat diesen schwarzen Pulli mit dem übergroßen Kragen an und kurze rotbraune Haare. Ziemlich kurz.
Sie spielt mit dem Kaffeelöffel rum, dreht ihn zwischen ihren Fingern in alle Richtungen. Es folgt keine Antwort von ihr, nur ein homöopathisches Lächeln, das sie ihm zuwirft, und ihr Blick geht wieder verträumt auf die Tasse, danach kurz zur Wand und noch einmal kurz zu ihm rüber. Aber er liest bereits weiter in seinem Buch, versucht, sie zu ignorieren. Dabei hat sie so etwas an sich, was man eine böse Aura nennen könnte, ein Gewittergrollen, das einem die bevorstehende Apokalypse verkündet. Von mittelschweren Umweltkatastrophen und apokalyptischen Frauenfiguren hat er eigentlich genug. Trotzdem kann er es nicht lassen, sie wenigstens noch einmal für einen Bruchteil einer Sekunde anzusehen, weil sie mindestens weiß, wer Immendorff ist, und das Buch gelesen hat.
Die Blicke der beiden Akteure im Raum treffen sich und schaffen eine seltsam beleuchtete Bühne, die keine Zeit und keinen Raum kennt.
»Entschuldigen Sie bitte«, sagt sie und lächelt ihn verlegen an. Volle Breitseite. Ein Lächeln, das mehr ihren Augen entspringt als ihren Lippen.
»Kennen Sie sich aus mit Oda?«, fragt er sie trocken und schlägt das Buch fast lautlos zu, obwohl er nur noch vier Seiten zu lesen gehabt hätte.
»Auskennen kann man das nicht nennen, interessieren vielleicht.«
»Was ist Ihre Erkenntnis zum derzeitigen Standpunkt?«, will der Namenlose wissen und ist bereits unbewusst in ihrem Netz kleben geblieben. Aber sie ist keine Schwarze Witwe, eher ein Fisch, der sich in einem Netz verfangen hat und Hilfe braucht. Wie passend zur Thematik der momentanen Ausstellung im Ypsilon. Fischgesellschaft heißt sie. Sind wir alle in Netzen gefangen oder knüpfen wir sie nur, um das Glück einzufangen? Der erste Gedanke mit Inhalt. Seit Wochen. Jetzt muss er unweigerlich lächeln, ein Ansatz.
Sie legt den Kopf etwas schief. »Wissen Sie, was ihr Name bedeutet? Oda Jaune, der gelbe Schatz?«
Es sei ihm nicht entgangen, während er das Buch gelesen hat, sagt er darauf und ist gespannt auf die Analyse der Unbekannten.
»Ich muss immer an die Gegenüberstellung des Guten und Schlechten denken, wenn ich den Namen höre. Gelb als Farbe des Unheils, verstehen Sie?« Sie nimmt sein Nicken zur Kenntnis, das auf ihre rhetorische Frage mit zusammengezogenen Augenbrauen folgt. »Gelb als Symbol für Gold,