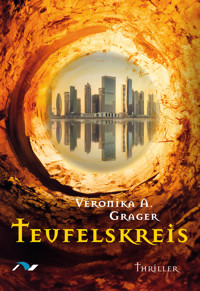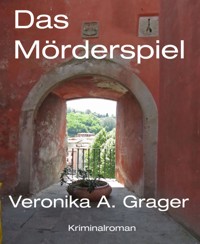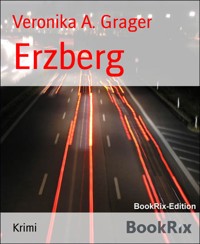Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Als die ehemalige Polizistin und Wiener Detektivin Stella Marini zwei neue Fälle übernimmt, ahnt sie nicht, dass die ihr ganzes Leben für immer verändern werden. Plötzlich besteht ihre Frau-plus-Hund-Detektei noch aus einer Sekretärin, ehemals Tänzerin in Nachtclubs, dem amerikanischen Partner Barry Denton, der aussieht wie ein Model für Indianerfilme und dem arbeitslosen Hacker Tippi.Mit dieser Truppe stolpert das Büro Denton-Marini bei den Ermittlungen zu einem verschwundenen Ehemann und dem Mord an einem Wissenschaftler in die undurchsichtige Welt der US-Geheimdienste. Barrys Schwester Sam, die als Reporterin in Afghanistan einem fiesen Agenten der USA auf der Spur ist, bringt weiteres Licht in die Sache, als sich herausstellt, dass der vermutlich auch in Stellas Ermittlungen eine Rolle spielt. Das Aufdröseln der Kriminalfälle, die anscheinend zusammenhängen, führt das Team und ihre Mitarbeiter von Wien über Ramstein bis nach Washington. Und was Sam in Afghanistan aufdeckt, beschäftigt sie bis in die Gegenwart – dem unrühmlichen Abzug der Besatzer und Blitzübernahme des Landes durch die Taliban.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin:
Veronika A. Grager wurde in Wien geboren und ist dort auf einem Bauernhof aufgewachsen. Nach einem interessanten und erfolgreichen Berufsleben trat sie 2005 in den Unruhestand und beschloss, ihrem Hobby intensiver nachzugehen und einen Roman zu schreiben. Der erste war eine Liebesgeschichte, der nächste ein Krimi. Wer weiß, dass sie schon als Kind ihre Puppen im Garten begraben hatte - sie wollte lieber einen Teddy -, wird sich darüber nicht wundern, dass ihr Krimis zu schreiben viel mehr Spaß bereitete. Das war die Geburtsstunde einer unerwarteten Karriere als Nachwuchsautorin im Rentenalter.
Heute lebt sie mit ihrem Mann und zwei großen Hunden in einem Dorf im südlichen Niederösterreich, wo noch immer Pech aus dem Harz der Bäume gewonnen wird, und wo auch ihre erste Regionalkrimiserie spielt.
Mehr Informationen auf www.grager.at
Neben Romanen und Kurzgeschichten wurden bisher folgende Kriminalromane aus ihrer Feder veröffentlicht:
„Erzberg“ (2008)
„Tote nur nach Voranmeldung“ (2010)
„Nanobots“ (2011, 1. Aufl.)
„Gnadenlos“, (2012)
„Saupech“ (2013)
„Sautanz“ (2014)
„Schlossteichleich“ (2015)
„Wer mordet schon in Niederösterreich“, Kurzkrimis, mit Jennifer B. Wind (2016)
„Sauglück“ (2017)
„Teufelskreis“ (2020, medimont)
„Nanobots“ (2022, 2. deutl. erweiterte Aufl.; medimont)
Veronika A. Grager
Nanobots
Gefährliche Teilchen
Thriller
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieser Roman ist ein Produkt der Fantasie. Jegliche Ähnlichkeiten mit realen Personen – lebenden oder toten – und Geschehnissen wären reiner Zufall.
Neuauflage (2. korr. und deutl. erw. Auflage)
©2022 by medimont verlag gmbh, 86453 Dasing, Marienstr. 31
Lektorat und Redaktion: Wolfgang K. Ernst
Umschlaggestaltung: Amalie v. Spreti, München
Umschlagabbildungen: Gesetzt in Adobe InDesign im Verlag
Druck und Bindung: ScandinavianBook, DK-6300 Gravenstein
Printed in the EU
Die erste Auflage erschien unter: Veronika A. Grager: „Nanobots“,
Murnau am Staffelsee: p.machinery, 2011
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
eISBN: 978-3-911172-66-0
Sie finden uns im Internet unter:
www.medimont.deBestell-Nr.: 35016
Für Manfred –Danke für ein Vierteljahrhundertwundervoller Partnerschaft
Inhalt
Über die Autorin
Washington Post, 25. Oktober 2014
Wien, 27. August
Wien, 28. August
Little Rock, 10. September
Wien, 29. August
Springfield, 11. September
Wien, 1. September
Washington, 15. September
Wien, 1. September
Tucson, Biosphere 2, 15. September
Wien, 2. September
Little Rock, 15. September
Wien, 3. September
Washington, 16. September
Wien, 8. September
Tucson, 20. September
Wien, 11. September
Tucson, 21. September
Wien, 15. September
Washington, 22. September
Wien, 20. September
Little Rock, 22. September
Wien, 22. September
Dallas, 24. September
Frankfurt am Main, 25. September
Wien, 25. September
Wien, 26. September
Kaiserslautern, 26. September
Wien, 27. September
Pirmasens, 28. September
Pirmasens, 29. September
Wien, 1. Oktober
Wien, 2. Oktober
Wien, 6. Oktober
Springfield, 6. Oktober
Biosphere 2, 15. September
Springfield, 6. Oktober
Springfield, 7. Oktober
Deutschland, 15. Oktober
Wien, 15. Oktober
Wien, 16. Oktober
Washington, 17. Oktober
Islamabad, 16. Oktober
Washington, 17. Oktober
Islamabad, 17. Oktober
Wien, 17. Oktober
Auf dem Weg nach Kabul, 17. Oktober
Nahe Kabul, 18. Oktober
Washington, 20. Oktober
Namaz Asay, 20. Oktober
Namaz Asay, 22. Oktober
Washington, 23. Oktober
Kunduz, 23. Oktober
Washington, 24. Oktober
Washington, 27. Oktober
Springfield, 30. Oktober
Springfield, 3. November
Springfield, 4. November
Buffalo, 5. November
Springfield, 5. November
Buffalo, 5. November
Springfield, 6. November
Buffalo, 8. November
Springfield, 8. November
Buffalo, 8. November
Washington Post, 12. November
Springfield, 12. November
Wien, 17. November
2021: Wien, 5. August
München, 5. August
Wien, 6. August
München, 7. August
Kabul, 7. August
München, 7. August
Kabul, 8. August
München, 9. August
Kabul, 9. August
Wien, 10. August
Kabul, 14. August
Wien, 16. August
Kurz vor Jalalabad, 16. August
Wien, 17. August
Jalalabad, 17. August
Wien, 17. August
Jalalabad, 18. August
Wien, 19. August
Jalalabad, 20. August
In einem Dorf nördlich von Jalalabad, 21. August
Daman, 22. August
Daman, 23. August, kurz nach Mitternacht
Kabul, Military Airbase, 24. August
Wien, 25. August, Nacht
Ramstein, 25. August
Wien, 28. August
Epilog
Danksagung
Quellen/Recherche
Washington Post, 25. Oktober 2014
Schießerei bei Party des Verteidigungsministers!
Die jährliche Charity Party der DeMonts zugunsten behinderter Kinder fand durch den Überfall einer Terrorgruppe ein blutiges Ende. Es gab mehrere Tote. Auch die Gattin DeMonts befindet sich unter den Opfern. Die Täter sind tot oder flüchtig. Bisher hat keine Organisation die Verantwortung für den Überfall übernommen.
Zwei Monate zuvor …
Wien, 27. August
Rita Prskavec warf einen Blick aus dem Fenster. Es hatte zu regnen aufgehört. Rita nahm den Müllsack auf, den sie neben der Eingangstür abgestellt hatte. Der musste auch mit. Das Vorzimmer stank. Sie verließ ihre winzige Wohnung und hörte, wie die alte Tür ächzend ins Schloss fiel. Ein Wunder, dass es sich noch sperren ließ. Bei nächster Gelegenheit musste das repariert werden!
Im engen Lichthof huschte sie flotten Schrittes zu den großen Müllcontainern. Nur nirgends anstreifen oder in die schleimigen Pfützen treten! Alles in diesem Hof war von Taubenkot verdreckt. Dazu stank es bestialisch von den großen Mistkübeln. Gott sei Dank gingen die Fenster ihrer Wohnung zur Straße hinaus und nicht in den Lichthof.
Rita öffnete den nächsten Müllcontainer. Verdammt, roch das widerlich! Millionen Fliegen surrten aus der Tonne. Der schreckliche Geruch verstärkte sich noch. Nur schnell den Müll loswerden und den Deckel wieder schließen. Rita trat widerstrebend näher und warf ihren Müllbeutel schwungvoll in den Container. Dabei sah sie etwas, das ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ.
In dem Container lag ein Mensch. Viel konnte sie von dem Typ nicht erkennen. Na toll, jetzt kam das Frühstück auch noch hoch! Sie trat ein wenig zur Seite und erbrach sich würgend solange, bis absolut nichts mehr in ihrem Magen war und nur noch bitterer Magensaft kam.
Rita taumelte zurück ins Haus. Sie suchte ein Taschentuch und wischte ihren Mund ab. Verdammt! Warum musste ausgerechnet sie eine Leiche finden? Sie würde zu spät zur Arbeit kommen.
Sie fischte ihr Handy aus der Handtasche. Wählte mit zitternden Fingern den Polizeinotruf und meldete den Leichenfund. Sie beschrieb alles genau und sagte dann, dass sie in ihrer Wohnung warten würde. Neben der Leiche hielt sie es echt nicht aus. Gleich danach rief sie ihren Chef an. Er klang wie immer muffig.
»Sie kommen schon wieder zu spät!«, schnauzte er sie an, bevor sie außer ihrem Namen irgendetwas von sich geben konnte.
»Es tut mir leid. Aber ich habe soeben in unseren Müllcontainern eine Leiche entdeckt. Die Polizei hat mir gesagt, dass ich bleiben muss, weil sie meine Aussage brauchen. Ich weiß noch nicht, wann ich kommen kann.«
»Ich bin Ihre dummen Ausreden leid. Wenn Sie bis zehn nicht hier aufkreuzen, sind Sie gefeuert!« Und damit legte er auf. Arschloch! Bis zehn würde sie es nie schaffen. Ihre Uhr zeigte ja schon halb neun.
Ach, was soll’s? Diesen miesen Job zu verlieren ließ die Welt nicht untergehen. Sie putzte in einem Nachtklub. Eigentlich wollte sie dort Tänzerin werden. Der Besitzer hatte sie beim Vortanzen fürs Pole Dancing kurz angesehen, mit einem Blick, der sich richtig beleidigend anfühlte und wohl genauso gemeint war, denn er hatte ihr dann den Putzjob angeboten. Weil sie dringend Geld gebraucht hatte, nahm sie ihn an und beschloss, sich weiter umzusehen. Das lag fünf Monate zurück.
Warum nur war sie zu faul gewesen, sich um einen anderen Job zu bemühen? Aber jetzt musste sie etwas tun. In diesen ekligen Klub wollte sie nie wieder zurück! Sie drückte auf Wahlwiederholung.
»Was ist denn noch?«, meldete sich ihr übellauniger Chef zur Begrüßung.
»Nichts! Schieben Sie sich Ihren Scheißjob in den Arsch! Ich kündige.«
»Wunderbar. Und Sie brauchen hier auch gar nicht mehr anzutanzen. Alles, was Sie noch ausständig haben, überweisen wir Ihnen. Ich will Sie hier nicht mehr sehen.«
»Ganz meinerseits.«
Rita warf das Handy angewidert auf den Tisch. So ein Kotzbrocken! Einen Toten zu finden, war nicht angenehm. Die Begleiterscheinung schon eher. Endlich fand sie die Kraft und den Mut, diese eklige Arbeit hinzuwerfen.
Nicht nur die Tätigkeit widerte sie an. Alles, was in dem Lokal lief, war seltsam. Da verkehrten Leute, die sie niemals in einem derartigen Etablissement vermutet hätte. Wissenschaftler zum Beispiel, wie der freundliche Herr von neulich. Oder der Mann, der sie vor ein paar Tagen um ein Glas Wasser gebeten hatte und der aussah, als hätte er einen Geist gesehen. Die kamen und gingen zu allen möglichen und unmöglichen Zeiten. Und Typen, die so heruntergekommen oder schleimig wirkten oder eindeutige Verbrechervisagen hatten, dass sie sich wunderte, dass der Türsteher sie herein ließ. Die Bude war einfach nicht astrein. Das spürte sie im Urin.
Rita schlüpfte aus ihren hochhackigen Schuhen. Für das Interview mit der Polizei würden es die bequemeren Trotteurs wohl auch tun.
Rita empfing einen der Polizisten in ihrem winzigen Wohnzimmer. Obwohl die Fenster weit offen standen, roch man immer noch den Mief vom Abfall. Bei der Hitze musste sie das Zeug jeden Tag entsorgen. Aber nach dem heutigen Vorfall würde es ihr nicht leicht fallen, den Lichthof mit den Müllcontainern wieder zu betreten.
Der junge schüchterne Polizist nahm ihre Daten auf. Wie sie den Toten gefunden hatte. Ob sie ihn kannte.
»Na, hören Sie. So wie der aussieht, würde ihn vermutlich selbst die eigene Mutter nicht erkennen. Aber ich glaube nicht, dass es jemand aus unserem Haus ist. Die meisten Mieter sind ältere Frauen oder Ausländer. Und der sah eher wie ein junger Inländer aus, denn die Leiche hat kurze blonde Haare. Mehr konnte ich nicht erkennen. Er liegt ja mit dem Gesicht nach unten im Container. Außerdem war er bereits teilweise mit Müll bedeckt. Ich verstehe ohnehin nicht, wieso ihn nicht schon jemand vor mir gefunden hat. Da haben ja schon mindestens zehn andere Leute ihren Mist auf ihn drauf geworfen.«
Der Polizist machte sich gewissenhaft Notizen in ein kleines Buch.
»Die anderen Parteien werden wir auch noch befragen.«
Der junge Beamte wollte eben ihre Wohnung verlassen, als es an der Tür klingelte. Ein älterer Polizist stand draußen. Sein Gesichtsausdruck war alles andere als freundlich.
Er fuhr sie an: »Der Tote hat in seiner Tasche eine Visitenkarte von Ihnen. Auf der Rückseite steht handschriftlich: Komm um sieben zu mir. Ich kann dir helfen. Was haben Sie dazu zu sagen?«
Rita blieb die Spucke weg. Wollten die ihr jetzt einen Mord anhängen? An jemandem, den sie gar nicht kannte?
»Hören Sie, ich weiß nicht, welche Spielchen Sie mit mir treiben. Aber ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Visitenkarte besessen! Also, was soll das?«
Der griesgrämige Polizist nickte nur.
»Sobald wir wissen, wie lang der Mann tot ist, werden wir Ihr Alibi überprüfen. Sie denken am besten gleich schon einmal darüber nach, was Sie die letzten drei Tagen gemacht haben. Und zwar jede Stunde des Tages. Im Übrigen sollten Sie in Ihrer Wohnung ab sofort nichts putzen oder verändern.«
»Wieso denn das?«
»Das würde bei einer Durchsuchung nach Beseitigung von Spuren oder Beweisen aussehen.«
So ein kranker Hirni! Warum hätte sie einen ihr völlig unbekannten Mann umbringen sollen? Und wie bitte in den Container hieven? Die Bullen konnten sie mal! Aber das kam davon, wenn man die gesetzestreue Bürgerin spielen wollte. Sie hätte einfach zur Arbeit fahren und die Meldung der Entdeckung einer Leiche einem anderen Hausbewohner überlassen sollen. Wie schon etliche vor ihr, die nicht so dämlich waren wie sie. Sie könnte sich jetzt noch ohrfeigen.
Als sie Stunden später zum Einkaufen ging, war die Straße immer noch von den Einsatzwagen der Polizei zugeparkt. Die Leiche war bereits abtransportiert worden, das hatte sie vom Fenster aus gesehen. Aber jetzt wurden die Spuren gesichert, der Müll aus den Containern in große Plastiksäcke verfrachtet und abtransportiert. Musste ein irrer Job sein, das stinkende Zeug auf brauchbare Hinweise zu durchwühlen! Rita schüttelte sich. Da war sogar der Putzjob in der Bar, den sie heute gekündigt hatte, noch toll dagegen.
Auf dem Rückweg kaufte sie sich eine Zeitung. Am besten fing sie sofort damit an, die Stellenanzeigen zu lesen. Sie hatte zwar einen kleinen Notgroschen gespart, aber der würde höchstens ein paar Wochen reichen. Bis dahin brauchte sie neue Arbeit! Und ein paar Wochen waren schnell um.
Vor ihrer Tür stand der griesgrämige Beamte und rauchte eine Zigarette. Vermutlich stand er schon länger dort. Denn am Boden lagen mehrere ausgetretene Kippen.
»Na endlich«, knurrte er.
»Ich hab doch nicht ahnen können, dass Sie mich schon wieder heimsuchen«, ging Rita gleich in die Defensive.
»Können wir hineingehen oder wollen Sie auf dem Flur mit mir reden?«
Der Kerl hatte eine Art am Leibe, die Rita auf die Palme brachte. »Ich geh rein. Was Sie machen, ist Ihr Problem«, entgegnete sie schnippisch.
»Schätzchen, da täuschen Sie sich gewaltig. Nichts davon ist mein Problem. Die Probleme sind alle auf Ihrer Seite.«
Der Blödmann ging immer noch davon aus, dass sie etwas mit der Sache zu tun hatte. Sie musste sich ein wenig zurückhalten. Sie wollte nicht in eine Mordgeschichte hineingezogen werden, nur weil sie einen dämlichen Polizisten gegen sich aufbrachte. Rita schlüpfte aus den Schuhen und schlenkerte sie geübt in die Ecke zwischen Wohnzimmer- und Klotür.
»Na, dann kommen Sie schon weiter.« Rita wies ihm mit dem Arm in Richtung Wohnzimmer.
»Der Tote von heute Vormittag heißt Peter Droemer. Sagt Ihnen der Name was?«
Rita schüttelte den Kopf. »Nie gehört.«
»Wir haben seine Brieftasche gefunden. Hier das Foto aus dem Führerschein. Haben Sie ihn schon einmal gesehen?«
Er klappte den altmodischen, dreiteiligen rosa Schein vor ihrem Gesicht auf. Rita rutschte auf der Couch nach vorne, damit sie besser sah. Scheiße, das war doch der Typ, dem sie vor ein paar Tagen ein Glas Wasser spendiert hatte. Vermutlich sollte sie den Mund halten. Aber sie konnte einfach keine Information verschweigen.
»Ich glaube, der war einmal in dem Schuppen, in dem ich bis heute geputzt habe.«
»Hat der Schuppen auch einen Namen?«
»›Chez Gerard‹«, erwiderte Rita und legte so viel Verachtung wie möglich in diese drei Silben. »Ein Nachtklub. Mit komischem Publikum. Und der Chef ist ein Arschloch. Ich habe heute gekündigt. Aber er hätte mich ohnehin rausgeworfen. Weil ich den Toten fand und auf die Polizei warten musste, wäre ich zu spät gekommen. Er hat mir nicht geglaubt.«
»Und wann und wobei haben Sie den Typen gesehen?«
»Er war blass um die Nase und sah aus, als ob er gleich aus den Latschen kippen würde. Er bat mich um ein Glas Wasser. Ich habe es ihm gebracht. Das war es dann! Passiert ist das vor drei oder vier Tagen. Mehr weiß ich nicht von ihm.« Der Polizist nickte und fischte einen Kugelschreiber aus seinem Sakko.
»Haben Sie ein Blatt Papier? Ich brauche von Ihnen eine Schriftprobe. Schreiben Sie schnell dreimal hintereinander »Komm um sieben zu mir. Ich kann dir helfen« auf den Zettel. Wir möchten Ihre Schrift mit der Nachricht auf Ihrer Visitenkarte vergleichen.«
»Es ist nicht meine Visitenkarte. Ich habe keine. Nie welche besessen. Wofür auch? Um mich als Putze zu bewerben?« Rita lachte abfällig. »Oder als Tänzerin in einem Nachtklub? Glauben Sie mir, da braucht man ganz andere Referenzen.«
Sie wiegte sich in den Hüften und streckte ihren Busen vor.
Der Kerl blieb davon völlig unbeeindruckt.
»Wir werden sehen. Schreiben Sie jetzt bitte.«
Rita seufzte. Schreiben war nicht gerade ihre große Stärke.
Also schrieb sie langsam mit ihrer kindlich runden Schrift
Kom um siben zu mir, ich kan dir helven …
»Das reicht«, unterbrach der Polizeityp sie.
»Sagen Sie, haben Sie auch einen Namen?«
»Mein Name ist Pokorny, Walter Pokorny.«
Er nahm Papier und Kuli an sich und steckte beides in seine linke Rocktasche.
›Mein Name ist Bond, James Bond‹, äffte Rita ihn innerlich nach und bemühte sich angestrengt, nicht zu grinsen.
»Glauben Sie allen Ernstes, dass ich den Burschen umgenietet und dann in den Mülleimer gekippt habe? Sehen Sie mich doch an. Einssiebzig groß, vierundfünfzig Kilo. Ich bin froh, wenn ich mein eigenes Gewicht heil die Stiegen rauf und runter bringe. Der Mann im Klub war sicher einen Kopf größer als ich, wenn er es überhaupt war, und hat mindestens neunzig Kilo gewogen. Wie hätte ich den Kerl in den Hof bringen sollen? Und dann noch in die Mülltonne werfen?«
Walter Pokorny wiegte seinen Kopf.
»Komplize?«, murmelte er.
»Ach ja. Die Männer stehen bei mir Schlange, um unliebsame Kerle aus dem Weg räumen zu dürfen!«
»War der Mann unliebsam?«
Rita biss sich auf die Lippen. Das war wohl keine besonders glückliche Formulierung gewesen. Warum konnte sie nicht einfach den Mund halten?
Sie schüttelte den Kopf. »Ob Sie es mir glauben oder nicht, ich weiß es nicht. Ich habe ihn nur dies eine Mal gesehen.«
Wien, 28. August
Stella Marini knallte den Telefonhörer auf die Basisstation. »Dieser verdammte Macho!«
Da sie mit Ausnahme ihres Hundes allein im Büro war, konnte sie nur die Wand anschreien. Warum bekam sie immer wieder diese miesen Scheidungsgeschichten?
Stella arbeitete seit fünf Jahren als Privatdetektivin. Doch sie hatte manchmal das Gefühl, dass an ihrer Bürotür ein für sie unsichtbares Schild angebracht sein musste, das ihre potenziellen Kunden warnte: Nimmt nur Scheidungsfälle und Personenschutz. Verdammt noch mal! Sie wollte endlich richtige Fälle. Eine verschwundene Millionenerbin wiederfinden. Den Bankangestellten auftreiben, der mit dem Inhalt des Safes abgehauen war,. Die geklauten Diamanten einer Society Lady zurückklauen. Das waren die Jobs, die sie sich erträumte! Aber was bekam sie? Fälle wie den Affen, den sie eben am Telefon hatte. Ein absolutes Arschloch, der seine Frau auf die Schnelle billig loswerden wollte. Zufälligerweise war die ihm aber treu. Stella beobachtete sie seit drei Wochen und hatte nichts feststellen können. Die einzigen Männer, mit denen die Frau überhaupt Kontakt hatte, waren der Postbote, der Mann an der Tankstelle und der Kassier im Supermarkt. Ansonsten chauffierte sie die beiden Kinder zu den Schulen, Nachhilfen, Sportveranstaltungen und Freizeitvergnügen und holte sie wieder ab. Sie kaufte ein, schleppte kistenweise Vorräte ins Haus, putzte und werkte ununterbrochen. Sie hatte keinen Tennislehrer, ging nicht einmal mit Freundinnen aus. Und als sie das eben dem Ekelpaket am Telefon mitteilte, antwortete der: »Dann finden Sie was. Dafür bezahle ich Sie.«
Was dachte sich dieser Wichser eigentlich? Sollte sie einen Freund für seine Frau erfinden oder meinte er, sie sollte sie gleich mit einem Mann verkuppeln? Wie sie das ankotzte!
Sie versank wieder in ihrem persönlichen Blues. Personenschutz, ihr zweites Standbein, war auch nicht das Gelbe vom Ei. Viele Promis und etliche, die glaubten, dazuzugehören, engagierten heutzutage Personenschutz. Das war derzeit echt in. Stella lernte, dass das im Wesentlichen zwei Gründe hatte: Erstens, um die Bekannten, Freunde und Feinde zu beeindrucken. Mit einem Personenschützer verkündet man der Umwelt: Ich bin ein Mensch von Bedeutung! Zweitens, weil viele von den Leuten niemanden hatten, mit dem sie normal reden konnten. Das heißt, diese Jobs bestanden meist darin, jemanden abzuholen, eventuell auch zu chauffieren. Sich Geschichten reindrücken und manchmal wie ein Dienstmädchen behandeln zu lassen. Ein dickes Honorar einzusacken und gelegentlich noch ein fürstliches Trinkgeld dazu, wenn es ihr gelungen war, nicht allzu gelangweilt herumzustehen und vielleicht noch einen guten Rat beizusteuern. Ganz selten einmal musste sie Neugierige zurückdrängen und erst ein einziges Mal war sie so weit gegangen, ihre Hand auf die Waffe im Holster zu legen. Doch da war der Spuk auch schon vorüber.
Bertoni, ihr Schäferhund, gleichzeitig mit ihr aus dem Polizeidienst ausgeschieden, schnarchte leise unter dem Tisch. Er war es gewohnt, dass sie mit sich selbst redete.
Stella konnte sich nicht wirklich beklagen. Das Geschäft lief mittelprächtig, sodass sie sich nicht gerade nach einer Mitarbeiterin umsehen musste. Aber sie nagte auch nicht am Hungertuch. Ihr Büro lag zwar nicht in der City, aber in einer ruhigen Gegend, in der Grundackergasse in Wien Favoriten, mit relativ viel Grün rundherum. Die Einrichtung war nicht protzig, dafür zweckmäßig. Sie besaß eine schöne Wohnung, die sie sich auch leisten konnte. Sie litt einfach nur an Langeweile. Kein fordernder und aufregender Fall weit und breit.
Bertoni ließ ein leises Wuph ertönen und meldete damit einen Besucher an.
Ein zaghaftes Klopfen an der Eingangstür riss Stella endgültig aus ihrem Selbstmitleid. Sie fuhr sich mit beiden Händen durch das verwuschelte kurze Haar. Vermutlich sah sie wieder aus, als würden Vögel in ihrem Hinterkopf nisten. Was soll’s. Keine Zeit mehr, sich jetzt noch zu behübschen.
»Herein! Ist offen«, rief sie.
Die Eingangstür bewegte sich in Zeitlupe. Kam da jetzt ein Einbrecher oder Kundschaft? Doch eher Letzteres. Mittlerweile stand die Tür ganz offen und eine junge Frau trat zaghaft näher. Ihre ganze Erscheinung signalisierte: Ich bin gar nicht da. Ihre schleppenden Schritte und ihr unsteter Blick lieferten das Bild eines zutiefst verstörten Menschen.
Stella sprang auf und begrüßte die Frau. Die Hand, die ihre umschloss, war eiskalt und der Händedruck zart wie die Berührung durch ein herabfallendes Blatt im Herbst.
»Mein Name ist Stella Marini. Bitte nehmen Sie doch Platz.« Damit bugsierte sie die Frau in den Besuchersessel, bevor diese umkippen konnte. Bertoni hob kurz den Kopf. Keine Gefahr in Sicht. Er sank wieder in seligen Schlummer.
Als sie die Unbekannte im Sessel geparkt hatte und diese dort wie ein Häufchen Elend in sich zusammensank, fragte Stella, was sie für sie tun könnte.
»Mein Mann ist verschwunden.«
Die Stimme leise. Jedes Wort kam zögerlich über die Lippen.
Die Frau wirkte, als stünde sie unter Schock.
»Wann ist Ihr Mann denn verschwunden?«
»Vor vier Tagen.«
»Haben Sie eine Vermisstenanzeige aufgegeben?«
Die Frau nickte.
»Aber die Polizei hat Ihnen gleich gesagt, dass Ihr Mann wahrscheinlich nur fremdgeht, und sicher bald wieder auftauchen wird.«
Die Mundwinkel zuckten andeutungsweise nach oben, wie zu einem kurzen Lächeln.
»So ähnlich. Jedenfalls werden sie nichts machen. Sie meinten, die meisten Männer tauchen von selbst wieder auf. Und sei es nur, um ihre Wertsachen abzuholen und die Scheidung einzureichen.«
Ach ja. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Man durfte nie vergessen, dass der Spruch rein männlich war. In einem Berufsstand, in dem selbst Frauen, die dort arbeiteten, heute immer noch als seltsam verirrte Mannweiber galten.
Stella musterte ihre Besucherin. Sie war groß und sehr schlank. Das Haar halblang und fast schwarz. Riesige ausdrucksvolle Augen. Diese Farbe hatte sie überhaupt noch nie gesehen. Dunkles Veilchenblau. Sie wirkte zart, ihre Armmuskulatur jedoch definiert. Die Hände gepflegt, kräftig. Die Kleidung dezent, aber gediegen. Kein Make-up. Verständlich, denn die Augen sahen aus, als hätte sie noch vor Kurzem geweint.
»Verraten Sie mir Ihren Namen?«, fragte Stella die Fremde.
»Mein Gott, entschuldigen Sie bitte. Wo hab ich nur meine Gedanken! Ich heiße René Oriocho.«
»Was kann ich für Sie tun, Frau Oriocho?«
»Bitte finden Sie meinen Mann.«
»Haben Sie ein Foto von Ihrem Mann?«, fragte Stella ihre Auftraggeberin.
»Hier.«
René Oriocho nahm eine Fotografie aus ihrer voluminösen Handtasche.
Dabei fiel ein Stapel Noten heraus und verteilte sich im Umkreis von einem Meter rund um sie.
»Ach herrje. Die Noten für heute. Jetzt ist alles durcheinander.« Sie sprang auf und hockte sich mitten in den Notensalat auf den Boden.
»Sie spielen ein Instrument?«
»Cello im Rundfunk-Sinfonieorchester. Heute Nachmittag haben wir eine Aufzeichnung. Und jetzt habe ich alles durcheinandergebracht.«
Resignierend schob René Oriocho die letzten Notenblätter zusammen. »Doch das ist im Moment noch meine kleinste Sorge.«
Stella war fast froh, dass der Frau die Noten aus der Tasche gefallen waren. Durch die Bewegung und die Ablenkung bekamen ihre Lippen wieder etwas Farbe. Sie sah zumindest nicht mehr aus, als würde sie jeden Moment umkippen.
»Erzählen Sie mir bitte, wie und wann Sie Ihren Mann zum letzten Mal gesehen haben.«
René Oriocho sank wieder in ihrem Stuhl zusammen.
»Am Sonntag. Er kam von der monatlichen Tour zurück. Einmal im Monat besuchte er die Kunden des Forschungsinstitutes für Baustoffe. Das ist immer anstrengend für ihn. Da ist er ziemlich fertig. Normalerweise kommt er schon am Samstag zurück. Am Sonntag mag er dann gar nichts unternehmen. Aber bis Montag hat er sich immer wieder erholt. Seine Arbeit dürfte ansonsten relativ langweilig sein. Er hat einen anspruchslosen Job, kaum Überstunden, nichts Aufregendes. Die einzige Abwechslung ist immer nur die Bundesländertour.«
»Ist Ihnen irgendetwas Besonderes aufgefallen?«
Frau Oriocho schüttelte den Kopf.
»Das habe ich mich selber schon hunderte Male gefragt. War er anders an diesem Tag? Mir ist nichts aufgefallen. Außer dass er später als sonst heimgekommen ist.«
Stella kaute an ihrem Bleistift und betrachtete das Foto, das ihr Frau Oriocho überreicht hatte. Leicht unscharf, aber der Mann deutlich zu erkennen. Ein ungewöhnlich gutaussehendes Exemplar. Groß, schlank, fast schlaksig. Das Haar um einige Schattierungen heller als das seiner Frau. Die Farbe der Augen konnte sie auf der Aufnahme nicht erkennen.
»Und was geschah dann?«
»Kurz vor acht am Abend läutete das Telefon. Andi ging ran und sagte mir dann, sein Chef habe angerufen, er muss nochmals weg. Der Chef braucht Unterlagen von ihm, aber weil er am nächsten Morgen zeitig den Flieger nach München erwischen muss, wäre er ihm dankbar, wenn er sie ihm am Abend noch vorbeibringen könnte. Andi sagte noch, ich solle nicht mit dem Essen auf ihn warten, aber es würde nicht lange dauern. Er gab mir einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Da habe ich ihn zum letzten Mal gesehen.«
René Oriocho würgte das Taschentuch in ihren Händen.
Stella lächelte Frau Oriocho aufmunternd an.
»Ihr Mann heißt also Andreas mit Vornamen, habe ich das richtig verstanden?«
Frau Oriocho nickte.
»Ich muss Ihnen noch eine unangenehme Frage stellen. Wie ist Ihre Ehe? Hat ihr Mann eine Freundin?«
René Oriocho blickte ihr offen in die Augen.
»Ausschließen kann man das nie. Aber wir führen eine harmonische Ehe. Es gibt überhaupt nur zwei Punkte, wo wir kleine Probleme haben. Einerseits habe ich meinem Mann mangelnden beruflichen Ehrgeiz vorgeworfen. Denn mit seiner Qualifikation hätte er sicher eine weit bessere Anstellung finden können. Zum anderen wollten wir Kinder. Und seit Jahren warten wir darauf, dass ich endlich schwanger werde. Ich glaube nicht, dass er eine Beziehung hat. Außerdem ist er gar nicht der Typ für so etwas.«
»Was für ein Typ ist er denn?«
René Oriocho legte ihren Kopf in den Nacken, den Blick zur Decke gewandt, ihre rechte Hand am Kinn. »Nachdenklich, ein wenig grüblerisch, in sich gekehrt. Ein bisserl der Typ zerstreuter Professor. Verlegt die Schlüssel oder das Telefon. Mit seinen Gedanken schwebt er oft in höheren Sphären. Andererseits humorvoll, liebevoll, ritterlich. Sie wissen schon, auf die altmodische Art. Hilft einer Frau in den Mantel, hält ihr die Tür auf und so.«
Bieder wirkte er auf dem Foto allerdings nicht gerade.
»Gut, Frau Oriocho. Jetzt brauche ich noch Namen und Adresse des Instituts, in dem Ihr Mann arbeitet und den Namen seines Vorgesetzten. Dazu noch eine Telefonnummer, unter der ich Sie erreichen kann. Sie bezahlen mich jetzt für drei Tage. Dann lege ich Ihnen meinen ersten Bericht vor. Möglicherweise habe ich Ihren Mann bis dahin schon gefunden oder er ist von sich aus wieder aufgetaucht. Wenn nicht, können Sie dann entscheiden, ob ich weitermachen soll. Aber auch ich behalte mir vor, den Fall nicht anzunehmen, wenn ich keine Aussicht auf Erfolg sehe. Sind Sie damit einverstanden?«
Frau Oriocho nickte. Stella notierte sich den Namen des Vorgesetzten, Doktor Bruno Margolies. Irgendetwas klingelte bei ihr im Unterbewusstsein. Diesen Namen hatte sie schon gehört. Aber in welchem Zusammenhang? Keinem angenehmen, wenn sie ihrem Instinkt trauen konnte. Plötzlich machte sich ein flaues Gefühl in ihrer Magengegend breit. Doch um nichts in der Welt hätte sie diesen Auftrag sausen lassen! Endlich tat sich einmal etwas.
Little Rock, 10. September
Samantha Evers trommelte ungeduldig auf die Tastatur ihres Laptops. Seit Tagen versuchte sie, eine Story zu recherchieren. Und stieß immer wieder an Mauern. Mauern des Schweigens, des Desinteresses oder der Gleichgültigkeit. Und wenn sie etwas auf den Tod nicht ausstehen konnte, dann Geschichten, bei denen sie nicht weiterkam.
Sam war Journalistin. Zweiunddreißig, geschieden und unabhängig.
Bis vor zwei Jahren hatte sie für einen Fernsehsender gearbeitet. Doch die dauernde Bevormundung und die ständigen Hinweise auf quotenträchtige Sensationsmeldungen gingen ihr derart gegen den Strich, dass sie beschloss, selbstständig zu arbeiten und ihre fertigen Reportagen den diversen Medien anzubieten. Sie verdiente im Schnitt zwar nicht viel weniger, doch ungleichmäßig verteilt. Dafür gestaltete sich die Arbeit um einiges befriedigender und vor allem wesentlich interessanter.
Im Augenblick recherchierte sie an einer Story, die spektakulär begann und plötzlich in der Versenkung verschwunden war. Und zwar auf allen Ebenen.
In der Wüste von Arizona stand ein eindrucksvolles Bauwerk: Biosphere 2. Ein von der Außenwelt völlig abgeschlossenes Ökosystem. Das zentrale Gebäude bestand aus einem Dom aus Glas und rostfreiem Stahl. Auf fast zweieinhalb Hektar überwachten mehr als eintausend Sensoren das Klima, die Luft-, Boden- und Wasserbeschaffenheit und lieferten die Daten an ein zentrales Kontrollsystem. Die Kuppel beherbergte fünf Ökosysteme: Regenwald, Savanne, Küste, Sumpf und Meeresstrand mit einer Korallenbank. Dazu landwirtschaftliche Anbauflächen und Arbeitsräume sowie Wohnstätten für die Menschen, die hier wohnten.
Seit 1991 fanden Versuche statt, die Aufschluss darüber geben sollten, wie sich Menschen auf fremden Planeten mit begrenzten Ressourcen ernähren, ihre Luft erneuern, oder die Abfälle recyceln konnten. Es handelte sich um eine kleine abgeschlossene Welt. Sie war derart hermetisch abgedichtet, dass sich dagegen die Raumstation ISS wie ein Sieb ausnahm. Die erste Gruppe von acht Leuten stellte einen bis heute ungebrochenen Rekord von zwei Jahren Aufenthalt in einer hermetisch abgeschlossenen Umwelt auf. Nebenbei demonstrierten sie eindrucksvoll, wie erfolgreich ökologische Landwirtschaft funktionieren kann.
Als sich 1996 der Milliardär Edward Bass, einer der Hauptsponsoren, aus dem Projekt zurückzog, wurde der Komplex der Columbia University übergeben, die dort Untersuchungen durch Studenten durchführen lassen konnte. Vermutlich aus Geldnot öffnete man Biosphere 2 auch für Besucher. Seither wurden keine Versuche mehr unter geschlossenen Bedingungen durchgeführt. Die Universität sollte das Gelände laut Vertrag bis 2010 betreiben. Doch Ende 2003 bekam die Hochschule einen neuen Präsidenten. Und der stellte die Kooperation mit der Betreibergesellschaft von B2 ein. Seitdem war lange Zeit nichts mehr von B2 in den Medien zu hören gewesen.
Plötzlich, vor einem halben Jahr, war unter erheblichen Medienrummel wieder ein achtköpfiges Team in den Dom eingezogen und die Anlage hermetisch verschlossen worden. Der Sprecher der Gesellschaft, die das Gebäude erworben hatte, sprach von Tests, die für die Weltraumfahrt in den kommenden Jahren von essenzieller Bedeutung sein würden. Hier gehe es nicht so sehr um die Fähigkeit, sich autark zu ernähren. Vielmehr darum, die sozialen und medizinischen Aspekte einer langen Abgeschiedenheit vom Rest der Menschheit wissenschaftlich zu erforschen. Die Ergebnisse sollten die Grundlagen für spätere Raumbasen auf dem Mond und Flüge zum Mars bilden.
Und danach hörte man nie wieder etwas von diesem Experiment.
Sam, einmal mehr bei ihrer Internetsuche erfolglos, hatte durchaus ein persönliches Interesse an dem Experiment. Einer der acht Insassen war ein Junge, der in der Nähe ihres Elternhauses gelebt hatte. Sie verband eine fast lebenslange Freundschaft, die einmal durch ein halbjährliches intimes Verhältnis und später durch längere Abwesenheit des einen oder anderen von ihnen unterbrochen wurde. Er hieß Peter Mangold und war ein eher unscheinbares Kind gewesen. Der erwachsene Peter war allerdings ein kraftstrotzender Kerl geworden. Als sie sich zuletzt gesehen hatten, erzählte er von der Army, der er als Berufssoldat diente.
Daher fand Sam es bemerkenswert, dass er an einem Experiment teilnahm, das zumindest offiziell als wissenschaftliche Arbeit einer privaten Stiftung zur Förderung der Raumfahrt auftrat. Die etwas sperrige Bezeichnung lautete AFISFAHUR – Agency for Interstellar Flights and Human Research. Sam notierte sich damals diese Bezeichnung, weil sie meinte, sie würde sich nie wieder daran erinnern.
Und jetzt gab es nichts über eine derartige Gesellschaft. Nicht die kleinste Notiz über den Betrieb von Biosphere 2. Keinerlei Angaben, wem die Anlage nun gehörte. Nicht eine Zeile dazu, dass dort ein Langzeitversuch lief. Es schien, als habe das Ding in der Wüste Arizonas nie existiert. Zumindest nach 2003 nicht mehr.
Resigniert schob Sam ihre Lesebrille auf die Stirn. Für heute hatte sie echt genug. Sie würde jetzt ins Fitnesscenter gehen und dann war sie mit einer ihrer ältesten Freundinnen verabredet. Erst eine Kleinigkeit essen und dann ins Kino gehen. Sie würden sich den nächstbesten Schmachtfetzen aussuchen. Gemeinsam lachen und weinen und sich in ihre Schulzeit zurückversetzt fühlen. B2 war vermutlich auch morgen noch ein Rätsel. Es konnte durchaus einen Tag warten.
Wien, 29. August
Rita saß eben beim Frühstück und studierte die Stellenanzeigen. Nichts Brauchbares für sie dabei. Wenn sie angezogen war, wollte sie in das Internetcafé zwei Gassen weiter übersiedeln. Da konnte sie die Jobbörse checken. Sie faltete die Tageszeitung vom Vortag zusammen und warf sie enttäuscht zu Boden. In dem Moment klingelte es an ihrer Tür. Wer kam denn schon in aller Herrgottsfrüh? Wobei das relativ war. Immerhin zeigte ihr Wecker elf Uhr dreißig.
Sie linste durch den Türspion. Nicht schon wieder! Ihr spezieller Freund Walter Pokorny stand draußen. Der hatte sie wohl echt in Verdacht.
»Komme gleich. Muss mir nur etwas überziehen.«
Vor der Tür hörte sie ein undeutliches Gemurmel. Sie warf sich schnell ein Sommerkleid über den Kopf, fuhr sich mit allen zehn Fingern durch das Haar und öffnete die Tür. Pokorny warf eben seinen Zigarettenstummel zu Boden und trat ihn aus.
»Herrgott! Haben Sie noch nie was von der Erfindung des Aschenbechers gehört? Ich muss das dann wieder wegputzen, sonst krieg ich Ärger mit dem Hausmeister!«
Pokorny murmelte etwas, das entfernt an ›Entschuldigung‹ erinnerte, bückte sich und hob die Kippe auf. Dann stand er mit dem Ding in der Hand da und wusste typisch nicht, wohin damit.
»Ach, geben Sie schon her!«
Rita ärgerte sich jedes Mal, wenn sie diesen Tollpatsch von Polizisten sah.
»Und, müssen Sie mich jetzt verhaften, oder was?«
»Sind Sie schuldig, dass Sie mich das fragen?«, entgegnete der Bulle.
›Herr, gib mir die Geduld, diesen Menschen zu ertragen, ohne ihm eine zu knallen.‹ Rita riss sich am Riemen und fragte mit unschuldigem Augenaufschlag: »Was führt Sie also um diese Uhrzeit zu mir?«
»Ich möchte von Ihnen wissen, wo Sie vorgestern Abend waren. Das ist der Todeszeitpunkt von Peter Droemer.«
»Vorgestern?« Rita schüttelte den Kopf. »Bis kurz vor acht hab ich im ›Chez Gerard‹ gearbeitet. Dann bin ich heimgefahren und war zu Hause.«
»Kann das irgendwer bestätigen?«
Schön langsam ging ihr dieser Pokorny echt auf den Geist.
»Wie lang ich in der Firma war, können dort alle bestätigen. Nach Hause brauche ich mit der Straßenbahn eine gute halbe Stunde oder ein bisserl länger, wenn ich eine gerade verpasse. Zu Hause lebe ich allein, wie Sie sehen, und daher wird es wohl keine Zeugen geben.«
Rita war sich bewusst, dass sich ihre Chancen, damit aus dem Kreis der Verdächtigen auszuscheiden, nicht gerade verbesserten.
»Aber warten Sie mal. Vorgestern hat mich Lilly angerufen. Das ist eine ehemalige Arbeitskollegin. Das muss so gegen halb zehn gewesen sein. Und wir haben länger miteinander gequatscht.«
»Geben Sie mir Lillys vollen Namen und die Adresse. Ich werde das überprüfen«, antwortete Pokorny.
»Herrgott noch einmal, Sie glauben wirklich, ich habe mit dem Tod dieses Mannes etwas zu tun!«
Pokorny zuckte die Schultern. »Was ich glaube oder nicht, ist ohne Belang. Sie gehören zu den Verdächtigen und ich muss Ihr Alibi überprüfen.«
Mit diesen Worten klappte er sein Notizbuch zu, in dem er die Adresse von Lilly notiert hatte, und verließ ihre Wohnung.
Rita schüttelte ratlos den Kopf. Warum sollte sie zu den Verdächtigen zählen? Wegen der komischen Visitenkarte, die ihren Namen trug, aber gar nicht von ihr stammte? Wer in aller Welt konnte ein Interesse daran haben, ihr einen Mord in die Schuhe zu schieben? Ob sie jetzt einen Anwalt brauchte? Nein, eher einen Privatdetektiv, der herausfand, wer den Mann erledigt hatte!
Sie hob die Zeitung vom Boden auf und suchte unter den Anzeigen, ob sie einen Detektiv fand. Fehlanzeige. Keine Annonce. Sie holte die Gelben Seiten des Telefonbuches aus dem Schrank im Vorzimmer. Wie schrieb man eigentlich Detektiv? Sie würde es einmal mit D am Anfang versuchen. Unter Detekteien wurde sie fündig. Mein Gott, was gab es da für riesige Anzeigen! Und jeder Zweite von denen hatte eine Adresse im ersten Bezirk. Die konnte sie sich ganz bestimmt nicht leisten! Sie studierte die kleinen Einträge. Dabei stieß sie auf einen, der sie ansprach.
Stella Marini
Auskunftei und Personenschutz
1100 Wien
Grundackergasse 15
Das klang solide und nicht nach Höchstpreisen. Sie schnappte sich das Telefon. Fragen, was das kostet, konnte sie ja einmal. Dann warf sie das Handy wieder auf den Tisch zurück. Besser, sich selbst ein Bild von der Tussi machen! Ihre Menschenkenntnis war ziemlich gut. Kein Wunder, bei ihrem Beruf. Sie war keine Nutte. Aber als ehemalige Tänzerin, die vorwiegend fast nackt auftrat, sammelt man so seine Erfahrungen. Und als Putzfrau sowieso.
Sie sah auf die Uhr. Freitag später Nachmittag. Sie hatte keine Ahnung, ob Detektive auch Freitag Frühschluss machten. Aber übers Wochenende war das Büro sicher nicht besetzt. Ihr Entschluss stand fest. Gleich Montag früh wollte sie die Tante aufsuchen.
Springfield, 11. September
Sam hatte sich entschlossen, wieder einmal nach Hause zu fahren. Ihre Eltern lebten immer noch in Springfield und waren restlos begeistert, Sam zu sehen. Am liebsten hätten sie ihre Tochter umsorgt. Doch sie hatte andere Pläne. Sie tätigte einen Anruf und sagte dann zu ihrer Mutter: »Warte nicht mit dem Essen auf mich. Ich treffe mich mit jemandem von früher und wir werden unterwegs essen.«
Damit verließ sie das Haus und ließ ihre Eltern ein wenig ratlos zurück.
»Hi, Judy, wie geht es dir?«
»Hallo, Sam.«
Judy war die aktuelle Freundin von Peter Mangold. Sie wusste zwar nichts über Sams früheres Verhältnis mit ihrem Peter, aber sie war immer schon ein wenig eifersüchtig gewesen. Dass sie heute zugesagt hatte, sich mit Sam zu treffen, war ein reines Wunder.
»Judy, hast du im letzten halben Jahr von Peter gehört?«
»Wieso fragst du?« Judy blickte sie misstrauisch an.
»Hör zu. Ich wollte über den laufenden Versuch im B2 berichten. Ich recherchiere seit mehr als einer Woche und erziele null Ergebnisse. Ich will dich nicht beunruhigen, aber wenn solche Versuche groß angekündigt werden und nach einem halben Jahr hört man gar nichts mehr darüber, dann ist meistens etwas schiefgelaufen. Aber was?«
Judy schluckte und plötzlich waren ihre Augen nass. »Ich glaube auch, dass etwas nicht in Ordnung ist. Peter durfte sich einmal im Monat melden. Diesen Monat ist die Meldung ausgeblieben.«
»Mein Gott, Judy, das tut mir leid. Vielleicht könnte ich helfen, wenn ich die Öffentlichkeit mobilisieren kann. Weißt du, welche Versuche dort liefen?«
Judy nickte. »Das darfst du aber niemals schreiben. Versprich es mir in die Hand.«
»Ich verspreche es.«
Judy strich sich die widerspenstigen dunklen Locken aus der Stirn. »Im Biosphere liefen verschiedene Versuche. Darüber hat Peter auch nicht viel gewusst. Oder er wollte mir nichts sagen. Außer, dass es Tests der Army waren. Er sollte als Versuchskaninchen für einen Impfstoff herhalten, der die Menschen im Weltall unempfindlich gegenüber kosmischer Strahlung machen soll.«
»Willst du damit sagen, dass Peter sich mit irgendetwas impfen ließ und dann großer Strahlenbelastung ausgesetzt wurde?«
Judy schluchzte. »Genau das. Ich habe versucht, ihm das auszureden. Aber er meinte, das wäre eine todsichere Sache.«
Todsicher war wohl der richtige Ausdruck dafür. Und wenn alle anderen Experimente auch von der Army veranstaltet wurden, dann war klar, warum man nirgends etwas darüber erfahren konnte.
»Ich werde einmal meine Fühler ausstrecken, ob ich mehr herausbekomme. Wenn ja, gebe ich dir sofort Bescheid.«
Judy lächelte unter Tränen. »Ich danke dir. Und ich möchte mich für mein früheres Benehmen dir gegenüber entschuldigen. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass Peter und du viel zu vertraut miteinander umgeht.«
Sam lachte. »Wir kennen uns seit dem Sandkasten. Wir sind Freunde, ein Leben lang. Vertraut auf eine andere Art als ihr beide. Wir haben nur berufsbedingt in den letzten Jahren viel seltener Kontakt miteinander.«
Kaum zurück in ihrem Auto, rief Sam ihre Schwester Kelly an. Kelly arbeitete als Ärztin auf der internen Station des Krankenhauses von Cleveland. Sie befand sich auf Visite, aber man versprach Sam, ihrer Schwester auszurichten, dass sie zurückrufen sollte.
Eine halbe Stunde später hatte sie Kelly am Apparat.
»Sam, altes Haus! Wie geht es dir?«
»Kelly, ich bin für zwei Tage zu Hause. Mum und Dad sind allerdings ziemlich frustriert, dass ich mich nicht von ihnen beglucken lasse, sondern dauernd unterwegs bin. Na, du weißt ja, wie sie sind.«
»Ja, am liebsten hätten sie uns Kinder nie aus dem Haus gelassen. Und jetzt sind wir in alle Winde zerstreut. Hast du einen besonderen Grund, mich anzurufen, oder wolltest du nur wissen, ob ich noch lebe?«
»Sowohl als auch. Du erinnerst dich doch noch an Peter Mangold?«
»Der unscheinbare Typ aus unserer Straße, mit dem du eine Zeit lang gegangen bist?«
»Genau der. Heute ist er alles andere als unscheinbar. Und er ist einer der Kandidaten des laufenden Langzeitversuches in Biosphere 2.«
»Ich habe davon in der Zeitung gelesen, als die eingerückt sind. Allerdings kann ich mich nicht erinnern, Peters Namen entdeckt zu haben.«
»Der wurde auch nicht erwähnt. Aber es gab in einer kleinen Regionalzeitung ein Bild der Teilnehmer. Und darauf habe ich Peter erkannt. Ich möchte dir jetzt ein paar Fragen stellen. Denn irgendetwas ist im B2 los und es scheint eine totale Nachrichtensperre zu geben.«
»Wenn ich helfen kann? Schieß los, Sam! Was willst du wissen?«
Sam öffnete ihr Notizbuch und nahm einen Stift zur Hand, damit sie sich Stichworte aufschreiben konnte. »Peters Freundin meinte, dass er an einem Experiment teilnimmt, wo er mit einer Substanz geimpft und dann mit hohen Strahlendosen beschossen wird. Das soll dazu dienen, herauszufinden, wie man die Besatzung von Raumschiffen auf Langzeitflügen vor der interstellaren Strahlung schützen kann. Ihr arbeitet in der Krebstherapie doch auch mit ähnlichen Dingen.«
»Na, das ist sicher nicht damit zu vergleichen. Aber ich erzähle dir, was ich weiß. Die Zellbiologin Lyudmilla Burdelya vom Roswell Park Cancer Institut hat vor einiger Zeit entdeckt, dass man aus der Geisel von Salmonellen Flagellin gewinnen kann. Von diesem Protein war bekannt, dass es die Substanz NF-kB aktiviert, welche die Apoptose unterdrückt. Das heißt, sie verhindert den Selbstmord der Zellen, die mit Strahlen beschossen werden. Ein Versuch an Mäusen hat gezeigt, dass siebenundachtzig Prozent der Tiere, die diesen Wirkstoff injiziert bekamen, eine tödliche Strahlendosis überlebten. Krebszellen jedoch starben ebenso wie alle ungeschützten Tiere.
Wir benutzen diese Erkenntnisse in der Strahlentherapie von Krebskranken. Darüber hinaus wage ich mir nicht einmal vorzustellen, was passieren könnte, würde man Menschen damit impfen und einer erhöhten kosmischen Strahlung aussetzen. Für mich käme ein derartiges Experiment einem Mordversuch gleich.«
»Danke, Kelly. Ich glaube, ich hab alles verstanden. Wenn ich noch Fragen habe, schreibe ich dir eine E-Mail.«
»Schön, wenn ich dir helfen konnte. Lass unsere Eltern grüßen. Ich versuche in drei Wochen, wenn ich wieder mal ein paar Tage frei habe, nach Hause zu kommen.«
»Richte ich gerne aus. Bye.«
Sam saß in ihrem Wagen und starrte wie blind vor sich hin. Das war alles gar nicht gut. Zum einen, dass die AFISFAHUR nur eine Scheinfirma war und die Experimente in Wahrheit von der US Army durchgeführt wurden. Des Weiteren, dass im B2 verschiedene Versuche liefen. Und zum Dritten, dass Peter an einem Himmelfahrtskommando von Selbstversuch teilnahm. Viertens war nicht anzunehmen, dass die anderen Experimente harmloser waren. Vermutlich testeten sie neue biologische Kampfstoffe oder Ähnliches. Kein Wunder, dass die Army mauerte, das tat sie immer. Erst recht, wenn irgendetwas schief gelaufen war. Und dass etwas aus dem Ruder geraten war, erschien Sam mittlerweile wahrscheinlich. Sie startete ihren alten Chevy und zuckelte planlos durch die Gegend. Sie musste jetzt einmal nachdenken.
Wien, 1. September
»Komm, Bertoni, wir laufen einmal um den Block und dann besuchen wir die Arbeitsstelle von Andreas Oriocho.«
Bei »Komm« stellte Bertoni seine Lauscher auf, bei dem Wort »laufen« sprang er mit einem Satz auf und sein Schwanz wedelte voll wilder Begeisterung. Er holte seine Leine vom Haken an der Garderobe im Wartezimmer und stand freudig hechelnd vor seinem Frauchen.
»Na, mein Braver. Eine Runde um den Park. Im Laufschritt!« Doktor Bruno Margolies. Wo hatte sie diesen Namen schon gehört? Oder war sie ihm schon begegnet? Stella konnte sich nicht richtig konzentrieren, denn Bertoni gebärdete sich heute extrem störrisch. Scheinbar hatte er sich in den Kopf gesetzt, dass er heute sie an der Leine führte. Immer wieder musste sie ihn mit dem Kommando »zurück« auf den rechten Weg bringen. Doch ihre Gedanken kreisten nach wie vor um Doktor Margolies.
Und dann fiel es ihr plötzlich wieder ein. Einen ihrer ersten Einsätze mit ihrem Chef bei der Polizei hatte sie bei Doktor Margolies gehabt. Seine Frau hatte den Notruf gewählt, weil er sie angeblich verprügelt hatte. Als sie ankamen, war Margolies von einer beispiellosen Arroganz und rief gleich seinen Freund im Innenministerium an, damit er den übereifrigen Polizisten zurückpfiff. Beim Anruf seiner Frau bei der Polizei hatte es sich nur um einen dummen Scherz gehandelt, dem eine Wette der Eheleute zugrunde lag, wie lang es dauerte, bis wer kam. Die Geldbuße wegen des unnötigen Einsatzes würde er gerne bezahlen.
Ihr Chef bestand trotz allem darauf, die Ehefrau zu Gesicht zu bekommen. Margolies lachte ihn nur aus und warf ihnen die Türe vor der Nase zu. Sie aufbrechen zu lassen, getraute sich ihr Chef nach dem Telefonat mit dem hohen Mitarbeiter des Innenministeriums nicht mehr. Es blieb ihnen daher nichts anderes übrig, als mit eingezogenem Schwanz abzuziehen. Insgeheim hatte sie ihrem Ekelchef diese Niederlage ja von Herzen gegönnt. Trotzdem war der Margolies eine harte Nuss und ein schlimmer Finger.
Na, bestens. Wenn es ihrem Vorgesetzten bei der Polizei schon nicht gelungen war, diesem Menschen Informationen zu entlocken, wie sollte sie als kleine Detektivin etwas in Erfahrung bringen? Jede Wette, der empfängt mich nicht einmal!
Nach dem kurzen Lauf mit Bertoni nahm Stella eine erfrischende Dusche. Auch wenn dieser Margolies ein Ekelpaket war, schweißtriefend und stinkend wollte sie ihm nicht gegenübertreten.
Rund um die TU in der Wiedner Hauptstraße war erwartungsgemäß kein Parkplatz zu ergattern, daher nahm Stella gleich die U-Bahn. Sie musste sich zum Institut für Betonbau, Baustoffe und Bauphysik durchfragen. Endlich angekommen stand sie einem Assistenten gegenüber, der in jedem Schwarzenegger-Film als Gegenspieler von Arnie hätte mitwirken können. Allerdings nur, wenn sie ihn auf ein Podest gestellt hätten. Was ihm in der Größe fehlte, hatte er in der Breite zu viel. So sah man nicht allein durch jahrelanges Bodybuilding aus, da mussten auch noch jede Menge Anabolika und Steroide im Spiel gewesen sein, dass man einen derart aufgeblähten Körper vorweisen konnte. Sie fragte nach Doktor Margolies.
»Haben Sie einen Termin?«, fragte Don Anabol, ohne von seinen Papieren aufzublicken.
»Nein, ich vertrete die Ehefrau eines Mitarbeiters.«
»Hat sie etwas mit dem Doktor, dass Sie die Lady vertreten?« Scheißkerl! Immerhin sah er sie jetzt an.
»Nein, ihr Mann. Und damit wir uns nicht missverstehen, er hat einen Arbeitsvertrag. Und er ist seit Tagen verschwunden. Kann ich jetzt mit Doktor Margolies sprechen?«
»Wie heißt der Mann?«
»Andreas Oriocho.«
Don Anabol blätterte in einem gebundenen Büchlein.
»Bei uns ist kein Andreas Oriocho beschäftigt.«
»Das ist unmöglich. Er arbeitet seit Jahren hier. Oder gibt es noch eine andere Abteilung für Baustoffe an der Uni?«
»Nein. Ich habe hier das Verzeichnis aller Studenten, Doktoranden und Professoren. Es gibt keinen Herrn Oriocho hier! Es gibt übrigens auch keinen Doktor Marlis.«
»Margolies.«
»Egal. Wer immer Sie da hergeschickt hat, hat Ihnen einen gewaltigen Bären aufgebunden.«
»Vielleicht schreibt er sich anders?«
»Hören Sie, gute Frau, ich habe hier Arbeit zu verrichten, wofür mich der Steuerzahler sponsert. Ich kann nicht mit Ihnen darüber philosophieren, warum wir hier keinen Mann dieses Namens haben, obwohl Sie davon überzeugt sind. Ich bitte um Entschuldigung.«
Die letzten Worte klangen eindeutig höhnisch. Er nahm einen Stapel Akten in seine linke Hand und eilte zum Ausgang.
Dem tat gar nichts leid, höchstens dass er arbeiten musste. Stella gab noch nicht auf.
»Wie heißt denn der Vorstand dieses Institutes?«
»Professor Hoffmann.«
»Kann ich mit ihm sprechen?«
»Nein, er ist im Ausland.«
Don Anabol ließ sie endgültig stehen und wieselte Richtung Treppenhaus davon.
»Ich hoffe, Sie finden alleine raus«, rief er ihr im Davoneilen noch über die Schulter zu.
Das fing ja gut an! Sie hatte damit gerechnet, nicht an Doktor Margolies heranzukommen. Das war ja auch eingetreten. Aber der Hammer war, dass weder Andreas Oriocho noch Doktor Margolies hier beschäftigt waren! Wo war Oriocho in den letzten Jahren hingegangen, wenn er seiner Frau erzählte, er ginge ins Büro? Was hatte er mit Margolies zu tun, der auch nicht hier arbeitete? Und was hatte es dann mit den Reisen auf sich, die Oriocho regelmäßig durch das Land führten?
»Frau Oriocho, ich muss Sie bitten, mich noch einmal in meinem Büro aufzusuchen«, sprach Stella eben ins Telefon, als Bertoni kurz Laut gab. Gleich darauf wuselte eine große Blondine mit üppiger Oberweite unter beträchtlicher Lärmentwicklung in ihr Büro.
»Augenblick, bitte.« Stella legte den Hörer kurz auf den Tisch.
»Würden Sie bitte einen Moment im Vorzimmer warten? Ich führe hier ein vertrauliches Gespräch mit einem Mandanten.«
Blondchen nickte und stöckelte mit schwingenden Hüften und wippenden Brüsten nach draußen. Sagenhafter Auftritt! Stella nahm den Hörer wieder auf.
»Frau Oriocho? Danke, dass Sie gewartet haben. Ich habe heute an der Technischen Universität versucht, mit dem Vorgesetzten Ihres Mannes zu sprechen. An der TU kennt man weder Ihren Mann noch Doktor Margolies. - Ja, achtzehn Uhr passt mir ausgezeichnet.«
Das hatte die Dame eben recht locker aufgenommen. Weil sie nicht daran glaubte, dass Stella am richtigen Institut nachgefragt hatte? Sie würde sehen, was Frau Oriocho zu diesem Thema beizutragen hat, wenn sie am Abend kommt. Sie öffnete die Tür zum Vorzimmer und Blondchen schoss vom Besuchersessel in die Höhe.
»Hallo, ich bin Rita Prskavec. Ich habe Ihre Adresse aus dem Telefonbuch. Ist richtig nett bei Ihnen, aber Sie brauchen dringend eine Sekretärin.«
»Stella Marini, schönen guten Tag. Wie meinen Sie das mit der Sekretärin?«
»Na, erstens liegen hier Haufen von Akten und Zetteln wild durcheinander herum. Die gehören abgelegt. Staub wischen könnte auch nicht schaden. Zweitens würde eine Sekretärin Besucher anmelden, die dann nicht mehr in vertrauliche Gespräche platzen können.«
Stella lächelte. Diese Rita hatte die wesentlichen Schwächen ihres Büros in drei Sätzen auf den Punkt gebracht. Sie war eine gute Beobachterin.
»Sie haben recht. Aber ich kann mir keine Sekretärin leisten. Was kann ich denn für Sie tun?«
Rita holte tief Luft. »Das ist gar nicht so einfach.«
»Na, dann fangen Sie mit dem komplizierten Teil an«, ermunterte Stella ihre Besucherin lächelnd.
Und dann erzählte Rita der Detektivin ihre Erlebnisse vom Leichenfund, ihrer Kündigung, bis zum Polizisten Walter Pokorny, der sie verdächtigte, den Mann ermordet zu haben. »Und was möchten Sie von mir in dieser Geschichte?«, fragte Stella.
»Naja, ich dachte mir, wenn Sie den richtigen Mörder finden, dann hackt der komische Bulle nicht weiter auf mir herum. Aber eigentlich wollte ich zuerst fragen, wie viel das kosten könnte.«
Jetzt war die gestylte Blondine richtig leise geworden. Als Arbeitslose hatte sie sicher wenig Geld zur Verfügung.
»Ich nehme eine Pauschale von fünfhundert Euro für drei Tage. Darin nicht enthalten sind Aufwendungen aller Art, vom Transport bis zu den Bestechungsgeldern für Informanten. Dann erfolgt ein Zwischenbericht mit empfohlenen weiteren Schritten. Sie entscheiden, ob Sie mich dann beauftragen. Danach wird nach Stunden abgerechnet. Spesen exklusive.«
Rita schluckte. »Das ist eine Menge Moos.«
Stella grinste. Das Mädchen war erfrischend direkt. »Meist bin ich das Geld auch wert.«
»Gut. Dann finden Sie bitte dieses Arschloch, das den Mann aus der Mülltonne erledigt hat. Dann werde ich wieder ruhiger schlafen.«
Rita stand auf. »Und Sie wollen wirklich keine Sekretärin? Ich suche ohnehin gerade einen Job.«
Stella konnte ein Lächeln kaum unterdrücken. Bei dem Aufzug in Kombination mit den auffälligen körperlichen Attributen ihrer Besucherin wäre das Büro wohl bald von pubertierenden Halbstarken und alten Lustmolchen belagert. »Ich überlege es mir.«
Rita pfiff ein Liedchen und sprang leichtfüßig die Treppe zu ihrer Wohnung hoch. Die Detektivin machte einen guten Eindruck auf sie. Hoffentlich fand sie bald den Mörder. Denn vor ihrer Tür stand erneut – Pokorny, der Schmalspur-Bond für arme Wiener.
»Was ist denn jetzt noch?«
Er hatte schon wieder seine Zigaretten auf den Fliesen ausgetreten. Sie musterte ihn ungnädig und schüttelte den Kopf. »Verheiratet können Sie nicht sein. Ihre Frau hätte sie längst erschlagen.« Sie unterstrich ihre Worte mit einer Bewegung ihres Kinnes Richtung Zigarettenstummel.
»Ach ja? So wie Sie den Droemer?«
»Herrgott, jetzt wachen Sie doch einmal auf, Mann! Warum sollte ich einen mir völlig unbekannten Kerl umbringen? Das ist doch absolut bescheuert!«
Pokorny räusperte sich. »Ich habe mit Ihrer Freundin Lilly gesprochen. Sie hat Ihr Alibi bestätigt. Sie war sich zwar nicht mehr sicher, an welchem Tag das war. Aber mithilfe der Sendungen im Fernsehen, die vor und nach dem Telefonat liefen, konnten wir den Tag feststellen.«
»Sehen Sie? Ich habe Ihnen gleich gesagt, Sie vergeuden Ihre Zeit.«
»Sie sind zwar nicht mehr die Hauptverdächtige. Aber gewisse Zweifel bleiben. Sie könnten ja mit einem Komplizen arbeiten. Aber momentan reihen wir Sie weiter hinten in der Liste. Das wollte ich Ihnen nur sagen.« Pokorny wirkte verlegen.
»Schon gut. Brechen Sie sich keinen Zacken ab. Ich bin nicht nachtragend.«
»Da ist noch etwas.« Pokorny trat von einem Fuß auf den anderen.
Rita fragte sich, ob er dringend zur Toilette musste. Oder wand er sich vor Verlegenheit?
»Spucken Sie es schon aus!«
»In der Wohnung des Opfers fanden wir ein paar Sachen von Ihnen.«
»Wie bitte? Von mir? Ich weiß doch nicht einmal, wo der gewohnt hat!«
»Da lag Ihr Feuerzeug, ein paar Kosmetika und Parfum. Eine Jacke und ein paar Schuhe. Ihre Kolleginnen haben das alles als Ihr Eigentum bezeichnet. Am besten, Sie kommen auf die Wache und sehen es sich selbst an. Falls Sie den Kerl nicht ermordet haben, dann haben Sie einen schweren Feind, der Ihnen die Geschichte unbedingt anhängen will.«
»Das kann man laut sagen.«
Rita rang noch immer um ihre Fassung. All die Dinge, die der Polizist jetzt aufzählte, waren ihr während des letzten Monats abhandengekommen. Für sie rätselhaft, denn da sie nicht gerade mit materiellen Gütern gesegnet war, passte sie auf ihre Sachen gut auf. Sie hatte sich schon gefragt, ob eine ihrer Kolleginnen im Klub vielleicht klaute.
»Soll ich mich da vorher anmelden, wenn ich komme?«
»Nein. Wer immer gerade Dienst hat, wird Ihnen die Sachen zeigen. Sie müssen dann nur sagen, ob Sie Ihnen gehören oder nicht.«
Sie würde mit der Detektivin hingehen.
Washington, 15. September
Viersternegeneral Adam Hurst hatte ein absolut angenehmes Wochenende verbracht. Seit Freitagmittag blieb sein Handy abgeschaltet und er nicht mehr erreichbar. Den Luxus gönnte er sich nur einmal im Jahr. Eigentlich müsste er rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Aber aller Voraussicht nach sollte dieses Wochenende nichts Weltbewegendes passieren.
Ein bekannter Waffenhändler und führendes Mitglied der National Rifle Association NRA hatte den Verteidigungsminister und einige hochrangige Militärs zur Jagd auf seine Ranch eingeladen. Das war alljährlich der Höhepunkt der Saison, wo wild durch die Gegend geballert und jede Menge Alkohol vernichtet wurde. Nebenbei reichte man exzellente Speisen und Getränke, und erstklassige Damen wurden zur Unterhaltung der Herren zur Verfügung gestellt. Das Wochenende war in mehr als einer Hinsicht herausragend gewesen.
Jetzt, Montag neun Uhr früh, betrat Adam Hurst eben sein Büro. Er hängte den Uniformrock penibel auf den Kleiderbügel in der Garderobe. Seine Sekretärin, ein ältliches Mädchen, die sicher Klosterschwester geworden wäre, wenn sie bei der Army nicht diese hervorragend für sie geeignete Stelle gefunden hätte, brachte ihm Kaffee und die Post, die seit Freitag eingetrudelt war. Er überflog die Schriftstücke. Nichts Aufregendes dabei. Wie er es vermutet hatte.
Er lehnte sich zurück und erinnerte sich genüsslich an die Nacht von Samstag auf Sonntag, die er mit zwei feurigen Mädchen verbracht hatte. Eine knabenhaft schlank, die andere üppig gebaut mit sensationellen Brüsten. Selbst die Erinnerung ließ den kleinen Adam groß werden!
General Hurst startete seinen Computer. Jetzt noch die eingegangenen E-Mails kontrollieren. Aber wahrscheinlich war er auch hier keiner Menschenseele abgegangen.
Einige E-Mails erregten sofort seine Aufmerksamkeit. Von einem Insassen des Biosphere 2 mit Priorität hoch. Was war denn dort schon wieder los? Konnten die nie etwas allein entscheiden? Manchmal kam er sich vor wie der Betreuer einer Kindergartentruppe. Seit die acht Leute ins B2 gezogen waren, herrschten dort Streit und Hader. Jeder meinte, sein Aufgabenbereich sei der Wichtigste. Vermutlich musste er wieder einmal vermitteln.
Resignierend öffnete er die erste E-Mail. Während er sie las, wurde ihm leicht schwarz vor Augen. Wann war das verdammte Ding eingegangen? Oh Gott, es war zu spät. Er las sicherheitshalber nochmals den Text.
Von: Peter Mangold
Datum: Freitag, September 12, 1:38 p.m.
An: General Adam Hurst
Betreff: schwerwiegendes Problem
Priorität: hoch
Versuche seit Stunden, Sie zu erreichen. Leider gingen weder Sie noch einer Ihrer Jungs ans Telefon. Wir befinden uns in einer dramatischen Situation. Da wir seit Wochen eine Schlechtwetterperiode nach der anderen hatten, ist die Sauerstoffversorgung sehr mangelhaft. Die Stickstoffkonzentration war permanent viel zu hoch. Jetzt ist auch noch die Fotovoltaikanlage ausgefallen und mit unseren Mitteln nicht zu reparieren. Vor ein paar Stunden ist die Stromversorgung völlig zusammengebrochen. In weiterer Folge kann weder Sauerstoff erzeugt, noch das Klima geregelt werden. Wie Sie wissen, sind wir auf die Zufuhr von Sauerstoff über die Klimaanlage angewiesen, sodass jetzt ein echter Notstand eingetreten ist. Brauchen dringend sofort Hilfe von außen.
Da wir, wie bekannt, aus Sicherheitsgründen die Türen von innen nicht öffnen können, bitten wir Sie, die Eingänge aufschließen zu lassen, bis die Versorgung mit Strom und daher mit Sauerstoff wieder funktioniert. Außerdem brauchen wir sofort einen externen Reparaturtrupp.
Verfügbarer Zeitrahmen: etwa 48 Stunden. Dann wird die Luft knapp.
Während er sich mit den Huren vergnügt hatte, war den Leuten im B2 die Luft ausgegangen. Vielleicht gab es noch etwas zu retten.
Er klickte die E-Mail weg und öffnete die nächste. Der Ton war schon wesentlich ruppiger.
Mein Gott, Hurst, schlaft ihr alle? Die Hälfte der verfügbaren Zeit ist um, und ihr meldet euch nicht einmal! Wir werden hier alle sterben! Und keiner schert sich darum. Wir brauchen Hilfe! Und zwar dringend.
Wenn von euch in einer Stunde keine Hilfe kommt, wende ich mich an die Feuerwehr oder die Polizei hier vor Ort. Scheiß auf die Geheimhaltung.
Das konnte böse Folgen haben. Vor allem für ihn. Er hatte seinen Männern frei gegeben, damit ihn nur ja keiner an dem exklusiven Jagdwochenende stören konnte. Mit zitternden Fingern öffnete er die letzte E-Mail von Peter Mangold.
Jetzt reicht es! Wir wenden uns jetzt an die lokalen Behörden. Was seid ihr nur für Arschlöcher! Lasst uns hier einfach verrecken. Ich hoffe, Sie kommen vors Militärgericht. Ende.
»Schicken Sie mir Leutnant Briggen herein«, bellte Hurst der Sekretärin ins Telefon. Er musste seinen Kragen öffnen. Irgendwie bekam er jetzt selbst zu wenig Luft.
Kurze Zeit später meldete sich Briggen.
»Versuchen Sie, Peter Mangold im Biosphere zu erreichen.« Der Mann salutierte und verließ das Büro. Nach einer halben Stunde meldete er sich wieder und erstattete Bericht. Er hatte niemanden erreicht.
»Seltsam. Die können doch nicht alle mitten am Tag schlafen?«
Adam Hurst würde die E-Mails von seinem Computer löschen. Am Mittwoch war ohnehin die routinemäßige Meldung fällig. Wenn sie ausblieb, würde er ein Erkundungsteam losschicken. Falls die Insassen des B2 dann noch lebten, wäre es außerordentlich peinlich. Aber vermutlich sind sie ohnehin schon tot. Es wäre daher absolut sinnlos, deswegen die eigene Karriere zu gefährden.
Er griff zum Telefon. Er brauchte sofort einen vertrauenswürdigen EDV-Fachmann, den er in der Hand hatte. Der sollte alle Spuren verwischen, herausfinden, ob die B2- Besatzung noch E-Mails an zivile Stellen abgeschickt hatte und im Übrigen schweigen wie ein Grab.
Wien, 1. September
»Es tut mir furchtbar leid, aber die Angaben Ihres Mannes können nicht stimmen.«
Frau Oriocho schniefte in ihr Taschentuch. »Sie haben sicher am falschen Institut gefragt.«
»Ich muss Sie enttäuschen. Es gibt kein anderes. Wie haben Sie Ihren Mann denn in der Firma telefonisch erreicht?«
Vielleicht gab die Telefonnummer Aufschluss über den Dienstgeber.
»Nur am Handy. Er sagte, er sei viel unterwegs, da sei das Handy am sichersten.«
Besonders, wenn er gar nicht dort arbeitete, wo ihn seine Frau vermutete. Sie musste ihrer Auftraggeberin jetzt den nächsten Schock versetzen.