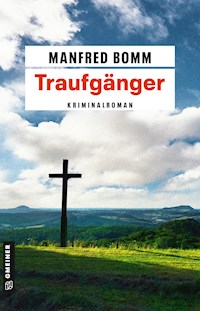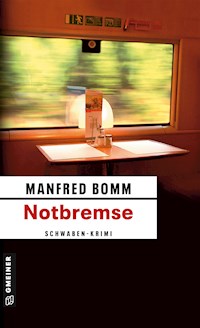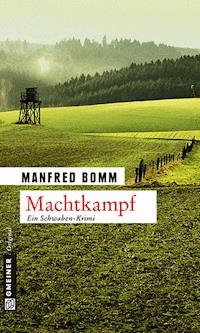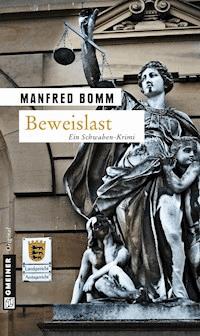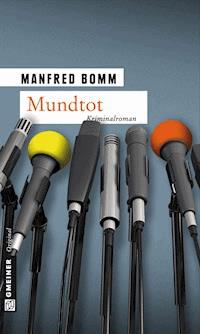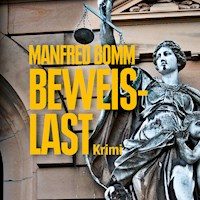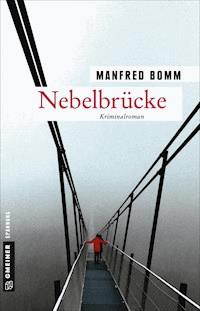
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar August Häberle
- Sprache: Deutsch
Botschaft aus dem Jenseits? Ein Unternehmer aus Ulm erhält dubiose E-Mails, deren Absender behauptet, vor 49 Jahren ermordet worden zu sein. Die Details, die er dazu offenbart, scheint außer den Betroffenen niemand zu kennen. Als sich zudem immer mehr Merkwürdiges und Mysteriöses ereignet, geht der Unternehmer auf den Vorschlag des anonymen E-Mail-Schreibers ein. Ein gefährliches Vorhaben, das ihn bis nach Tirol führt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 691
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Bomm
Nebelbrücke
Der achtzehnte Fall für August Häberle
Impressum
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Traufgänger (2017), Todesstollen (2016), Lauschkommando (2015),
Machtkampf (2014), Grauzone (2013), Mundtot (2012),
Blutsauger (2011), Kurzschluss (2010), Glasklar (2009),
Notbremse (2008), Schattennetz (2007), Beweislast (2007),
Schusslinie (2006), Mordloch (2005), Trugschluss (2005),
Irrflug (2004), Himmelsfelsen (2004)
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2018
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Armin Walch, GF Burgenwelt Ehrenberg
ISBN 978-3-8392-5658-9
Widmung
Gewidmet allen, die auch in einer materiellen Welt noch in der Lage sind, die kleinen Zeichen des Himmels wahrzunehmen, ohne dabei die Bodenhaftung zu verlieren.
Beschreiten wir mit Bedacht und mit wachen Augen den schmalen Grat, auf dem wir von heimlichen Signalen, nüchterner Realität und bisweilen auch Aberglauben umgeben sind. Vertrauen wir einer großen Macht, die uns auch dann wieder in die Sonne führt, wenn die Nebel der Vergangenheit uns zu verhüllen drohen. Im festen Glauben daran, dass auch Unmögliches möglich erscheint, wird sich vor jedem Abgrund eine Brücke finden, die uns zu einer anderen Seite führt.
1
Es war ein Schock. 49 Jahre lang hatte er es verdrängt. Eine halbe Ewigkeit. Und jetzt hielt er einen Brief in den zitternden Händen, der die alten Wunden aufriss. Walter Temmings glasige Augen waren starr auf das Stück Papier gerichtet, das zwischen seinen unruhigen Fingern zu vibrieren begann. Zweimal schon hatte er den Text gelesen, der am Computer geschrieben und mit klarer Schrift ausgedruckt worden war. Er schob mit der linken Hand die dicke Brille höher auf die Nase, als erhoffte er sich, der Inhalt des Briefes würde sich bei schärferem Sehen ändern.
»Lieber Bruder Walter«, las er nun schon zum dritten Mal, während nur das Ticken der antiken Standuhr das herrschaftliche Wohnzimmer erfüllte. »Du wirst erstaunt sein, von mir als Deinem gehassten Bruder nach so langer Zeit wieder etwas zu hören. Aber das Schicksal hat es so gewollt, dass sich unsere Wege in Deinem Leben noch einmal kreuzen. Auch wenn Du es nicht für möglich halten wirst, aber ich bin gekommen, um das, was vor 49 Jahren geschehen ist, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.«
Das musste ein schlechter Witz sein. Temming überflog den letzten Satz noch einmal. »… bin gekommen, um das, was vor 49 Jahren geschehen ist, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.«
Ja, 49 Jahre war das jetzt her. Oktober 1968. Gefühlte Hunderttausend Mal hatte er es gedanklich durchlebt. Überhaupt war ihm dies alles nie aus dem Gedächtnis gegangen. Wie ins Gehirn oder in die Seele eingebrannt, so hat es ihn ein Leben lang verfolgt. Wenigstens war es ihm im Laufe der Zeit gelungen, darüber zu schweigen, obwohl seine Frau, wie er befürchtete, hin und wieder das Bedürfnis hatte, die Angelegenheit anzusprechen. Nein, er wollte nicht. Für ihn war das Thema abgeschlossen, sosehr es ihn auch plagte. Manchmal traf es ihn aber unversehens, wie ein Keulenschlag aus dem Nichts. Mit dem Abstand der Jahre schien es sogar immer heftiger an ihm zu nagen – als sei alles erst vor wenigen Wochen gewesen. Die Vergangenheit frisst einen auf, dachte er dann.
Doch was nicht zu ändern ist, so lautete seine Devise im harten Geschäftsleben, damit musste man sich abfinden. Da lohnte alles Grübeln nichts und schon gar kein schlechtes Gewissen. Außerdem, mein Gott, damals war er gerade mal 21 gewesen. Ein unerfahrener junger Kerl, aus heutiger Sicht.
Er griff nach dem Kuvert, das er hastig aufgerissen hatte. Aber da gab es keinen Absender. Und seit Poststempel abgeschafft waren, ließ sich nur die zweistellige Zahl des Briefzentrums jener Region erkennen, in der der Brief eingegangen war. Briefzentrum 73 – Salach. Also nicht weit von hier.
Ob es Fingerabdrücke darauf gab? Für einen Moment zuckte dieser Gedanke durch Temmings Gehirn. Aber mit welcher Begründung würde er den Brief zur Polizei bringen können? Zwangsläufig käme die Frage auf, was denn vor 49 Jahren geschehen sei. Da gab es sicher noch Akten. Oder war längst alles verjährt? Nein, so etwas verjährte in Deutschland nie.
Auf seiner faltigen Stirn hatten sich dünne Schweißperlen gebildet, als er weiterlas: »Du hast mich um das Erbe des Vaters gebracht. Ein gnädiges Schicksal oder besser gesagt eine Geldzuwendung und ein Todesfall haben Dich davor bewahrt, dafür büßen zu müssen. Aber noch ist es nicht zu spät. Ich bin gekommen, meinen Teil zu holen oder Dich der gerechten irdischen Strafe zuzuführen.«
Temmings Hände zitterten heftiger. Nicht wegen seines Alters von 70 Jahren, dazu war er viel zu fit, sondern aus purem Entsetzen. Seine Augen klebten an dem Wort ›Strafe‹. Er spürte, wie seine Kehle austrocknete und sein Blutdruck in die Höhe schnellte. Gleichzeitig erschreckte ihn der Halbstundenschlag der antiken Standuhr.
»Damit du nicht glaubst, ein Trittbrettfahrer würde Dich zu erpressen versuchen, solltest Du Dich an einige Details erinnern, die nur wir beide kennen«, las er weiter. »Die Haushaltsleiter war aus Holz, und auf einer Seite waren drei Stufen mit roter Farbe beschmutzt, weil du ein paar Tage zuvor eine Farbdose ausgeleert hast.«
Unglaublich. Temming drückte seine Brille erneut fester auf die Nase. So war es. Ganz genau so. Er hatte damals das hölzerne Gartenhaus gestrichen, wobei ihm die Dose mit der roten Farbe aus der Hand gerutscht war.
Temmings Blick verfinsterte sich zunehmend, als er weiterlas: »Du brauchst also keinen Zweifel zu haben, dass ich es bin. Leider bin ich mir erst jetzt darüber bewusst geworden. Aber nun wurde mir die Gelegenheit geboten, ins Vergangene einzugreifen.«
Und dann endete der Brief: »Dein Bruder Siegfried.« Keine Unterschrift. Aber noch ein PS: »Schönen Gruß von Barbara. Ich hab sie inzwischen getroffen. Es geht ihr gut.«
Barbara. Es war wie ein Stich in die Seele. Barbara.
Verdammt, wer konnte dies wissen?
Temmings Blutdruck schoss weiter in die Höhe. Er überflog den Text noch einmal, dann besah er sich das Papier und hielt es gegen das Licht, um ein Wasserzeichen zu suchen. Nichts. Es dürfte sich um ganz normales Druckerpapier handeln. Das Schriftbild war unpersönlich. Typ Arial, vermutete er, zweieinhalbfacher Zeilenabstand. Eindeutig neueren Datums, denn 1968 hatte es noch keine PCs und keine Drucker gegeben.
Er kannte sich in Schriftsätzen aus, schließlich war er ein Leben lang Geschäftsführer seiner Chemiefabrik gewesen. Erst voriges Jahr hatte er sie seinem Sohn Sven überschrieben, sich dabei aber pro forma als Berater noch ein Mitspracherecht gesichert, vor allem aber ein Büro, in dem er sich nahezu täglich ein paar Stunden sehen ließ. Die prächtige Jugendstilvilla, die noch von seinem Vater stammte, bot in dem kleinen Örtchen Kuchen – direkt an der Bahnlinie Stuttgart-Ulm gelegen – zwar genügend Raum für Ruhe und Gelassenheit. Doch so schön es hier am Rande der Schwäbischen Alb auch war, er konnte nicht einfach Däumchen drehen oder sich mit der Pflege des weitläufigen, parkähnlichen Gartens die Zeit totschlagen. Den Tag, an dem er das Chefbüro seiner Firma in Ulm räumen musste, hatte er mit Unbehagen auf sich zukommen sehen. Fast 30 Jahre lang war er dort der alleinige Herrscher gewesen, der Patriarch sozusagen – und dies mit Erfolg, wie er immer wieder voll Zufriedenheit feststellte. Das Unternehmen florierte, hatte alle Rezessionen unbeschadet überstanden und seit einigen Jahren sogar neue Märkte im Nahen Osten erschlossen. Was sein Vater einstens mit Schuhcreme und Zahnpasta begonnen hatte, entwickelte sich zu einer Chemiefabrik, die sich längst nicht nur mit haushaltsüblichen Produkten befasste. Chemie war heute ein breiter Begriff, der nahezu alle Wirtschaftszweige umfasste. Ob Metallverarbeitung oder Lebensmittel, ob Pharmazie, Landwirtschaft oder Fahrzeuge – es gab keinen Bereich und keine Branche, die nicht auf chemische Substanzen angewiesen war.
Temming faltete das Blatt sorgfältig zusammen, steckte es in das rechteckige Kuvert zurück, durch dessen Folienfenster das Adressfeld sichtbar wurde, und ging zu der wuchtigen Schrankwand, deren massives Eichenholz schon seit einigen Jahrzehnten das Wohnzimmer beherrschte. Der Mann öffnete zitternd ein Klapptürchen, hinter dem mehrere Aktenordner und gestapelte Papiere zum Vorschein kamen. Für einen kurzen Moment besah er sich die Unordnung, entschied sich dann aber, den Brief irgendwo zwischen die Schriftstücke zu stecken. Er wollte seine Frau nicht damit beunruhigen. Noch nicht. Zuerst musste er feststellen, was dies bedeutete. Und dazu brauchte er Zeit zum Nachdenken. Er musste sofort den Termin absagen, den er heute Nachmittag in der Firma in Ulm hatte. Ihm war jetzt nicht nach einer Rede vor einer Besuchergruppe. Er würde sich erst wieder morgen Vormittag in dem Betrieb sehen lassen.
Nun galt es, vorsichtig zu agieren. Sehr sogar. Denn der Inhalt des Briefes war brisant. So konnte nur jemand schreiben, der den damaligen Sachverhalt genau kannte. Aber die wenigen, die davon wussten, waren doch längst tot.
49 Jahre war das jetzt her, schoss es ihm wieder durch den Kopf. Was sollte ein Erpresser damit anfangen können? Vermutlich war aber mit weiteren Attacken zu rechnen. Und aus Erpressungen, die in den Medien breit getreten worden waren, musste man schließen, dass der ersten Kontaktaufnahme weitere folgten, die stets massiver wurden. Deshalb musste er handeln – und dies ziemlich schnell.
2
Die Akten von damals hatte er im Keller aufbewahrt. Eigentlich war er schon vor Jahren drauf und dran gewesen, sie zu beseitigen. Doch dann hatte er sich mit seiner Frau darauf geeinigt, sie im hintersten Kellerraum der Villa, zwischen einer Vielzahl von geschäftlichen Unterlagen, aufzubewahren, deren brisanter Inhalt es ebenfalls geraten erscheinen ließ, sie vorsichtshalber außerhalb der Firma zu deponieren.
Er wartete ungeduldig, bis sich seine Frau an diesem Nachmittag zu ihrem monatlichen Kaffeekränzchen mit Unternehmergattinnen verabschiedete, vergewisserte sich, dass ihr schwarzes Audi Cabrio aus der Grundstückseinfahrt hinausrollte, und machte sich voll innerer Unruhe und zitternden Beinen sofort auf den Weg in das Untergeschoss. Dort ließ er die Leuchtstoffröhren aufblitzen, durcheilte den Raum, in dem Waschmaschine und Trockner standen, und schloss auf der gegenüberliegenden Seite eine Metalltür auf. Er fingerte nach dem Lichtschalter, worauf Aluregale sichtbar wurden, die in Dreierreihen bis zur Decke reichten und auf mehreren Zwischenböden dicht mit Aktenordnern beladen waren. Temming stieg trockene und staubige Luft in die Nase. Sein Interesse galt aber nicht den Tausenden Papierseiten, auf denen die Geschäftsbeziehungen vergangener Jahrzehnte dokumentiert waren. Stattdessen durchquerte er den Raum in einer der Regalgassen und erreichte an der Stirnseite einen hölzernen Aktenschrank aus alten Bürozeiten. Während der untere Teil aus Klapptürchen bestand, konnte im oberen Bereich die Vorderseite wie ein Rollladen nach oben geschoben werden.
Temming zögerte keinen Augenblick, sondern griff seitlich mit den Händen in den schmalen Spalt zwischen Schrankrückwand und der weiß gestrichenen Wand. Es war für ihn kein Problem, das Möbelstück nach vorne zu rücken. Er stemmte sich mit den Füßen gegen den Wandsockel und zog den Schrank mit drei kräftigen Bewegungen zu sich her, was jedes Mal ein kurzes, aber lautes Quietschen des Holzes auf dem gefliesten Boden zur Folge hatte.
Als eine Seite des Aktenschrankes weit genug von der rückwärtigen Wand weg war, fiel Temmings Blick auf eine beige Metalltür. Er zwängte sich in den entstandenen Freiraum, um mit dem Rücken das Möbelstück noch einen halben Meter weiter in den Raum hineindrücken zu können. Dann holte er einen Schlüssel aus der Tasche und entriegelte die Tür, hinter der sich verbarg, was niemals dem Finanzamt oder, noch schlimmer, irgendwelchen Juristen in die Hände fallen durfte.
Die Tür ließ sich hinter dem abgewinkelten Schrank jetzt gerade so weit öffnen, dass sich Temming in einen kleinen Raum zwängen konnte, aus dem ihm trockene, kühle und abgestandene Luft entgegenschlug, die den Geruch alten Papiers mit sich trug. Der Mann, der sich nicht entsinnen konnte, wann er das letzte Mal hier unten gewesen war, ließ auch hier eine Leuchtstoffröhre aufflackern. Ihn beschlich das Gefühl, einen Bunker zu betreten, in dem die Vergangenheit konserviert wurde. Der Boden bestand aus roh belassenem Beton, und an den ebenfalls betongrauen Wänden waren in Viererreihen Regalbretter an die Wände montiert. Nicht schön, aber zweckmäßig. Die meisten Regale, die in einer Ecke an einen halbhohen, verschrammten Aktenschrank stießen, waren leer. Auf einigen jedoch stapelten sich zusammengeschnürte Papierbündel. Dazwischen suchten prall gefüllte Aktenordner aneinander Halt. Ihre Rückseite war mit Zahlen und Buchstaben beschriftet, die vermutlich niemand außer der Verfasser selbst deuten konnte. Temming warf einen flüchtigen Blick darauf und stellte erleichtert fest, dass nichts verändert war.
Noch aber war er nicht am Ziel dessen, was er suchte. Mit ein paar Schritten erreichte er den Aktenschrank, besah sich den schmalen Zwischenraum, der sich beidseits der Regale bot, und überlegte für einen Moment, wie er dieses eingezwängt wirkende Möbelstück nach vorne wegrücken konnte. Hier war es nicht damit getan, es einfach an einer Seite bis zu einem bestimmten Winkel von der Wand zu lösen. Es würde sich an den Regalen verkanten.
Diese Konstruktion, das fiel ihm ein, war einst bewusst so gewählt worden. Nicht zweckmäßig sollte sie sein, sondern unauffällig. Immerhin waren dort Dinge verborgen, von denen er gehofft hatte, sie nie mehr im Leben jemals wieder brauchen zu müssen. Und nach menschlichem Ermessen waren diese Schriftstücke auch jetzt noch dort. Doch bevor er sich für irgendwelche Maßnahmen entschied, musste er Gewissheit haben.
Er beugte sich durch zwei Regaletagen und spürte plötzlich einen stechenden Schmerz im Rücken. Dies machte ihm mit einem Schlag bewusst, dass er vor Kurzem seinen 70. Geburtstag gefeiert hatte. Anstrengungen wie diese waren seiner Gesundheit alles andere als zuträglich. Trotzdem konnte ihn jetzt nichts davon abbringen, auch diesen Schrank zu bewegen. Seine Finger fanden den schmalen Spalt an der Rückseite, dann nahm er all seine Kraft zusammen, stemmte sich mit den Füßen ab und schaffte es, das Möbelstück auf der rechten Seite ein paar Zentimeter nach vorne zu ziehen. Mehr durfte es auch nicht sein, weil sich der Schrank ansonsten links an den Regalen verkantet hätte.
Temming atmete schwer und spürte sein schweißnasses Hemd an der Haut kleben. Er blieb für einen Moment stehen, wandte sich der linken Seite zu und zog auch dort den alten Holzschrank mit den Fingerkuppen so kräftig es ging heraus. Nachdem er dies einige Male wiederholt hatte, war es geschafft: Das Möbelstück hatte die Enge zwischen den Regalen überwunden und konnte nun vollends zur Seite geschoben werden. Dahinter zeigte sich auf Augenhöhe das stählerne Vorderteil eines Wandtresors, der die Fläche eines mittleren Fernsehgeräts umfasste. Temming besah sich das fest verankerte Türchen, auf dessen Mitte die Rasterrädchen eines Zahlenkombinationsschlosses angebracht waren. Alles schien seit Jahren unberührt zu sein. Keine Gewaltanwendung. Und die eingestellten Ziffern waren exakt jene, die Temming zuletzt hinterlassen hatte: sein Geburtsdatum. Hätte sich jemand daran zu schaffen gemacht, wäre vermutlich etwas anderes abzulesen gewesen. Er brauchte nicht zu überlegen, welche fünfstellige Kombination die richtige zum Öffnen war. Diese Zahl hatte er einstens gewählt, weil sich mit ihr jenes Ereignis verband, das ihn bis ins Grab verfolgen würde. Es war das Datum von damals: 51068. Als ob ein alter Film auf den Tresor projiziert würde, sah er vor seinem Auge, was sich damals abgespielt hatte. Die Leiter mit den roten Farbflecken. Sie stand am offenen Fenster im zweiten Stock, wo sein ein Jahr älterer Bruder Siegfried eine verklemmte Jalousie reparieren wollte. Ein trüber regnerischer Tag. Ein Samstag. Sie hatten geglaubt, nur zu dritt im Hause zu sein: er und Gisela, seine damalige Verlobte und heutige Ehefrau, sowie Siegfried, der den Eltern versprochen hatte, während ihrer Abwesenheit diese Jalousie wieder gangbar zu machen. Siegfried war handwerklich begabt, hatte damals in einem großen Maschinenbauunternehmen einige vierwöchige Ferienjobs absolviert und dann ein naturwissenschaftliches Studium begonnen. Er galt als ehrgeizig und hatte das Zeug, Vaters Betrieb eines Tages übernehmen zu können.
Ganz sicher wäre es auch so weit gekommen, dachte Walter Temming. Denn er selbst war damals anderen Dingen zugetan gewesen. Er hatte sich politisch engagiert und gespürt, dass sich seine Generation von den Fesseln der autoritären Väter lösen musste. Auch er hatte ein Studium begonnen, aber nicht der Chemie und auch nicht der Betriebswirtschaft, wie es der Vater gerne gehabt hätte, sondern der Philosophie. Eine Entscheidung, die er gegen den energischen Willen seines ›alten Herrn‹ durchsetzte, der sich eigentlich vorgestellt hatte, dass die beiden Söhne den Betrieb eines Tages fortführen würden.
Temming überkam jedes Mal ein Gefühl der Selbstzweifel, wenn er – wie jetzt – an die Wochenenden dachte, an denen er nach Hause gekommen war und es regelmäßig einen heftigen Krach gegeben hatte. Und die Drohungen, ihm eines Tages nur das Pflichtteil zu vererben und Siegfried als den eigentlichen Nachkommen einzusetzen, waren immer unüberhörbarer geworden.
Auch Siegfried vermochte nicht zu verstehen, dass sein Bruder linken Parolen nachhing, entsprechende Bücher und Zeitschriften las und über den Kapitalismus herzog, der doch gerade dieser Generation Wohlstand und Luxus beschert hatte.
Temming versuchte, diese rebellierenden Gedanken zu stoppen. Das waren doch nur Jugendsünden gewesen. Ausrutscher. Es war die Zeit Ende der 60er-Jahre, da lehnten sich die Jungen auf, gingen auf die Straße, skandierten linke Parolen, forderten ein Ende des Vietnamkrieges. Sie wollten Frieden und soziale Gerechtigkeit.
Aber nachdem, was an jenem verhängnisvollen 5. Oktober 1968 geschehen war, hatte sich sein Weltbild verändert. Seines und das seiner damaligen Verlobten und jetzigen Ehefrau Gisela. Es waren die schlimmsten Tage seines Lebens gewesen. Die Eltern schockiert und entsetzt. Dazu polizeiliche Ermittlungen, weil der Arzt einen nicht natürlichen Tod attestiert hatte – wie bei Unglücksfällen üblich. Der Vater zwischen tiefster Betroffenheit, Enttäuschung und Wut hin- und hergerissen. Dazu die Befürchtung, der Ruf der Familie und damit auch der des mühsam aufgebauten Unternehmens könnte beschädigt werden. Für den Vater hatte es nur ein Ziel gegeben: Schaden abwenden und nach vorne blicken, wie er dies als Firmenchef immer getan hatte. Sachlich und nüchtern, emotionslos.
Wenn in Walter Temming diese Tage wieder lebendig wurden, überkamen ihn all die Gefühle, die damit verbunden gewesen waren. Die panische Angst, die Verzweiflung, das energische Auftreten seines Vaters, die Vorwürfe, die Anschuldigungen – und die heißen Diskussionen.
Was war ihm letztlich anderes übrig geblieben, als auf Drängen des mächtigen Vaters in den elterlichen Betrieb einzusteigen – und die bisherige weltanschauliche Gesinnung über Bord zu werfen? Es war genau so gekommen, wie er es sich gewünscht hatte. Mit einem Schlag hatte er die Chance erhalten, alleiniger Erbe zu sein. Sehr schnell hatte er erkannt, dass damit ein Leben ohne finanzielle Sorgen auf ihn zukommen würde. Er entsagte sich revolutionärer Gedanken, gab sein Studium der Philosophie auf und ordnete sich zwangsläufig seinem dominanten Vater unter – auch wenn dies mitunter zu kräftigen und emotional aufgeladenen Auseinandersetzungen führte.
Dass er von der Chemiebranche nicht allzu viel verstand, räumte er nur für sich selbst ein. Nach außen hin versuchte er, den Fachkundigen zu mimen – und hatte außerdem ein Gespür dafür entwickelt, wann fehlende Kompetenz durch energisches Auftreten und Arroganz zu kompensieren war. Er hatte sich im Laufe der Jahre unter den 250 Mitarbeitern zum gefürchteten Juniorchef entwickelt, dem nachgesagt wurde, das Erbe des Firmengründers eines schönen Tages aus mangelndem Sachverstand an die Wand zu fahren.
Die personelle Fluktuation, die mit seiner Übernahme des Chefpostens 1987 begonnen hatte – als sein Vater beinahe so alt war wie er heute –, wertete er deshalb auch nicht als Folge seiner eigenen Defizite bei der Menschenführung, sondern als Zeichen dafür, dass die »verhätschelten Mitarbeiter« eben den heutzutage »flexiblen Anforderungen nicht gewachsen« seien. Er verschickte deshalb Abmahnungen zuhauf, sprach Kündigungen aus und lag mit Beriebsrat und Gewerkschaften im Dauerclinch. Sein Vater hatte ihm zwar, solange er noch lebte, zur Mäßigung geraten, aber das diplomatische Geschick dazu nicht seinem Nachfolger weitergeben können. Ohnehin lastete auf Walter Temming noch immer der Erfolgsdruck des Vaters – auch wenn der schon drei Jahre tot war.
Die Gedanken daran vermischten sich immer häufiger mit den Erinnerungen an jenen Tag im Oktober 1968. Sie zu unterdrücken oder zu ignorieren, war unmöglich. Sie blieben ein Trauma.
Sie kamen immer wieder aufs Neue. Nachts, wenn sie ihm den Schlaf raubten und er schwitzend erwachte. Tagsüber, wenn er im Büro über ein Problem nachsann. Dann gewannen sie Oberhand, blockierten ihm das Gehirn, lähmten seine Aktivitäten. Und wenn Oktober war, mied er es, dieses Dachzimmer im Giebel zu betreten. Er hatte Angst. Manchmal war es ihm so, als sei Siegfried noch im Haus. Als habe sich dessen Seele nicht wirklich von der Welt trennen können. Als schwebe die Seele noch immer unsichtbar durch die Räume.
Nur mühsam gelang es Walter Timming, sich auf sein Vorhaben zu konzentrieren. Hatte er eine Minute so dagestanden – oder zehn? Oder noch länger? Er vermochte sich selbst keine Antwort darauf zu geben. Aus dem Film, der vor seinen Augen abgelaufen war, zeichneten sich wieder diese Rädchen mit den Zahlenringen ab. Sie erinnerten ihn plötzlich an das runde Springbrunnenbecken im Garten, neben dem Siegfried aufgeschlagen war. An das viele Blut um seinen Kopf. Es war genauso rot wie die angetrocknete Farbe an der Holzleiter. Und dann der zweite Schock, als sie sich umgedreht hatten. Sie waren doch felsenfest davon überzeugt gewesen, dass niemand sonst im Hause sein würde.
Er schüttelte den Kopf, als wolle er diesen entsetzlichsten aller Gedanken endlich loswerden. Nein, er musste sich auf den Zahlenring vor sich konzentrieren. Nur deswegen war er heruntergekommen. Er griff an das kalte Metall und stellte mit unsicheren Fingern die richtige Kombination ein, worauf sich das schwer gängige Stahltürchen nach links aufklappen ließ. Ein Schwall modriger Luft zog an ihm vorbei.
Sofort erkannte er, dass alles noch da war: der Aktenordner mit den unzähligen anwaltlichen Schreiben, der Schnellhefter mit den Gutachten und Ermittlungsakten. Er nahm all diese Ordner nacheinander in die Hand, blätterte darin und empfand innere Beruhigung. Es war noch alles da – genau so, wie er es vor Jahrzehnten deponiert hatte. Zufrieden, aber angespannt legte er die Dokumente zurück. Er war gerade im Begriff, das Metalltürchen zu schließen, da drang ein Geräusch an sein Ohr. Er blieb regungslos stehen. Schritte. Es waren Schritte auf Steinboden. Schnell näherkommend. Sein Herz beschleunigte, der Puls raste. Er drehte sich vorsichtig zur Seite, um zwischen Schrank und Regalen einen Teil des Raums überblicken zu können. Doch die offene Tür, durch die die Schritte zu ihm hereinhallten, konnte er nicht sehen. Es würde nur noch ein paar Sekunden dauern, dann würde jemand auftauchen. Jemand, der sich nicht anschlich. Jemand, der ganz energisch näherkam. Der sich seiner Sache ganz sicher war, auf keinen Widerstand zu stoßen. Temming fühlte sich wehrlos. Wehrlos vor einem geöffneten Tresor, der all die Geheimnisse barg, die er ein Leben lang geheim gehalten hatte.
3
Sven Temming, gerade 42 Jahre alt geworden, war kein großer Redner. Und schon gar keiner, der improvisieren konnte. Dass er heute seinen übermächtigen Vater, den Senior des Hauses, vertreten musste, hatte ihn ziemliche Überwindung gekostet. Immerhin handelte es sich bei der Besuchergruppe, die vor ihm saß, um altgediente Unternehmer, die darauf vorbereitet gewesen waren, mit dem Senior ins Gespräch zu kommen. Der aber hatte kurzfristig aus persönlichen Gründen die Teilnahme absagen müssen, wie Sven Temming mit belegter Stimme erklärte. Und wieder einmal überkam ihn dabei das fahle Gefühl, noch immer als der wenig akzeptierte Junior zu gelten, der in diesem Familienbetrieb keine natürliche Autorität und kein Selbstbewusstsein entfalten konnte.
Als er voriges Jahr die Führung des traditionsreichen Chemieunternehmens übernahm, fühlte er sich ins eiskalte Wasser geworfen. Zwar war er drei Jahre lang der Juniorchef gewesen, doch hatte allein sein Vater die Richtlinien bestimmt. Und der war nicht davor zurückgeschreckt, den Sohn vor den Mitarbeitern bloßzustellen. Wenn der Senior seine berühmt-berüchtigten cholerischen Anfälle bekam, blieb davon auch Sven nicht verschont. Dann zog er sich meist wortlos zurück. Frühere Mitarbeiter hatten ihn einmal damit getröstet, dass auch der Seniorchef Ähnliches durchgemacht habe: »Der hat Ihren Vater in den 60er-Jahren regelrecht gezwungen, den Betrieb zu übernehmen«, war ein Satz, den Sven schon viele Male gehört hatte. Natürlich war es für seinen Großvater Georg gewiss nicht einfach gewesen, nach dem Zweiten Weltkrieg einen Betrieb zu gründen und erfolgreich zu sein. Sven wusste auch um die Fehde, die es damals innerhalb der Familie um den Nachfolger gegeben hatte. Und er kannte auch die Geschichte um den ›tragischen Unfall‹, wie der Tod des Bruders seines Vaters immer genannt wurde. Sven kannte den Siegfried natürlich nur von Fotos. Es wäre sein Onkel gewesen.
Sven hatte schon oft darüber nachgedacht, was geschehen wäre, wenn es diesen tragischen Fenstersturz nicht gegeben hätte. Dann wäre ganz gewiss nicht sein Vater Firmenchef geworden, sondern dieser Siegfried – und die Erbfolge wäre eine ganz andere geworden. So aber hatte das Schicksal nun ihn, den 42-jährigen Sven zum Unternehmer gemacht. Von Beruf Sohn, meldete sich oftmals eine innere Stimme. Irgendwo hatte er diese böse Bezeichnung einmal gelesen. Sie war nicht auf ihn bezogen gewesen, aber zutreffend war sie.
Einige Male schon hatte er nach einem Tobsuchtsanfall seines Vaters ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, die Firma zu verlassen und auf das Erbe zu verzichten. Dass er es doch nicht tat, lag an den enormen Gewinnen, die der Expansionskurs des Vaters zweifelsohne bescherte. Mitte der 90er-Jahre hatte der seine Fühler erfolgreich in den Nahen Osten ausgestreckt. Iran, Irak, Saudi-Arabien und die Arabischen Emirate. Der alte Herr hatte mithilfe seiner Parteifreunde einflussreiche Wirtschaftsvertreter aus diesen Ländern kennengelernt. Seither florierte das Geschäft, auch wenn die eine oder andere chemische Substanz, die sie exportierten, möglicherweise nicht allein für die offiziell bestimmte Nutzung verarbeitet wurde. Aber deshalb brauchten sie doch kein schlechtes Gewissen zu haben. Senior Temming hatte im Familienkreis einmal gesagt: »Wenn einer Kabel herstellt, weiß er doch auch nicht, ob der Käufer damit nur eine Lampe anschließt.«
Sven Temming fühlte sich unwohl. Der Krawattenknoten spannte, sein dunkles Jackett war viel zu dick. »Meine Damen und Herren«, begann er zögerlich und blickte in die Runde von einigen Dutzend Männern und Frauen, alles ältere Herrschaften, die einer Ruhestandsvereinigung der Industrie- und Handelskammer angehörten. Sie hatten sich zum Ziel gesetzt, ihre halbjährlichen Treffen stets mit der Besichtigung eines Betriebes zu verbinden. »Mein Vater lässt sich also entschuldigen«, wiederholte Sven Temming und blickte im Konferenzraum verunsichert auf die Besucher, die um eine U-förmig angeordnete Tischformation saßen, vor sich Getränke und Gebäck. Er glaubte zu spüren, dass sie ihn nicht ernst nehmen würden. Sie waren den Senior gewohnt, hatten sich jahrelang bei allen wichtigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anlässen getroffen. Da galt er, der Junior, doch nur als Mitläufer. Auch jetzt noch. Denn er hatte Hemmungen, sich irgendwelchen Gesprächskreisen oder unternehmerischen Aktivitäten außerhalb der Firma anzuschließen, übernahm keinerlei Funktion in der Industrie- und Handelskammer und galt als menschenscheu.
Er suchte vergeblich Blickkontakt mit einem Gesicht, das ihm gewisses Verständnis entgegenbringen würde. Sowohl die Damen als auch die Herren gaben sich vornehm distanziert und schienen enttäuscht zu sein, nur von ihm begrüßt zu werden. Zumindest bildete er sich dies ein.
»Die Alb-Donau-Chemiefabrik wurde 1952 gegründet«, erklärte er sachlich und bemerkte selbst, dass seine Stimme viel zu leise klang und nur mühsam das Gebläse des Beamers übertönte, der per Power-Point-Präsentation das Firmenlogo an die weiße Stirnseite des Raumes projizierte. »Eine mutige Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg«, fuhr er fort und ließ per Fernbedienung ein historisches Foto erscheinen, das ein kleines Haus am heutigen Firmensitz zeigte. »Mein Großvater Georg war Jahrgang 22 und wurde in keine gute Zeit hineingeboren. Seine Begeisterung für die Naturwissenschaften, insbesondere der Chemie, wurde schulisch nicht gefördert. Noch bevor er ein Studium aufnehmen konnte, wurde er in die Wehrmacht eingezogen, war bei der Besetzung Frankreichs und Belgiens dabei und entging nach der Invasion der Alliierten in der Normandie im Juni 1944 mit sehr viel Glück der englischen Gefangenschaft. Nach Ende des Krieges bemühte er sich um ein Studium der Chemie, das letztlich zu der mutigen Gründung eines kleinen Betriebs hier in Ulm führte.« Wie die ersten Produkte für den Haushalt aussahen, zeigten Bilder, die der Beamer an die Leinwand warf. Temming kommentierte: »Chemische Mittel für den Haushalt. Zuerst Schuhcreme, dann Putzmittel für die Spülsteine. Man hat damals ja noch nicht die heutigen Cromarganbecken gehabt. Hier …« Er ließ mit einem Knopfdruck das Bild eines Kartons mit entsprechender Aufschrift erscheinen. ›Donau-Feinputz – damit’s so sauber wie die Donau wird‹, hatte es geheißen. Ein Werbespruch, der aber mit zunehmendem Umweltbewusstsein sehr schnell aus dem Verkehr gezogen worden sei, betonte Timming kleinlaut.
Nachdem er eine Viertelstunde die weitere Entwicklung des Betriebs erläutert hatte, unterbrach ihn ein hörbar genervter Zwischenrufer aus dem Kreise der ältesten Besucher: »Wir hätten den verehrten Herrn Seniorchef heute auch mal gerne gefragt, wie er den Übergang von seinem Vater auf ihn erlebt hat. Es war für den Vater doch sicher nicht leicht gewesen, sich von seinem Lebenswerk zu trennen.« In der Stimme schwang Verbitterung mit.
Sven Temming war für einen Moment wieder verunsichert. Er musterte den Fragesteller, konnte mit dem Gesicht aber keinen Namen in Verbindung bringen. Augenblicke später hatte er sich einigermaßen gefangen: »Wenn Gründerväter ihr Lebenswerk an einen Nachfolger abgeben müssen, ist das keine einfache Entscheidung. Sie alle …« – er überflog die annähernd 40 ergrauten Köpfe – »… dürften da auch mehr oder weniger schmerzhafte Erfahrungen gesammelt haben.«
Ein kurzes Raunen ging durch den klimatisierten Raum, das Temming als akustisches Zeichen der Zustimmung wertete. Inzwischen stand ihm Schweiß auf der Stirn, sein korrekt gescheiteltes schwarzes Haar glänzte gegelt. »Mein Großvater Georg hat jedoch das aufblühende Geschäft bis ins hohe Alter verfolgen dürfen. Wie Sie wissen, ist er erst vor drei Jahren im hohen Alter von 92 Jahren verstorben.«
Der Fragesteller, selbst schon weit in den 80ern, aber geistig und körperlich fit, wollte sich damit nicht zufriedengeben: »Dann hat Ihr Vater noch sehr lange unter dem Erfolgsdruck seines Vaters gestanden. Nahezu während seiner ganzen eigenen unternehmerischen Tätigkeit, wenn ich das richtig sehe.«
Sven Temming holte tief Luft und fühlte sich ertappt: Vielleicht erging es ihm ja eines Tages genauso. Wieder spürte er, wie dieser Druck auf ihm lastete, wie er auf die Bilanzen der Vorjahre schielte, um sie möglichst weiter nach oben zu treiben. Der Vater schien allgegenwärtig zu sein, auch wenn er sich nicht am Firmensitz in Ulm aufhielt, sondern – wie heute – daheim in Kuchen, einer Gemeinde bei Geislingen an der Steige, rund 35 Kilometer von hier entfernt.
Temming hatte ein paar Sekunden für eine Antwort gebraucht: »Wir alle, das wissen Sie, stehen unter Erfolgsdruck. Aber die Zeiten ändern sich schnell – und alles war sicher gut zu seiner Zeit. Aber die Änderungen in Politik und Wirtschaft gehen rasant vonstatten, und da gilt es, mit den Mitteln der heutigen Zeit zu reagieren. Denken Sie nur an vergangenen Sommer, als die Briten plötzlich für den Austritt aus der EU gestimmt haben. Noch heute, ein Jahr danach, weiß niemand so genau, welche Folgen dies für die weitere wirtschaftliche Zukunft Europas hat. Oder denken Sie an die USA, an Präsidenten Donald Trump und dessen unberechenbare Politik.«
Temming musste sich eingestehen, dass er sich elegant einer konkreten Antwort entzogen hatte, und hoffte, keine weiteren Fragen zur familiären Situation entgegennehmen zu müssen. Er entschied, sie ab sofort einfach zu ignorieren.
4
Walter Temming stand wie zur Salzsäule erstarrt zwischen seinen Regalen, einige Schnellhefter in den zitternden Händen. Er kannte die Schritte, die durch die unterirdischen Räume näherkamen, schnell und entschlossen. Dann hallte auch schon eine Frauenstimme dumpf an seine Ohren: »Hallo, ist da jemand? Walter, bist du das?«
Seine Frau. Gisela. War sie schon zurück? Hatte etwas ihren Zeitplan durcheinandergebracht? Und woher wusste sie, dass er hier unten sein würde?
Er holte tief Luft, als sie bereits zwischen einem der Aktengänge auftauchte und sich ihre Blicke trafen. »Walter«, presste sie erschrocken hervor und hielt in der Bewegung inne. »Was zum Teufel ist in dich gefahren? Was suchst du denn hier?« Eine überflüssige Frage, denn sie wusste genauso gut wie ihr Mann, was sich in dem versteckten Tresor hinter dem hervorgeschobenen Schrank befand.
»Ich …«, kam es aus Walters trockener Kehle, und es hörte sich wie bei einem Buben an, der bei einem dummen Streich ertappt worden war. »Ich wollte nur sichergehen, dass noch alles da ist.«
»Wie bitte?« Gisela ging zögernd und misstrauisch weiter. »Walter, du bist ja ganz aufgeregt. Was geht hier vor?«
Er quälte sich ein Lächeln ab, das in seinem blassen und von Falten durchzogenen Gesicht gekünstelt wirkte. »Ich überleg mir, ob ich das Zeug endgültig vernichten soll«, stammelte er, doch seiner energischen Frau klang dies nicht überzeugend genug.
»Walter«, fuhr sie ihn an, »wie kommst du denn da drauf? Wir waren uns doch einig, dass es nicht außer Haus kommt. Auch nicht geschreddert.«
Er ließ die Hand mit dem Schnellhefter sinken. »Aber irgendwann muss das Zeug weg«, beharrte er.
»Hast du vergessen, was wir ausgemacht haben?« Gisela starrte ihn durch ihre dicken Brillengläser an, als suche sie in seinem Gesicht Anzeichen von geistiger Umnachtung. »Sven wird erst nach unserem Tod von diesem Zeug erfahren – und dann kann er damit machen, was er will.«
»Weiß ich doch«, versuchte Walter abzuwiegeln. »Aber ich hatte so ein ungutes Gefühl, es könnte nicht mehr da sein.«
»Nicht mehr da sein?«, wiederholte sie ungläubig. »Wie soll es denn verschwinden, wenn es in diesem Tresor drin ist?« Ihre Augen blitzten angriffslustig. »Geht’s dir nicht gut, Walter? Oder was ist los?«
»Entschuldige«, gab er sich kleinlaut und drehte sich zur Rückseite des weggerückten Schranks, um den Schnellhefter im Wandtresor verschwinden zu lassen. »Es war nur so eine Idee«, brummelte er.
»Das glaub ich dir nicht, Walter«, hörte er ihre keifende Stimme hinter sich. »Was um alles in der Welt hat dich bewogen, ausgerechnet jetzt, wo du gedacht hast, ich sei nicht im Haus, hier runterzugehen?«
Während er die Zahlenkombination des eingerasteten Schlosses auf seinen eigenen Geburtstag einstellte, ließ Gisela hinter ihm nicht locker: »Du machst dir die Mühe, zwei Möbelstücke wegzurücken und renkst dir beinahe das Kreuz aus – das würdest du nicht tun, wenn nichts geschehen wäre.«
»Weißt du«, drehte er sich um und sah seine noch immer adrette Frau an, die ein paar Jahre jünger war als er. »Auch wenn wir nicht mehr darüber reden. Man kriegt das nicht los. Es haftet an einem.« Er sah sie verunsichert an. »Wieso bist du eigentlich so schnell zurückgekehrt?«
Sie überlegte nicht lange. »Ich hatte plötzlich das Bedürfnis, es tun zu müssen. Außerdem ist mir eingefallen, dass ich noch wichtigen Schriftverkehr zu erledigen habe.« Ihr Blick verriet Überlegenheit. »Du weißt doch: Mein Gefühl trügt mich selten. Und wenn ich ihm folge, kommt es zu seltsamen Begegnungen.« Sie wartete keine Antwort ab, drehte sich um und verschwand zwischen den Regalen. Ihre lauten Trittgeräusche ebbten langsam ab.
5
Die Dame war gewiss schon weit über 70, aber geistig rege und ihr Erscheinungsbild sehr gepflegt, das volle Haar blond, sicherlich gefärbt – und ihr Auftreten energisch. Nach der Verabschiedung der Besucher hatte sie den Chef beiseitegenommen und ihm fest in die Augen geschaut: »Sie werden mich nicht kennen, aber ich fühle mich noch immer eng mit der Firma verbunden. Mein Name ist Ursula Fuchs, und ich war als junge Frau schon Betriebsrätin und später sogar die Vorsitzende. Mit Ihrem Großvater war ich nicht immer auf einer Linie, wie Sie sich denken können. Wir konnten uns streiten bis aufs Blut, aber letztendlich haben wir immer einen Kompromiss gefunden«, sagte sie milde lächelnd.
»Das freut mich, wenn Ihnen das gelungen ist«, erwiderte Sven Temming leicht gereizt. Er wollte nicht immer auf seinen Vater oder den Großvater angesprochen werden, aber er wusste, dass ehemalige Mitarbeiter gerne in der Vergangenheit schwelgten und ein großes Befürfnis hatten, ihre gewiss inzwischen geschönten Erlebnisse zu schildern. Für heute hatte er aber genug.
»Junger Mann«, ließ die Dame nicht locker, »es ist damals viel über die Sache mit Siegfried gesprochen worden, dem Bruder Ihres Vaters. Wir vom Betriebsrat fanden das nicht in Ordnung, wie die Nachfolge geregelt wurde.«
Sven Temming ahnte, worauf sie hinauswollte. »Bedenken Sie aber bitte, ich war damals, als es passiert ist, noch gar nicht auf der Welt. Das war 1968 – und ich bin 1975 geboren.«
»Das weiß ich doch«, unterbrach sie ihn schnell. »Ich rede auch von 1987, als Ihr Herr Vater auf den Chefsessel gestiegen ist. Deshalb hätte ich mich heute gern einmal mit ihm in Ruhe darüber unterhalten.«
Temming wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn und sah sich um. Der Konferenzraum hatte sich längst geleert, und es wurde höchste Zeit, zum Tagesgeschäft überzugehen.
»Geht’s Ihnen denn nicht gut?«, hörte er, kurz in Gedanken versunken, die Stimme dieser penetranten Frau.
»Doch, doch, doch«, beeilte er sich zu sagen. »Ich mache Ihnen einen Vorschlag, wenn Sie mit meinem Vater Vergangenheitsbewältigung betreiben wollen, dann rufen Sie ihn doch bitte an und vereinbaren einen Termin mit ihm.« Er lächelte verlegen. »Vielleicht freut er sich ja tatsächlich, mit Ihnen zu reden.«
Sie sah ihn von der Seite kritisch an. »Da bin ich mir nicht mal so sicher.«
6
Sie hatte nach dem unerwarteten Zusammentreffen im Aktenkeller nicht mehr darüber gesprochen. Gisela Temming, voller Elan und auf eine gute Figur bedacht, war schweigend in die Wohnung hochgegangen, jedoch fest entschlossen, das Thema heute noch anzusprechen. Nachdem sie ihren Schriftverkehr erledigt hatte und Walter von einem Spaziergang an dem Flüsschen Fils zurückgekehrt war, trafen sie sich zum Abendessen, das ihre gelegentliche Haushaltshilfe, eine ältere Dame aus der Nachbarschaft, zubereitet hatte. Es gab heute Urschwäbisches, nämlich Maultaschen und Kartoffelsalat. Walter Temming, der trotz allen unternehmerischen Erfolges bodenständig geblieben war, schätzte die regionale Küche. Zwar war er weit in der Welt herumgekommen, aber jedes Mal hatte er sich bei der Rückkehr auf ein heimisches Essen gefreut.
Seine Wurzeln hatte er hier im Filstal, hier, zwischen Stuttgart und Ulm. Sein Vater Georg war im benachbarten Geislingen an der Steige aufgewachsen und dort zum Unternehmer geworden. Dass er nach den ersten Erfolgen mit seinem Betrieb ins jenseits der Alb gelegene Ulm umgesiedelt war, war für ihn ein schwerer Entschluss gewesen, zumal er bereits diese herrschaftliche Villa in Kuchen erworben hatte. Aber zum einen hatte er in der Donaustadt ein brachliegendes Firmenareal, das seinen Bedürfnissen gerecht wurde, günstig erwerben können – und zum anderen war ihm Ulm als Standortadresse vorteilhaft erschienen. Außerdem gab es dort bereits in den 50er-Jahren relativ gute Fernverkehrsverbindungen sowohl auf der Schiene als auch auf der Straße. München war nur etwa eineinhalb Autostunden entfernt – ein entsprechendes Fahrzeug und günstige Verkehrsverhältnisse vorausgesetzt.
Die Haushaltshilfe war bereits gegangen, als sie sich an den runden Eichentisch setzten und sich einen guten Appetit wünschten. Walter Temming hatte sich sein geliebtes Weizenbier eingeschenkt, seine Frau bevorzugte Rotwein.
»Es tut mir leid, wenn ich dich erschreckt habe«, begann Gisela, nachdem sie sich während des Essens über Belanglosigkeiten unterhalten hatten, das Zusammentreffen im Aktenkeller anzusprechen. »Aber ich bin wirklich in Sorge, es könnte etwas geschehen sein. Jahrelang bist du nicht da unten gewesen.«
Walter wich ihren Blicken aus und aß weiter.
»Es wird nicht besser, wenn wir nicht drüber reden«, blieb sie hartnäckig.
Er wischte sich den Mund ab, nahm einen Schluck Bier und sah zu einem Glasschrank hinüber, während im Wohnzimmer nebenan die antike Standuhr mit ihrer Mechanik hörbar die Sekunden abhakte. »Es …«, begann er langsam, »es hat sich tatsächlich etwas ereignet.« Er hatte sich die Worte während seines Spaziergangs am nahen Fluss entlang wohl überlegt. »Es ist ein Brief gekommen.«
Giselas feine Gesichtszüge versteinerten sich. Die wenigen Worte hatten sie das gute Essen vergessen lassen. »Ein Brief? Von wem?«
Walter schob seinen leer gegessenen Teller ein Stück von sich weg. »Wenn du mich so fragst, Gisela, dann gibt’s nur eine Antwort: von Siegfried.«
»Von …?« Sie wagte es nicht auszusprechen. Für einen Moment überlegte sie, ob ihr Mann einen schlechten Scherz gemacht hatte. Aber bei diesem Thema war ihm ganz gewiss nicht danach. Ihr schnürte irgendetwas die Kehle zu. »Siegfried?«, wiederholte sie fassungslos und ungläubig gleichermaßen.
Er hatte sich während des Spaziergangs durchgerungen, ihr von dem anonymen Brief zu erzählen.
»Sag, dass das nicht wahr ist«, hörte er ihre Stimme, während er ins angrenzende Wohnzimmer hinüberging, um hinter dem Klapptürchen des Schranks den versteckten Brief zu holen.
»Ist heute gekommen«, sagte er ernst und zog das Papier aus dem weißen Kuvert. »Es liest sich, als habe Siegfried geschrieben.«
Gisela war blass geworden. »Weißt du auch, was du da sagst?« Sie nahm das Schreiben in die Hände und überflog den darauf gedruckten Text. Den Zusatz am Ende las sie mit zitternder Stimme laut vor: »›Schönen Gruß von Barbara. Ich hab sie inzwischen getroffen. Es geht ihr gut.‹« Sie starrte ihren Mann mit unsicheren Augen an. »Barbara«, widerholte sie. »Mein Gott, was hat das zu bedeuten?«
Walter schwieg. Ein paar stille Sekunden später zitierte Gisela einen weiteren Satz, der ihr eine trockene Kehle bescherte: »›Aber das Schicksal hat es so gewollt, dass sich unsere Wege in deinem Leben noch einmal kreuzen. Auch wenn du es nicht für möglich halten wirst, aber ich bin gekommen, um das, was vor 49 Jahren geschehen ist, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.‹« Sie hob den Blick und starrte ihren Mann erneut fassungslos an. »Was will uns das sagen?«
Walter zuckte mit den Schultern und trank sein Weizenbierglas leer. »Dass es nicht in Vergessenheit gerät.«
»Erpressung? Soll das eine Erpressung sein?« Sie las eine weitere Passage vor: »Ich bin gekommen, meinen Teil zu holen oder dich der gerechten irdischen Strafe zuzuführen. Das klingt doch nach Erpressung. Da will jemand Geld.«
»Geld und für mich die gerechte irdische Strafe, so könnte man das deuten«, flüsterte Walter, als habe er Angst, jemand könnte es hören. »Der Schreiber – oder die Schreiberin – ist mit den Ereignissen offenbar bestens vertraut. Daran besteht nicht der geringste Zweifel.«
Gisela konnte ihre Unruhe nicht verbergen, als sie einen weiteren Satz zitierte: »›Aber nun wurde mir die Gelegenheit geboten, ins Vergangene einzugreifen.‹ Das klingt unheimlich, Walter. Fast so, als habe es dein Bruder Siegfried selbst geschrieben.«
Ihr Mann musste diese Worte einige Sekunden lang verdauen, um dann sachlich anzumerken: »Tote schreiben keine Briefe.« Noch während er dies sagte, wurde ihm bewusst, dass Gisela ein Faible für Unerklärliches und Mysteriöses hatte. Ein Bücherregal war voll mit entsprechender Literatur über das, was nach dem Tode kommen könnte. Und dabei wehrte sie sich energisch dagegen, als Esoterikerin abgestempelt zu werden. Immerhin legte sie Wert auf Publikationen renommierter Autoren und Wissenschaftler, die dieses Thema kritisch angingen und entsprechende Erlebnisberichte unvoreingenommen prüften und untersuchten. »Die Welt ist voller Geheimnisse«, pflegte sie oft im Freundeskreis zu sagen.
Doch jetzt wollte Walter gleich gar keine Diskussion entfachen. Die Lage war viel zu ernst. »Wir sollten die Sache mit kühlem Kopf angehen«, entschied er. »Wahrscheinlich haben wir’s mit irgendeinem Verrückten zu tun, der all diese Gerüchte über die Sache mit Siegfried irgendwann gehört hat.«
»Mit all dem Detailwissen, das da drinsteht?«, fragte Gisela zweifelnd. »Die Haushaltsleiter, die umgefallene Farbdose beim Streichen des Gartenhauses …« Sie zögerte. »Und Barbara.«
»Da weiß jemand verdammt viel.«
»Und jetzt?«
»Nichts. Wir werden uns nicht verrückt machen lassen«, entschied Walter. »Vielleicht ein frustrierter Mitarbeiter aus früheren Zeiten.«
»Der jetzt im hohen Alter den Frust ablassen muss – über das, was er vor 49 Jahren gerüchteweise gehört hat?«, erwiderte Gisela fragend.
»Was anderes kann’s ja nicht sein – falls du nicht nur an ein Leben im Jenseits glaubst, sondern auch an ein Wiederkommen.«
»Du meinst Reinkarnation?«, gab sich Gisela informiert. Die Fachbegriffe dazu kannte sie aus dem jahrelangen Studium ihrer Fachbücher.
»Wenn man so dazu sagt, ja«, gab er zurück. »Aber wir haben’s nicht mit Buddhismus und Hinduismus zu tun, liebe Gisela. Sondern mit einem handfesten Problem.«
Gisela jagten Tausend Gedanken gleichzeitig durch den Kopf. »Vielleicht gibt es gravierende Ereignisse, die das Gefüge von Raum und Zeit durchdringen.«
Walter hob eine Augenbraue und vermied ein müdes Lächeln. »Entschuldige, Gisela, aber du solltest auf dem Boden der Realität bleiben. Gerade jetzt.«
7
Sven Temming hatte sich nur mit Mühe von der einstigen Betriebsratsvorsitzenden trennen können. Er wollte nichts mit den Querelen der Vergangenheit zu tun haben und sich schon gar nicht mit ehemaligen Mitarbeitern über die Probleme des Familienbetriebs unterhalten. Das heutige Geschäftsleben ließ keinen Platz für nostalgische Gefühle. Den Druck, der auf ihm lastete, empfand er als immer unerträglicher. Die Konkurrenz auf den Weltmärkten war gnadenlos, und der Brexit im vergangenen Jahr, als Großbritannien den Ausstieg aus der EU zu realisieren begann, bereitete ihm allergrößte Kopfschmerzen. Ganz zu schweigen von den USA und den Exporten nach China, die längst nicht mehr so gut florierten wie in den Jahren zuvor. Nein, er wollte sich nicht mit Klatsch und Tratsch, Gerüchten und Befindlichkeiten aus der Vergangenheit befassen.
Dass ausgerechnet heute noch ein Gesprächstermin mit einem jungen Mitarbeiter anstand, der darauf bestanden hatte, seine Beschwerden direkt bei ihm, dem geschäftsführenden Gesellschafter, vorzutragen, kam ihm wenig gelegen.
Dieser Adam Jarowski, der in einem der unzähligen Labore arbeitete, war ein ziemlich unangenehmer Bursche. Weder ein Vieraugengespräch mit dem Teamleiter, noch der Versuch einer Schlichtung durch den Betriebsrat hatte etwas gefruchtet. Temming überflog die Aktennotizen, die man ihm zu diesem Fall angefertigt hatte: Jarowski war demnach 32 Jahre alt und vor sechs Jahren als Chemielaborant eingestellt worden. Er las weiter: »Beste Abschlusszeugnisse, jedoch Aktivist einer Umweltschutzorganisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Produkte der chemischen Industrie kritisch zu beleuchten. Verdacht, dass er Dokumente an die Organisation weitergibt. Darauf angesprochen, reagiert er zornig und droht mit Gewaltanwendung.«
Rausschmeißen, dachte Sven Temming. So schnell wie möglich. Er würde mit diesem Kerl kurzen Prozess machen. Natürlich würde sich der Betriebsrat querstellen. Für einen Moment musste er an die Dame von heute Nachmittag denken, die eingeräumt hatte, oft mit seinem Großvater im Clinch gelegen zu haben. Personalangelegenheiten waren immer eine heikle Sache, die Sven Temming hasste wie die Pest.
Ein paar Minuten später führte die Sekretärin aus dem Vorzimmer den blassgesichtigen jungen Mann herein, der einen verschüchterten Eindruck machte und nicht zu dem Bild passte, das sich Temming aufgrund des Aktenstudiums von ihm zurechtgelegt hatte. Rein äußerlich kein Revoluzzer. Temming taxierte ihn, ohne jedoch Negatives festzustellen. Jeans und Hemd sauber, die Haare kurz. Auch kein Piercing und keine Tätowierungen – also nichts, was Temming verabscheute. Die Hand bei der Begrüßung feucht-kalt. Temming bot ihm einen Platz am Besuchertisch an, setzte sich ebenfalls und stellte klar: »Es kommt nicht alle Tage vor, dass jemand den Weg hierher findet.« Seine Stimme klang hart und entschieden. »Also, junger Mann, was erwarten Sie von mir?«
»Zunächst vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen«, begann Jarowski, wurde aber sofort unterbrochen.
»Zeit hab ich eigentlich keine, kommen Sie deshalb zur Sache.«
Temming nahm zufrieden zur Kenntnis, dass er sein Gegenüber offenbar eingeschüchtert hatte. Oder war das gespielt? Dem Kerl traute er alles zu.
Jarowski spielte nervös mit seinen Fingern. »Ich werde gemobbt«, rang er sich zu einer direkten Antwort durch. »Über mich werden Gerüchte und Lügen verbreitet …«
»… die natürlich nicht stimmen«, fuhr ihm Temming barsch über den Mund. »Es stimmt also nicht, dass Sie als Aktivist irgendeiner ultralinken Organisation öffentlich gegen die Chemieindustrie Stimmung machen?«
»Nein«, erwiderte Jarowski trotzig. »Deshalb bin ich hier. Ich möchte betonen, dass ich zu keiner Zeit …«
Wieder ließ ihn Temming nicht ausreden: »Sie wollen also behaupten, alles, was Ihr Teamleiter recherchiert hat, sei Lug und Trug. Dass er sich demnach alles aus den Fingern gesogen hat, um Sie loszuwerden.«
»So scharf würde ich das nicht formulieren.« Jarowski wurde kleinlaut.
»Wie dann? Sie bringen doch gerade zum Ausdruck, dass Herr Mulzenbach – das ist ja wohl Ihr Teamleiter – ein Lügner ist.«
»Es liegt mir fern …«
Temming war fest entschlossen, keine Widerrede zuzulassen: »Herr Jarowski, entschuldigen Sie bitte, aber was erwarten Sie von Ihrem ziemlich kühnen Vorstoß bei mir? Dass ich sage, ich hätte Verständnis für Ihre – mit Verlaub gesagt – etwas merkwürdige Freizeitbeschäftigung, bei der Sie wohl alles daran setzen, Ihren Arbeitgeber in Misskredit zu bringen? Soll ich sagen: Schön, dass Sie sich für die Umwelt stark machen, zu deren Erhalt im Übrigen die chemische Industrie auch einen Beitrag leistet? Oder haben Sie vergessen, wie unsere Ernten aussähen, wenn wir nicht Unkraut und Schädlinge bekämpfen könnten?«
»Das will ich doch gar nicht bestreiten, aber …«
»Nichts aber!«, wurde Temming noch deutlicher. »Wenn es da ein Aber gibt, dann gibt es nur eines, Herr Jarowski: Sie verlassen unser Unternehmen.«
Jarowski umklammerte die Armlehnen seines Stuhles, als müsse er inneren Druck ablassen. »Sie wollen damit sagen, dass …«
»… dass Sie zum nächstmöglichen Termin entlassen sind. Und ich möchte nicht auch noch aufgedeckt bekommen, dass durch Sie interne Papiere nach außen gedrungen sind.«
Jarowski sprang auf. »Sie wollen mir auch noch Betriebsspionage andichten?«
Temming blieb gelassen. »Nennen Sie es, wie Sie wollen. Aber da könnten sehr schnell auch Schadensersatzforderungen im Raum stehen.« Er räusperte sich. »Also, Herr Jarowski. Ich betrachte unser Gespräch als beendet. Selbstverständlich steht es Ihnen frei, mit Hilfe Ihrer Gewerkschaft oder eines Anwalts gegen uns vorzugehen.«
Jarowski schien es die Sprache verschlagen zu haben. Er stand vor dem Tisch wie ein Schuljunge, den der Rektor gerade zurechtgewiesen hatte.
Temming überlegte, ob diese Reaktion gespielt oder echt war. Er legte nach: »Sie sollten sich aber rechtliche Schritte genau überlegen, denn – wie gesagt – es könnte bittere Folgen für Sie haben.«
Jarowski schwankte zwischen unbändigem Zorn, maßloser Enttäuschung und eingeschüchtertem Verhalten.
»Sie können gehen«, schnarrte ihm die Stimme entgegen. Unpersönlich, gnadenlos.
Das wirst du mir büßen, dachte Jarowski und verließ wortlos und türeschlagend das Chefbüro.
8
Es war eine Nacht wie schon viele Tausend zuvor: Walter Temming quälten die Bilder, die ihn seit 49 Jahren verfolgten. Und jedes Mal schienen sie dramatischer und eindringlicher zu werden. Dies erst recht, nachdem es einen Unbekannten gab, der mit seinem anonymen Brief alles wieder in die Gegenwart zurückgeholt hatte. Mehr als je zuvor lief in Temmings Kopf das Geschehen wie in einem auf Endlosmodus gestellten Film ab. Und es schien, als würden diese Szenen immer mächtiger. Mit Vernunft dagegen anzugehen und sich einzureden, dass viele der Details vielleicht ganz anders waren, als sie sich nach dieser langen Zeit darstellten, nützte nichts. Die damit verbundenen Gefühle waren genau dieselben wie damals. Der Sturz von der Leiter, hinaus in den Abgrund, der Todesschrei, der dumpfe Aufprall des Körpers im Brunnenbecken – und dann das entsetzte Gesicht von Barbara, der Haushälterin, die ausgerechnet in diesem Augenblick in das Dachgeschosszimmer gekommen war. Bis heute plagte ihn die ungekärt gebliebene Frage, weshalb die damals hochschwangere junge Frau an jenem Samstag an ihre Arbeitsstelle zurückgekehrt war, obwohl sie seit zwei Wochen krankgeschrieben war. Sie habe etwas holen wollen, hatte sie zu Tode erschrocken ihre plötzliche Anwesenheit begründet. Und weil in den unteren Etagen niemand gewesen sei, sie aber von oben hämmernde Geräusche gehört habe, sei sie hochgegangen, um nachzuschauen, was dort gemacht werde.
Doch da war noch ein weiteres, bis heute ungeklärtes Rätsel: Siegfrieds Hausschlüssel war spurlos verschwunden. Zunächst hatten sie geglaubt, das er beim Sturz aus dem Fenster verloren gegangen sein könnte. Doch so sehr sie auch suchten, draußen im Brunnen und in den angrenzenden Blumenbeeten – er war nicht mehr aufzutreiben. Dabei hätte man den Schlüssel kaum übersehen können, denn Siegfried hatte einen ziemlich auffälligen Schlüsselanhänger, der aus einer Mininachbildung der Apollo-Kapsel bestand, mit der die NASA in den späten 60er-Jahren die Mondlandung vorbereitete. Siegfried war ein begeisterter Raumfahrtfan gewesen.
Temming lag schweißgebadet im Bett, während seine Frau nach einem langen Diskussionsabend nun dank des Rotweins mit gleichmäßigen Atemzügen schlief.
Er starrte in die Nacht, die ihm weiße, wild drehende Kringel vor die Augen projizierte. Doch da war nichts. Nur das undurchdringliche Schwarz. Der Rollladen war geschlossen, die Schlafzimmertür auch. Kein leuchtender Wecker, kein Standby-Licht irgendeines Gerätes. Nur stockdunkle Nacht. Auch kein Geräusch. Die herrschaftliche Villa stand weit genug von der Straße entfernt. Nur wenn nachts ein ratternder Güterzug durch das Tal fuhr, war das metallische Rauschen zu vernehmen.
Temming schloss die Augen, um die rotierenden und kreisenden Ornamente loszuwerden. Sie verschwanden nur kurz, und sobald er wieder in die Nacht hineinstarrte, waren sie wieder da. Diese Nebel der Nacht, diese undefinierbaren Fäden und Grau-Schwarz-Schattierungen, die sein Gehirn aus dem Nichts formte. Je länger er in solchen Nächten diese unwirklichen Bilder auf sich wirken ließ, desto mehr glaubte er, seltsame Formen zu erkennen – bis hin zu Gesichtern, die ihn anlächelten, jedoch sofort wieder ausgeblendet wurden. Manche trugen Brillen, andere waren bärtig. Aber so sehr er sich auch anstrengte, nie war ein ihm bekanntes Gesicht dabei. Es war meist ein wildes Durcheinander, ein Aus- und Einblenden – als ob ihm ein in kleine Stücke zerlegtes Video vorgespielt würde.
Oft schon hatte er sich überlegt, was er da tatsächlich sah. Waren es reine Hirngespinste, reine Fantastereien? Oder Energiefelder, die sich in der Dunkelheit zu irrealen Objekten manifestierten? Plasma womöglich?
Quatsch, versuchte er sich selbst zur Vernunft zu rufen. Vernunft? Gab es das überhaupt? Oder war Vernunft nur das, was als allgemeingültig galt – als ein Produkt dessen, was eine rein materielle Gesellschaft für regelkonform hielt? Wenn er an so etwas dachte, musste er sich eingestehen, dass Giselas Lebensphilosophien nicht spurlos an ihm vorbeigegangen waren. Obwohl ihm vieles, womit sich seine Frau seit geraumer Zeit befasste, ziemlich fremd war. Als Realist, der ein Leben lang mit harten Bandagen gegen die Konkurrenz gekämpft hatte, fehlte ihm der Zugang zu der spirituellen Welt, wie Gisela es ihm neuerdings immer häufiger vorhielt. Natürlich glaubte er an irgendeine Kraft und Macht, die hinter allem stand – nicht aber an einen personifizierten Gott, der da irgendwo thronte und dem offenbar seine Geschöpfe völlig entglitten waren. Temming tat sich auch schwer damit, wenn Theologen nach einer Katastrophe damit trösteten, dass Gottes Wege eben unergründlich seien. Dies wiederum, so dachte Temming, würde letztlich bedeuten, dass tausendfaches Leid und Elend nötig seien, um das Ziel der Schöpfung zu erreichen.
Für Temming waren Religionen der von Menschen gemachte Versuch, eine Erklärung für das Unerklärbare zu finden. Und dies auf einem schmalen Grat, den es heutzutage zumindest in der westlichen Hemisphäre zu beschreiten galt: Hier die gnadenlosen Realisten, die nur glaubten, was man beweisen konnte – dort die Spirituellen, die ein Gespür für etwas hatten, das nicht ins wissenschaftliche Weltbild passte. Wenn im Bekanntenkreis, der überwiegend aus knallharten Geschäftsleuten und Managern bestand, das Gespräch auf solche Themen kam, konnte Gisela wortreich die Realisten kritisieren, die sie als intolerant und Ignoranten beschimpfte, die keine andere Meinung gelten ließen.
Was seine Frau bewogen hatte, sich mit den sogenannten Grenzwissenschaften auseinanderzusetzen, konnte er nur ahnen: Vermutlich war es auch das Ereignis von 1968 gewesen, das ihre Sehnsucht nach einem Wissen darüber geweckt hatte, was nach dem Tode geschehen würde. Dass sie dies nicht mit esoterischer Literatur oder mit Veröffentlichungen irgendwelcher Scharlatane tat, beruhigte ihn. Gisela ließ sich auch nicht von abenteuerlichen Geschichten aus dem Internet beeindrucken, sondern suchte gezielt nach Dokumentationen, hinter denen seriöse Autoren und Verlage standen. Für Gisela bestand kein Zweifel: Es gab Phänomene, die sich bislang nicht erklären ließen. Sie pflegte oft zu sagen: »Vieles, was wir heute wissen, war für die Menschen vergangener Jahrhunderte ein rätselhaftes Phänomen. Warum soll es so etwas nicht auch jetzt geben?« Natürlich hatte sie recht. Das Wissen künftiger Generationen würde manches plausibel machen. Gerne würde Temming deshalb die Welt in 500 Jahren noch einmal sehen. Gisela war davon überzeugt, dass sich sowohl negative als auch positive Ereignisse in den Ort des Geschehens einbrannten – genau so, wie sie dies im menschlichen Gedächtnis taten. Für Gisela hatte auch die Umwelt ein Gedächtnis.
Temming vermochte dies allerdings nicht nachzuvollziehen. Aber falls an dieser Theorie etwas dran war, dann hatte sich auch in ihr Haus etwas Schreckliches eingebrannt. Gisela hatte diese Vermutung zwar nie erwähnt, doch stand sie unausgesprochen zwischen ihnen.
Als Beispiel für positives Umgebungsgedächtnis nannte Gisela meist die sakrale Atmosphäre einer Kirche. Dort werde durch Gebete und Gottesdienste so viel positive Energie gespeichert, dass sich dies auch auf die Menschen auswirke. Ähnliches glaubte Gisela auch in Veranstaltungsräumen zu spüren: Waren sie mit guter Energie erfüllt, fühlte sie sich bereits beim Betreten wohl – gab es schlechte, befiel sie ein innerer Schauder. Dasselbe galt für sie bei Treffen im Freundeskreis. Ihr Gefühl konnte ihr angeblich bereits nach wenigen Minuten sagen, ob die Stimmung gut oder schlecht sein würde.
Seit sich Gisela mit solchen Dingen beschäftigte, musste er in schlaflosen Nächten an all dies denken. Hatten Häuser wirklich ein Gedächtnis? War es dies, das ihn davon abhielt, das Dachgeschosszimmer zu betreten? Manchmal war er monatelang nicht da oben gewesen. Und wenn es sich nicht vermeiden ließ, überkam ihn jedes Mal ein eisiges Gefühl der Angst. Er hatte nie mehr wieder das Fenster geöffnet – und er mied es sogar, durch die Scheibe nach unten zu schauen, obwohl es den Brunnen schon lange nicht mehr gab. Sie hatten ihn gleich nach dem Geschehen zuschütten lassen.
Es gab sogar Nächte, in denen er befürchtete, sie seien nicht allein in dem großen Haus. Einige Male war er in den vergangenen Jahren aufgestanden, weil er Einbrecher vermutet hatte. Doch da hatte es nichts gegeben. Ein altes Haus verursachte eben Eigengeräusche. Wärme- und kältebedingt. Rohre dehnten sich aus und zogen sich zusammen, die Holzböden knarrten, das teilweise antike Mobiliar sowieso. Seltsamerweise hatte in solchen Fällen dann meist in irgendeinem Zimmer Licht gebrannt. Es war wohl vergessen worden, es auszuknipsen. Auch dass nach solchen belastenden Nächten sehr oft anderntags ein elektronisches Gerät nicht mehr funktionierte oder Glühlampen kaputt gingen, war nichts weiter als ein Zufall, dachte Temming nun wieder, während vom Wohnzimmer der dumpfe Zwei-Uhr-Schlag der Standuhr ins Schlafzimmer heraufdrang.
Unweigerlich fragte er sich, ob nach dieser Nacht auch morgen wieder etwas defekt sein würde …
9
Sven Temming hatte bis spätabends in seinem Büro gearbeitet, E-Mails gelesen und dabei immer wieder den Gedanken an diesen jungen Mann verdrängt. Adam Jarowski war kein sehr angenehmer Zeitgenosse. Aufsässig, egoistisch und unberechenbar. Temming hatte den Umgang mit Personal nie gelernt und kompensierte fehlende Menschenführung mit Arroganz. Zwar hatte er erst ein Jahr lang das Sagen, aber spürte längst, wie ihm von Seiten der Mitarbeiter ein Unbehagen entgegenschlug. Sein Vater Walter war zwar auch herrschsüchtig und polternd gewesen, hatte aber eine natürliche Autorität ausgestrahlt, die ihm Respekt verschaffte. Er, der notgedrungen in dessen Fußstapfen treten musste, verscherzte tagtäglich ein Stück mehr an Sympathie und wurde zur beliebten Zielscheibe eines – wie er es empfand – geradezu militanten Betriebsratsgremiums, das von den Gewerkschaften unterlaufen war.
Jarowski würde gewiss alle Register ziehen, um die Entlassung hinauszuzögern und womöglich eine Abfindung zu erstreiten. Denn die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden, fußten auf einer Reihe von Behauptungen anderer Mitarbeiter. Habhafte Beweise, dass Jarowski mit einer aggressiven Aktionsgruppe von Umweltschützern zusammenarbeitete, gab es hingegen nicht. Und Jarowski war gewiss clever genug, um zu behaupten, er pflege rein aus beruflichem Interesse enge Kontakte zu jenen Kreisen, die in der Chemieindustrie die Giftmischer der Nation sahen.
Temming überkam plötzlich ein ganz anderer Gedanke: Typen wie Jarowski war es auch zuzutrauen, dass sie zu ganz anderen Mitteln griffen. Die Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung hatte in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. Und womit Politiker jederzeit rechnen mussten, das galt für die Wirtschaftsführer erst recht. Temming junior war von diesem Szenario verunsichert. Er musste an seine junge Frau Sylvia und den vierjährigen Sohn Felix denken. Nicht selten waren in der Vergangenheit die Angehörigen von Inhabern großer Firmen entführt worden. War so etwas auch von Jarowski zu befürchten? Temming versuchte, sich zu beruhigen. Dass er jetzt übernervös und gereizt reagierte, lag ganz gewiss an dem stressigen Tag, den er heute durchzustehen hatte.
Kurz nach 21 Uhr entschied er, den Computer in den Ruhemodus zu schicken und nach Hause zur Familie zu fahren. Er knipste die Lichter im Büro aus und verließ das weiträumige Firmenareal. Wenige Minuten später rollte sein nagelneuer dunkler Mercedes GLC aus der Tiefgarage, vorbei am Pförtner, dem Temming freundlich zuwinkte.
Der Herbstabend war unwirtlich und längst dunkel. Für einen Moment trauerte Temming den hellen Sommertagen nach, die unendlich lang zurückzuliegen schienen. Die Fahrt führte ihn aus dem Ulmer Stadtrandgebiet hinaus auf die B 30, auf der in Richtung Friedrichshafen nur wenig Verkehr herrschte. Bereits zwei Ausfahrten weiter verließ er sie bei Laupheim wieder, um ein beschauliches Wohngebiet in der Nähe des dortigen Flugplatzes anzusteuern. Der Asphalt der kleinen Nebenstraße glänzte feucht, vereinzelt flatterte Laub durch die Oktobernacht. Der Nieselregen schien das Licht der Straßenlampen zu neutralisieren.
In Sichtweite zu seinem geräumigen Einfamilienhaus schwenkte das Garagentor auf, sodass er den SUV-Mercedes auf der breiten Hofeinfahrt mit einem weit ausholenden Bogen ins Trockene chauffieren konnte. Sofort ließ er hinter sich das Tor nach unten gleiten – aufmerksam prüfend, dass sich niemand ungesehen hereinschleichen konnte. Und wieder spürte er das Unbehagen, das ihn seit dem Zusammentreffen mit Jarowski heute beschlichen hatte.
Nie zuvor war ihm die schlechte Beleuchtung dieser Nebenstraßen aufgefallen. Nie zuvor hatte er befürchtet, jemand könnte sich über die Garage Zugang zum Haus verschaffen. Heute hingegen hatte er gelauscht, ob das Tor auch tatsächlich in die automatische Verriegelung fiel. Erst danach öffnete er die Verbindungstür zum Haus, knipste im Flur das Licht an, zog hinter sich die Tür nicht nur ins Schloss, sondern verriegelte sie auch mit dem Schlüssel. Seine Frau, die ihm mit dem ungestümen Felix im Schlepptau entgegenkam und ihm einen Kuss auf die Wange drückte, war irritiert: »Was ist’n heute los? Warum schließt du die Garagentür ab?«