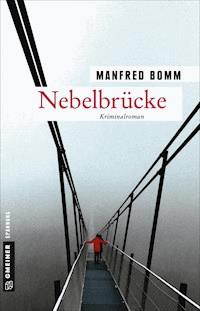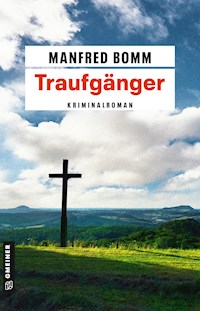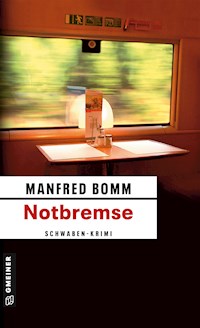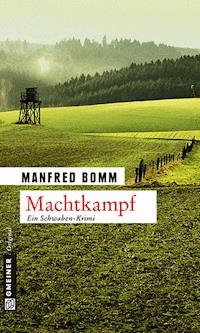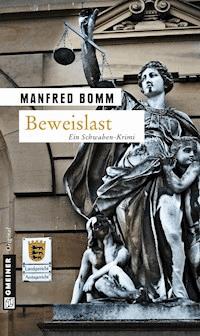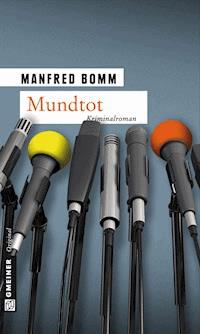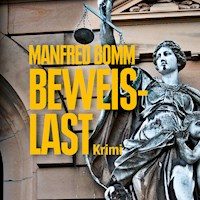Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar August Häberle
- Sprache: Deutsch
Es ist eine der größten Eisenbahn-Baustellen Europas: Zwischen Stuttgart und Ulm wird die Schnellbahn-Trasse durch die Schwäbische Alb gebohrt. Während in der baden-württembergischen Landeshauptstadt noch immer laut gegen das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 demonstriert wird, ist die Ruhe auf der Albhochfläche trügerisch. Denn eines Nachts liegen auf dem Transportband, mit dem das Abraummaterial aus den Stollen gefördert wird, Teile eines menschlichen Körpers. Unfall oder Mord? Kriminalkommissar August Häberle beginnt zu ermitteln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 680
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Bomm
Todesstollen
Der sechzehnte Fall für August Häberle
Impressum
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Lauschkommando (2015), Machtkampf (2014), Grauzone (2013), Mundtot (2012), Blutsauger (2011), Kurzschluss (2010), Glasklar (2009), Notbremse (2008), Schattennetz (2007), Beweislast (2007), Schusslinie (2006), Mordloch (2005), Trugschluss (2005), Irrflug (2004), Himmelsfelsen (2004)
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2016 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2016
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Donna – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4972-7
Widmung
Gewidmet allen, die sich trotz der großen Errungenschaften unserer Zeit einsam und verlassen fühlen, weil sie nicht am Luxus und Wohlstand derer teilhaben dürfen, die es auf geschickte, bisweilen aber wenig legale Weise zu Macht und Vermögen gebracht haben. Mögen all jene, die in das Räderwerk von Arbeitsdruck, Ausbeutung und Mobbing geraten sind, immer noch an das Gute glauben, das bisweilen leider viel zu spät obsiegt. Manchmal dauert es sehr lange, bis die Gerechtigkeit für Ausgleich und Zufriedenheit sorgt und jenen Genugtuung verschafft, die darunter hatten leiden müssen. Vergessen wir deshalb nie: Glaube versetzt Berge – und es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels.
1. Kapitel
Wie Pyramiden, gespenstisch und tiefschwarz, zeichneten sich die riesigen Schutthalden vom nachtgrauen Hintergrund ab. Immer, wenn Frank Niedermeier im grellen Scheinwerferlicht seines Radladers abrutschendes Gestein zusammenschob, um den Weg durch diese Deponie frei zu halten, fühlte er sich wie auf einem fremden Planeten. So musste es sein, wenn eines fernen Tages Menschen den unwirtlichen Mond oder den Mars besiedelten. Der junge Mann, der seine PS-starke Maschine einige Male hin und her rangierte, hätte sich diese bizarre Landschaft aus Abraumhalden auch als Kulisse für einen Science-Fiction-Film vorstellen können. Oder für einen Western, der in einem abgelegenen Tal einer Steinwüste spielte, wo jeden Augenblick Cowboys oder Banditen auftauchen würden.
Doch hier war weder Hollywood noch eine ferne Welt. Niedermeier, ein stämmiger Kerl aus Kärnten, hatte auf der Schwäbischen Alb einen Job, der ihm, wenn alles gut ging, noch jahrelang erhalten blieb. Sein Arbeitgeber – ein großes österreichisches Unternehmen – galt als Spezialist für die Aufbereitung von Abraumgestein aller Art, weshalb die Deponie so etwas wie ein Schotterwerk ohne Steinbruch war.
Den Rohstoff, den die Brechanlagen zu Kies und Schotter zerkleinerten, gab’s in Hülle und Fülle. Denn seit vor zwei Jahren damit begonnen worden war, die Tunnelröhren für die Schnellbahntrasse Stuttgart-Ulm zu graben, spuckte das Förderband, das inzwischen dreieinhalb Kilometer weit in die beiden nebeneinanderliegenden Stollen hineinreichte, unablässig Steinbrocken aus. Ratternd und scheppernd transportierte es seine schwere Fracht aus den Tiefen des Mittelgebirges quer über das weitläufige Baustellenareal, vorbei an den Bürocontainern, hinüber zu den immer höher aufragenden künstlichen Hügeln. Dort, wo das Förderband wie eine schiefe Ebene zum Himmel gereckt endete, fielen die Gesteinsbrocken dumpf polternd herab und ließen diese kegelförmigen Hügel wachsen, von denen es mittlerweile mehr als ein Dutzend gab. Sobald wieder einer hoch genug war, wurde das Ende der Transportanlage neu ausgerichtet. Bis das Material hier ankam, hatte es bereits ein Brechwerk passiert, in dem es zu handlichen Stücken gepresst und zerbröselt wurde.
Beim Anblick dieses automatisierten Ablaufs musste Niedermeier bisweilen gegen ein seltsam beklemmendes Gefühl ankämpfen – insbesondere nachts, wenn das Förderband wie ein Ungeheuer in den schwarzen Himmel ragte und unablässig Gesteinsbrocken spuckte. Nicht auszudenken, wenn irgendwo auf der langen Transportstrecke ein Mensch in das Räderwerk dieser Maschinerie geriet. Niemand würde die Todesschreie hören.
Niedermeier versuchte, solche Gedanken schnell wieder loszuwerden. In den vier Jahren, seit er bei diesem Unternehmen beschäftigt war, hatte er längst erkannt, dass auf Baustellen dieser Größenordnung tausenderlei Gefahren lauerten. Ständig und überall waren Sorgfalt und Umsicht höchstes Gebot. Außerdem gab es mehr als genug Sicherheitsvorschriften: Schutzhelm und Warnweste tragen, striktes Alkoholverbot, rücksichtsvoll fahren. Ganz abgesehen von einem ganzen Katalog an Bestimmungen und Regeln, manche davon ziemlich kleinlich, wie der junge Mann es empfand.
Selbstverständlich war gerade in der Nachtschicht hier draußen erhöhte Aufmerksamkeit gefragt. Auch wenn die Betriebsamkeit des Tages vorbei war, musste auf den schlecht beleuchteten Wegen und an den vielen unübersichtlichen Stellen jederzeit mit Fahrzeugen oder gar Personen gerechnet werden, die irgendwo auf diesem Gelände etwas zu erledigen hatten. Das konnten Ingenieure oder Poliere der unterschiedlichen Baufirmen sein, aber auch Geologen oder sogar die Vertreter der Bauaufsicht, die zum Leidwesen der Arbeiter zu den unmöglichsten Zeiten auftauchten.
Niedermeier hatte erst vorhin, als er mit seinem Radlader zur Deponie gefahren war, die Schutzwesten einiger Personen reflektieren sehen. Jetzt, während sein monsterhaftes Gefährt an den Abraumhalden entlangholperte und wie ein Schneepflug einige Gesteinsbrocken zur Seite schob, bemerkte er im linken Augenwinkel wieder eine Bewegung. Im Streulicht der Scheinwerfer zeichnete sich auf dem breiten geschotterten Weg die Silhouette einer Person ab, an der ebenfalls Leuchtstreifen reflektierten. Sie schien sich zu entfernen, abwärts zu den Bürocontainern des Betonherstellers, die in einer Mulde standen. Alles ganz normal, dachte Niedermeier, für den diese nächtlichen Fahrten mit dem Radlader eine willkommene Abwechslung zu seiner üblichen Arbeit darstellten. Tagsüber war er damit beschäftigt, die Abfuhr des aufbereiteten Materials zu überwachen. Wenn es jedoch personelle Engpässe gab, wie am späten Abend, dann war er gerne bereit, auch mal einzuspringen und Überstunden zu leisten.
Während er die Baumaschine mit geübten Griffen bediente, die hydraulische Schaufel hob und senkte, das grobe Material zusammenschob und gegen die Abraumhalde presste, ließ er seinen Gedanken freien Lauf – beflügelt von dieser lauen Nacht. Er öffnete das Seitenfenster des Führerhauses. Doch statt der erhofften sommerlichen Düfte, wie er sie in dieser Jahreszeit von der heimischen Landwirtschaft her kannte, wehten ihm beißende Dieselabgase entgegen. Sie machten ihm schmerzhaft bewusst, dass er diese traumhafte Sommernacht mit ihrem zunehmendem Mond nicht genießen konnte, und die Sehnsüchte, die sie weckte, nicht zu erfüllen waren. Eigentlich waren solche Stunden viel zu schade, um sie auf einer Baustelle zu vergeuden, dachte er und wünschte sich zu seiner Freundin nach Kärnten zurück. Doch die Vernunft zerrte ihn in die Realität: Du bist auf den Job und das Geld angewiesen, hämmerte es in seinem Kopf.
Geld. Natürlich Geld. Ihm blieb doch gar nichts anderes übrig, als hier zu malochen. Wie vielen anderen auch. Anfangs hatte er noch geglaubt, ein Job im Freien sei für ihn, den Naturburschen, genau das Richtige. Doch er hatte schnell erkennen müssen, dass er sich nicht im Kreise Gleichgesinnter befand. Die meisten seiner Kollegen hatten wenig Sinn für derlei Romantik. Ihnen ging’s allein um die Knete. Für die Schönheiten einer solchen Mondnacht mit den vielen, hier oben besonders prächtig strahlenden Sternen gab es da keinen Platz. Wer nahm schon zur Kenntnis, dass gerade jetzt Venus und Jupiter am Westhorizont ganz dicht beieinanderstanden und hell wie Ufos strahlten? Niedermeier war davon überzeugt, dass den meisten Menschen einfach das Gespür für die Natur verloren gegangen war, die sogar eine Großbaustelle mit tausendfachem neuen Leben füllen konnte.
Für ihn war es schlichtweg ein Wunder, dass sich all das schwirrende Kleingetier, das gerade um die Scheinwerfer des Radladers wirbelte, wieder hatte aufrappeln können, obwohl eine gewaltige Wunde in die Landschaft gerissen worden war.
Niedermeier musste bei solchen Gedanken gegen sein schlechtes Gewissen ankämpfen, das ihn mahnte, doch selbst an dieser Zerstörung maßgeblich beteiligt zu sein. Während er in seinem Führerhaus Pedale und Schalthebel wie automatisiert bediente und wieder eine Schaufel voll abgerutschten Materials vor sich herschob, als sei es Schnee, formte sein Unterbewusstsein ein Bild dieser Landschaft, wie sie noch vor zwei Jahren ausgesehen haben mochte.
Wer hätte auch wohl in der kleinen Gemeinde Hohenstadt, hier in Süddeutschland, jemals gedacht, dass eines Tages tief unterm östlichen Ortsrand eine Eisenbahnlinie verlaufen würde, die von Politikern gerne vollmundig als die »Magistrale zwischen Paris und Budapest« bezeichnet wurde?, überlegte er. Doch obwohl die Trasse mit all ihren Tunnels Bestandteil des umstrittenen Bahnhofsprojekts »Stuttgart 21« war, hatte es offenbar in der Abgeschiedenheit der Schwäbischen Albhochfläche bisher keinerlei Widerstände oder Proteste gegeben, die mit den Vorkommnissen in Stuttgart vergleichbar gewesen wären.
Trotzdem war das gesamte Baustellengebiet weiträumig abgesperrt, mit Kameras überwacht und durch einige strenge Zugangskontrollen gesichert worden. Allerdings schienen diese Maßnahmen weniger zum Schutze vor etwaigen militanten Projektgegnern ergriffen worden zu sein, als viel mehr zur Abschreckung neugieriger »Baustellentouristen«.
Niedermeier hatte jedenfalls in den Monaten, seit er hier war, den Eindruck gewonnen, von einem Stück heile Welt umgeben zu sein. Der abschätzigen Behauptung einiger seiner Kollegen, hier oben sagten sich »Fuchs und Hase Gute Nacht«, wollte er nicht zustimmen. Immerhin verlief gleich hinter den Abraumhalden die stark frequentierte Autobahn A8, die Karlsruhe mit Stuttgart und München und darüber hinaus auch mit Kärnten verband. An ihr hatten sich die Planer der Eisenbahntrasse orientiert, als eine kurze Verbindung über die Schwäbische Alb – und damit ein Ersatz für die kurvenreiche Geislinger Steige – gesucht worden war. Doch während die Autobahn über Aichelberg und Drackensteiner Hang die topografisch anspruchsvolle Nordkante der Schwäbischen Alb überwand, sollte dies die Eisenbahn dort in mehreren Tunnels tun – und zwar ziemlich gradlinig und mit nur sanften Kurven, aber trotzdem hinauf bis zum höchsten Punkt weit und breit.
Nach Meinung Niedermeiers wäre es sinnvoller gewesen, einen nahezu ebenen, dann jedoch weitaus längeren Basistunnel durch die ganze Alb zu treiben. Aber vermutlich waren solche Überlegungen gleich von vorneherein an den deutlich höheren Kosten gescheitert. Außerdem, so hatte er gehört, träumte man in der Gemeinde Merklingen auf der Hochfläche gerade von einem eigenen Bahnhof.
Aber was ging ihn dies alles an?, stellte er selbstkritisch seine sinnlose Grübelei infrage. Wahrscheinlich, so mutmaßte er, hatten sie in dieser Gegend Jahrzehnte lang geplant und, wie üblich, unzählige Streckenvarianten diskutiert. Jetzt, nachdem seit zwei Jahren die Arbeiten auf Hochtouren liefen, brauchte sich niemand mehr Gedanken über den Trassenverlauf zu machen. Denn nun galt es für die Baufirmen, einen engen Zeitplan einzuhalten.
Niedermeier wurde sich wieder bewusst, an einem Jahrhundert-Projekt mitwirken zu können. Begeisterung und Stolz bemächtigten sich seiner Gefühle und vertrieben die melancholischen Gedanken. Wie lange er in sie versunken gewesen war, hätte er nicht mehr sagen können.
Den Radlader hatte er unbewusst gesteuert – bis irgendetwas die Gedankenbilder verblassen ließ. Etwas, das seine Augen eher beiläufig erfasst hatten. Etwas, das nicht zu den roh belassenen und ineinander verkeilten Gesteinsbrocken passte, die unter der hochgehobenen Schaufel des Radladers im Scheinwerferlicht harte Schatten warfen. Zuerst war es der rötliche Schimmer, der zwischen dem weiß-grauen und dunklen Gestein an Eisenerz erinnerte. Doch solches gab es in dieser geologischen Schicht nicht, rief sich Niedermeier in Erinnerung. Instinktiv umklammerte er einen Schalthebel fester und trat kräftig auf die Bremse. Ohne den Fuß von diesem Pedal zu nehmen, erhob er sich umständlich aus seinem Sitz, um durch die staubige Windschutzscheibe hindurch besser auf das Abraummaterial sehen zu können.
Es dauerte zwei, drei Sekunden, bis es seinem Gehirn gelang, aus dem rötlichen Objekt zwischen all den Gesteinsbrocken etwas Vernünftiges zu erkennen. Etwas Vernünftiges?, schoss es Niedermeier durch den Kopf. Ihm stockte der Atem. Es musste eine Täuschung sein. Ganz sicher. Sein Gehirn gaukelte ihm aus den unzähligen Formen dieser Steine gewiss ein Bild vor, das es gar nicht gab. So, wie es beim Blick in Wolkenberge oftmals Figuren, Gesichter oder Tiere erscheinen ließ.
Niedermeier verharrte halb stehend, halb sitzend und eingezwängt hinterm Lenkrad, noch immer den rechten Fuß fest aufs Bremspedal gedrückt. Er wandte seinen Blick kurz zur Seite, um das schreckliche Bild zu löschen und ein neues formen zu lassen. Doch auch diesmal war das Schreckliche deutlich zu sehen. Ganz real.
Niedermeier atmete tief durch und ließ sich in seinen Fahrersitz sinken. Tausend Gedanken jagten gleichzeitig durch seinen Kopf.
Er stand strahlend vor ihr und nahm den gelben Schutzhelm ab. »Was für eine schöne Nacht«, sagte Lukas Brunner mit einem Akzent, der seine oberbayrische Herkunft nicht verleugnen konnte. Er stammte zwar aus Freilassing, ganz im Südosten Bayerns, doch seine familiären Wurzeln hatte er in Kärnten. Dort waren einige seiner Verwandten ebenfalls im Tunnelbau tätig und galten als gewiefte Experten auf diesem Gebiet. Brunner, Mitte 40 und als Bauingenieur dieser Familientradition gefolgt, hatte wieder einmal Überstunden gemacht und dabei festgestellt, dass die Mineure im Steinbühltunnel ihren Zeitplan bislang einhalten konnten. Zehn Meter pro Tag baggerten und sprengten sie sich vorwärts. Bis jetzt hatte das Gestein keine bösen Überraschungen beschert.
Brunner streifte seine rot reflektierende Schutzweste ab und zog sich einen Stuhl an den Schreibtisch der Geologin, die an zwei Computermonitoren gleichzeitig zu arbeiten schien. Vor ihr türmten sich Pläne und Aktenordner. »Willst du Kaffee?« Natascha Frese, die ihr Studium erst vor zwei Jahren abgeschlossen und trotz ihrer mangelnden Praxis diese Stelle bekommen hatte, sah ihn stirnrunzelnd an – eine Mimik, die er nicht zu deuten vermochte.
»Wenn du hast?«, sagte er leicht verunsichert. Sie holte eine große Tasse hervor und goss ihm aus einer Warmhaltekanne Kaffee ein.
»Findest du nicht auch, dass man solche Nächte anderweitig nutzen sollte, als nur für Arbeit?« Seine Frage klang wie eine versteckte Aufforderung.
»Ach, Lukas«, erwiderte sie, warf ihre langen Haare über die Schulter und sah ihn im grellen Licht der Leuchtstoffröhren durchdringend an. »Auch ich könnte mir Schöneres vorstellen, als nächtelang hier zu sitzen. Aber ich hab den Eindruck, je mehr ich schufte, desto weniger sehe ich Land.«
»Fang bloß nicht schon mit einem Burn-out an, Mädel«, sagte er und nahm einen Schluck Kaffee. »Auf so einer Baustelle wie dieser geht’s etwas rauer zu als in einer Vorlesung.«
»Versuch mir jetzt bitte nicht einzureden, der Job hier sei nichts für Frauen.« Sie holte tief Luft.
Brunner erkannte, dass sie jetzt nicht in der Stimmung war, sich ihm und seinen Bemerkungen zu widmen. »Ist nur gut gemeint«, beschwichtigte er. »Ich wollte nur sagen, dass du rechtzeitig nach dir selbst schau’n sollst, eh’ es zu spät ist.«
Sie rückte ihre auffällige Designerbrille zurecht und gab sich selbstbewusst. »Lukas, wir können gerne mal wieder ausgehen. Du weißt, ich hab das neulich in Ulm genossen, aber lass mir bitte Zeit. Ich brauch noch ein paar Tage, dann hab ich die geologische Prüfung für den aktuellen Abschnitt abgeschlossen.« Sie deutete auf die großformatigen Pläne, die vor ihr ausgebreitet waren.
Brunner nickte verständnisvoll. Er hatte etwas sagen wollen, hielt aber seine Worte zurück. Es wäre der falsche Zeitpunkt gewesen. Aber irgendwann musste er es ansprechen. Er rang sich ein Lächeln ab und zeigte sich an ihrer Arbeit interessiert: »Bist du heut Abend auch schon drin gewesen?«
»Im Weststollen, ja«, erklärte sie schnell. »Sie kommen weiterhin gut voran. Der Weißjura hat trotz heftiger Verkarstung auch noch keine großen Hohlräume beschert.«
»Gott bewahre uns«, seufzte Brunner. »Stell dir vor, davon kriegen irgendwelche Höhlenforscher Wind, was dann hier abginge.«
»Keine Panik«, gab sie zurück, »die baden-württembergischen Höhlenforscher wollen mit der Bahn kooperieren. Sie dürfen etwaige Höhlen dokumentieren, mussten sich aber verpflichten, ihre Erkenntnisse während der Bauphase nicht zu veröffentlichen.«
»Weiß ich, ja. Aber …«, er lächelte ihr vielsagend zu, »… am zweckmäßigsten wär’s natürlich, wenn gleich gar keine Höhlen gefunden würden. Wenn du verstehst, was ich meine.«
Natascha Frese schob ihre Computermaus hin und her, um anzudeuten, dass sie sich jetzt auf keine Konversation einlassen wollte. »Du, es ist Viertel vor eins. Ich muss noch dringend diesen Text hier fertigstellen.« Sie deutete mit einer Kopfbewegung auf den Bildschirm. »Und morgen früh um halb neun taucht schon wieder einer von Klemper-Beton …«
»Okay, okay«, gab sich Brunner geschlagen und trank seine Tasse leer. Leicht säuerlich entschied er, dann doch noch den Namen zu nennen, den er vorhin nicht hatte erwähnen wollen. Er stand auf und ließ beim Öffnen der Tür eine Bemerkung fallen, die ihre Wirkung nicht verfehlte. »Und um die Mittagszeit hast du dann einen Termin mit …«, er drehte sich wieder um und sah, wie Natascha ihren Kopf vom Bildschirm wandte, weshalb er eine Sekunde verstreichen ließ, bis er weitersprach, »… mit Simon, nehm ich an.«
Ihre Blicke trafen sich, als würden gleich gefährliche Funken sprühen. Natascha schien mit sich zu ringen, ob sie einen Gegenstand nach ihm werfen oder einfach hinauslachen sollte. Doch sie ließ sich nichts davon anmerken, sondern überlegte kurz. »Ist er denn gekommen?«, fragte sie spitz. Brunner war irritiert. Natürlich wusste er, worauf sie anspielte. Doch bevor er etwas erwidern konnte, erfüllte die schnell herannahende Sirene eines Einsatzfahrzeugs den Raum. Dann zuckten vor dem Bürofenster Blaulichter durch die Nacht. Irgendwie war er erleichtert, auf diese Weise einer Antwort ausweichen zu können.
Natascha sprang auf und war mit zwei, drei Schritten am Fenster. Doch die Scheiben spiegelten vor der Schwärze der Nacht nur den hellen Innenraum wider. Dazwischen deuteten einzelne Lichtpunkte die Scheinwerfer an, die punktuell das Baustellenareal ausleuchteten. Brunner war von der Tür, die in den schmalen Gang des Bürocontainers führte, ebenfalls zum Fenster geeilt, um es mit einem energischen Ruck aufzureißen. Sofort heulte ihnen intervallmäßig die Sirene entgegen. Zu welcher Art Einsatzfahrzeuge sie gehörte, ließ sich nicht feststellen. Das zuckende Blaulicht hatte sich schnell über die Baustraße in Richtung der Deponie entfernt und war nun außer Sichtweite. Schon aber hörte es sich so an, als näherten sich von der Zufahrt her weitere Sirenen.
»Es wird doch hoffentlich nicht brennen im Stollen«, flüsterte Natascha und rückte am engen Fensterrahmen nah an Brunner heran, um besser in die Dunkelheit hinaussehen zu können. Dabei legte sie unbewusst einen Arm um seine Schulter.
Die erschöpfte Person, die sich im tiefschwarzen Schlagschatten, den die Abraumhalden im diffusen Scheinwerferlicht warfen, versteckt hielt, war in der Bewegung erstarrt, als die heulende Sirene eines Einsatzfahrzeugs lauter und anschwellender wurde. Zunächst hatte es sich noch so angehört, als dringe der schaurige Ton nur von der nahen Straße herüber, die Hohenstadt mit Merklingen verband. Doch jetzt bestand kein Zweifel mehr, dass sich die Sirene dem Baustellen-Areal näherte. Alarm?, fühlte sich die Person schockiert, die in dieser mondhellen Nacht zwischen den Hügeln der Deponie völlig außer Atem in Deckung gegangen war. Hatte es einen Alarm gegeben? Automatisch ausgelöst? Jetzt bloß keine Panik. Ruhe bewahren, auch wenn die Pulsfrequenz ins Unermessliche stieg. Keine verdächtigen Geräusche verursachen, hämmerte es im Kopf, obwohl doch das ratternde Förderband ohnehin jeden Tritt auf dem geschotterten Untergrund übertönte.
Inzwischen hatte das Einsatzfahrzeug offenbar angehalten, die Sirene verstummte. Doch von ferne drang eine weitere Sirene herüber. In schneller Folge zuckte das Blaulicht an den steilen Abraumhalden entlang, die der dunkel gekleideten Person noch immer Schutz boten. Doch jetzt, nachdem weitere Sirenen durch die Nacht heulten, schien es gefährlich zu werden. Hatte es etwas zu bedeuten, dass der Motor des Radladers vor einer Viertelstunde abgestellt worden war, obwohl die Arbeiten noch gar nicht beendet sein konnten? Hatte der Fahrer gar bemerkt, dass sich jemand auf der Deponie aufhielt?
Flucht? Aber wohin? Auf keinen Fall durchs Gelände. Das wäre viel zu auffällig, zumal jetzt, nachdem ein Einsatzfahrzeug nach dem anderen heranraste. Jetzt bloß nicht gesehen werden. Schon gar nicht in diesem Zustand.
Aber wohin? Die Deponie war zur Autobahn hin mit einem hohen Zaun umgeben. Dort gab es gewiss Videokameras, die auch bei Dunkelheit gestochen scharfe Bilder lieferten. War die Falle jetzt zugeschnappt?
Würde er einen Schutzhelm tragen, hätte er sich ziemlich sicher sein können, nicht gleich aufzufallen. Bei so vielen Arbeitern, die hier ständig ein und aus gingen, war es unmöglich, dass jeder jeden kannte. Aber wenn man sich ohne das übliche Outfit hier bewegte, konnte es durchaus kritische Blicke geben. Auch in der Nacht. Und außerdem gäbe es möglicherweise unliebsame Begegnungen mit Personen, die vom Lärm der Einsatzfahrzeuge angelockt wurden.
Und den Sirenen nach zu urteilen, kam eine ganze Armada von Einsatzfahrzeugen angerast. Großalarm auf der Baustelle? War etwas Schlimmes entdeckt worden? Wurde gar schon jemand gesucht? Wenn ja, dann erschien es erst recht geboten, möglichst schnell zu verschwinden. Alles ließ darauf schließen, dass sogar ein ganzes Spezialeinsatzkommando (SEK) anrückte.
»Etwas verdammt Unappetitliches.« Die Stimme, die um 1.14 Uhr aus dem Telefonhörer krächzte, verhieß nichts Gutes. Gerade noch im Tiefschlaf, jetzt aber schlagartig hellwach geworden, lauschte August Häberle den Schilderungen seines Kollegen vom Kriminaldauerdienst, während seine Ehefrau Susanne bereits ahnte, dass auf ihren Mann wieder arbeitsreiche Tage zukommen würden. Dabei hatte er sich so sehr gewünscht, die letzten Tage vor seinem Ruhestand einigermaßen stressfrei über die Runden zu kriegen. Sie drehte sich um und zog die Bettdecke übers Ohr, obwohl sie jetzt auch nicht mehr schlafen konnte. Gleich würde August aus dem Bett springen und zu irgendeinem Tatort fahren. Wie seit Jahr und Tag. Trotz aller dienstlichen Widrigkeiten, die es nach der baden-württembergischen Polizeireform gegeben hatte, war er noch immer hoch motiviert. Für einen kurzen Moment überlegte sie, wie er seine freie Zeit im Ruhestand verbringen würde und ob er es psychisch überhaupt verkraften konnte, keine kniffligen Fälle mehr lösen zu dürfen.
»Ach«, kommentierte er knapp und betroffen, was ihm der Kollege aus Ulm geschildert hatte. »Und wo ist das genau?«, vergewisserte er sich, um dann zu erwidern: »Kenn ich natürlich. Ich werd in einer Dreiviertelstunde dort sein.« Er beendete das Gespräch und strich seiner Frau liebevoll über die Haare, als habe er ihre Gedanken erraten: »Tut mir leid, aber ich glaube, da bahnt sich mein letzter großer Fall an.«
Susanne hob den Kopf und drehte sich wieder zu ihm. »Ist denn so was Schlimmes passiert?«
Er sah ihr tief in die Augen und überlegte, ob er aussprechen sollte, was ihm der Kollege soeben gesagt hatte. Dann atmete er tief durch und flüsterte: »Vielleicht sogar das Schlimmste überhaupt ist passiert. Ich ruf dich an.« Er stand auf, während Susanne jetzt ebenfalls hellwach wissen wollte: »Was heißt das? Bitte, August, nur ein Stichwort.«
»Sie haben möglicherweise eine Leiche gefunden. Bei diesem neuen Eisenbahntunnel in Hohenstadt oben.«
Die dunkel gekleidete Person, die sich seit fast einer halben Stunde schon zwischen den Abraumhalden versteckt gehalten hatte, war noch eine Zeit lang regungslos stehen geblieben. Doch je mehr Einsatzfahrzeuge eintrafen, desto geringer wurde die Chance, das Gelände unbemerkt verlassen zu können. Der geschotterte Weg, der zu der Baustraße in Richtung Ausgang führte, war von Polizisten, Feuerwehrleuten und Dutzenden von Bauarbeitern bevölkert und bot ein unüberwindbares Hindernis. Als jetzt auch noch ein Hubschrauber auftauchte, gab es hinter den Schuttbergen keine ausreichende Deckung mehr. Es blieb nur eine einzige Möglichkeit, dem Licht zu entkommen: ein Stapel Kunststoffrohre, von denen jedes einzelne etwa zehn Meter lang war. Ihr Durchmesser von etwa einem halben Meter bot zwar im Inneren einem erwachsenen Menschen nicht sonderlich viel Platz, doch gelang es mühelos, hineinzurobben und von der Bildfläche zu verschwinden. Was aber, wenn sie das gesamte Gelände durchkämmten und sogar Hunde einsetzten?, durchzuckte es die Person, die sich erst jetzt, beim Umdrehen von Bauch- auf Rückenlage der Enge bewusst wurde, von der sie in dieser rauen und stockfinsteren Röhre umgeben war. So beklemmend musste es sich auch in älteren Kernspintomografen anfühlen.
Eine schnelle Flucht jedenfalls war ausgeschlossen. Wieder herauszukriechen, das ging nur mit den Beinen voraus und unter allergrößter Anstrengung, denn die Knie ließen sich hier drinnen nur minimal anwinkeln.
Platzangst, signalisierte das Gehirn. Platzangst. Panik.
Der Versuch, am liegenden Körper vorbei an den Füßen und damit in Richtung Ausgang zu schielen, flößte noch mehr Angst ein, denn der Kopf stieß bei jeder Bewegung gegen die Rundung des Rohrs, das unter den dröhnenden Schallwellen des Helikopters vibrierte. Die Öffnung war als grau-schwarzes Loch zu erkennen, das wie ein großes Teleskop nur einen winzigen Ausschnitt der Umgebung abbildete. Aus dieser Perspektive waren es ein paar Quadratmeter schummrig angestrahlter Schutthalde.
Die quälende Enge schien den Atem zu rauben, während diese verdammte Platzangst die Frequenz des Pulsschlags ins Unermessliche steigerte. Die Ungewissheit über das, was da draußen vor sich ging, projizierte in rasender Geschwindigkeit Angstszenarien: Würden sie die gestapelten Rohre beiseiteschaffen? Hochhieven? Oder gar versehentlich verschütten? Was, wenn in unmittelbarer Nähe ein Feuer ausbrach? Wenn jetzt der Kreislauf kollabierte? Oder wenn ein Baustellenfahrzeug versehentlich über die Rohre rollte?
Mittlerweile waren auf der Großbaustelle »Pfaffenäcker« – so benannt nach einer alten Flurbezeichnung der Gemarkungsgemeinde Hohenstadt – sämtliche Scheinwerfer angeschaltet worden. Allerdings reichten sie nicht, um jeden Winkel des weitläufigen Areals auszuleuchten – vor allem aber auch nicht die gesamte Deponiefläche. Nachdem das Förderband abgeschaltet worden war, hatte sich vorübergehend eine unheimliche Stille breitgemacht, nur unterbrochen vom Heulen der Martinshörner. Auf der Baustraße, die sich an den mehrstöckigen Wohncontainern im Eingangsbereich vorbei durch eine Mulde zur Deponie hinüberschlängelte, parkten unzählige Einsatzfahrzeuge dicht hintereinander. Ganz vorne stachen die hellen Rettungs- und ein Notarztwagen heraus, weiter hinten zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Hohenstadt, die vorsorglich alarmiert worden war, falls technische Hilfe nötig sein würde.
Noch bevor die Bereitschaftspolizei in Göppingen mehrere mobile Lichtmasten herbeischaffen konnte, war bereits ein Hubschrauber herangeflogen, der nun einen Höllenlärm verbreitete, weil er in knapp 30 Metern Höhe über dem Areal schwebte und mit starken Scheinwerfern die Szenerie von oben beleuchtete. Spätestens jetzt wurden alle Arbeiter, die in den nahen Wohncontainern schliefen, auf das Spektakel aufmerksam. Inzwischen war auch eine Videoverbindung zwischen dem Hubschrauber und dem Einsatz- und Lagezentrum Ulm geschaltet, sodass dort an Monitoren die Situation aus der Vogelperspektive beobachtet werden konnte.
Unterdessen trafen bei der Deponie weitere Einsatzkräfte ein und versuchten vergeblich, die vorderste Abraumhalde zu besteigen, auf die noch bis vor wenigen Minuten das Förderband seine Ladung geschüttet hatte. Das Vorhaben erwies sich als viel zu gefährlich, weil mit jedem Schritt, den die Männer und Frauen taten, das instabile Material wie auf einer Geröllhalde im Gebirge nachrutschte. Das Führungs- und Lagezentrum in Ulm forderte deshalb die Feuerwehrdrehleiter aus Laichingen sowie die Bergwacht aus Gruibingen an. Diese Einsatzkräfte würden in der Lage sein, die Schutthalde mit entsprechender Ausrüstung zu erklimmen oder sie von einem hochgehievten Rettungskorb aus zu inspizieren.
Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei Göppingen machten sich unterdessen über das kilometerlange Transportband her, dessen stehen gebliebene Last jedoch auf der rund 300 Meter langen Strecke zwischen Tunnel und Deponie unter einer Plastikplane verborgen war. Erschwerend kam hinzu, dass es teilweise in schwindelerregender Höhe auf einer Stahlgitterkonstruktion verlief und nur mithilfe einer Hebevorrichtung erreicht werden konnte.
Drinnen in den beiden Stollen waren auf Anordnung des Polizeipräsidiums die Arbeiten am sogenannten »Vortrieb«, wie in der Fachsprache das Graben, Sprengen und Bohren an vorderster Front genannt wurde, eingestellt worden. Beamte der Spurensicherung ließen sich mit einem klapprigen Kleinbus der Tunnelbauer mehr als dreieinhalb Kilometer weit in den Untergrund fahren. Ihr Interesse galt der Brechanlage, die dort am Beginn des Förderbands das Gestein ein erstes Mal zerkleinerte.
Mittlerweile war die ganze Baustelle aus der nächtlichen Ruhe gerissen. Viele Bauarbeiter hatten ihre Wohncontainer verlassen, um zur hell erleuchteten Deponie zu eilen. Im ohrenbetäubenden Dröhnen des Hubschraubers beschränkten sich ihre Gespräche jedoch auf kurze Zurufe, ergänzt durch heftige Gesten.
Die Beamten des Kriminaldauerdienstes versuchten genervt, sich ein erstes Bild von dem Geschehen zu machen, und notierten Namen und Adressen von Personen, die auf dieser Baustelle Verantwortung trugen. Außerdem verlangte die Ulmer Einsatzzentrale unablässig neue Informationen, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber nicht zu beschaffen waren. Sogar der Polizeipräsident hatte sein Kommen angedroht, wie die Ermittler diese Ankündigung empfanden. Und auch der nächtliche Bereitschaftsdienstler der Staatsanwaltschaft war bereits unterwegs.
Die Kriminalisten, die sich, umgeben von den vielen Bauleuten, in deutlicher Minderzahl fühlten, konzentrierten sich auf den einzigen Zeugen, den sie bisher ausfindig machen konnten: Frank Niedermeier. Der junge Mann mit dem vollen schwarzen Haar und dem unrasierten Gesicht saß in einem Kleinbus und zitterte, während ein ebenso junger Kriminalist handschriftlich ein kurzes Protokoll aufnahm. »Wenn ich Sie richtig verstehe«, wiederholte er, »dann ist Ihnen diese Hand rein zufällig aufgefallen.«
»Ja, hätt ich nicht genau hingeschaut, wär sie mit der nächsten Schaufelladung in dieser Schutthalde verschwunden«, erwiderte Niedermeier. Er hatte im ersten Schreck noch geglaubt, irgendjemand habe sich einen Spaß erlaubt und einen jener Scherzartikel weggeworfen, wie es sie meist zu Halloween oder auch zur Fastnacht gab – also eine ziemlich echt aussehende menschliche Hand aus Kunststoff. Doch die dunkelrote Verfärbung und die Art und Weise, wie der zerbrochene Gelenkknochen hervorstand, ließen auf etwas Schreckliches schließen. Niedermeier hatte dann sofort seinen Chef angerufen, der innerhalb einer halben Stunde zur Stelle gewesen war und diesen zwischen Gesteinsbrocken liegenden Körperteil vorsichtig mit der Spitze eines aufgeklappten Meterstabs abgetastet hatte, bis an der Echtheit keinerlei Zweifel mehr bestand. »Verdammte Scheiße«, hatte der Chef gebrummt und auf seinem Handy 110 getippt, »das hat uns gerade noch gefehlt.«
2. Kapitel
Philip Mende, gerade erst zum Oberkommissar ernannt, und sein etwas jüngerer Kollege Thomas Keller, der noch auf diese Beförderung warten musste, waren nach dem Notruf gleich losgefahren. Jetzt saßen sie, mit Warnwesten und Schutzhelmen ausgestattet, in der Fahrerkabine des verdreckten VW-Kastenwagens und ließen sich von einem Bauarbeiter in den Stollen bringen. Zuvor hatte ihnen der aufgeregte Mann noch pflichtgemäß die Funktion des Selbstretter-Geräts erläutert, das bei plötzlichem Sauerstoffmangel ein einstündiges Überleben garantiert.
Die beiden Kriminalisten beschlich ein mulmiges Gefühl. Nie zuvor waren sie so weit in einen Berg hineingefahren. Dicke Wassertropfen, die gegen die Windschutzscheibe klatschten, erweckten den Eindruck, das mit rohem Beton verfestigte Deckengewölbe über ihnen sei gar nicht so stabil, wie es aussah. Die Sohle des Stollens, dessen Durchmesser sie auf über zehn Meter schätzten, war ein einziger lehmiger Weg, über den das Fahrzeug holperte und rumpelte, während hinter ihnen im geschlossenen Laderaum allerlei Werkzeuge und sonstige Utensilien bei jeder Unebenheit schepperten und klapperten. Die verschmutzten Scheinwerfer des Transporters warfen nur ein spärliches Licht und tanzten mit jeder Unebenheit über diese unterirdische Piste. Beidseits markierten senkrecht an die Wände montierte Leuchtstoffröhren den Streckenverlauf– bis der Stollen weit vorne in eine Rechtskurve überging und sich tiefer in den Berg senkte. »Da brauchen S’ keine Angst zu haben, das hält«, hatte der Mann am Steuer, ein altgedienter Bauarbeiter mit zerfurchtem Gesicht, gleich beim Einfahren in den östlichen der beiden Stollen gesagt und hinzugefügt: »Das ist jetzt der Tunnel für die Fahrtrichtung Stuttgart, nebenan wird der für die Gegenrichtung gebaut, nach Ulm. Im Abstand von etwa 20Metern.«
»Gleichzeitig?«, fragte Mende nach, der den Mittelplatz auf der Sitzbank eingenommen hatte.
»Ja, gleichzeitig. Deshalb sind immer zwei Schichten im Berg. Und die beiden Stollen«, er deutete nach links zu einer gewölbeartigen Ausbuchtung, »die sind in regelmäßigen Abständen durch sogenannte Querschläge miteinander verbunden. Alle 500Meter.«
Als Kommissar Thomas Keller, der bisher schweigend die Tunnelfahrt auf sich hatte wirken lassen, zu husten begann, sah sich der Bauarbeiter veranlasst, auf das riesige Rohr zu deuten, das ein Stück weit in den Stollen hineinführte. »Damit werden die beiden Röhren ›bewettert‹, wie wir hier sagen. Frischluft kommt da genügend rein, aber Staub lässt sich nicht vermeiden. Manchmal ist’s ganz schlimm, wenn gesprengt wird.«
»Gesprengt?«, wiederholte Mende ungläubig. »Da wird gesprengt, wenn Leute drin sind?«
»Ja klar. Sie können doch nicht jedes Mal kilometerweit rausfahren. Natürlich sind da strenge Richtlinien zu beachten. Und Abstände einzuhalten.«
Keller, der von seiner Position aus im diffusen Licht das Gewirr vieler Kabel, Schläuche und sonstiger Installationen an sich vorbeiziehen sah, darunter auch Schaltkästen und Trafostationen, deutete zu einer Vorrichtung, die über ihm dem Stollenverlauf folgte. »Und das Ding da oben ist wohl das Förderband, oder seh ich das falsch?«
»Nein, das sehen Sie nicht falsch. Es läuft aus dem Stollen raus bis zur Deponie und es muss hier drinnen hin und wieder verlängert werden– wenn die Mineure weit genug vorangekommen sind«, erklärte der Fahrer und steuerte den Kleinbus links an einem abgestellten Radlader und einem monströsen Bagger vorbei. »›Mineure‹«, fügte er erklärend an, »so heißen die Jungs, die ganz vorne sind und sich in den Berg beißen, an der ›Ortsbrust‹, wie es in der bergmännischen Sprache heißt.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!