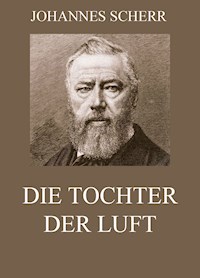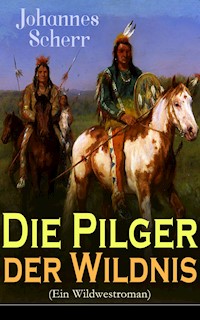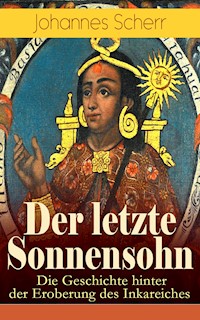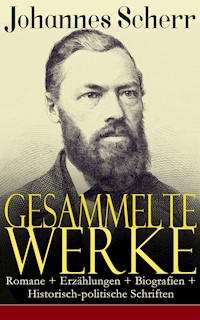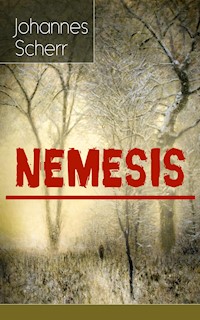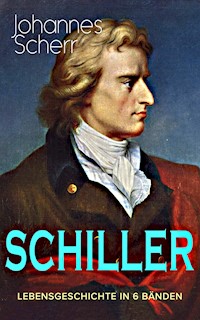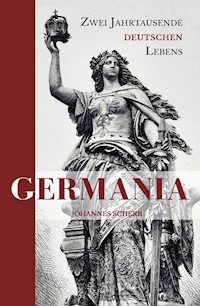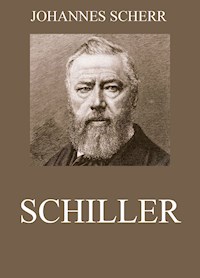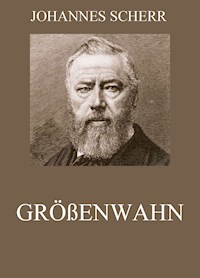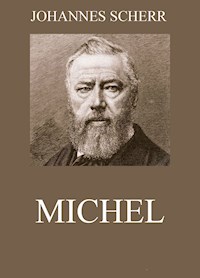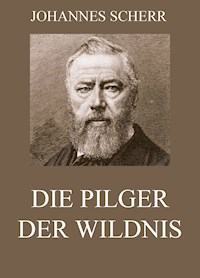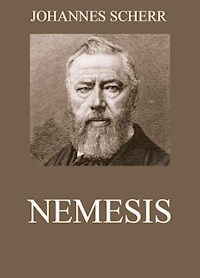
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Roman aus dem Novellenbuch, einer der größten Schöpfungen des Schriftstellers. Scherr war einer der vielseitigsten Kenner der Literatur- und Kulturgeschichte und ein sprachgewandter und geistvoller Schriftsteller, dessen Leben und Wirken in gleichem Maße der Schweiz wie Deutschland angehörte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nemesis
Johannes Scherr
Inhalt:
Johannes Scherr – Biografie und Bibliografie
Nemesis
1. Hoch droben.
2. Ein Wiedersehen.
3. Die Heimkehr des Erben.
4. Wer ist der Herr und wer der Knecht?.
5. Zwei Briefe.
6. Am Donnerfall.
7. Vor fünfzig Jahren und jetzt.
8. Memento!.
9. »Herr Jesus, mein Konrädle!«.
10. Wie Bruder und Schwester.
11. In einem Hohlweg.
12. Vor einem Sarge.
13. Eine Dorfgeschichte beim Mondschein.
14. Eine Dorfgeschichte beim Sonnenschein.
15. Ein Stück Untergangstum.
16. »Und befreiet in Flammen Jauchzt in Lüfte der Geist uns auf.«.
17. In seliger Verschollenheit.
18. Die Runs! Die Runs!.
19. Aus alter Zeit.
20. Tropisches.
21. Der Spion.
22. »Dich, Hekate, nun ruf' ich an!«.
23. Dem Donar ein Opfer!.
24. »Doch die Wasser, ja die Wasser decken vieles zu«.
Nemesis, J. Scherr
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849634964
www.jazzybee-verlag.de
Johannes Scherr – Biografie und Bibliografie
Schriftsteller, geb. 3. Okt. 1817 in Hohenrechberg bei Schwäbisch-Gmünd, gest. 21. Nov. 1886 in Zürich, besuchte das Gymnasium in Gmünd und die Universitäten in Zürich und Tübingen, wirkte dann eine Zeitlang als Lehrer und ließ sich 1843 in Stuttgart nieder. wo er 1844 mit der Schrift »Württemberg im Jahr 1844« den politischen Kampfplatz betrat, auf dem er sich in den nächsten Jahren als Vorkämpfer aller freiheitlichen Bestrebungen hervortat. 1848 wurde er in die württembergische Abgeordnetenkammer und in den Landesausschuß gewählt und stand während der Revolutionszeit an der Spitze der demokratischen Partei, weshalb er nach Auflösung der Kammer 1849 nach der Schweiz flüchtete. Er ließ sich zunächst in Winterthur nieder, wo er längere Zeit schriftstellerisch tätig lebte, bis er 1860 als Professor der Geschichte und Literatur an das eidgenössische Polytechnikum in Zürich berufen wurde. Außer einer Reihe von Romanen und Erzählungen (darunter: »Schiller«, Leipz. 1856; 3. Aufl. 1902, 2 Bde.; »Michel. Geschichte eines Deutschen unserer Zeit«, Prag 1858, 4 Bde.; 10. Aufl., Leipz. 1905, 2 Bde.; »Rosi Zurflüh«, Prag 1860; »Die Gekreuzigte«, St. Gallen 1860; 2. Aufl., Leipz. 1874) sowie einigen humoristischen Schriften veröffentlichte er: »Bildersaal der Weltliteratur« (Stuttg. 1848; 3. Aufl. 1884, 3 Bde.), woraus im Sonderdruck der »Bildersaal der deutschen Literatur« (1887) erschien; »Deutsche Kultur- und Sittengeschichte« (Leipz. 1852–53, 11. Aufl. 1902); »Allgemeine Geschichte der Literatur« (Stuttg. 1851; 10. Aufl. als »Illustrierte Geschichte der Weltliteratur«, das. 1900, 2 Bde.); »Geschichte der deutschen Literatur« (2. Aufl., Leipz. 1854); »Geschichte der englischen Literatur« (das. 1854, 3. Aufl. 1883); »Geschichte der Religion« (das. 1855 bis 1857, 2 Bde.; 2. Aufl. 1859); »Dichterkönige« (das. 1855; 2. Aufl. 1861, 2 Bde.); »Geschichte der deutschen Frauenwelt« (das. 1860; 5. Aufl. in 2 Bdn. 1898); »Schiller und seine Zeit« (illustrierte Quartausgabe, das. 1859, 3. Aufl. 1902; Volksausgabe, 4. Aufl. 1865); »Drei Hofgeschichten« (das. 1861, 3. Aufl. 1875); »Farrago« (das. 1870); »Dämonen« (das. 1871, 2. Aufl. 1878); »Blücher, seine Zeit und sein Leben« (das. 1862–63, 3 Bde.; 4. Aufl. 1887); »Studien« (das. 1865–66, 3 Bde.); »Achtundvierzig bis Einundfünfzig« (das. 1868–70, 2 Bde.; 2. Aufl. u. d. T.: »1848, ein weltgeschichtliches Drama«, das. 1875); »Aus der Sündflutzeit« (das. 1867); »Das Trauerspiel in Mexiko« (das. 1868); »Hammerschläge und Historien« (Zürich 1872, 3. Aufl. 1878; neue Folge 1878); »Sommertagebuch des weiland Dr. gastrosophiae Jeremia Sauerampfer« (das. 1873); »Goethes Jugend« (Leipz. 1874); »Menschliche Tragikomödie«, gesammelte Studien und Bilder (das. 1874, 3 Bde.; 3. Aufl. 1884, 12 Bde.); »Blätter im Winde« (das. 1875); »Größenwahn, vier Kapitel aus der Geschichte menschlicher Narrheit« (das. 1876); das Prachtwerk »Germania. Zwei Jahrtausende deutschen Lebens kulturgeschichtlich geschildert« (Stuttg. 1876–78, 6. Aufl. von H. Prutz, 1905); »1870–71. Vier Bücher deutscher Geschichte« (Leipz. 1878, 2 Bde.; 2. Aufl. 1880); »Das rote Quartal« (das. 1882); »Vom Zürichberg«, Skizzen (das. 1881); »Porkeles und Porkelessa« (Stuttg. 1882, 3. Aufl. 1886); »Haidekraut«, neues Skizzenbuch (Teschen 1883); »Neues Historienbuch« (Leipz. 1884); »Gestalten und Geschichten« (Stuttg. 1885); »Die Nihilisten« (u. Aufl., Leipz. 1885); »Letzte Gänge« (Stuttg. 1887). S. war ein vorzugsweise der eigentümlichen darstellenden und räsonierenden Weise Th. Carlyles nachgearteter Schriftsteller, von blitzender Lebendigkeit, begeistert oder maßlos in seinen Abneigungen, von schneidiger Schärfe und gelegentlich körnigster Grobheit, in seinen letztern Schriften jedoch allzusehr der Kopist seiner eignen Manier. Ein Teil seiner Erzählungen erschien gesammelt als »Novellenbuch« (Leipz. 1873–77, 10 Bde.).
Nemesis
1. Hoch droben.
Im ersten Dämmerschein des Morgens trat ein Mann aus dem Düster des Tannenforstes.
Am Saume desselben blieb er stehen, schlug die Arme übereinander und schaute bohrenden Blickes in das graue Frühlingsnebelmeer hinab, welches hart unter seinen Füßen die Tiefe füllte und meilenweit hinzuwogen schien.
Der Hochwald, aus welchem der Mann getreten, krönte eine Kuppe, von welcher aus man über die Nebelmassen hinweg ostwärts und südwärts die grandiosen und bizarren Formen einer Reihe von schneeglänzenden Kolossen in den blaßblauen Himmel emporragen sah. Aber diese Bergriesen hatten jetzt, wie immer vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang, ein unheimlich geisterhaftes Ansehen, etwas leblos Starres, Ankältendes. Der Winter schien auf ihnen zu schlafen, bleiern, unnahbar, mit eisigem Odem Licht und Leben aus seiner Nähe bannend.
Ringsher lautlose Stille, nur unterbrochen durch ein dumpfes Geräusch wie von stürzenden Wassern, welches in monotoner Wiederkehr durch das Dunstgeschwele herauf und herüber kam.
Da rührte ein leiser Morgenwindzug die Wipfel der Tannen, und nach kurzer Weile war die Szene wesentlich verändert.
Im Osten leuchtete es auf, erst schwach und weißlich flimmernd, dann hell und rosenfarben. Grünlich grelle Streiflichter zuckten über die Granitwände und Schneefelder des Hochgebirges hin, schwanden, kamen wieder, nahmen zu an Stärke und Kraft der wechselnden Farben, sprangen gedankenschnell von Fels zu Fels, von Firn zu Firn und pflanzten dann auf all den zahllosen Zacken und Hörnern die rotleuchtenden Banner des Tages auf, dessen Gestirn mählich hinter den östlichen Bergen emporstieg.
Jetzt bot der Ort, wo der Mann stand, einen kontrastvollen Ausblick. Oben alles Licht und Glut, unten noch dämmerndes Grau. Aber die Sonne, höher und höher steigend, griff mit ihrer belebenden Macht bald auch in die Tiefe hinein. Die rotglühenden Alpenspitzen warfen zitternde Reflexe auf das Nebelmeer, dessen Oberfläche dann unter dem Einflusse der Morgenbrise zu wogen und zu wallen begann. Im nächsten Augenblick hob und schob sich die ganze ungeheure Masse in die Höhe, trennte und furchte sich da und dort, dehnte sich in dichten Bänken hüben und drüben an den Bergen aufwärts. In der Mitte bildete sich eine riesenhafte muldenförmige Vertiefung, deren Grund die Gestalt eines dünnen weißen Flors annahm. Jetzt zerrissen ihn die Sonnenstrahlen, und herauf blitzte blau und silbern der Spiegel des Sees.
Er war von bedeutendem Umfang, allein seine Ufer waren vorerst noch nicht zu überblicken. Langsam und seine Massen in grotesken Bildungen durcheinanderschiebend quoll und brodelte der Nebel nach allen Seiten hin auseinander. Wie ein strahlend Aug' schaute das Wasser aus der Tiefe. Dann wurde der Riß weiter und weiter, der See dehnte sich nach rechts und links, die Dünste schwammen und drängten eilfertiger nach oben, und schon begannen die obersten Schichten an den Bergwänden ringsum in einzelne Wolken zu zerflattern. In dem Maße, in welchem sie aufstrebend die Felszacken und Schneekuppen verschleierten, lichtete sich drunten die Szene. Während der Nebel in halber Höhe der Berge einen rötlichweißen Gürtel bildete, der nach und nach verqualmte, lagen die Ufer des Sees dem Auge bloß. Es war ein herrlicher Wasserspiegel von länglich-ovaler Form, die aber auf der südlichen und östlichen Seite wildzerrissen sich wies. Hier stiegen die Berge oft in schwindelnd hohen senkrechten Felswänden, überall aber jäh und scheinbar unzugänglich in das Wasser herab. An seinem westlichen Ende drängte sich der See mehr und mehr zusammen und ergoß den Überfluß seiner Wasser in das Bett eines Stromes, welcher eine Strecke weit rauschend zwischen engzusammentretenden Felsen sich hinwand, dann in ein offenes Talgelände hinaustrat und dort dem Auge entschwand. Aus dem Tale herauf führte eine Straße an den See, welche den Verkehr der Gebirgslandschaft mit den ebeneren Gegenden vermittelte. Wenige Büchsenschüsse weit unterhalb der Ausmündung des Sees in den Fluß war über diesen eine jener in Berggegenden häufigen hölzernen Brücken geschlagen, deren Dach einen hellroten Anstrich hatte. Diesseits dieser Brücke zweigte sich von der am rechten Ufer des Flusses herauf führenden Straße ein schmalerer Fahrweg ab. Er ging über die Brücke, zog sich jenseits derselben eine Strecke weit in einem Halbbogen um den See und führte auf ein Gehöfte zu, dessen Hauptgebäude sich durch das Grauweiß seines Daches als eine Mühle verriet. Das Räderwerk derselben wurde durch einen Teil des Wassers, welches ein gewaltiger Bergbach aus den Schneefeldern herabbrachte, in Bewegung gesetzt. Etwas linkshin hinter der Mühle sah man dieses wilde Bergwasser aus den Klüften des Hochgebirges auf ein bewaldetes Plateau heraustreten, welches in steilen, zackigen Felsschichten jählings abstürzte. Von dieser wohl an fünfhundert Fuß hohen Wand warf sich der Strom in drei majestätischen Sprüngen, die von unzähligen kleineren Kaskaden und Kaskadellen umflattert wurden, in die Tiefe und bildete so einen prachtvollen Katarakt, welcher unter dem Namen des Donnerfalls weitum berühmt war. Weiter aufwärts den See sah die südliche Seite seines Gestades unwohnlich und unwirtlich aus. Überall abschüssige Granitwände, an denen sich von den höher gelegenen Gletschern stärkere und schwächere Silberfäden herabspannen. Da und dort unterhalb der Schneegrenze eine malerische Gruppe von Ahornbäumen, Tannen und Bergkiefern oder auch einzelne grüne Matten, Ausläufer schmaler Hochtäler, die sich in den mächtigen Gebirgsstock hineingelagert hatten und zur Sommerszeit die Schauplätze einer genüglichen und munteren Sennenwirtschaft waren. Einzelne Sennhütten klebten da droben wie Schwalbennester an den Abhängen. Das Ufer des Sees dagegen schien oberhalb der Mühle auf dieser Seite keine Spur von menschlicher Besiedelung zu zeigen; denn es gehörte ein sehr scharfes Auge dazu, im Hintergrund einer kleinen Bucht ein zwischen zwei mächtige Tannenstämme hineingepreßtes Häuschen wahrzunehmen, dessen graues Schindeldach mit dem Grau des schroff hinter ihm aufragenden Gesteins zusammenfloß. Zwei kleine, in der Morgensonne blitzende Fenster verrieten jedoch, daß dort ein menschliches Wesen in die Einsamkeit zwischen Fels und Wasser sich eingenistet habe. Das östliche Gestade des Sees verschwamm in dämmender Unbestimmtheit, weil auf dasselbe die über ihm aufgetürmten Berge noch ihre Schatten warfen. Dagegen lag das nördliche Ufer schon in voller Beleuchtung und bot einen von dem gegenüberliegenden wesentlich verschiedenen Anblick. Das Land stieg hier in sanftgeschwungenen Wellenlinien vom Wasser auf und bog dann weiter nach Norden hin in eine weite Ebene aus, in welcher inmitten von reichen Saatfeldern und Wiesengründen Gehöfte, Weiler und Dörfer zerstreut lagen und mehrere spitz zulaufende rote Kirchtürme aus dichten Obstbäumepflanzungen hervorlugten. Die letzteren, namentlich die Frühobstbäume, begannen eben in Blüte oder, wie man hier herum sagte, in Blust zu schießen und hoben sich um so anmutiger von dem jungen Grün der Saaten und Matten ab. Durch das schöne Gelände schlängelte sich, von den ostwärts gelegenen Bergen herkommend, ein stillgleitender Fluß, auf weitem Umwege sein Wasser dem See zuführend. Da, wo er die Grenzmarke des dem See zunächstgelegenen Dorfes verließ, trat er in ein tiefes, schmales, von wildem Gestrüpp überwuchertes Tobel, aus welchem hervorrauschend er in so launischen Wendungen dem See zufloß, daß man vermuten durfte, Kunst habe hier dem Wasser seinen Lauf vorgezeichnet. So war es in der Tat. Die Gartenkunst hatte den Lauf des Flusses zwischen dem Tobel und dem See zu ihren Zwecken benutzt und zwar so geschickt, daß dieses Wasser eine Hauptzierde des weitläufigen Parkes abgab, welcher sich weit am Seeufer hin- und weit an der sanften Abdachung desselben hinaufzog. Dieser Anlage, von der Natur so außerordentlich begünstigt, fehlte auch jener Zauber der Romantik nicht, welcher den trümmerhaften Überbleibseln früherer Jahrhunderte anhaftet. Jenseits des Flüßchens nämlich, in halber Höhe der Abdachung, sprang aus derselben ein hoher felsiger Hügel vor, dessen Gipfel die Ruinen einer Feudalburg krönten. Birken und Fichten waren zwischen den Trümmern aufgeschossen, und über die Baumgipfel hinweg ragte jener Kern mittelalterlicher Festen, der gewaltige Wartturm, genannt das Berchfrit, noch jetzt mit der nur wenig verwüsteten Kraft einer eisernen Zeit.
Auch hier aber zeigte sich eine Erscheinung, die an den Sitzen alter Geschlechter häufig vorkommt. Die Nachkommen der Burgherren hatten das Schloß ihrer Ahnen nicht mehr wohnlich und bequem genug gefunden und hatten sich deshalb am Ufer des Sees einen Wohnsitz geschaffen, welcher den Bedürfnissen und Gewohnheiten einer vorgeschritteneren Zeit mehr entsprach. Der ältere Teil dieses neuen Schlosses, das eigentliche Hauptgebäude, verriet durch seine edlen Verhältnisse, daß es noch zur Zeit der Renaissance entstanden sei. Später hatte man ihm zwei Flügel angefügt, die zu jenem in keinem Verhältnisse standen und deutlich zeigten, daß ihre Entstehung schon in die Rokoko-Periode gefallen, wo die Forderungen der Architektur vor den maßlosen Ansprüchen einer üppigen Ornamentik zurücktreten mußten. Diese Seitenflügel waren rechte Triumphe des Zopfstils. Von dem Mittelflügel führte eine leichtgeschwungene Freitreppe in einen Garten herab, zu dessen Anlage man eine in den See hinausgehende Landzunge benutzt oder auch eine solche künstlich geschaffen hatte. Der Garten hatte die Form seiner ursprünglichen Anlage beibehalten. Er prunkte also, wahrend der Park hinter dem Schlosse nach den naturgemäßeren Grundsätzen der englischen Hortikultur eingerichtet war, mit jener steifen Korrektheit, auf welche die deutsche Gärtnerei des vorigen Jahrhunderts in sklavischer Nachahmung der Gärten von Versailles und Trianon so versessen war. Die beiden Seitenflügel des Schlosses endigten jeder in einem achteckigen Turm mit wunderlichen Bedachungen, welche man chinesische Kuppeln zu nennen beliebte. Der Balkon eines dieser Türme, des östlichen, verlängerte sich in einen gußeisernen Steg, welcher nach einem aus dem See aufragenden Felsblock hinüberführte, auf dessen Oberfläche ein zierlicher Pavillon errichtet war. Wenngleich der architektonischen Symmetrie ermangelnd, verriet die ganze Besitzung, wie sie, weich ans Seegestade hingebettet, aus den herrlichen Baumgruppen des Parkes aufstieg und angesichts der Größe und Schönheit des Hochgebirges dalag, die Sicherheit und das wohlige Behagen großen und von Geschlecht zu Geschlecht ununterbrochen vererbten Reichtums. Es war ein Herrenhaus im vornehmsten Sinne des Wortes.
Vor der Fronte des westlichen Flügels breitete sich ein großer Hofraum aus, welchen im Halbkreise gebaute Stallungen, Remisen und Dienerwohnungen einfaßten. Vom Hoftor ab lief eine breite Allee prächtiger alter Linden und Kastanien am rechten Seeufer hin, ließ mittels einer steinernen Brücke den hier in den See mündenden Fluß hinter sich und dehnte sich schnurgerade bis zur Einlaßpforte des Parkes. Der Wächter derselben konnte von den Fenstern seines Häuschens aus in die lange Gasse eines großen Dorfes hineinsehen, dessen Häusergruppen am Fuße des Berges lagen, von welchem wir zuerst gesprochen. Verfolgte man vom Parktore aus die Straße gegen das Dorf zu, so erblickte man am. Eingang desselben rechts und links ein ansehnliches Gebäude. Das eine war die Oberförsterei, das andere die Oberrentei der ehemals reichsfreien, jetzt mediatisierten Grafschaft Wippoltstein. Inzwischen war die Sonne höher gestiegen. Die Nebelmassen hatten sich an den Bergen emporgewunden und an den Firnen zerteilt, um droben in der blauen Unermeßlichkeit wieder zu rötlich schimmernden Morgenwolken zusammenzufließen. Der Tag schritt belebend über die Landschaft. Alles in ihr wurde Ton und Klang. Aus den Saatfeldern in der Ebene schwirrten Lerchen tönend in die Lüfte, während im Hochwalde das Pfeifen des Eichhorns und das Glucksen des Birkhuhns in den Schlag des Schneefinken und der Goldamsel sich mischten. Aus den Dörfern hervor sah man Bauern zu Acker fahren, und ein paar Fischerkähne furchten die leichtgekräuselte Fläche des Sees. Vom andern Ufer desselben trug der Morgenwind das laute Gebrause des Kataraktes herüber, und allwärtsher stieg aus den Gründen aufwärts zu den Höhen jenes verworrene, aus hundert verschiedenen Tönen gemischte Tosen, welches dem Mann auf der Bergkuppe verriet, daß die Menschen da unten an ihr mannigfaltiges Tagewerk gegangen.
Er stand noch immer mit verschränkten Armen und sah in all die Pracht hinein. Dann schnippte er mit den Fingern und brummte in den Bart:
»Die alte Geschichte, bei Iove! Granit, Schnee und Wasser die Hülle und Fülle, drüberhin ein Stückchen blauer Luft, dort der Edelsitz mit seinem großprahlerisch hochmütigen Aussehen, da unten die Dörfer mit ihren Äckern, worauf sich arme Narren für andere abplacken. Die alte Geschichte, ganz die alte Geschichte!«
Der so sprach, war ein Mann über Mittelgröße und über die Mitte des Lebens hinaus. Unter seinem breitkrempigen und ziemlich vernutzten grauen Filzhut standen eisengraue Kopfhaare hervor, und ein mächtiger Backenbart von derselben Farbe rahmte ein tiefgebräuntes, fast bronziertes Gesicht ein, welches mit seinen grauen, rastlosen, stahlscharfen Augen, seiner breiten Stirn, über welche sich eine düstere Furche bis zur Nasenwurzel herabzog, mit seiner übergroßen, aber nicht gemein geformten Nase und dem energischen Kinn wie eine Ruine der Intelligenz aussah. Das Schlimmste darin war der Mund mit den dünnen farblosen Lippen, in deren tiefherabgezogenen Winkeln ein stereotyper bösartiger Hohn zu lauern schien. Wollte man diesen Zug übersehen, so konnte man der ganzen Physiognomie den Charakter eines gewissen brutalen Humors zuerkennen. Seine fünfzig Jahre drückten offenbar den Mann nicht sehr. Seine muskulöse Gestalt hielt sich fest und gerade, und sein Kopf saß aufrecht auf dem sehnigen braunen Hals, den er bloß trug, so daß ein nicht eben sehr weißer Hemdkragen zum Vorschein kam. Sein Anzug, bestehend aus einem schwarzen Manchesterrock mit Schnurwerk und hechtgrauen Beinkleidern, hatte früher augenscheinlich Anspruch auf Eleganz gemacht, näherte sich aber jetzt dem bedenklichen Zustand der Fadenscheinigkeit. Über die linke Schulter hatte er einen zusammengerollten Mantel von dunkler Farbe geworfen, an der rechten Seite hing ihm eine Ledertasche mit Messingbeschlägen, wie man sie auf Reisen zur Aufbewahrung von Barvorrat zu tragen pflegt, und in der Hand führte er einen tüchtigen Knotenstock.
Die ganze Erscheinung des Mannes machte so ziemlich den Eindruck dessen, was die Engländer schäbige Gentilität zu nennen pflegen. Wir könnten das etwa mit flottem Strolchentum vertauschen, wenn nicht beide Begriffe doch wieder zu harmlose wären, um hier in Anwendung gebracht zu werden. Es war etwas in diesem Gesicht, was, in Worte übertragen, ganz deutlich lautete: Wahre dich!
Der Mann zog eine vielgebrauchte lederne Kapsel hervor, nahm daraus eine Stange Kautabak, biß davon ein »Quid« ab und schob es in seine linke Backenhöhle. Diesem transatlantischen Genusse sich überlassend, blickte er abermals mit großer Aufmerksamkeit in die prächtige Landschaft hinab. Nach einer Weile mit einer Vehemenz, um die ihn ein Yankee beneidet haben würde, einen Strahl brauner Jauche zwischen den Zähnen hervorspritzend, murmelte er:
»Erinnere mich, daß ich an so'nem Frühlingsmorgen just an der Stelle da stand in meinen Grünlingsjahren und so 'nen Sonnenaufgangsspektakel mit ansah wie heute. Machte damals ein Gedicht darauf, ein ganz passables Gedicht, bei Jove! Hm,« fuhr er fort, »rechne, es war eine ganz hübsche Zeit damals, und ist das Altwerden 'ne schnöde Erfindung. Das Land da unten ist jung geblieben und recht hübsch, das muß man sagen. Habe doch pompöse Gegenden gesehen, höllisch pompöse, aber kalkuliere, ist was an dem, was die Poeten von Heimat und Heimatgefühl zu klingklingeln wissen. Wie sagt der Lateiner? Ille terrarum mihi praetor omnes angulus ridet. Ja, ja, 's ist was dran. Kommt mir das alte Zeug da von Bergen und Wasser fast glorioser vor als alles, was ich in der alten und neuen Welt von der Art gesehen, und wird mir so wunderlich zumute, daß ich, by all the powers! imstande wäre, wieder ein Gedicht zu machen. – Bin jedoch,« setzte er hinzu, indem er sich mit der Hand über das Gesicht fuhr und laut gähnte, »schier zu alt zu solchen Narreteien und will drum lieber trachten als dichten, trachten nach einem bequemen Winkel, wo ich mich komfortabel hinhocken und über den Lauf der Welt philosophische Betrachtungen anstellen kann. Ich habe philosophieren gelernt, sollt' ich meinen – ein bißchen anders freilich als die Herren Kathederphilosophen, deren Quark die liebe dumme Jugend vertrauensvoll in ihren Mappen mit nach Hause trägt. Rechne, daß ich doch höllisch jung sein mußte, als ich dies auch tat. – Schloß Wippoltstein da unten sieht noch immer recht herrenmäßig aus, von außen – wollen bald erfahren, wie's drinnen aussieht. Konnte aus dem Kauderwelsch des albernen Köhlers nicht recht klug werden. Nun, der Meister Veit lebt noch, so viel ist sicher. Der wird wohl Bescheid wissen. Was der glatte Halunke für Augen machen wird! Mag er, kümmert mich verteufelt wenig, bei Jove! Bin der Mann dazu, ihm den Kopf zurechtzusetzen, bin es, kalkulier' ich. – Doch 's ist schier kühl hier oben, und die göttliche Aussicht fängt allgemach an langweilig zu werden. Müssen uns nach etwas Soliderem, Substantiellerem umsehen – 's wird nachgerade Zeit sein zum Luncheon, wie die Yankees sagen. Wollen uns daher die liebe Heimat mehr aus der Nähe betrachten.«
Mit diesen Worten brach er das verworren schweifende Selbstgespräch ab, rollte sein Quid aus der linken Backenhöhle in die rechte und begann den schmalen, talwärts führenden Fußpfad hinabzusteigen.
Rasch ausschreitend hatte er nach einer halben Stunde den freien Platz zwischen dem Parktor und dem Dorfe erreicht und ging ohne Zögern in das letztere hinein. Bei dem stattlichen Wirtshause zum Steinbock angelangt, blieb er einen Augenblick stehen und sagte für sich:
»Hm, die alte Kajüte sieht noch immer recht einladend aus. Haben das Schild neu malen lassen, rechne ich. Ob sie wohl drinnen auch noch so guten Roten schenken, wie vorzeiten? Könnte nichts schaden, es mal zu probieren, denk ich – doch nein, bin auf dem Geschäftswege jetzt, also vorwärts.« Und er schritt weiter, die lange Gasse hinab, an der Kirche und dem Pfarrhause vorüber, die Häuser links und rechts scharf ins Auge fassend, doch ohne irgend eine Bewegung zu verraten. Die Begegnenden blieben stehen, um dem Wanderer nachzusehen. Er aber schlenderte weiter, ohne dieser dörflichen Neugierde die geringste Beachtung zu schenken.
2. Ein Wiedersehen.
Als er das Dorf im Rücken hatte, befand er sich auf der Straße, welche, wie wir gesehen, rechtshin an dem aus dem See strömenden Flusse in das Tal sich hinabzog. Er verfolgte diese Richtung, bis er an der rotbedachten Brücke angekommen war. Hier bog er von der Straße ab, ging über die Brücke und am andern Ufer den Fahrweg hinauf, welcher auf die Mühle zuführte. Halbwegs begegnete ihm der Müllerwagen, welcher nach dem Dorfe fuhr, und er fragte den Knecht, ob sein Herr daheim sei. Auf die bejahende Antwort hin ging er weiter und langte bald bei der Mühle an.
Es war ein stattliches Gehöft und der Eindruck der Wohlhabenheit, welchen es machte, drang sich dem Herangekommenen so deutlich auf, daß er in den Bart brummte:
»Meister Veit hat sich gut gebettet, bei Jove! Vermute, er hat die Kunst, Erworbenes zusammenzuhalten und zu mehren, besser verstanden als ich. Der Mann war von jeher ein Geizkragen.«
Hiermit ging er zwischen der Scheune und den Stallungen hindurch in den Hof und auf die Mühle selber zu, aus deren Untergeschoß ein lustiges Geklapper hervorscholl. Der gewaltige Hofhund schoß bellend aus seiner Hütte hervor und wurde nur durch seine Kette verhindert, auf den Fremden einzuspringen. Dieser kümmerte sich jedoch nicht sehr um das grimmige Tier, sondern schritt geradenwegs auf die Haustür zu und war im Begriff, die Klinke derselben zu drücken, als die Tür aufging und ihm ein Mann aus der Flur entgegentrat.
Der Fremde hatte den Müller – denn der war es – kaum erblickt, als er ihm die Hand entgegenstreckte und in kordialem Ton sagte:
»Guten Morgen, Freund Veit. Freut mich ungemein, Euch so wohlauf zu treffen.«
Beim Anblicke des Fremden war das gelbliche Gesicht des Müllers erdfahl geworden und die Stimme desselben machte ihn ordentlich einen Schritt zurücktaumeln.
»Twerenbold?« preßte er endlich mühsam heraus, staunend, überrascht, durch diese Begegnung offenbar im höchsten Grade erschreckt.
»Ja, Twerenbold, mit Eurer Erlaubnis,« versetzte der andere keck und setzte im Tone des gutmütigen Polterers hinzu: »Aber, by all the powers, wie die Irishmen schwören, ist das 'ne Art, einen alten Freund willkommen zu heißen?«
»Twerenbold?« wiederholte der Müller. »Wie? Ihr seid zurückgekommen?«
»In Lebensgröße, wie Ihr seht,« lachte Twerenbold.
Dem Müller war es ganz und gar nicht ums Lachen zu tun. Er stand regungslos, starrte den Eindringling an und sagte dann:
»Und was wollt Ihr hier, Meister Twerenbold?«
Die Frage klang verzweifelt kühl, unfreundlich, abweisend, und doch auch wieder ängstlich forschend, furchtsam.
»Was ich hier will? Nun, zunächst will ich, daß Ihr mich nicht so zwischen Tür und Angel stehen laßt wie 'nen schäbigen Bettler, sondern mir die Hand gebt und aus vollem Herzen zu mir sagt: Willkommen, guter alter Freund!«
Der Müller zauderte und warf einen schielend forschenden Blick auf den »guten, alten Freund«, aber das harte Auge desselben übte eine Macht auf ihn, welcher er nicht zu widerstehen wagte.
Widerstrebend bot er ihm die Hand hin und sagte:
»Ihr seid willkommen. Folgt mir.«
Der Gast ließ sich das nicht zweimal sagen und folgte seinem Wirt die Treppe hinauf. Droben ging der Müller über einen langen Gang, schloß eine Hinterstube auf, in welche das Geräusch des Mühlwerks nur sehr gedämpft drang, und ließ seinen Besuch eintreten.
Twerenbold legte ohne Umstände Mantel, Hut und Stock ab und sah sich bedächtig in dem Zimmer um.
Es war so, wie man es unter dem Dach einer Gebirgsmühle zu finden nicht erwarten durfte, denn die ganze Einrichtung war nicht nur städtisch, sondern sogar luxuriös und nicht ohne Geschmack. Gestickte Vorhänge an den Fenstern, auf dem Boden ein bunter Teppich, Möbel von eleganter Form und weicher Sammetpolsterung, eine schöne Pendule auf der Marmorplatte des Sekretärs, Spiegel und gute Kupferstiche in Goldrahmen an den tapezierten Wänden, in der einen Ecke ein reichversehener Gewehrkasten, in der andern ein Glasschrank mit reichgebundenen Büchern – das alles sah keineswegs ländlich aus.
Die Erscheinung des Hausherrn trat zu diesem Gemach nicht in Gegensatz. Er trug zwar einen müllerfarbenen Rock, aber dieser war von städtischem Schnitt. Seine weißen Hände verrieten keine große Bekanntschaft mit den Werkzeugen seines Gewerbes, und seine dünne, mittelgroße Gestalt zeigte deutlich, daß seine Schultern wohl nie mit den Mehlsäcken in Berührung gekommen. Das Gesicht des Mannes war von gelblich-bleicher Farbe und trug vorherrschend den Ausdruck von List und Verschlagenheit. Das eine seiner blaßblauen Augen schielte, und dieser Naturfehler machte diese weitaus mehr zurückstoßende als anziehende Physiognomie durchaus nicht liebenswürdiger. Das Gebaren des Müllers paßte ganz und gar nicht zu seinem Stand. Es war an ihm nichts Derbes, Kräftiges, Vierschrötiges, sondern überall etwas Glattes, Abgemessenes, Leisetretendes. Ein Menschenkenner hätte daraus schwören können, in dem Meister Veit einen alten Herrendiener vor sich zu haben, eine echte und gerechte Kammerdienernatur.
Welches Band der Gleichheit auch den Müller und seinen Gast vereinigen mochte, so viel war klar, daß der robuste, zuversichtlich auftretende Twerenbold wenigstens den Vorteil der Männlichkeit vor seinem Wirte voraus hatte und daß er diesem bedeutend imponierte.
»Diese Stube,« sagte der Gast, »ist für eine Mühle sehr anständig, bei Jove! Sie sieht gerade so aus, als würde sie von weichen weißen Frauenhänden in Ordnung gehalten. Wollt Ihr mich Eurer Frau vorstellen, teurer Freund? Ich komme aus einem Lande, wo selbst in den Squattershütten auf gute Lebensart gehalten wird.«
»Ich habe keine Frau,« entgegnete der Müller mit schlecht verhehltem Verdruß über die Ungeniertheit seines Gastes, »sondern nur eine Haushälterin.«
»Ah,« versetzte Twerenbold mit zynischem Blinzeln, »Ihr liebt noch immer den Wechsel, alter Junge?« »Sprecht vernünftig, Meister Twerenbold. Ich liebe die Wirtshausspäße nicht, wie Ihr wißt.«
»Ja, ich weiß, Ihr machtet stets den Aristoteles zuschanden, welcher den Menschen ein geselliges Tier nennt. Ihr waret stets eine sich absondernde, ernsthafte Bestie, mein guter Veit.«
Ein Blitz des Hasses brach aus den Augen des Müllers, als sich Twerenbold umwandte und ein Fenster öffnete, um seinen Mund des Kautabaks zu entledigen. Aber das Wort Bestie war in einem Tone gesprochen, in welchem ein orientalischer Despot mit seinem Sklaven redet, und Meister Veit kannte die Bedeutung dieses Tones recht wohl. Er hatte jedoch seine Züge nicht so in der Gewalt, daß Twerenbold, als er sich wieder vom Fenster zu ihm wendete, nicht wahrgenommen hätte, was in des Müllers Seele vorging.
»Mein lieber Freund,« sagte jener mit vollkommener Ruhe, »Ihr wünscht mich zu allen Teufeln, nicht wahr?«
Ausweichend erwiderte der Müller:
»Wie konntet Ihr wagen, nach Wippoltstein zurückzukommen – nach Europa überhaupt – mit Verletzung des heiligsten Eidschwurs?«
»Wie ich das wagen konnte? Bah! Was hatte ich denn dabei zu riskieren? Und wie mögt Ihr, ein aufgeklärter Mensch, von jenem Firlefanz mit dem Eide sprechen, Ihr, der Ihr recht gut wißt, daß weitaus die meisten Eide nur dazu da sind, gebrochen zu werden? Jetzt spaßt Ihr, teurer Freund, kalkulier' ich. Mag ich erschossen werden, wenn ich Euch nicht mehr Spunk zugetraut hätte, bei Jove!«
»Und sind die amerikanischen Redewendungen, die Ihr im Munde führt, alles, was Ihr aus der neuen Welt mit heimgebracht?« »Alles? Nein, das nicht. Seht einmal her – wie gefällt Euch das?«
So sprechend öffnete der Abenteurer die Ledertasche, welche er an einem Riemen über die Schulter hängen hatte, und nahm daraus eine Handvoll größerer und kleinerer Quarzstücke, welche alle von mehr oder weniger starken Goldadern durchzogen waren.
»Goldstufen?« rief der Müller aus, und sein Auge funkelte gierig. Twerenbold ließ die Quarzstücke langsam in die Tasche zurückfallen und sagte:
»Ihr seht, daß ich nicht ganz als Bettler in die liebe Heimat zurückgekommen. Weitaus die meisten dieser Dinger sind unterwegs, namentlich in London und Paris hängen geblieben. Aber was hatte das zu sagen? Wußte ich doch, daß mich daheim treue Freunde und eine gute Versorgung erwarteten.«
»Wie! Wie meint Ihr das?«
»Wie ich das meine? Davon nachher. Was mir zunächst nottut, ist ein reelles Frühstück. Wollte gestern drüben in Lerchenau übernachten, aber die Sehnsucht, meinen teuren Freund Veit zu sehen, trieb mich noch spät abends auf den Weg. Schlug den Fußpfad über den Reißenstein ein, verirrte mich aber in dem dummen Walde da oben und mußte in einer Köhlerhütte unterkriechen, wo nur ein sehr mangelhaftes Abendbrot aufzutreiben war. Also vor allen Dingen das Frühstück, wenn's Euch beliebt.«
Der Müller versuchte keine Einwendung, sondern verließ das Gemach, um das Verlangte herbeizuschaffen.
Twerenbold trat an den Bücherschrank, musterte den Inhalt desselben, nahm einen Band heraus, rückte einen Lehnstuhl an den Tisch, machte es sich in demselben bequem und blätterte in dem Buche.
Nach wenigen Minuten kehrte der Hausherr zurück, auf einem Servierbrett kalte Küche und zwei Weinflaschen tragend.
»Meister Veit,« sagte der Gast, mit dem Zeigefinger auf eine Stelle in dem Buche weisend, wie gefällt Euch der Vers:
Die stärksten Bande schmiedet das Verbrechen?«
Der Müller gab keine Antwort, sondern ordnete schweigend das Frühstück auf dem Tisch.
»Nicht wahr,« nahm Twerenbold wieder das Wort, »unter den Poeten trifft man doch hier und dort einen, welcher Welt und Menschen gründlich kennt? Doch lassen wir jetzt die Phantasien und beschäftigen wir uns jetzt mit dem Materiellen. Ihr werdet natürlich mit mir frühstücken und mir in Eurem Wein Bescheid tun. Ich bin ein geselliges Tier, ich, und liebe es nicht, allein zu essen und zu trinken.«
»Ich habe bereits gefrühstückt.«
»Oh, rechne, das macht gar nichts. Man tut einem alten guten Freunde Schwereres zu Gefallen, als zweimal frühstücken. Laßt einen zweiten Teller und ein zweites Glas kommen und macht keine Umstände.« Ein vielsagender Blick, einer, jener Blicke, womit Twerenbold den Müller beherrschte, begleitete diese Worte. Veit ging hinaus, kam mit einem zweiten Teller und Glas zurück und setzte sich seinem Gaste gegenüber.
»Greift zu und schenkt ein,« sagte der Abenteurer. »Der Wirt muß mit gutem Beispiel vorangehen.«
Und er rührte weder einen Bissen an, noch setzte er das Glas an die Lippen, bevor der Hausherr von den Speisen und dem Getränke gekostet hatte. Sobald dies aber geschehen, vertiefte er sich mit allem Ernst in das Geschäft des Frühstückens und sprach der Flasche wacker zu. »Dieser Schinken und diese Hammelkeule sind vortrefflich,« sagte er nach einer Weile, »und was den Wein betrifft, so könnte er, kalkulier' ich, mit Ehren auf der Tafel des gräflichen Schlosses erscheinen.«
Bei Erwähnung des Schlosses warf der Müller einen lauernden Blick auf seinen Gast, welcher aber keine Notiz davon zu nehmen schien. Nachdem er seinem Appetit genuggetan, schob er den Teller zurück, füllte sein Glas aufs neue und sagte nachlässig:
»Vermute, daß das zierliche Strohkistchen dort auf dem Pfeilertischchen eine anständige Zigarre enthält. Ist es so, teuerster Freund?«
Der Hausherr stand auf, holte das bezeichnete Kistchen und stellte es vor seinen Gast hin, welchem in nichts zuwider zu handeln er beschlossen zu haben schien.
Twerenbold wählte mit Kennermiene einen Glimmstengel, ließ sich das von seiten des Müllers dargebotene Zündhölzchen gnädigst gefallen, lehnte sich behaglich in den Sessel zurück, schlürfte seinen Wein und blies mit viel Kunst die korrektesten blauen Ringe in die Luft.
Der Müller schickte sich gerade an, das entstandene Schweigen zu brechen, als Twerenbold zu ihm sagte:
»Ich lese Neugierde in Euren Augen, mein werter Freund. Fragt mich immerhin. Bin in einer ganz komfortablen Stimmung und werde mit der Offenherzigkeit antworten, die mir eigen ist und an welche Ihr Euch gewiß noch zu erinnern vermögt.« Meister Veit zwang ein Lächeln auf seine Lippen und entgegnete:
»Nun ja, ich bin neugierig – man wird das gern auf dem Lande. Nach dem Inhalt Eurer Tasche da zu schließen, kommt Ihr aus Kalifornien?«
»Nicht direkt, wohl aber auf Umwegen. Ja, ich war, kalkulier' ich, wo die Flüsse statt Kiesel Goldquarze rollen und wo es des gelben Quarks in Hülle und Fülle gibt für einen, der ihn an den rechten Orten zu suchen und aufzuheben versteht.«
»Und warum seid Ihr nicht in diesem gesegneten Lande geblieben, Meister Twerenbold?«
Der Abenteurer blies ein halb Dutzend Rauchringe vor sich hin, bevor er eine Erwiderung gab, und als er das tat, geschah es nur in Form einer Frage.
»Habt Ihr mal vom Lynchen und von der Lynchjustiz gehört oder gelesen, teurer Freund?«
»Nur oberflächlich.«
»Schade! Ist das ein allmächtig merkwürdiges Ding, versichere Euch. Seht, eines schönen Morgens werdet Ihr von Euren Nachbarn am Kragen genommen, mit welchen Ihr vielleicht noch gestern in aller Freundschaft ein Glas Brandy getrunken habt. Man schnürt Euch die Hände auf den Rücken, setzt Euch auf einen Gaul und führt Euch zu Walde, wohin man gemeiniglich nicht weit zu gehen hat. Dort angekommen, legt man Euch die zulaufende Schlinge eines verteufelten Lederstrickes um den Hals und befestigt das andere Ende besagten Lederstrickes an dem solid aussehenden Ast einer ehrwürdigen Eiche. Dies getan, gibt man Euch zu erwägen, ob es nicht gut getan wäre, in möglichster Kürze für das Heil Eurer Seele zu sorgen. Dann nimmt einer von denen, die Euch das Geleite gegeben, die Peitsche zur Hand und versetzt damit dem Gaul, auf welchem ihr sitzt, einen tüchtigen Hieb. Das Beest reißt mit einem wütenden Satze aus und Ihr – je nun, Ihr baumelt an dem Ast, zuckt noch ein wenig, strampelt ein bißchen mit den Beinen und – wutsch dich! schnappt Ihr hinüber in die Ewigkeit. Eine sehr inkonvenable Situation das, nicht?« »Gewiß,« versetzte der Müller, einen leichten Schauder unterdrückend.
Twerenbold leerte sein Glas mit einem raschen Zug, schob es seinem Wirte zum Wiederfüllen hin und fuhr fort:
»Zuweilen, wenn Eure guten Freunde, die Hinterwäldler oder Goldsucher, besser gelaunt sind, nimmt die Sache einen weniger tragischen, für den Betreffenden jedoch immerhin durchaus nicht komischen Ausgang. Man schnürt Euch in diesem Falle auch die Hände zusammen, bindet Euch mittels eines Riemens an einen Baumast, aber nur, um Euch zu peitschen, bis Euch die Haut in Fetzen den Rücken hinunterhängt. Dann steckt man Euch bis ans Kinn in ein Teerfaß, hebt Euch mit Stangen wieder aus demselben und wirft Euch in ein anderes, das mit Federn gefüllt ist. Man nennt das Teeren und Federn, und wenn Ihr nach dieser Prozedur noch Kraft genug dazu habt, könnt Ihr Euch als Papageno für Geld sehen lassen.«
»Wohl, aber in dem einen Falle wie in dem andern muß der von Euch mit so viel Sachkenntnis beschriebenen Zeremonie ein Motiv zugrunde liegen? Keine Wirkung ohne eine Ursache.«
»Ihr seid ein Mann von Logik, Freund Veit,« versetzte Twerenbold, ohne sich durch den boshaft höhnischen Blick seines Wirtes irremachen zu lassen. »Allerdings handeln die Pfleger der edlen Lynchjustiz nicht ohne Motive und es gibt deren so viele, vermut' ich – Übeltaten am lebenden und am – künftigen Geschlecht.«
Die letzten Worte betonte der Abenteurer wieder so eigen, so schneidend, daß Meister Veit vor der Stimme und dem Blicke seines Gastes scheu die Augen senkte. Twerenbold fuhr fort:
»Ich habe, da Euch doch meine amerikanische Ausdrucksweise zu gefallen scheint, ich habe die Notion, daß Ihr es ferner unterlaßt, mich nach den Motiven zu fragen, welche mich bewogen, das Goldland und Amerika überhaupt zu verlassen, und daß Ihr Euch damit begnügen werdet, wenn ich Euch ein für allemal sage, daß es mir beliebte, in unsere alten Berge heimzukehren. Sie sind gar so schön, und hatte ich, wißt Ihr, von jeher an Naturschönheiten ein absonderliches Wohlgefallen.«
Veit antwortete nicht, und so trat abermals eine Pause ein, welche Twerenbold ganz gemütlich mit Trinken und Rauchen ausfüllte. Dann nahm er das Gespräch wieder auf mit den Worten:
»Diesen Morgen fiel mir ein, daß heute, als am ersten Mai, gerade zwanzig Jahre vergangen sind, seit ich von hier wegging. Erinnert Ihr Euch, daß Ihr mir die Freundschaft erwieset, mich bis zur nächsten Poststation zu begleiten? Still, Ihr braucht Euch nicht so verlegen umzusehen. Ich will nicht von damals, sondern von jetzt reden; aber tut mir den Gefallen, die Fragen, welche ich an Euch richten werde, klar und bestimmt zu beantworten.«
»Fragt mich.«
»Wohl, so gefallt Ihr mir, und ich sehe, nicht nur alte Liebe, sondern auch alte Freundschaft rostet nicht. Fürs erste also: Lebt die Lore noch?«
»Die Traumlore?«
»Traumlore! Was soll denn das?«
»Nun, man nennt das alte Weib so, weil es sich damit abgibt, dem Bauernpack seine Träume auszulegen.«
»Also die gute Lore ist noch am Leben? Freut mich, bei Jove! Aber sagt, ist sie gezwungen, auf die Dummheit der Menschen zu spekulieren?«
»Nein, sie tut das und anderes Ähnliches nur aus Neigung und zum Zeitvertreib.«
»Sie wohnt im Dorfe?«
»Nein, droben am See in der Drachenkluft.«
»Was, zum Teufel! In der Einsiedelei zum Sankt Georg?«
»Ja. Als der alte Mann mit seinem großen Bart gestorben war und sich kein neuer Kandidat für die Einsiedlerstelle finden wollte, erbat sich die Lore die Einsiedelei von dem gnädigen Herrn und hat seither dort gehaust. Es ist schon manches Jahr her.«
»Steht sie noch in Beziehungen zum Schlosse?«
»Ich weiß es nicht. Sie war, seit ich sie kenne, nie sehr umgänglich, und ich pflege meine Gesellschaft niemand aufzudringen.«
Twerenbold hielt es nicht der Mühe wert, die gehässige Bedeutung der letzten Worte des Müllers zu beachten. Er nahm sich eine frische Zigarre, brannte sie gemächlich an und fuhr mit Fragen fort. »Wie steht es im Schlosse? Was tut Graf Nepomuk?«
»Seine Erlaucht der gnädige Herr Graf von Wippoltstein befinden sich wohl.«
»Kalkuliere, Meister Veit, Ihr laßt die kammerdienerischen Schnörkel aus unserer Unterhaltung fort. Bei Jove, sie klingen übel in den Ohren eines Bürgers der Vereinigten Staaten, denn einen solchen habt Ihr in mir zu respektieren. Auch seid Ihr ja nicht mehr Kammerdiener, sondern sitzt auf Eurer eigenen Hufe, könnt Euch demnach der steifleinenen Redensarten ganz gut entschlagen.«
»Gewohnheit, Meister Twerenbold, Gewohnheit. Auch war ich, wie Ihr wißt, stets ein höflicher Mann und schulde meinem gnädigen Herrn die höchste Achtung und Dankbarkeit.«
»Bah,« versetzte der Abenteurer verachtungsvoll, »behaltet solche baumwollene Phrasen für Gimpel. Ihr wißt recht gut, daß Eure Achtung vor dem Grafen nicht mehr und nicht weniger groß ist als die meinige, und was Eure Höflichkeit angeht, so hab' ich, by all the powers! bei meinem Eintritt in dieses Haus eine sattsame Probe davon erhalten. Doch genug davon! Ich vernahm gestern abend, daß der Graf vor nicht langer Zeit eine zweite Heirat geschlossen. Wie ist's damit?«
»Der Herr Graf hat sich vor zwei Jahren wieder vermählt.«
»Mit einer Witwe seines Alters oder mit einer jungen Dame?«
»Mit einem kaum achtzehnjährigen Mädchen.«
»Ist die Gräfin schön?«
»Wie die Tugend.«
»Wie die Tugend? Bah!«
»Soll ich sagen, wie das Laster?«
»Ist sie reich?«
»Das weniger. Sie stammt aus einem sehr großen Hause, war aber das zwölfte Kind ihrer Eltern.«
»Verstehe, die Heirat mit dem Grafen wurde als eine standesmäßige Versorgung für das zwölfte Kind angesehen.«
»Wahrscheinlich. Die Braut wurde, wie ich sagen hörte, aus dem Kloster, wo sie erzogen worden, an den Altar geführt.«
»Sehr vornehm das, ganz der alte gute Ton. Sind Kinder aus dieser Ehe vorhanden?«
»Nein.«
»Und leben der Graf und seine junge Frau glücklich mitsammen?«
»Wie könnt' ich das wissen?«
»Oh, geht mir mit Eurer Bescheidenheit! Ihr seid der Mann dazu, so etwas zu wissen. Muß ich meine Frage wiederholen?«
»Soviel mir bekannt, leben der gnädige Herr und die gnädige Frau, wenigstens in neuerer Zeit, mehr nur auf dem Fuße der Konvenienz miteinander als auf einem vertraulicheren.«
»Das will sagen, jedes lebt für sich. Wie kam das?«
»Die Frau Gräfin ist stolz.«
»Aha, die junge Dame fand es nicht nach ihrem Geschmacke, daß der Herr Gemahl, wie in seinen jungen Jahren, so auch noch in seinen alten gegenüber dem weiblichen Geschlecht so ungemein herablassend war?«
»Ihr seid scharfsinnig, Meister Twerenbold.«
»Sehr verbunden. Aber wie kommt es, daß der Graf jetzt so viel auf dem Lande lebt? Ich hörte in Lerchenau, er hätte schon seit anderthalb Jahren Wippoltstein nur selten und immer nur auf wenige Tage verlassen.«
»So ist es. Ich denke, der gnädige Herr hat das Residenzleben satt bekommen.«
»Vielleicht infolge der revolutionären Bewegungen in der Hauptstadt, wie?«
»Ich weiß nicht. Hier oben blieb alles ruhig und beim alten.«
»Nun, es ist ja auch drunten wieder so. Aber der junge Graf?«
Bei dieser Frage schaute der Müller auf und seinem Gast mit einem lauernden Blick ins Gesicht.
Twerenbold verzog keine Miene.
»Der junge Herr Graf? Ihr meint Junker Robert?«
»Ja.«
»Er ist zu einem stattlichen Manne herangewachsen, steht bei den blauen Husaren, hat den Feldzug in Italien mitgemacht und wurde auf dem Schlachtfelde von Custozza wegen seiner in dieser Schlacht bewiesenen außerordentlichen Bravour zum Rittmeister seiner Schwadron ernannt.«
»Und wo befindet er sich jetzt?«
»Er hat, soviel mir bekannt, den Winter in der Residenz verlebt, wird aber täglich auf dem Schloß erwartet oder ist vielleicht schon angekommen.«
»Was für eine Art Mensch ist er?«
»Soweit ich ihn kenne, ein Kavalier comme il faut, ein bißchen exzentrisch und sehr –«
»Sehr?«
»Hochmütig. Wenigstens sagt die Schloßdienerschaft so.«
»Ein echter Vollblutaristokrat demnach?«
»Ich glaube.«
»Gut. Das wäre der eine junge Graf. Aber der andere, der echte?«
Und bei dieser Frage bohrte der Blick Twerenbolds hart und scharf in die Augen seines Wirts.
Veit senkte den Kopf und rückte unbehaglich auf dem Sofa hin und her.
»Der andere, der echte?« wiederholte der mitleidslose Frager.
»Lassen wir die Toten ruhen,« murmelte der Müller.
»Der arme Junge starb?«
»Er starb.«
»Wann?«
»Ungefähr zwei Jahre nach Eurer Abreise.«
»Wie?«
»An Entkräftung.«
»Ich dachte es,« sagte Twerenbold mit gesenkter Stirne und Stimme, mehr zu sich selbst als zu Veit sprechend, »ich dachte es und mußte es wissen. Der unglückliche Knabe war zu zart gebaut, um jene – um jenen Unfall lange zu überleben. Ich wußte es.«
Und er stürzte sein volles Glas mit einem Zug hinunter und stieß dicke Rauchwolken aus seinem Munde.
»Das arme Jüngelchen!« sagte der Müller. »Es war recht trübselig zu sehen, wie das gute Herrchen von Tag zu Tag abnahm. Als er starb, war große Trauer im Schloß. Der gnädige Herr ließ durch die Lore, die ja manche ärztliche Kunst von Euch gelernt hat, Meister Twerenbold, den armen kleinen Leichnam mit den köstlichsten Spezereien einbalsamieren, und als er in der Ahnengruft beigesetzt wurde, war es das prächtigste Leichenbegängnis, welches je in diesen Bergen gesehen worden. Ja, es war recht traurig.«
Diese Worte wurden mit dem hölzern kläglichen Ton eines Leichenbitters vorgebracht.
Twerenbolds Lippen umzog ein grimmiger Hohn, und seine Züge nahmen einen Ausdruck unsäglicher Verachtung an.
Langsam und schneidend versetzte er:
»Meister Veit, Ihr seid ein –«
»Mann von langem Gedächtnis, wollt Ihr sagen? Ja, seht, da habt Ihr recht. Aber so ein langes Gedächtnis ist ein zweischneidig Ding. Leidet Ihr auch daran?«
»Ich habe ein langes Gedächtnis, Mensch, und erinnert mich dasselbe sehr deutlich an wohlerworbene Rechte. Aber ich leide nicht daran, denn ich bin ein Mann und weiß, daß es Torheit ist, um Vergangenes zu sorgen.«
»Wohlgesprochen, aber nicht ich bin es, sondern Ihr seid es, der Vergangenes aufstört. Lassen wir die Toten ruhen, sag' ich nochmals.«
Der Abenteurer schaute nachdenklich vor sich hin und gab keine Antwort.
Das Schweigen schien dem Müller bald lästig zu werden. Er goß den Rest der zweiten Flasche in das Glas seines Gastes und sagte:
»Ihr habt mich zu Anfang unserer Unterredung Euren guten alten Freund genannt, Meister Twerenbold. Als solcher nehme ich mir, obgleich ich sonst gerne meine Finger von anderer Leute Brei fern halte, die Freiheit, Euch zu fragen, was Ihr hier in diesen Bergen zu treiben beabsichtigt. Dabei bemerke ich Euch, daß Ihr leicht Schwierigkeiten finden dürftet, als Arzt ein erträgliches Auskommen zu finden, weil wir seit etwa fünfzehn Jahren einen sehr tüchtigen hier haben, der sich weitum eines großen Rufes erfreut.«
»So?« entgegnete Twerenbold nachlässig. »Ich gönne meinem Nachfolger seine Praxis von Herzen, denn wißt, ich will mich zur Ruhe setzen.«
»Zur Ruhe setzen?«
»Ja, guter alter Freund, zur Ruhe setzen und mein Leben, soweit es noch reicht, komfortabel genießen. Ruminiere, so will ich.«
Der Müller warf einen zweifelhaften Blick auf den Anzug seines Gastes. Dieser fing den Blick auf und fragte ruhig:
»Wißt Ihr, Meister Veit, was ein Bummler ist?«
»Ein Bummler? Man hat in den letzten tollen Zeiten dieses Wort oft genug in den Zeitungen lesen müssen. Bin ich recht berichtet, so ist ein Bummler so viel wie gar nichts.«
»Bravo, bei Jove! Nun ist es an mir, Euch ein Kompliment wegen Scharfsinns zu machen. Seht, ich las und hörte jenseits des großen Baches soviel von ganz ungeheuerlichen, unglaublichen Errungenschaften, welche dem guten deutschen Michel eines schönen Morgens wie gebratene Tauben ins Maul geflogen. Das machte mir, begreift Ihr, den Mund, gewaltig wässern, und ich machte mich auf, dem Vaterland einen seiner verlorenen Söhne zurückzugeben. Als ich aber das rechte Rheinufer wieder betreten hatte, was sah ich da? Alle die gepriesenen Errungenschaften waren bereits wieder verschwunden, verduftet, verraucht, unsichtbar geworden, zu allen Teufeln gegangen. Nur eine einzige war geblieben, freilich eine kostbare: das Wort und der Begriff Bummler, welchen das englische Wort Rambler oder das amerikanische Ranger oder das französische Flaneur nicht einmal annäherungsweise wiederzugeben vermag. Da faßte ich, nachdem ich in meinem Leben, namentlich in den letzten zwanzig Jahren desselben, so vielerlei gewesen, den festen Entschluß, mich fürohin mit Leib und Seele der edlen Bummelei zu weihen, und so will ich denn als Bummler leben und sterben. Was meint Ihr dazu?«
»Gar nichts. Das ist Geschmackssache, und über Geschmackssachen läßt sich nicht streiten. Wenn ich aber unter Bummelei behagliches Nichtstun verstehe, so scheinen mir dazu mehr Mittel erforderlich zu sein, als Eure Ledertasche enthalten mag.«
»Ist ein Fakt, wie meine ehrenwerten Mitbürger, die Yankees, sagen. Allein ich habe noch andere Hilfsmittel.«
»Andere Hilfsmittel? Also habt Ihr Euer schönes Kapital tüchtig umgetrieben und wohl gar vermehrt?«
»Tüchtig umgetrieben, jawohl, darauf könnt Ihr alle Eide der Welt schwören. Was dagegen das Vermehren betrifft, so mag es sich in anderen Händen vermehrt haben, die meinigen verstanden sich bloß aufs Vertreiben.«
»Also habt Ihr alles durchgebracht?«
»Reinen Tisch gemacht, tabulam rasam, wie der Lateiner sagt. Ist 'ne brutale Tatsache, ein fait accompli.« »In diesem Falle begreife ich nicht, wie Ihr als Bummler solltet leben können.«
»Ihr begreift nicht, sagt Ihr? Kalkuliere, ist das wunderlich. Gab Euch ja schon zu verstehen, daß ich noch anderweitige Ressourcen habe, Kapitalien, die schlechterdings nicht durchzubringen sind und hübsche Interessen abwerfen.«
»Wo sind sie?«
»Wo sie sind? Gesetzt den Fall, ich spräche: Erstlich ist so ein sicheres großes Kapital die Freundschaft meines guten alten Freundes Veit, welcher sich als Besitzer der einträglichen Donnerfallmühle und der dazu gehörigen liegenden Gründe sicherlich ein nettes Vermögen gemacht hat – wie?«
»Ich habe Euch schon einmal bemerkt, daß ich kein Freund von Späßen bin.«
»Wer sagt Euch denn, daß ich diese Sache von der spaßhaften Seite betrachte?«
Twerenbold sprach so ruhig und bestimmt, daß den Müller ein höchst unangenehmes Gefühl anwandelte. Er rückte wieder auf dem Sofa hin und her, als wären dessen Polster mit Nadeln gespickt, und durchspähte dann mit seinen Luchsaugen die Physiognomie des Gastes, einen Zug darin zu entdecken, welcher ihm einen Ausweg aus dieser Klemme zeigen könnte. Aber er fand nur eine eherne Mauer, von welcher endlich sein Blick scheu abprallte, während der in ihm kochende Grimm große Schweißtropfen auf seine Stirne trieb. Seine ganze Haltung gegenüber dem Abenteurer war das Sichkrümmen einer feigen Natur unter dem Druck einer energischen.
Twerenbold betrachtete einige Sekunden lang seinen Wirt mit mephistophelischem Behagen. Dann brach er in ein lautes Lachen aus und sagte:
» By all the powers! ein so gescheiter Mann, wie Ihr seid, Meister Veit, sollte keine so klägliche Figur machen, wenn es sich um eine Bagatelle handelt.«
»Um eine Bagatelle?«
»Nun, ja doch. Ich bin, kalkulier' ich, über die jugendliche Hitze und demnach auch über die Zeit hinaus, wo der Verschwendungstrieb in dem Menschen waltet. Meine Ansprüche an das Leben sind daher, rechne ich, ganz bescheidene. Eine bequeme Stube, die nicht gerade so schloßmäßig möbliert zu sein braucht wie diese da, ein warmer Ofen im Winter, der Anzug eines zurückgezogen lebenden Gentleman, ein Mittagstisch im guten alten Wirtshaus zum Steinbock, Wein von besseren Jahrgängen, eine anständige Zigarre, zur Abwechselung ein Ausflug da und dorthin – das sind, denk' ich, die Bedürfnisse, auf deren Befriedigung ich Anspruch mache.«
»Ihr wollt also ein Herrenleben führen?« fragte Meister Veit bitter.
»Ein Herrenleben? Bah! dazu gehören noch ganz andere Dinge. Ich versteige mich nicht zur Forderung einer Equipage, etlicher Schlingel von Lakaien, einer Maitresse und dergleichen mehr.« »Wirklich? Ihr seid in der Tat bescheiden.«
»Nicht wahr? Etwas übrigens vergaß ich. Da ich nämlich jenseits des Meeres ein großer Politiker geworden, das heißt, da ich mich gern an dem leidigen Komödienspiel ergötze, welches die Leute Politik nennen, so muß ich mir schlechterdings drei oder vier Zeitungen halten. Ihr werdet das billig finden, wie?«
Der Müller, dessen Verstellungsgabe allmählich erschöpft war und dem die Wut des Geizes die Kehle zuschnürte, brachte nur ein hysterisches Lachen hervor.
Twerenbold fuhr mit verzweifelter oder vielmehr seinen Wirt zur Verzweiflung bringender Kaltblütigkeit fort:
»Rechne ich alles zusammen und berücksichtige ich dabei, daß es hier oben in den Bergen immerhin noch viel billiger zu leben sein muß, als drunten in den Städten, so komm' ich zu dem Fazit, daß ich mit einhundert Talern monatlich oder zwölfhundert Talern jährlich als lediger Mann anständig auskommen werde.«
»Zwölfhundert Taler!« rief der Müller aus. »Das sind ja nach landesüblichem Zinsfuß die Interessen eines Kapitals von vierundzwanzigtausend Talern!«
»Kalkuliere, sie sind's – ist ein Fakt.«
»Und wer, ich bitt' Euch, soll Euch diese schöne Jahresrente ausbezahlen?«
»Werdet es sogleich erfahren, teurer Freund. Habt nur die Gefälligkeit, mir Papier und Schreibzeug zu geben.«
Der Müller gehorchte mechanisch, holte das Geforderte aus dem Sekretär und setzte sich dann wieder dem Abenteurer gegenüber.
Twerenbold schob die Schreibmaterialien dem Hausherrn zu und sagte:
»Schreibt, was ich Euch diktieren werde.«
Veit zögerte, aber ein Blick seines Gastes machte ihn die Feder ergreifen, wenn auch mit einer unverkennbaren Gebärde des Widerwillens.
»Stellt Euch doch nicht so viereckig an, Mann«, sagte Twerenbold. »Doch halt, laßt Euch vorher noch etwas sagen. Eure Hand wird, vermut' ich, willfähriger und fester sein, wenn ich Euch eröffne, daß keineswegs Ihr die Person seid, welche mir meine Bummlerrente ausbezahlen soll.«
Der Müller atmete hoch auf und spitzte die Ohren. »Der Graf Nepomuk von Wippoltstein, unser gemeinsamer guter Freund,« fuhr der Abenteurer fort, »lebt in Glanz, Ehre und Reichtum, und sein Sohn Robert wird von ihm eine der schönsten Herrschaften erben, welche es auf deutschem Boden gibt. Das ist Tatsache. Ist es nicht?«
»Es ist, wie Ihr sagt.«
»Wohl! Aus den angegebenen Prämissen ziehe ich den Schluß, daß mir der besagte gemeinsame Freund die mehr erwähnte Rente zusichern und verabfolgen lassen wird. Es ist dies, ich gebe es zu, an und für sich ein gewagter Schluß, aber Ihr, der Ihr, ich wiederhole es, ein vortrefflicher Logiker seid, werdet denselben bündig, klar und vollkommen in der Ordnung finden. Seht mir ins Gesicht und sagt, ob dem so ist oder nicht.«
Ohne die Augen von dem vor ihm liegenden Papier zu erheben, erwiderte der Müller:
»Ich finde den Schluß vollkommen begreiflich, wenigstens von Eurer Seite.«
»Gut. Was die andere Seite, die gräfliche angeht, so werdet Ihr, guter alter Freund, alles Nötige tun, um auch dieser andern Seite die unantastbare Richtigkeit meines Schlusses klar zu machen.«
»Ich?«
»Ja, Ihr. Und jetzt schreibt!«
Twerenbold diktierte, und der Müller schrieb:
»Ich Unterfertigter, Graf Nepomuk von und zu Wippoltstein, habe mich bewogen gefühlt, dem Achatius Twerenbold, Graduierten der Medizin, vordem Arzt im Flecken Wippoltstein, in Anerkennung alter, guter, treuer Dienste von seiten desselben, eine lebenslängliche Rente von zwölfhundert Talern jährlich auszusetzen, und soll nach meinem Ableben mein Sukzessor und vorkommendenfalls dessen Sukzessor in diese von mir besagtem Achatius Twerenbold gegenüber übernommene Verpflichtung eintreten. Erwähnte Rente soll in monatlichen Raten von je einhundert Talern an den Inhaber oder dessen Bevollmächtigten von der Kasse der gräflichen Oberrentei ausbezahlt werden und soll die erste Monatsrate mit heutigem Datum fällig sein. Dieser mein Erlaß ist in zwei völlig gleichlautenden Exemplaren von meiner eigenen Hand ausgefertigt und soll das eine in der Kanzlei der Rentei niedergelegt, das andere besagtem Achatius Twerenbold, meinem guten, alten, treuen Diener und Freund, eingehändigt werden. Gegeben auf meinem Schloß Wippoltstein, unter meinem Siegel und Wappen am 1. Mai 185...«
»Habt Ihr buchstäblich geschrieben, wie ich angab?«
»Ja.«
»Zeigt her.«
Der Abenteurer durchlas die Schrift aufmerksam, nahm die Feder und unterstrich die darin vorkommenden Worte »alter, guter, treuer Dienste« und »meinem guten, alten, treuen Diener und Freund«. Hierauf gab er das Papier an Veit zurück mit der Bemerkung:
»Heute haben wir also den ersten Mai. Morgen, als am zweiten, werde ich um die Mittagszeit bei Euch vorsprechen und Ihr werdet mir dann das wörtlich nach diesem Entwurf ausgefertigte, von der Hand unseres gräflichen Freundes geschriebene – Ihr wißt, ich kenne seine Handschrift genau – unterzeichnete und besiegelte Dokument zustellen. Hierauf werde ich mich nach der Rentei verfügen, von dem dort niedergelegten zweiten Exemplar Einsicht nehmen, mir die erste Monatsrate meiner Leibrente ausfolgen lassen und dann im Steinbock meine erste Flasche als vergnüglicher Bummler leeren. Basta!«
»Und Ihr glaubt allen Ernstes, das werde so rasch und glattweg gehen und der gnädige Herr werde keinen Anstand nehmen, in diese – diese –«
Während in der Donnerfallmühle das soeben mitgeteilte Gespräch statt hatte, fuhr ein Extrapostwagen die Talstraße herauf.
Der Postillion hatte das lustige Stücklein, womit er die schönen Dörflerinnen ans Fenster lockte, noch nicht zu Ende geblasen, als sich der Kopf eines jungen Mannes aus dem Schlage bog und dem auf dem Bocke sitzenden Diener, einem Greis von straffer, soldatischer Haltung, zurief, den Wagen halten zu lassen.
Das Trara des Posthorns schnappte mitten in einem bedenklichen Triller ab, und das Gefährt hielt vor dem Eingang des Pfarrgartens, welcher sich vom Seeufer bis zur Straße heraufzog und in dessen Mitte das Pfarrhaus stand.
Der alte Diener war an den Schlag getreten.
»Geh fragen, Andres«, befahl ihm der Reisende, »ob der alte Herr zu Hause sei.«
»Sehr wohl, Herr Rittmeister«, versetzte Andres, die Hand an seine Mütze legend, und ging durch das offenstehende Gattertor in den pfarrherrlichen Garten.
Bald kam er zurück und meldete:
»Der Herr Pfarrer ist noch nicht von seinem Morgenspaziergang zurück, welchen er nach der Messe angetreten. Die alte Urschel wird ihn aber bei der Heimkehr sogleich von der Ankunft Euer Gnaden in Kenntnis setzen.«
»Vorwärts also und bedeute den Postillion, daß jetzt des Blasens genug sei. Ich will nicht wie ein Seiltänzer in den Park einfahren.«
Der Alte richtete seinen Auftrag aus, indem er wieder auf den Bock stieg, und der Wagen rollte weiter, entlang das Dorf und dann hinein in den Park. Die Bäume der zum Schloß führenden Avenue begannen erst Laub anzusetzen, und so genoß der heimkehrende Erbe der Grafschaft Wippoltstein eines Durchblicks auf See und Gebirg. Auf den Wagenschlag gestützt, schwelgte er in dem prächtigen Panorama.
»Es ist schön hier, sehr schön, beim Himmel!« sagte er vor sich hin. »Ein müdes und enttäuschtes Herz könnte hier Ruhe und Frieden finden. Aber mein eigenes ist noch nicht müde, und ich bin noch zu jung, um hier den müßigen Träumer oder den Landjunker zu spielen, welcher Ochsen mästet und mit den Pächtern rechnet. Solche Prosa möchte ich mir doch noch möglichst vom Leibe halten. – Ah, sieh dort drüben die Einsiedelei! Ob die Traumlore wohl noch lebt? Ich möchte wissen, ob die Frau mit ihren dunklen Reden auch jetzt noch einen so seltsamen, fast unheimlichen Eindruck auf mich machte wie vordem in meinen Knabenjahren. Ich erinnere mich deutlich der Szene, als sie sich die Einsiedelei von meinem Vater erbat. Er beeilte sich, ihrem Wunsche zu entsprechen, als sie denselben kaum geäußert hatte. Es war in ihrem Auge etwas düster Gebieterisches. Ich mußte mir wunderliche Gedanken machen, so oft ich später daran dachte. Doch fort damit! Da sind wir ja!«
Der Wagen hielt auf dem Hofe vor dem Portal des westlichen Schloßflügels. Andres öffnete den Schlag, und der heimkehrende Sohn des Hauses sah sich beim Aussteigen von einem halben Dutzend Livreemenschen empfangen, an deren Spitze ihm der schwarzgekleidete Hausmeister in wohlgesetzten Worten ein Willkommen darbrachte.
»Wo finde ich meinen Vater?« fragte der junge Edelmann.
»Seine Erlaucht, der gnädige Herr, befinden sich in seinem Kabinett.«
»Gut. Andres, laß meine Siebensachen ins Haus schaffen und vergiß den Postillion nicht.«