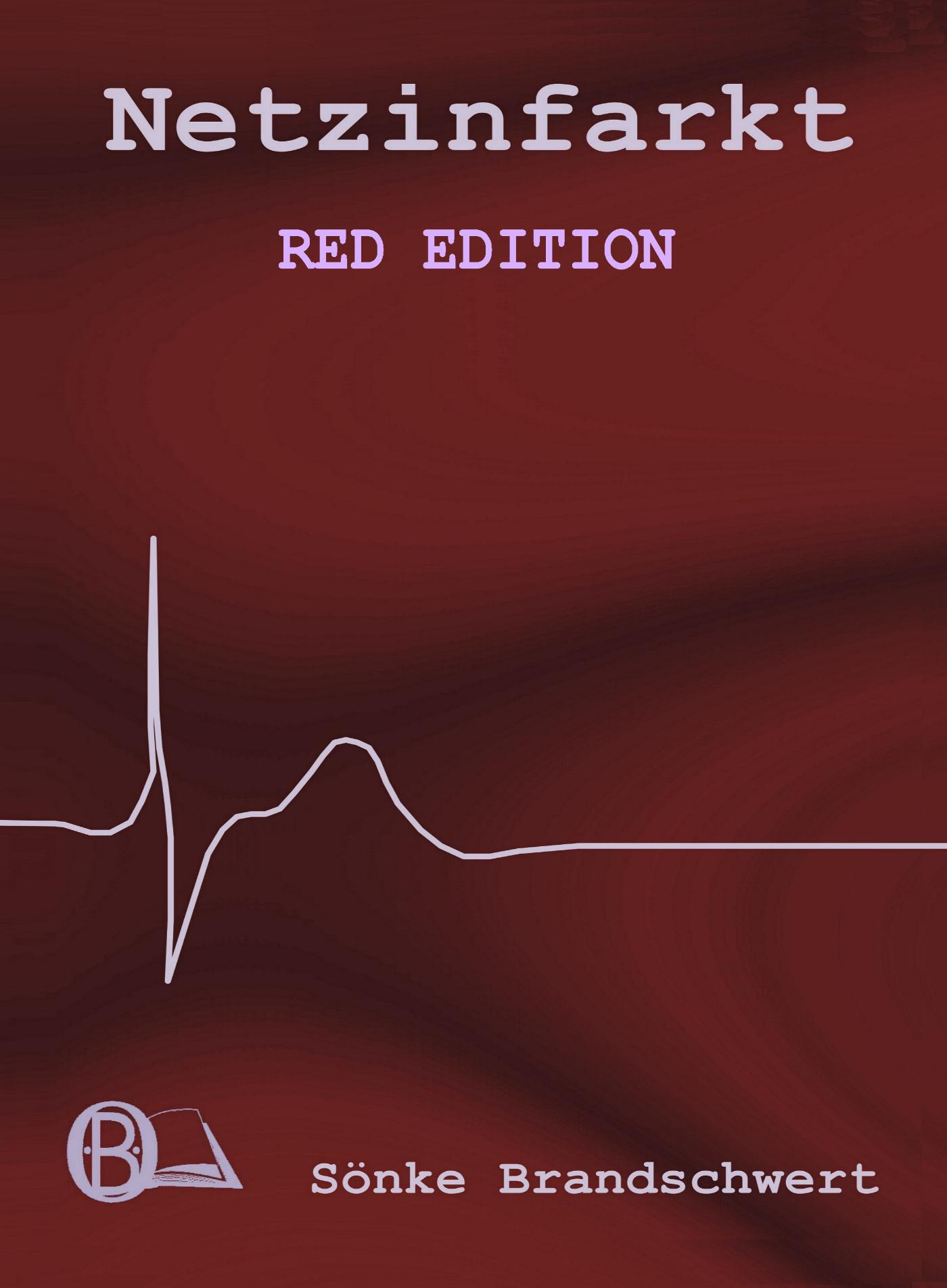
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Gina und Sven Krimi
- Sprache: Deutsch
Der junge Informatiker Sven führt ein ruhiges Leben, bis er versehentlich einer terroristischen Organisation in die Quere kommt. Mittels modernster Technologie soll die Weltwirtschaft ins absolute Chaos gestürzt werden. Zusammen mit seiner Kollegin Gina wird er in eine atem-beraubende Odyssee katapultiert. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt... Ein packender Krimi über den Terrorismus und seine Machenschaften, Terrornetzwerke und ihre weitläufigen Verstrickungen, über Fanatismus, die Macht der Täter und die Ohnmacht der Opfer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 588
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Netzinfarkt
NetzinfarktVorwort zur eBook-VersionIrgendwo in Afrika...6 Jahre später, 6. September, 8:45 Uhr6. September, 18:55 Uhr6. September, 23:00 Uhr7. September, 7:40 Uhr7. September, 8:15 Uhr8. September, 13:20 Uhr11. September, 7:30 Uhr12. September13. September14. September15. September18. September22. September23. September24. September25. September26. September27. September29. September30. September1. Oktober2. Oktober5. Oktober15. Oktober30. Oktober8. NovemberImpressumNetzinfarkt
ein Thriller von
Sönke Brandschwert
ISBN: 9783955777203
Erstveröffentlichung der Printversion:
2004 im Sigrid Böhme Verlag
Copyright © 2020 by Sigrid Böhme Verlag
Lektorat: Claudia Basdorf
Alle Rechte vorbehalten.
Kopieren, Nachdruck, schriftliche oder digitale Veröffentlichungen, auch auszugsweise, sind genehmigungspflichtig.
Als Ausnahme sind Veröffentlichungen im
Zuge von Rezensionen und Buchvorstellungen bis zu zehn Buchseiten ausdrücklich erlaubt, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form.
Vorwort zur eBook-Version
Dies ist eine ungekürzte Ausgabe und enthält auch Kapitel, die in der Blue Edition gekürzt waren.
Es sind nun über zehn Jahre vergangen, seitdem ich „Netzinfarkt“ geschrieben habe. Als ich es jetzt gelesen habe, fiel mir auf, dass das Thema heute sogar noch viel aktueller ist als damals! Die Technik entwickelt sich in so großen Sprüngen weiter, dass die Menschen heute noch viel abhängiger von ihr sind als zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Thrillers. Obwohl der eine oder andere beschriebene Sachverhalt inzwischen schon veraltet sein mag, würde ich die meisten Dinge heute genauso beschreiben wie damals.
„Netzinfarkt“ war mein Erstlingswerk. Schon ganz am Anfang meiner Autorenkarriere habe ich auf Spannung gesetzt. So werden auch die Leser und Leserinnen Freude an dem Roman haben, die in technischen Dingen nicht so bewandert sind. Damals habe ich bewusst keine realen Namen benutzt oder existierende Firmen genannt. So heißt das gebräuchlichste Betriebssystem im Roman eben nicht Windows, sondern Frames. Hersteller von Software und Hardware heißen nicht Microsoft, SAP oder Cisco, sondern beispielsweise CatSpeed oder Shortsoft. Die Leser/innen werden damit sicher genauso viel anfangen können. Für meine fachlichen Kollegen aus der IT-Branche sei gesagt, dass ich manche Dinge für die bessere Lesbarkeit sehr vereinfacht dargestellt habe. Man möge mir daher die eine oder andere Ungenauigkeit verzeihen.
Nun wünsche ich spannende Unterhaltung!
Irgendwo in Afrika...
Peter Sternberg konnte sich nicht daran erinnern, jemals so sehr geschwitzt zu haben. Die Luftfeuchtigkeit war ungewohnt hoch, was am nahe gelegenen Delta liegen musste. Sein grauer Anzug und das schicke, weiße Hemd taten ihr Übriges, um ihm den Schweiß aus allen Poren zu treiben. Hätte er gewusst, dass sein Gesprächspartner ihn in lockeren, khakifarbenen Hosen und T-Shirt empfangen würde, wäre er nicht so zugeknöpft erschienen. Aber es sollte ja ein Vorstellungsgespräch für eine gut dotierte Position sein, also hatte Peter sich in Schale geworfen.
Ein Schweißtropfen rann in sein rechtes Auge und es fing an zu brennen. Bei dem Versuch, es mit dem Handrücken trocken zu wischen, rieb er nur noch mehr Schweiß hinein. Innerlich fluchend versuchte er, sich seinen Unmut nicht anmerken zu lassen.
Er spürte, dass sein Hemd schon völlig durchnässt war. Der Anzugjacke ging es vermutlich ein wenig besser. Dennoch mussten die Schweißflecken auch dort deutlich zu sehen sein.
Unsicherheit überfiel ihn - und das nicht zum ersten Mal an diesem Tag. Zu Hause war alles anders. Dort kannte er sich aus; kannte die Gepflogenheiten und wusste stets, was von ihm erwartet wurde. Meistens hatte er seine Freunde im Rücken, die ihm zusätzlich Sicherheit gewährten. In seiner gewohnten Umgebung war es leicht, den selbstsicheren Mann zu geben. Doch hier kam er sich unbeholfen und fehl am Platz vor. Es schien ihm, als würden all seine positiven Eigenschaften, egal ob innere oder äußere, nicht zählen. In Deutschland punktete er meistens schon mit dem ersten Eindruck, noch bevor das erste Wort gesprochen war. Seine schwarzen Haare, die dunkelbraunen, fast schwarzen Augen und seine glatten Gesichtszüge verliehen ihm ein freundliches und weltmännisches Aussehen. Zusammen mit seiner Wortgewandtheit konnte er in jedem Gespräch überzeugen.
Dieser Termin aber verlief völlig anders als alle, die er bisher erlebt hatte. Im überdimensionalen Spiegel hinter seinem Gesprächspartner sah er, dass seine Haare klebten, das Gesicht klatschnass war und seine Augen nach der anstrengenden, zermürbenden Anfahrt müde aus ihren Augenhöhlen schauten. Fast empfand er es als Frechheit, dass er das Gespräch direkt nach seiner Ankunft führen musste, obwohl er zuvor weit über zehn Stunden auf einer welligen Sandpiste durchgeschüttelt worden war. Der Flug davor hatte ebenfalls zehn Stunden gedauert und war nicht sehr erholsam gewesen. Und jetzt saß er diesem Fremden gegenüber, der wie alles aussah, nur nicht wie ein Geschäftsmann. Dennoch war er rhetorisch so versiert, dass er Peter mit seinen Fragen in die Ecke drängen konnte und ihn bereits nach kurzer Zeit mehrfach zu Antworten verleitet hatte, die ihm umgehend peinlich waren. Je länger das Gespräch ging, umso unsicherer fühlte er sich. Selbst seinen Blick konnte er nicht kontinuierlich auf den Fremden gerichtet lassen.
Wieder schaute er in den großen Spiegel. Er sah genauso aus, wie er sich fühlte: wie ein müder, schwacher Junge, der eigentlich eine führende Hand bräuchte. Eine Hand, die ihn hier herausführte.
Was um alles in der Welt hatte er hier verloren? Er saß einem Mann gegenüber, der ihm von einem großartigen Unternehmen erzählte. Ein Mann, der ärmer schien als er selbst, sprach von Reichtum und grenzenloser Freiheit, von Selbständigkeit und Unabhängigkeit. Wieso sollte er sich auf ein derartiges, leeres Geschwätz einlassen?
Doch es gab eine weitere Überraschung: Genauso, wie am letzten Montag die Flugtickets plötzlich in seinem Briefkasten gelegen hatten, lag jetzt ein dicker Stapel Geldscheine vor ihm. Es waren 500-Euro-Scheine. Peter schätzte, dass es mindestens zwanzig waren, vermutlich wesentlich mehr.
„Das ist Ihr Geld, wenn Sie zusagen.“ Das Lächeln im Gesicht des Fremden wurde noch breiter und sanfter. Selbst bei seinen bohrenden und teilweise gemeinen Fragen hatte er gelächelt. Von seinem Äußeren her hätte er Inder sein können. Er war farbig, aber wesentlich heller als die Afrikaner. Der Kopf war kahl geschoren, das schlanke Gesicht wurde von einem Vollbart eingerahmt. Peter Sternberg hielt ihn für kaum älter als dreißig Jahre.
„Aus diesem Geld werden Sie viele Millionen machen, Peter. Und ich werde Ihnen sagen, wie!“ Das Englisch des Fremden hörte sich perfekt britisch an. Es passte nicht so recht in dieses Land.
Bei dem Anblick des Geldes fühlte Peter Sternberg neue Kraft in sich aufkommen. Das Geld war real. Wenn der Fremde kein reelles Ziel mit diesem Treffen verfolgte, wieso hätte er es dann überhaupt in die Wege geleitet? Wahrscheinlich entstammte er einer reichen Familie, die in Afrika viele Unternehmen besaß. Und nun wollte er womöglich in Europa Fuß fassen und brauchte dafür Mitarbeiter, die ihm dabei helfen sollten. Um das zu erreichen, war er offenbar gewillt, gut zu bezahlen.
Peter Sternberg wusste nicht recht, wie er reagieren sollte. Er wollte nicht einfach zusagen, obwohl seine Entscheidung für eine Mitarbeit eigentlich schon längst gefallen war. Doch er wollte es nicht so deutlich zeigen. Ihm fiel nichts Besseres ein, als zu fragen: „Wer garantiert Ihnen, dass ich nicht einfach das Geld nehme, nach Hause fliege und Sie nie wieder etwas von mir hören?“
„Sagen Sie erst Ja oder Nein. Dann erkläre ich Ihnen meine Sicherheiten. Sie werden überzeugt sein.“
Diese übertriebene Freundlichkeit vermittelte Peter Sternberg Unbehagen. Es schien alles so unecht und völlig überzogen. Aber was wusste Peter schon davon, wie solche Unterhaltungen hier geführt wurden. Er kannte weder die hiesige Mentalität noch die seines Gastgebers im Besonderen.
Dennoch kam ihm irgendetwas seltsam vor. Sein Examen hatte er zwar mit ‚Sehr gut’ abgeschlossen, aber er war sich im Klaren darüber, dass es noch weit Bessere gab. Er konnte kaum glauben, dass sein Wissen tatsächlich so viel wert war, dass jemand keine Mühen scheute, um ihn als Mitarbeiter zu bekommen.
Egal, was sollte es. Selbst wenn es sich einfach um einen reichen Verrückten handelte: Geld stank nicht. Und Erfahrungen im internationalen Business machten sich im Lebenslauf immer gut. Eine zu freundliche Zusammenarbeit war immer noch besser als eine unfreundliche.
„Ich bin selbstverständlich glücklich, für einen Mann wie Sie arbeiten zu können. Meine Antwort ist: Ja!“
Ein kurzes Funkeln in den Augen des Fremden zeigte eine winzige Gefühlsregung, die erste überhaupt. Ansonsten sprach der Mann scheinbar gleichgültig weiter. „Dann stecken Sie das Geld ein. Es sind 25.000 Euro. Wenn Sie wieder zu Hause sind, eröffnen Sie ein Aktiendepot. Sie überweisen 10.000 Euro von Ihrem Privatkonto auf dieses Depot. Heben Sie den Kontoauszug zu dieser Überweisung gut auf! Sobald das Geld auf dem Aktienkonto ist, ordern Sie für die gesamte Summe Aktien der amerikanischen Firma ‚CPfA’. Von dem Geld, das Sie von hier mitnehmen, leben Sie zunächst. Lassen Sie es sich für ein paar Monate gut gehen. Im Laufe der Zeit kommen dann weitere Anweisungen.“
Das alles war doch ein Traum, oder? Bei diesem Gedanken nahm Peter Sternberg das Geldbündel und steckte es in die Innentasche seines Jacketts. Er fühlte, dass auch schon die Vorderseite der Jacke schweißnass war.
„Darf ich jetzt noch einmal nach Ihrer Sicherheit fragen? Sie haben mich doch sehr neugierig gemacht. Was ist, wenn ich nun mit dem Geld durchbrenne?“ Er machte eine kurze Pause, bevor er fortfuhr: „Ich habe das natürlich nicht vor. Aber wie können Sie sich dessen so sicher sein?“
Der Fremde sah ihn einige Sekunden mit einem durchdringenden Blick an. Dann stand der Gastgeber auf. Während er zu einer kleinen Anrichte ging, sagte er: „Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Kommen Sie her!“ Dabei nahm er ein hübsch verziertes Holzkästchen von dem Möbelstück.
„Ich weiß, dass Sie in Ihrem Land ein guter Sportschütze sind. Damit haben wir ein gemeinsames Hobby.“
Er öffnete den Deckel der kleinen Kiste und hielt sie seinem Gast hin. Peter Sternberg war mittlerweile zu ihm herangetreten und sah neugierig hinein. Erstaunt erkannte er eine chromglänzende Waffe.
„Nehmen Sie sie!“, forderte der Fremde ihn auf. Interessiert griff Sternberg nach der Pistole, wog sie in der Hand, richtete sie spielerisch auf ein imaginäres Ziel an der Wand und nickte dann bewundernd. Obwohl er sich sehr gut auskannte, konnte er nicht sagen, um was für eine Marke es sich handelte.
Mit einem wissenden Lächeln erklärte der Gastgeber: „Es ist eine Spezialanfertigung. Sie ist perfekt ausgewogen und passt hervorragend in meine Hand. Ich nehme oft an Wettbewerben teil. Seit vier Jahren habe ich keinen mehr verloren. Und seit vier Jahren habe ich diese Waffe.“
Beinahe ehrfürchtig legte Sternberg die Waffe zurück, wusste aber nicht genau, was der Fremde ihm damit nun sagen wollte. Die Erklärung ließ nicht lange auf sich warten.
„Ich gewinne, weil ich die Gabe habe, mir immer das richtige Material auszusuchen. Das ist im Sport so, in meinem Privatleben ist das so und geschäftlich ist das ebenfalls so.“
Mit diesen Worten stellte der Mann das Kästchen auf den Tisch, ohne den Deckel zu verschließen. Dann setzte er sich wieder. Sternberg tat es ihm gleich. Ein unangenehmes Schweigen machte sich breit. Irgendwie hatte Peter Sternberg das Gefühl, dass sich etwas verändert hatte. Er konnte nicht sagen, was es war, aber plötzlich schien die Stimmung umgeschlagen zu sein. Es war fast körperlich zu spüren. Und jetzt konnte Sternberg es auch im Gesicht des Fremden sehen, denn mit einem Mal wurde es ernst.
Nachdem das breite Lächeln verschwunden war, schien das Gesicht noch schmaler zu sein. Der Blick hatte sich verändert. Nicht wirklich unfreundlich, aber durchdringend, irgendwie kalt. Einen Moment sahen sich die Männer direkt in die Augen, bis Sternberg dem Blick nicht mehr standhielt und zu Boden sah. Dann wandte sich der Fremde zur Tür und rief laut: „Nakomi, bring mir unseren ersten Gast her!“
Erneut erfasste der kalte Blick Peter Sternberg, der nun wieder aufsah. Ein unangenehmes Gefühl breitete sich in Sternbergs Magen aus. Der Fremde war merkwürdig. Doch im nächsten Moment kam das freundliche Lächeln zurück. Die Augen strahlten abermals Wärme aus und Sternbergs Magen beruhigte sich ein wenig. Die Hitze Botswanas und der Schlafmangel beeinflussten offenbar sein Wahrnehmungsvermögen. Das Gehirn spielte ihm einen Streich. In Wirklichkeit war alles in Ordnung. Der Fremde war ein gütiger Mann, der sein Geld in Europa investieren wollte.
„Sehen Sie, wir hatten gestern einen anderen Gast“, fuhr der Fremde fort. „Er kommt aus Frankreich und sollte dort eine ähnliche Stelle einnehmen wie Sie in Deutschland. Wir führten eine Unterhaltung, die der unseren in etwa gleichkam. Mit dem einen Unterschied: Er hat sich gegen eine Zusammenarbeit entschieden. Das ist sehr bedauerlich, ist er doch hierhergekommen, um mich und mein Haus zu sehen und mein Angebot zu erhalten. Es gleicht Ihrem Vorschlag, einfach mit dem Geld durchzubrennen. Sie müssen verstehen, dass Geld mir eigentlich gleichgültig ist. Ich habe ausreichend davon und setze es so ein, wie es mir am meisten hilft. Man bekommt fast alles, wenn man nur gut genug bezahlt.“ Immer noch das freundliche Lächeln. „Aber ein paar wenige Dinge sind etwas schwieriger zu bekommen. Dinge wie Verschwiegenheit und Loyalität. Doch auch diese Dinge sind für meine Ziele überaus wichtig.“ Das Wort ‚wichtig’ betonte der Fremde übertrieben stark. Dabei verschwand für einen kurzen Moment das Lächeln, kam aber sofort wieder. „Ich denke, Sie werden verstehen, was ich meine.“
Sternbergs Magen meldete sich wieder mit dem unangenehmen Gefühl. „Ja, natürlich verstehe ich das.“ Sternberg verstand in Wirklichkeit gar nichts. Aber es war ihm egal. Der Fremde hatte ihm 25.000 Euro Vorschuss gegeben und dafür sollte der Mann die Antworten bekommen, die er erwartete. Jetzt konnte es ja nicht mehr lange dauern, bis er auf dem Weg nach Hause war. Bis dahin würde er es schon noch aushalten, obwohl die Schwüle ihm fast die Luft zum Atmen nahm. Sein Mund war trotz der hohen Luftfeuchtigkeit entsetzlich trocken.
Plötzlich kam es Sternberg so vor, als würde der Fremde nicht aus Freundlichkeit lächeln, sondern aus Schadenfreude über die Pein seines Besuchers. Er hatte seinem Gast nicht einmal etwas zum Trinken angeboten. Auch die Klimaanlage, die in der Ecke hinter ihm hing, war ausgeschaltet.
Sternberg schloss kurz die Augen, um die Gedanken zu verscheuchen. Rede dir keinen Unsinn ein, dachte er, nimm dich zusammen! Er öffnete die Augen wieder und brachte tatsächlich ein Lächeln zustande, das den Fremden scheinbar zu einem noch breiteren Grinsen anspornte.
Dann tauchte Nakomi Djom in der Tür auf. Der farbige Bedienstete hatte Peter Sternberg vom Flughafen in Windhoek abgeholt und ihn den weiten Weg hierhergefahren. Er war nicht alleine, sondern schob einen schmalen, weißen Mann vor sich her, der offenbar in einer noch schlechteren Verfassung war als Sternberg. Die Kleidung der beiden Gäste ähnelte sich. Auch der andere Gast war im Anzug erschienen, wahrscheinlich unter ähnlichen Umständen wie er selbst, vermutete Sternberg. Die Hände hielt der Mann hinter dem Rücken. Seine Augen waren müde und leer. Die kurzen, schwarzen Haare waren gewellt und das Gesicht erinnerte Sternberg an den jungen Jean-Paul Belmondo. Peter Sternberg begrüßte ihn mit einem englischen „Hello“. Der Franzose antwortete nicht.
Mr. Djom hielt ein kleines, silberfarbenes Tablett in der Hand. Erst als er damit zu seinem Chef ging und es ihm reichte, sah Sternberg den darauf liegenden Handschuh aus dunkelbraunem Wildleder. Der Herr des Hauses nahm das kleine Kleidungsstück mit einem Lächeln und bedankte sich bei Mr. Djom. Mit langsamen Bewegungen zog sich der schmalgesichtige Mann den Handschuh an. Dann beugte er sich ebenso langsam vor und griff in die Kiste. Während der ganzen Zeit blieb das Lächeln wie eingefroren auf seinem Gesicht. Obwohl es eigentlich ganz offensichtlich war, verfolgte Sternberg mit Spannung, ob der Mann tatsächlich die Waffe aus dem Kästchen nehmen würde. Als die Hand des Gastgebers wieder erschien, war sie nicht leer.
Langsam drehte sich die Mündung des Laufes in die Richtung des Franzosen, der mit weit aufgerissenen Augen dastand. Das Entsetzen, das in seinem Gesicht stand, würde Sternberg sein Leben lang nicht vergessen.
Ein kurzes „Merde!“ war das Letzte, was der Franzose herausbrachte, bevor der ohrenbetäubende Schuss fiel. Augenblicklich hatte sich die Situation verändert. Von einer etwaigen Freundlichkeit war im Raum nichts mehr zu spüren. Sternbergs Herz setzte kurz aus, bevor es plötzlich mit heftigen Schlägen losraste. Jeden Schlag spürte er bis in den Kopf. Die Adern in seiner Schläfe, so erschien es Sternberg, wollten jeden Moment unter dem ungeheuren Druck platzen. Ich werde sterben, dachte er.
Noch immer schaute er in die weit aufgerissenen Augen des Franzosen, auf dessen Brust sich ein roter Fleck ausbreitete. Als ihn die Kugel getroffen hatte, war ein kurzes Zucken durch den Mann gegangen und die Augen hatten sich noch mehr geweitet.
Jetzt stand er einfach nur reglos da. Sternberg kam es unendlich lange vor. Als er schon nicht mehr damit rechnete, fiel der Körper einfach in sich zusammen, als wären die Beine plötzlich aus Papier.
Sternberg drehte sich bestürzt zu seinem Gastgeber. Auf dessen Gesicht war noch immer das leichte Lächeln, unverändert, wie die höhnische Fratze aus einem Gruselfilm.
„Sie sehen, Sternberg, es war eine sehr weise Entscheidung, mein Angebot anzunehmen. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und wer gegen mich ist und zu viel von mir weiß, muss sein Wissen für sich behalten. Ich sorge dafür, dass das gewährleistet ist. Und deshalb, Herr Sternberg“, und diese Worte unterstrich der Fremde mit langsamem Kopfnicken, „und deshalb kann ich sicher sein, dass Sie nicht mit dem Geld durchbrennen werden. Nakomi ist nicht mein einziger Bediensteter. Ich habe viele davon. Hier und überall in der Welt. Sie werden für mich arbeiten, Sternberg. Für mich arbeiten oder sterben. Aber Sie wollen nicht sterben, das wissen wir beide. Also arbeiten Sie für mich. Ich versichere Ihnen, dass es Ihnen dabei sehr gut gehen wird. Es wird Ihnen an nichts fehlen. Ein reicher Mann werden Sie sein und man wird Sie um Ihre Erfolge beneiden. Sie werden so viel Geld für Ihr Unternehmen zur Verfügung haben, wie Sie brauchen, um es ganz nach oben zu bringen. Das Einzige, was ich dafür erwarte, ist hin und wieder ein Gefallen. Es wird sich um kleine Gefälligkeiten handeln, die Sie vor keinerlei größere Probleme stellen werden.
Auch werden Sie nicht mit dem Gesetz in Konflikt kommen, es sei denn, Sie verlassen jetzt mein Haus und gehen zur hiesigen Polizei. In diesem Fall werden Sie als Mörder verurteilt. Nakomi und ich haben mit angesehen, wie Sie aus Habgier diesen Franzosen umgebracht haben. Ihre Fingerabdrücke sind auf der Waffe und Sie haben sehr viel Geld in bar bei sich. Auf einigen Scheinen sind die Fingerabdrücke des Franzosen zu finden. Natürlich ist das so, denn es war ja sein Geld. Sie haben es ihm weggenommen, nachdem Sie ihn erschossen haben. Uns haben Sie gesagt, wenn wir uns in den nächsten Stunden rühren, würden Sie auch uns erschießen. Wir hatten selbstverständlich Angst und sind deshalb noch nicht zur Polizei gegangen.“
Der Mann machte eine kurze Pause, wobei er sein Lächeln nicht verlor. „Natürlich können Sie auch erst in ein paar Tagen zur Polizei gehen. Bis dahin wird sich allerdings kein Anzeichen eines Toten mehr finden lassen. Man wird Ihnen letztendlich kein Wort glauben. Ein paar Tage später würden Sie selbst einen tragischen Unfall erleiden.“
Eine weitere Pause von mindestens einer Minute folgte. Für Sternberg zog sich diese Minute hin bis zur Unendlichkeit. Er war zu keinem vernünftigen Gedanken fähig. Nur überleben, bis ich hier raus bin, hämmerte es immer wieder in seinem Bewusstsein. Neben diesem Gedanken war sein panisch rasendes Herz das Einzige, was er wahrnahm.
Nach einer gefühlten Ewigkeit nickte der Mann wieder bedächtig, noch immer den Revolver in der Hand. „Nein, Sie werden nicht zur Polizei gehen. Sie haben sich richtig entschieden, Sternberg. Sie haben sich entschieden für Reichtum, Erfolg, Zufriedenheit und Glück.“ Dann sah er Peter Sternberg eindringlich an. „Kann ich auf Sie zählen, Peter?“
Obwohl er vermutete, keinen Ton hervorbringen zu können, war Peter Sternbergs Stimme klar und fest, als er antwortete: „Ja, Sie können auf mich zählen.“
„Gut. Dann gehen Sie jetzt. Nakomi wird Sie nach Namibia zum Flughafen fahren. Verfahren Sie, wie wir es besprochen haben. Dann warten Sie auf weitere Anweisungen. Sie können auf beliebige Art und Weise an Sie herangetragen werden. Alle diese Anweisungen werden eines gemeinsam haben, damit Sie sie als die meinigen erkennen: Sie alle werden den Namen Nakomi enthalten. Tun sie das nicht, so kommen sie nicht von mir.“
Ohne eine Antwort von Sternberg abzuwarten, drehte sich der Mann zu Nakomi Djom, nickte ihm zu und sagte: „Fahr Peter Sternberg bitte zurück zum Flughafen. Ich werde mich hier um alles kümmern.“
Nakomi sah zu Sternberg. „Kommen Sie. Wir müssen uns beeilen!“ Damit drehte er sich um und ging voraus. Sternberg stand auf, bemerkte eine entsetzliche Schwäche in den Beinen und wankte Mr. Djom hinterher.
6 Jahre später, 6. September, 8:45 Uhr
Sven Steinhammer kam ungewöhnlich früh zur Arbeit. Am Vorabend hatte er noch sehr viel zu tun gehabt, sodass er nicht mehr dazu gekommen war, ein Testnetzwerk für Thomas aufzubauen. Das wollte er an diesem Morgen erledigen. Am liebsten wäre er im Bett geblieben, denn Janette hatte heute frei. Aber er hatte Thomas versprochen, dass er sich um alles kümmern würde, also tat er es auch. Janette traf sich um zehn Uhr mit einer Freundin, mit der sie dann durch die Stadt bummeln würde. Dabei wäre er sowieso überflüssig gewesen.
Jetzt war es fast neun Uhr und das kleine Testnetzwerk lief. Da Sven nicht wusste, worum es sich bei Thomas’ Tests genau handelte, baute er ein Netz auf, wie er es aus der Wirklichkeit kannte. Er simulierte zwei Bürohäuser, die mit einer gemieteten Leitung verbunden waren. Auf beiden Seiten stand ein sogenannter Router, der den Kontakt mit der Gegenstelle im anderen Gebäude herstellen konnte. In Wirklichkeit standen die Geräte in seinem Büro direkt nebeneinander, aber das wussten sie ja nicht. Für sie gab es keinen Unterschied, ob sie nun mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt waren oder nur wenige Zentimeter. Hauptsache die Leitung dazwischen übertrug ihre Signale.
An beide Geräte, also in jedem der fiktiven Bürohäuser, hatte er als Netzwerkverteiler jeweils zwei Switche angeschlossen. An diese konnte man bis zu zwanzig Computer anschließen. Die meisten Netzwerke bestanden aus solchen oder ähnlichen Geräten. Svens Firma benutzte ausschließlich Geräte der Firma CatSpeed. Sie waren teuer, aber derzeit das Beste, was der Markt zu bieten hatte. CatSpeed war beinahe ebenso Standard im Netzwerkbereich, wie es Frames im Bereich der Betriebssysteme war. Ein großer Teil des Internets war mit CatSpeed-Geräten aufgebaut.
Die Tür öffnete sich, als Sven gerade dabei war, die Funktionen in seinem kleinen Netz zu testen. Gina Bodoni, die einzige weibliche Person in seiner Abteilung, betrat das Büro. Sven hatte sich zunächst schwer damit getan, sie einzustellen. Er hatte befürchtet, dass sie die Männer in der Abteilung durcheinanderbringen könnte. Sie war eine ziemlich hübsche Frau mit einem schlanken, wohlproportionierten Körper. Ihre schulterlangen, schwarzen Haare umrahmten ein freundliches Gesicht, aus dem zwei fröhliche, grüne Augen blickten. Mit ihren 1,73 Metern war sie fast so groß wie Sven.
Während des Vorstellungsgespräches hatte Gina ihn von ihrem umfangreichen Wissen und ihrer Kompetenz im Netzwerkbereich überzeugen können und er hatte sich eine so gute Arbeitskraft nicht entgehen lassen wollen. Bisher musste er seine Entscheidung nicht bereuen. Nach zwölf Monaten Zugehörigkeit bei DeHSIP, dem „Deutschen High Speed Internet Provider“, war sie seine beste Kraft. Manchmal empfand Sven sie als ein klein wenig zickig, dies tat ihren beruflichen Leistungen aber keinen Abbruch.
„Morgen! Ich hab gehört, du baust ein kleines Spielzeug für Thomas auf?“
Sven blickte auf, als sie hereinkam. Gina sah müde aus und er wunderte sich, dass sie so früh da war. Am Vortag hatte sie gesagt, dass sie später kommen würde.
„Hey, wolltest du nicht ausschlafen?“
Sie schloss die Tür hinter sich, wobei sie unverhohlen gähnte, ohne sich die Hand vor den Mund zu halten. „Ja, das wollte ich. Aber kann ich meinen Chef bei so einer wichtigen Arbeit alleine lassen?“ Sie lachte kurz. „Nein, nein. Ich bin einfach neugierig. Ich hab gestern noch Thomas angerufen, weil er mir was mitbringen sollte. Er hat mir von den seltsamen Phänomenen bei der NSI AG erzählt.“
Sven zog die Augenbrauen hoch. „Aha? Ich weiß davon bisher gar nichts. Thomas hat nur aufgezählt, was er brauchen würde.“
„Ich weiß. Er hatte keine Zeit. Seine Kids waren doch gestern nicht da und das wollte er ausnutzen und mit Tanja essen gehen. Ich habe ihn auf dem Handy im Auto erwischt, als er gerade auf dem Heimweg war.“
Sie setzte sich neben ihn und schaute auf den Bildschirm. Er konnte ihr dezentes Parfüm wahrnehmen. Vielleicht war es auch der Geruch ihres Duschgels. In jedem Fall roch es sehr frisch.
„Thomas hat sich gestern das neue Datensicherungsprogramm von der NSI vorführen lassen“, erklärte sie. „Zunächst schien alles gut zu laufen. Sie haben im Labor eine Menge Daten gesichert und wieder zurückgespielt. Lief alles gut. Dann hat Thomas verlangt, dass man alle Geräte des Testlabors auf ein Datum setzt, das vier Monate in der Zukunft liegt. Nur damit alles realistisch ist. Wer braucht schon Daten von einer Sicherung am gleichen Tag? Du kennst ja Thomas, immer perfektionistisch bis ins Detail.“
„Ja, und?“
„Nach der Umstellung lief anscheinend gar nichts mehr. Nicht nur das Sicherungsprogramm hatte Probleme, sondern auch die Server.“
„Dann würde ich sagen, dass die NSI AG ein paar Mitarbeiter hat, die ihren Job nicht verstehen“, meinte Sven.
„Vermutlich. Aber Thomas will das hier wohl nachstellen, um sicherzugehen, dass es kein Problem ist, das uns auch irgendwann treffen könnte.“
Das kam Sven übertrieben vor, aber er sagte nichts. Schon zu lange arbeitete er mit Thomas zusammen und schätzte ihn und sein Knowhow sehr. Für seinen Kollegen würde er einiges tun, auch wenn er es als unsinnig betrachtete. Umgekehrt wäre es, so vermutete er zumindest, genauso.
„Also? Was kann ich tun?“, fragte Gina.
„Kaffee kochen“, war seine prompte Antwort.
„Vergiss es! Ich werde hier nicht fürs Kaffeekochen bezahlt.“ Ihr patziger Tonfall verriet, dass sie seine Aufforderung nicht als Scherz aufgefasst hatte. „Aber du könntest mir einen besorgen. Vielleicht schaffe ich es dann, wach zu bleiben.“
Sven sah sie etwas genervt an und verzog den Mundwinkel. Er mochte es nicht, wenn jemand so ernst auf einen Scherz reagierte. Aber vielleicht verstand man seine Scherze einfach nicht immer. Er atmete einmal tief durch und stand auf. „Ich muss sowieso rüber zu den Desktop-Jungs. Die sind schon eine Weile da, also gibt es da wahrscheinlich auch Kaffee. Ich bring dir einen mit. Vielleicht kannst du solange nach dem einen Switch schauen. Irgendwie bringt der lauter Fehlermeldungen, obwohl er noch gar nichts zu tun hat.“
Beim Verlassen des Raumes hörte er noch ihr müdes „Okay“.
Sven wandte sich nach links und ging den Flur hinunter in Richtung Küche. Die weißen Wände wurden hier und da durch blassblaue Türen unterbrochen. Die meisten davon standen offen, nur wenige waren geschlossen. Kurz vor der Zwischentür zu den Aufzügen befand sich die Küche. Sowohl das Geräusch von durchlaufendem Wasser als auch der wahrnehmbare Geruch signalisierten ihm, dass jemand frischen Kaffee kochte. Das war gut. So brauchte er keinen bei den Desktop-Leuten zu klauen. Er öffnete gerade die gläserne Zwischentür, als die leise Glocke von den Fahrstühlen ertönte. Sven sah, wie die in der Mitte geteilte Edelstahltür sich öffnete und ein lächelnder Thomas erschien.
„Morgen, Sven. Na, alles bereit?“
„Noch nicht ganz. Aber wir sind dran. Ich bin gerade auf dem Weg, um ein paar Rechner zu besorgen.“
Thomas zog ein pessimistisches Gesicht. „Na, dann viel Glück.“
Sie verabredeten sich zu einer Lagebesprechung in Svens Büro in fünf Minuten.
Sven hielt Thomas die Glastür zu den Büroräumen auf. „Bringst du Gina bitte einen Kaffee mit? Sie sitzt bei mir.“
Ohne eine Antwort abzuwarten, wandte er sich um und setzte seinen Weg fort. Zwei Türen weiter war das Büro von Stefan Kuhlbert. Er war der Abteilungsleiter im Bereich „IT Desktop“. Hier war die Zentrale für alles, was mit den Computern der Mitarbeiter zusammenhing. Die Desktop-Jungs installierten sie, spielten benötigte Software auf, führten Programmerneuerungen durch und nahmen letztendlich auch die vielen Anfragen und Fehlermeldungen entgegen, die von den Benutzern kamen.
Stefan verwaltete die Frames-Server, legte neue Benutzer an und war mehr oder weniger dafür verantwortlich, dass es eine gewisse Datensicherheit gab.
Sven hatte eine zwiespältige Meinung von ihm. Auf der einen Seite hielt er Stefan für egoistisch und intrigant. Auf der anderen Seite schätzte er ihn als Fachkraft. Sven kannte niemanden, der auf dem Gebiet von Frames besser war als Stefan. Auch scheute Stefan keine Arbeit. Wenn etwas getan werden musste, dann tat er es, und was er tat, tat er richtig. Das Unternehmen konnte auf ihn zählen.
„Hi Stefan“, begrüßte er ihn. „Wie läuft‘s denn so?“
Stefan saß, wie fast immer, an seinem Rechner, arbeitete fleißig und hatte eine Zigarette im Mund. Er war der Einzige, der sich nicht an das Rauchverbot in den Büros hielt. Durch die Brille mit dem dünnen Goldrahmen sah er Sven an. Der bemerkte die kurzen Bartstoppeln in dem rundlichen Gesicht.
Der Mann, dessen fülliger Körper in einer braunen Cordhose und einem rot-weiß karierten Holzfällerhemd steckte, nahm einen tiefen Zug aus seiner Zigarette. „Ach ja, es geht so. Was willst du denn? Wenn du hier auftauchst, dann doch nicht ohne Grund.“
Stefans direkte Art gehörte zu den Eigenschaften, die Sven schätzte. Ebenso direkt antwortete er: „Fünf Rechner. Heute. Jetzt.“
Die beiden Männer sahen sich ein paar Sekunden lang direkt in die Augen. Sven überlegte, ob er zu lachen anfangen sollte. In Stefans Augen erkannte er, dass es diesem ebenso erging. Beide hielten ihr Lachen zurück.
„Zwei Stunden. Wo?“
„Mein Büro.“
Noch immer sahen die beiden sich in die Augen. Dann drehte Sven sich zur Tür, während er noch ein „Danke“ von sich gab.
Als er in sein Zimmer kam, saß Gina noch immer in seinem Stuhl, jetzt aber mit einer Tasse Kaffee in der Hand. Schräg vor ihr saß Thomas auf dem Tisch. Sowohl die verfügbaren Wandflächen als auch die Fensterfront waren mit Tischen verbaut, sodass sich ein großes U aus Arbeitsflächen ergab.
„In zwei Stunden haben wir die Computer“, sagte Sven zu Thomas. Und dann, zu Gina gewandt: „Und, geht’s dir jetzt besser?“
Gina nahm schlürfend einen Schluck von ihrem schwarzen Kaffee, bevor sie antwortete. „Geht so. Aber wir haben ein Problem mit dem Switch. Ich glaube, es ist ein Hardwaredefekt. Vielleicht haben wir Glück und es ist nur ein Fehler in der Software, was ich aber nicht annehme. In jedem Fall lade ich mir gerade die neueste Version des Programms herunter und versuche es damit noch einmal. Versprich dir aber nicht zu viel davon.“
Das hatte Sven noch gefehlt. Hier hatte er seine derzeit letzten Reservegeräte aufgebaut. Wenn eines davon den Geist aufgab, dann hatten sie ein Problem.
„Na, wollen wir hoffen, dass es nur die Software ist“, meinte Sven und wandte sich wieder an Thomas. „Apropos Software – ich rotiere hier schon den ganzen Morgen, um ein Testnetzwerk aufzubauen, habe aber noch nicht verstanden, was du überhaupt vorhast. Gina hat mir nur erzählt, dass es bei der NSI AG ein Problem mit den Systemen gab.“
„Ein sehr massives Problem sogar“, betonte Thomas. „Es begann nach der Umstellung des Datums auf einen Tag im Dezember. Wir wissen alle nicht, was wir davon halten sollen, aber ich finde, es könnte nicht schaden, intensivere Untersuchungen anzustellen. Ist Gregor eigentlich schon da? Er war gestern mit mir bei der NSI.“
Sven überlegte. „Gregor? Nein, aber der kommt doch immer ein bisschen später. Praktikanten sind auch nicht mehr das, was sie mal waren ...“
„Er hat sich gestern bei dem Termin recht wacker geschlagen! Sein Outfit war allerdings für einen Besuch bei einem Geschäftspartner sehr abenteuerlich. Aber er hat ziemlich viel auf dem Kasten. Wir sollten ihn beim Testen einbeziehen.“
„Können wir machen“, stimmte Sven zu. „Was ist mit Kaffee?“
Thomas griff mit der linken Hand hinter sich, während er grinsend sagte: „Ich habe da etwas Besseres. Schau mal.“
Seine Hand kam mit einer Dose Kakao hervor. Dann drehte er sich zur anderen Seite, streckte diesmal die rechte Hand nach hinten und eine Milchpackung kam zum Vorschein. „Magst du einen heißen Kakao?“
Sven hielt das für eine gute Idee, aber bevor er antworten konnte, meldete sich Gina zu Wort. „Warum hast du mich nicht gefragt, bevor du mir den Kaffee gebracht hast? Ich hätte vielleicht auch lieber einen Kakao getrunken. Aber so weit denkt ihr ja nicht.“
Die beiden Kollegen sahen einander an, schüttelten den Kopf und verzogen sich in die Küche. Sie würden sich bei Ginas Kakao besonders viel Mühe geben, um sie wieder milde zu stimmen.
In Ermangelung einer anderen Möglichkeit benutzten die beiden Männer kurzerhand den Wasserkocher, um die Milch zu erhitzen. Das Ergebnis war eine von angesetzter Milch bräunlich verfärbte Heizspirale, die sie irgendwie wieder sauber kriegen mussten.
Während Sven mit einem Löffel an der Oberfläche der Spirale kratzte, suchte Thomas nach weiteren Hilfsmitteln. In einem Schrank fand er Spiritus, den er sogleich als geeignetes Reinigungsmittel einstufte. Er ging zur Spüle und nahm Sven den Wasserkocher ab.
„Gib mal her. Das haben wir gleich.“ Schon schüttete er reichlich Spiritus in den Kocher.
Sven staunte nicht schlecht. „Den Geschmack bekommst du nie wieder raus, Thomas.“
Aber Thomas ließ sich nicht stören. Jetzt nahm er den Löffel und schabte fleißig in der Spirituslake. „Den Belag bekommst du sonst auch nicht ab. Aber jetzt geht’s. Schau mal. Sieht schon fast wie neu aus!“
Thomas spülte das Gefäß noch einmal aus und reichte es stolz Sven zur Ansicht. Der sah hinein und konnte keinen Belag mehr entdecken. Dann roch er kurz daran. Die Folge war ein Hustenanfall. Es roch nicht nur, nein, es stank nach Spiritus. Thomas bekam einen Lachanfall. Auch Sven konnte nicht mehr ernst bleiben.
Als er Gina vor der Küchentür stehen sah, bemühte er sich um Fassung, was ihm jedoch nicht gelang. Seine Kollegin schüttelte ungläubig den Kopf. „Wer hat euch eigentlich eingestellt?“ Daraufhin verschwand sie in der Damentoilette gegenüber.
„Wir kochen ihn noch mal aus.“
Nachdem das Wasser kochte, schüttete Sven es in das Spülbecken, wobei es wahnsinnig dampfte. Wieder mussten beide lachen.
„Das darf kein Mensch sehen, was wir hier machen“, meinte Thomas, während er zum Fenster ging und es öffnete. Sven machte die Riechprobe. Es war kein Spiritusgeruch mehr festzustellen. „Der ist wieder okay. Lass uns den Kakao trinken gehen.“
Schnell holten sie aus einem der Hängeschränke ein kleines Tablett, stellten die drei Tassen mit Milch darauf, legten vier Löffel dazu und verließen die Küche. Zurück blieb eine hohe Luftfeuchtigkeit.
Wieder im Büro angekommen, schloss Sven die Tür hinter sich. Gina saß inzwischen wieder auf ihrem Platz und bediente geschäftig die Tastatur. Sven erkannte ein kurzes Lächeln, als sie die beiden Kollegen ansah. Dann wurde sie wieder ernst und angespannt. „Meine Milch bitte ohne Haut!“
Ein Blick auf die Milch und Sven wusste, was sie meinte. Auf der Oberfläche jeder Milchtasse hatte sich eine dicke Schicht Haut gebildet, die er entfernte, bevor er den Kakao hinzugab.
Eine Tasse stellte er vor Gina auf den Tisch. „Und, wie sieht’s aus?“, fragte er.
Gina schüttelte mit dem Kopf. „Schlecht. Die Kiste ist kaputt. Mit der kannst du nichts mehr anfangen.“ Sie nahm einen Schluck Kakao. „Warum habt ihr euch eigentlich so viel Mühe für eine Tasse kalten Kakao gemacht?“
Sven dachte einen Moment nach. Der Kakao war inzwischen nur noch warm, weil sie mit ihrer Reinigungsaktion so viel Zeit vertrödelt hatten. Aber jetzt mussten sie sich wieder mit ihrer Arbeit beschäftigen. „Wir haben doch noch einen Switch im Safe, oder?“
Er dachte an den Schranksafe, in dem alle teureren Teile gelagert wurden.
Wieder schüttelte Gina den Kopf. „Nein. Den hab ich letzte Woche in München eingebaut. Dort hatte es einen Defekt gegeben. Die haben zwar einen Backup-Switch, aber wenn der auch noch ausgefallen wäre, hätten vierzig Mitarbeiter nicht mehr arbeiten können.“
Mit einem leichten Nicken bestätigte Sven, dass er sich an die Aktion erinnern konnte. CatSpeed, der Hersteller der Geräte, kam kaum noch mit der Produktion von Hardware hinterher und hatte Lieferschwierigkeiten. „Ich hab noch einen zu Hause. Den könnte ich holen“, schlug er vor.
Die prompte Antwort kam von Thomas. „Na, was machst du dann noch hier? Während du ihn holst, kann ich Gina schon mal erklären, wie das Phänomen im Detail aussieht und was ich alles vorhabe.“
„Ja, ja, schon gut“, antwortete Sven gespielt beleidigt. „Ich verschwinde schon, wenn ihr mich loswerden wollt.“
„Endlich merkst du es“, gab Gina zurück.
Sven erwiderte ihr breites Grinsen, froh darüber, dass ihre Laune sich offenbar besserte. Dann nahm er seine Jeansjacke von der Lehne des Stuhls und verschwand aus dem Raum. „Ich bin in einer Stunde wieder da!“, rief er zurück.
Die Fahrt dauerte länger als erwartet. Schwer schleppte sich der Verkehr durch Frankfurts Innenstadt. So zügig wie möglich bahnte Sven sich mit teilweise rasanten Spurwechseln seinen Weg.
Am Morgen war es noch wolkenfrei und klar gewesen. Jetzt konnte Sven sehen, dass vom Taunus her dunkle Wolken aufzogen, die Frankfurt bereits erreicht hatten. Von der wärmenden Sonne war nichts mehr zu sehen. Die Wolken hingen so tief, dass es Sven vorkam, als würden sie gleich die Spitzen der Hochhäuser berühren, die an der Mainzer Landstraße einen Großteil der Frankfurter Skyline schufen.
Als Sven nach rechts in den Grüneburgweg einbog, fielen die ersten dicken Regentropfen. Schnell nahm der Regen zu und wurde so stark, dass Sven die schnellste Stufe des Scheibenwischers einstellen musste. Zum Glück war es nicht mehr weit. In der Fichardstraße suchte er sich einen Parkplatz. Im Gegensatz zu abends war das um diese Uhrzeit kein Problem.
Als er angehalten hatte, sah Sven zu, wie der Regen auf das dunkle Blau der Motorhaube prasselte. Warten, bis es weniger regnen würde? Oder einfach Augen zu und durch? Immerhin wollte er in einer Stunde wieder im Büro sein. Oben konnte er sich kurz abtrocknen, notfalls auch etwas Frisches anziehen. Für den Rückweg würde er sich einen Schirm mitnehmen.
Mit schnellen Bewegungen schälte Sven sich aus dem Auto und rannte los. Obwohl er sich beeilt hatte, kam er nach ein paar Schritten völlig durchnässt bei seinem Hauseingang an. Als er die Stufen hinauf zum dritten Stock nahm, quietschten die nassen Gummisohlen seiner Schuhe.
Aus der Nachbarwohnung hörte er laute Musik. Vielleicht kam es auch von einem Stockwerk höher. Als die Musik beim Öffnen der Tür jedoch plötzlich lauter wurde, erkannte Sven, dass sie in Wirklichkeit aus seiner eigenen Wohnung kam. Das erstaunte ihn. Zum einen dachte er, dass Janette gar nicht zu Hause sein würde. Zum anderen machte sie üblicherweise die Musik nicht so laut.
Während er eintrat und die Tür hinter sich schloss, versuchte er, das Lied zu erkennen. Es gelang ihm nicht. Es war ein sehr ruhiges, fast melancholisches Lied. Sven vermutete, dass es auf einer der Kuschelrock-CDs war.
Um den Boden zu schonen, zog er die Schuhe aus. Mit einem Blick durch die erste Tür auf der rechten Seite des Flurs erkannte er, dass Janette nicht im Wohnzimmer war. Auch die Musik kam nicht von hier. Ein wenig verwundert zog Sven die Stirn in Falten. Langsam ging er den Flur entlang, am Bad vorbei und erreichte dann auf der rechten Seite die Schlafzimmertür. Eindeutig kam die Musik von dort.
Sven fragte sich, ob Janette vielleicht einen Streit mit Katrin gehabt hatte. Katrin war schon sehr lange ihre beste Freundin und ein Streit mit ihr würde sie sicher ziemlich herunterziehen.
Irgendwie war es merkwürdig: die verschlossene Schlafzimmertür, die laute, etwas traurige Musik. Vielleicht lag Janette auf dem Bett und weinte? Oder war sie einfach nur eingeschlafen? Einen Moment lang überlegte Sven, wie er die Tür öffnen sollte, ohne sie zu erschrecken. Sie würde ihn um diese Zeit nicht erwarten. Er beschloss, leise zu sein, falls sie schlief.
Langsam drückte er die Klinke herunter und öffnete sachte die Tür. Während er dabei nicht das leiseste Geräusch verursachte, wurde die Musik noch lauter. Zunächst sah er nur den sich bewegenden Schatten, der ihm verriet, dass Janette nicht schlief. Eine halbe Sekunde später fühlte Sven, wie sein Herz für einen Schlag aussetzte. Er hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit dem, was er sah. Und wenn er damit gerechnet hätte, dann nicht in dieser Form. Er schluckte schwer. Sein Hals fühlte sich plötzlich an wie zugeschnürt.
Ganz offensichtlich hatte es keinen Streit mit Katrin gegeben. Janette hatte auch sonst keinen Grund dazu, traurig zu sein. Zwar lag sie auf dem Bett, aber sie war nicht die erste Person, die Sven wahrnahm. Sein Blick blieb zunächst an Katrin hängen. Obwohl er sie nur von hinten sah, erkannte er sofort die lockige, blonde Mähne. Katrin kniete auf dem Bett und bewegte ihr Becken im Takt der Musik. Sie war vollkommen nackt.
Auch Janette erblickte er. Sie lag mit dem Rücken auf dem Bett. Ebenso wie Katrin war sie unbekleidet. Ihr Gesicht befand sich direkt unter dem sich wiegenden Körper ihrer Freundin. Ihre Hände hielten Katrins Oberschenkel fest.
Svens Kopf war leer. Kein Gedanke war mehr da. Er hätte nicht sagen können, wie lange er regungslos dastand, bevor sich Katrin zu ihm umdrehte. Ihre Augen weiteten sich, als sie Sven sah. Im gleichen Moment öffnete sich sein Mund, als ob er etwas sagen wollte, aber er brachte kein Wort heraus. Sekunden verstrichen. Die beiden sahen sich direkt in die Augen.
Sven war wie versteinert. Noch bevor Janette verstand, was passiert war, fand Sven seine Sprache wieder. Er schluckte noch einmal schwer, bevor er „Entschuldigung“ stammelte, sich umdrehte und die Tür hinter sich schloss.
Dann ging er wie in Trance ins Wohnzimmer, öffnete die unterste Schublade des großen Schranks und entnahm das Gerät, welches etwa die Größe eines Satellitenreceivers hatte. Im Flur zog er seine Schuhe an und verließ die Wohnung.
Auch beim Herabsteigen der Treppe war sein Kopf noch leer. Die Bewegungen erfolgten automatisch. Im Moment hatte er nur ein einziges Ziel. Er wollte dieses Gerät zur Arbeit bringen, denn Thomas benötigte es dringend. Bevor er hinaus auf die Straße trat, versteckte er es unter seiner Jacke, damit es nicht nass wurde.
Es regnete jetzt noch stärker. Dieses Mal beeilte er sich nicht, die Strecke zwischen Haus und Auto rasch zurückzulegen. Es war ihm egal, ob er nass wurde. Nachlässig warf er den Switch auf den Rücksitz, nahm hinter dem Lenkrad Platz und steckte den Zündschlüssel ins Schloss. Doch er startete den Wagen nicht, sondern legte nur die Hände auf das Steuer.
Lange Zeit beobachtete er die Regentropfen dabei, wie sie auf die Motorhaube schlugen. Ihm ging durch den Kopf, dass sein Wagen ein hübsches, dunkles Blau hatte. Mit dem Regenwasser darauf sah der Lack aus, als sei er frisch gewachst worden.
Plötzlich rollten ihm Tränen über die Wangen. Schnell holte er aus dem Handschuhfach ein Päckchen Taschentücher, öffnete es umständlich und putzte sich die Nase. Mit einem zweiten Taschentuch wischte er sich die Tränen aus dem Gesicht. Dann warf er sowohl die benutzten Taschentücher als auch das angebrochene Päckchen auf den Beifahrersitz. Entschlossen startete er den Wagen und ließ den Motor aggressiv aufheulen.
Beim Fahren merkte er kaum, wohin er fuhr. Unbewusst nahm er die richtigen Wege. Seine Augen verfolgten zwar den Verkehr, aber sein Gehirn verarbeitete nur einen Teil davon.
Seine Gedanken beschäftigten sich mit ganz anderen Dingen. Janette betrog ihn mit ihrer besten Freundin. Gut. Aber was änderte das für ihn? War Katrin nun eine Konkurrenz für ihn? Wohl kaum. Die beiden Frauen hatten sich bereits viele Jahre gekannt, bevor Sven mit Janette zusammenkam. Wenn es ihnen um eine feste Beziehung gegangen wäre, dann hätte Janette sich gar nicht erst mit ihm eingelassen.
Nein, Janette wollte mit ihm zusammen sein und zusammenbleiben, davon war Sven überzeugt. Es ging ihr bei Katrin vermutlich rein um die sexuelle Seite. Okay. Einen weiblichen Körper konnte er ihr nicht bieten. So gesehen gab es für Janette keine andere Möglichkeit, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, als sich eine andere Person dafür zu suchen. Das musste gar nichts mit ihm zu tun haben. Er hatte immer den Eindruck gehabt, dass sie mit ihm glücklich war. Nur gab es da einfach etwas, das sie niemals von ihm bekommen konnte. Und das holte sie sich von Katrin.
Sven dachte darüber nach und fragte sich, was eigentlich so schlimm daran war. Zunächst hat sie mich hintergangen, stellte er fest. Sie hätte mit mir darüber reden sollen. Wenn ich es von Anfang an gewusst hätte, dann wäre es kein so großes Problem gewesen. Vor allem keine Überraschung. Etwas durch Zufall zu entdecken, heißt immer, sich hintergangen zu fühlen.
Man sagt, dass sich ein Partner verändert, wenn er fremdgeht. Aber Sven hatte keine besonderen Veränderungen bei Janette festgestellt, seitdem sie zusammen waren. Daher schlussfolgerte er, dass es das Verhältnis mit Katrin schon vor der gemeinsamen Zeit gegeben haben musste.
Plötzlich bremste er scharf. Fast hätte er das kleine Kind am Zebrastreifen nicht gesehen. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals und das Adrenalin schoss ihm ins Blut.
Er versuchte, die unschönen Gedanken zu verdrängen. Was war schon geschehen? Seine Freundin liebte ihn und wollte bestimmt bei ihm bleiben. Sie hatte lediglich eine ganz besondere sexuelle Neigung, die sie in einer erotischen Beziehung zu ihrer besten Freundin befriedigte. Alles war in Ordnung.
Nach einem tiefen Durchatmen schaffte Sven es endlich, sich wieder zu sammeln. Seine Aufmerksamkeit wandte sich dem Straßenverkehr zu und jetzt fuhr er auch wieder schneller. Er fühlte sich ein wenig besser. Obwohl da noch etwas nagte, ganz tief in seinem Unterbewusstsein. Ihm war klar, dass sich etwas verändert hatte. Was genau, darüber war er sich noch nicht im Klaren.
Ihm fiel plötzlich ein, wie oft Janette alleine unterwegs oder aber mit Katrin zusammen war. Wie oft sie abends wegging. Es gab keine Sekunde, in der er ihr misstraut hatte. Vielleicht war er zu leichtgläubig und zu vertrauensselig gewesen? Aber was wäre das für eine Beziehung, wenn man sich nicht blind vertrauen konnte?
Seine Gedanken drifteten wieder weg vom Straßenverkehr. Er fragte sich, ob er ihr überhaupt irgendwann wieder vertrauen würde. Sie hatte ihn bewusst angelogen. Dass sie zum Einkaufsbummel gehen würde, hatte sie ihm erzählt. Wahrscheinlich hatte sie da schon gewusst, dass sie und ihre Freundin etwas ganz anderes tun wollten. Im letzten Moment erfasste Sven, dass die Autos vor ihm gar nicht mehr fuhren, sondern an einer roten Ampel standen. Die Reifen quietschten, bevor er zum Stehen kam. Keine Handbreit trennte ihn mehr vom Vordermann. Ohne ABS wäre es zu einem Unfall gekommen.
Verdammt, du musst dich zusammenreißen, dachte Sven. Das letzte Stück schaffst du auch noch.
Als er sein Auto abstellte, konnte er sich an viele Abschnitte der Fahrt gar nicht mehr erinnern. Jedem anderen Menschen hätte er gesagt, dass es unverantwortlich wäre, in solch einem Zustand Auto zu fahren.
Beim Überqueren der Straße steckte er den Switch wieder unter die Jacke. Es regnete noch immer. Die dicken Wolken, die jetzt über der ganzen Stadt hingen, ließen nicht darauf hoffen, dass es bald aufhören würde. Dass es so düster war, verstärkte Svens deprimierte Stimmung noch. Wenn er nicht gewusst hätte, dass Thomas auf ihn wartete, wäre er nicht mehr ins Büro gekommen.
Gerade als er das Bürohaus betreten hatte, piepte sein Handy. Während er mit der rechten Hand den Switch hielt, kramte seine linke das Telefon hervor. Im Display erkannte er die Nummer von zu Hause. Es war also Janette. Er meldete sich mit einem knappen „Hi“.
Ihre Stimme klang ängstlich. „Bist du okay?“
„Ja.“ Eine kurze Pause, in der keiner etwas sagte. „Habt ihr Spaß gehabt?“ Noch bevor er zu Ende gesprochen hatte, bereute er es. Seine Stimme hatte vorwurfsvoll geklungen.
„Ja, haben wir.“ Sie hingegen klang verletzt. Das ärgerte Sven. Was hatte sie für einen Grund, verletzt zu sein? Fast hätte er gefragt, ob es besser gewesen sei als mit ihm, konnte es sich aber gerade noch verkneifen. Er nahm sich vor, nicht kindisch zu sein.
Zwei Sekunden lang sammelte er sich, atmete tief durch und sagte dann mit einer Stimme, die so ehrlich wie nur irgend möglich klingen sollte: „Das ist gut. Es tut mir leid, dass ich euch erschreckt habe. Ich musste etwas für die Arbeit holen und habe die Musik im Schlafzimmer gehört. Ich konnte ja nicht wissen, dass ...“
„Es war nicht deine Schuld.“ Pause. „Sven, ich ... ich weiß nicht, was ich dir sagen soll ...“
„Nichts, Janette. Gar nichts.“
„Du kommst doch heute Abend heim?“
Beinahe wäre ihm ein „Wenn ich nicht störe“ herausgerutscht. Aber er konnte den Impuls unterdrücken. Stattdessen sagte er: „Natürlich. Wo sollte ich denn sonst hingehen?“
„Ich weiß nicht. Zu Thomas vielleicht.“
„Nein. Ich komme nach Hause. Wenn du auch da bist?“
„Ich warte auf dich.“ Ihre Stimme war fast ein Flüstern.
„Es kann sein, dass ich etwas später komme. Thomas hat da ein Problem, bei dem ich ihm helfen muss.“
„Rufst du an, bevor du kommst? Ich möchte dir gerne etwas Besonderes kochen.“
„Kann ich machen.“ Um die Situation etwas aufzulockern, fügte er hinzu: „Was gibt‘s denn Leckeres?“ Es klang unbefangener, als er sich tatsächlich fühlte. Das entspannte die Atmosphäre etwas.
„Lass dich überraschen.“ Pause. „Sven?“
„Ja?“
„Ich hab dich lieb.“
„Gut.“ Pause. „Ich denke, ich kann damit leben, wenn du auch eine andere Frau gerne hast. Es würde anders sein, wenn es ein Mann wäre.“ Er war sich längst nicht sicher, ob das wirklich so war.
„Wir reden heute Abend drüber.“ Sie zog sich wieder etwas zurück.
„Okay. Ich küss dich.“
„Ich küss dich.“
Dann legten sie auf und Sven ging hinauf in sein Büro.
„Du bist ein bisschen blass. Ist alles in Ordnung bei dir?“, erkundigte sich Gina, als sie Sven mit dem Switch in der Hand erblickte.
„Äh, ja. Danke der Nachfrage!“, stammelte Sven, noch immer in Gedanken woanders. Sven war erstaunt darüber, wie schnell Gina erfasst hatte, dass er nicht auf der Höhe war. Aber jetzt wurde es Zeit, sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Die Sache mit Janette musste er jetzt beiseitelegen. Schließlich bekam er nicht wenig Geld von seiner Firma und dafür wurde auch einiges erwartet.
„Das, was du über die Sache bei der NSI erzählt hast, hört sich sehr nach einem Virus an“, versuchte er, an Thomas gerichtet, das Thema zu wechseln.
Gregor, der junge Praktikant, war inzwischen auch da. Ebenso die von Stefan versprochenen Computer. Die PCs waren unspektakulär nackt, im Gegensatz zu Gregor, der heute ein schwarzes T-Shirt in XXL-Größe trug. Es hing schlabbernd an der schmalen Gestalt herab. Das Motiv war ein riesiges, grünes Hanfblatt, welches mit einem roten Kreuz durchgestrichen war. Sven überlegte, was Gregor damit zum Ausdruck bringen wollte. Über seinen Stil konnte man zwar streiten, aber der Praktikant brachte mit seinen schrillen Outfits definitiv etwas Leben in die Bude.
„So einfach ist das leider nicht“, kam von Thomas die Antwort. „Wir wollten gestern noch einen letzten Versuch mit einem Computer starten, bei dem das Datum zunächst nicht umgestellt werden sollte. Die Jungs in der Technik hatten noch einen originalverpackten Rechner – da konnte also kein Virus drauf sein.“
„Und was passierte damit?“
„Wir haben das Betriebssystem aufgespielt und es funktionierte einwandfrei. Auch eine Datenbank und das Backup-System von der NSI konnten wir problemlos installieren. Ebenso war das Erstellen einer Sicherheitskopie erfolgreich. Dann haben wir das Datum umgestellt. Zunächst sah alles gut aus. Wir konnten sogar Daten von der Sicherungskopie zurückholen. Aber bei der Überprüfung haben wir festgestellt, dass die Daten unbrauchbar waren. Herr Lenzenhagen von der NSI hat mich dann ziemlich schnell so höflich wie möglich verabschiedet.“
„Es war ihm sicher peinlich, dass sein Programm solche Fehler produziert.“
Sven sah Thomas an, der ihn für einen Moment anscheinend gar nicht wahrnahm, sondern nachdenklich auf einen imaginären Punkt in der Ferne blickte. Nach einer Weile antwortete er: „Das Problem ist nur, dass ich nicht von einem Fehler in Lenzenhagens Software ausgehe.“
6. September, 18:55 Uhr
Sebastian Fink sah aus dem kleinen Fenster. Sie mussten bald da sein. Die bisher wolkenfreie und klare Luft wurde immer diesiger. Es war das dritte Mal, dass er dieses traurige Schauspiel beobachten konnte. Immer war es die immense Dunstglocke, welche die große Stadt ankündigte. Sebastian Fink vermutete, dass es sich um eine der zehn größten und schlimmsten Smoggebiete der Welt handelte. Der immer dichter werdende graue Schleier verriet stets die baldige Ankunft. Jetzt, in der Dämmerung, war es nicht so deutlich zu erkennen, doch wer früher schon einmal nach Kairo geflogen war, konnte die Dunstwolke zumindest erahnen.
Noch einmal dachte Fink über den Grund seines Besuchs nach. Er war mit einem Mann namens Anan Erachnaton verabredet. Erachnaton war offenbar bereit, ihm wichtige Informationen zu geben. Seine Ermittlungen gingen bisher ziemlich schleppend voran. Doch von seinem amerikanischen Kollegen George Lloyds hatte er eine Menge erfahren können. Umgekehrt war es ebenso gewesen. Beide lernten voneinander. Die Einzelteile, die jeder von ihnen gesammelt hatte, passten zusammen wie ein Puzzle. Gemeinsam hatten sie versucht, immer tiefer in das verschlungene Netz einzudringen. George Lloyds war, ebenso wie er selbst, ein hochrangiger Polizeibeamter mit Schwerpunkt Wirtschaftskriminalität. Während Fink einer entsprechenden Einheit beim BKA angehörte, war Lloyds für die CIA tätig. Da Lloyds ein sehr guter Bekannter von Finks Vorgesetztem war, hatte der Kontakt ohne den sonst üblichen Papierkram zustande kommen können.
Bald merkten Lloyds und Fink, dass sie tatsächlich an Fällen arbeiteten, die miteinander in Verbindung zu stehen schienen. Nach intensiveren Gesprächen wurde ihnen klar, dass die Spur ihrer Fälle sogar in die gleiche Richtung lief. Immer mehr Kleinigkeiten deuteten darauf hin, dass sich hinter vielen einzelnen Fällen am Ende eine richtig große Sache verbarg. Um dieser Sache gezielt nachzugehen, wurde eine internationale Task-Force gebildet, die den Namen ‚International Stock Money Maker Task Force’ bekam, von Eingeweihten meistens nur die ‚Money Makers’ genannt. Neben George Lloyds und Sebastian Fink gehörten mittlerweile Beamte aus sieben verschiedenen Ländern zu der Gruppe.
Während des Landeanflugs dachte Sebastian Fink über den Fall nach. Was wussten sie bisher? Offenbar gab es überall auf der Welt Leute, die auf die gleiche Weise zu großem Reichtum gekommen waren. Natürlich gab es immer Menschen, die tatsächlich viel Glück hatten. Aber diese speziellen Personen, die für die ‚Money Makers’ interessant waren, hatten eines gemeinsam: Alle hatten mit einer verhältnismäßig geringen Summe innerhalb von weniger als zwei Jahren ein kleines Vermögen gemacht, indem sie mit Aktien eines bestimmten amerikanischen Unternehmens spekuliert hatten. Die Bilanzen dieses Unternehmens erschienen sehr fragwürdig. Hauptsächlich stellte die Firma Verpackungen her, die ausschließlich nach Afrika verkauft wurden. Mal schien das Geschäft so gut zu laufen, dass der Kurs des an der Börse gehandelten Papiers auf über 100 US Dollar stieg, ein anderes Mal lief es so miserabel, dass der Kurs wieder unter die Ein-Dollar-Marke fiel. Dies ging alles so schleichend, dass es zunächst niemandem aufgefallen war. Es war auch kein unregelmäßiges Auf und Ab. Es sah vielmehr nach einem System aus. Zunächst stiegen die Kurse über ein Jahr kontinuierlich, dann fielen sie ein Jahr lang, bis sie wieder am Ausgangspunkt waren. Anschließend wiederholte sich das Spiel. Kurz bevor die Werte fielen, verkauften die meisten Anleger, die bei dem niedrigsten Wert gekauft hatten. Als ob sie genau gewusst hätten, dass nun der Höchststand erreicht war. Die nächsten neuen Anleger, die im Folgejahr das große Geld damit machten, kauften just wieder beim niedrigsten Stand.
Man konnte bisher niemandem irgendwelche Absprachen oder Ähnliches nachweisen. Aber nach allem, was bekannt war, schloss man einen Zufall aus. Diejenigen, die zum Höchstkurs der Aktien kauften und so den Reichtum der anderen finanzierten, kamen ausnahmslos aus exotischen Ländern, die außerhalb des Zugriffsbereiches der NATO-Länder lagen. Sie hatten Aktienkonten bei diversen großen Brokern in Amerika eröffnet und überwiesen das Geld aus dem Ausland. Die Eröffnung der Konten erfolgte per Telefon, E-Mail oder Fax. Diese Leute hatten die USA nie betreten. Es waren genau 50 dieser Personen mit den dazugehörigen Konten bekannt, wobei ‚bekannt’ nur bedeutete, dass man den jeweiligen Namen hatte, auf den das Depot eröffnet worden war.
Theoretisch war es möglich, die Konten von der Regierung sperren zu lassen. Aber offiziell hatten sich die Leute ja nichts zuschulden kommen lassen. Im Gegenteil: Anstatt Geld aus den USA herauszuschaffen, überwiesen sie Geld nach Amerika, spekulierten damit und verloren es. Dass andere dadurch zu viel Geld kamen, war kein Verbrechen. Genau genommen hatte man an der ganzen Sache noch nicht die geringste Kleinigkeit gefunden, die illegal war. Dennoch waren sich alle Mitarbeiter der ‚Money Makers’ einig, dass da etwas nicht stimmte. Wenn man nur endlich einen Anhaltspunkt finden würde.
George Lloyds hatte bereits über das Finanzministerium eine unauffällige Buchprüfung bei der CPfA Inc., der ‚Cheap Packaging for Africa Incorporated’, veranlasst. Es war als Routinekontrolle getarnt gewesen, denn man wollte nicht, dass die Hintermänner Verdacht schöpften und daraufhin alle Spuren verwischten. Leider blieb die Prüfung ergebnislos. Alle Bücher waren so sauber geführt, dass sich jedes amerikanische Unternehmen ein Beispiel daran hätte nehmen können. Alle Einnahmen waren ordnungsgemäß versteuert, alle Abgaben bezahlt und alle Gesetze eingehalten worden. Da die meisten Geschäfte aber mit außeramerikanischen Unternehmen abgewickelt wurden, konnte nicht kontrolliert werden, wie die Gegenbuchungen bei den Geschäftspartnern aussahen. Wie man es auch drehte und wendete: Obwohl alle wussten, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zuging, war einfach nichts Greifbares zu finden.
Eine Turbulenz riss Sebastian Fink aus seinen Gedanken. Das Flugzeug sackte kurz ab, fing sich jedoch sofort wieder. Es war ein Gefühl wie bei der Abfahrt in einer Achterbahn. Fink packte seinen Laptop weg, nachdem man über die Bordlautsprecher darum gebeten hatte, alle elektrischen Geräte abzuschalten.
Wer ihn so dasitzen sah, wäre niemals darauf gekommen, dass er ein Kriminalbeamter mit einer Spezialausbildung war. Er sah eher aus wie ein Geschäftsmann. Schon seine geringe Größe von nur einem Meter vierundsechzig ließ viele Menschen überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass er Polizist sein könnte. Für die meisten musste ein Polizist groß sein, besonders ein Angehöriger der Kripo. Doch gerade die Kripo hatte ganz andere Maßstäbe. Eine sehr große Portion an Intelligenz war gefragt. Es war nicht einfach, durch die Aufnahmetests zu kommen. Selbstverständlich durfte auch die Sportlichkeit nicht fehlen. Aber wenn man alle anderen Voraussetzungen erfüllte, dann machte eine geringe Körpergröße gar nichts aus. So klein wie er war, so schmal schien er auch zu sein. Eine sehr schlanke, fast zierliche Gestalt. Dass jeder einzelne Muskel durch hartes Training gestählt war, konnte man durch seinen grauen Anzug nicht erkennen.
Ebenso konnte man nicht erahnen, mit welch unglaublicher Schnelligkeit er sich bewegen konnte. Schon im Kindesalter hatte er seinen Körper trainiert, als seine Eltern ihn in eine Judoschule gesteckt hatten. Mit sieben fing er mit Taekwondo an und als Zehnjähriger suchte er sich eine Schule für Kickboxen. Da er mit diesem Sport angefangen hatte, noch bevor sich die kindlichen Sehnen und Muskeln zusammengezogen hatten, erhielt er sich eine unglaubliche Dehnung und Gelenkigkeit. Er war mit dem Sport aufgewachsen und jede Bewegung war ihm in Fleisch und Blut übergegangen.
Er tastete nach den Taschentüchern in seiner rechten Jacketttasche. Sie waren da. Ein sehr wichtiges Utensil für ihn. Wegen der extrem schlechten Luft bekam er häufig Nasenbluten, wenn er sich in Kairo befand. Aber der Besuch würde sich lohnen.
Anan Erachnaton, der Mann, den er treffen würde, hatte lange Zeit für eines der Unternehmen gearbeitet, die von der CPfA beliefert wurden. Der Kontakt war von einem Informanten hergestellt worden. Im Laufe der Jahre hatte Sebastian Fink ein großes Netzwerk an V-Leuten aufgebaut. Es gab immer kleine Gefallen, die man jemandem tun konnte. Dafür erhielt man dann hier und da eine Information.
Erachnaton war bereit, Fink zu treffen, aber natürlich nur in seinem eigenen Land. Er verlangte dafür 200 britische Pfund. Das war viel Geld, aber Felix Herdt, Finks Vorgesetzter, hatte ein eigenes Budget. Einen Teil davon stellte er Fink zur freien Verfügung, wofür Fink sehr dankbar war. Es gab ihm eine große Freiheit und erleichterte sein selbständiges Arbeiten. Außerdem motivierte es natürlich. Dafür lieferte Fink stets die besten Ergebnisse. Auch in diesem Fall wollte er den größten Teil der internationalen Ermittlungen bewältigen.
Das Flugzeug setzte auf. Zum Glück hatte Fink nur Handgepäck, so brauchte er nicht auf die Koffer aus dem Gepäckraum zu warten. Da er nur eine Nacht in Kairo bleiben würde, benötigte er lediglich ein frisches Hemd und frische Unterwäsche. Am nächsten Morgen um 5:45 Uhr würde er den Lufthansa-Flug nehmen und gegen 9:00 Uhr wieder in Frankfurt sein.
Schon in der Halle wurde er von mehreren Taxifahrern angesprochen, die jedem neu angekommenen Touristen einen ziemlich teuren Service andrehen wollten. Fink kannte das schon und ging daher schnell und ohne Antwort an ihnen vorbei. Draußen sah er sich nach einem Taxi um, in dem ein Fahrer wartete. Der Zufall wollte es, dass er einen entdeckte, mit dem er früher schon einmal gefahren war. Er ging zu dem alten, verrosteten Peugeot, der aussah, als würde er jeden Moment auseinanderfallen. Fink erinnerte sich, dass der Fahrer so gut wie kein Englisch sprechen konnte und ihm somit auch nicht die Ohren vollquasseln würde. Er öffnete die Beifahrertür, wobei ihm ein Schwall abgestandener Rauch aus dem Fahrzeug entgegenströmte. Aber besser Rauch als nerviges Gequatsche. Der alte, unrasierte Fahrer lächelte, sodass etliche Zahnlücken und schwarze Zähne zum Vorschein kamen. Fink setzte sich ins Taxi und nahm seine Tasche, in der auch sein Laptop war, auf den Schoß.
„Hotel Longchamps“, sagte er langsam und deutlich. Das Hotel hatte er selbst gebucht. Natürlich wäre auch ein besseres Hotel infrage gekommen, aber Fink mochte keinen unnötigen Luxus. Außerdem kannte er das Hotel von früheren Besuchen. Während er die Tür zuzog, was verhältnismäßig viel Kraft erforderte, nannte er den Preis in Ägyptischen Pfund, den er zu zahlen bereit war. Es war wichtig, den Preis vorher festzusetzen, sonst wurde man unweigerlich über den Tisch gezogen. Der Fahrer nickte stumm und ließ das Auto an. Die Geräusche, die dabei auftraten, machten keinen vertrauenerweckenden Eindruck, aber der Wagen sprang schnell an.
Er hat seit meinem letzten Besuch nichts an dem Wagen machen lassen, dachte Fink amüsiert. Still beobachtete er die Bewegungen, die ihn schon bei seiner ersten Begegnung mit dem Taxifahrer fasziniert hatten. Unaufmerksame Fahrgäste mochten es gar nicht bemerken, dass dem alten Mann das linke Bein fehlte. Fink vermutete, dass es ein Raucherbein gewesen war und abgenommen werden musste. Es hätte sich aber ebenso um einen Unfall oder sogar einen Geburtsfehler handeln können. Natürlich war das Fahrzeug nicht für einen Menschen mit einer Behinderung umgebaut. Für so etwas fehlte hier den meisten Leuten das Geld. Hier behalf man sich eben anders. Ohne dabei ein Zeichen von Anstrengung zu zeigen, bediente der Ägypter die Kupplung mit seiner Krücke. Der linke Arm ersetzte so das fehlende Bein. Für die meisten Mitteleuropäer wäre das sicher ein Ding der Unmöglichkeit, aber hier herrschte eine andere Mentalität.
Fink musste unweigerlich an Tiere denken. Er hatte einmal einen Hund gesehen, der nur drei Beine hatte. Es sah etwas anders aus, wenn er lief, aber ansonsten benahm er sich wie jeder andere Hund auch. Und andere Hunde benahmen sich ihm gegenüber genauso, wie sie sich jedem anderen Hund gegenüber benommen hätten. Genauso grob und unvorsichtig. Der Hund lebte ein ganz normales Leben. Er tollte und spielte und man gewann den Eindruck, dass es ein fröhlicher Hund war. Genauso kam Fink der Taxifahrer vor. Das war ein Stück Ägypten, das er liebte.
Wie erwartet, gab es während der Fahrt kein Gespräch. Aus dem Radio dudelten die fremdartigen Klänge recht leise, was Fink verwunderte. Die Einheimischen ließen ihre Musik normalerweise sehr laut ertönen. Aber Fink war dankbar dafür, denn die Musik war ein Stück Ägypten, das ihm nicht gefiel.
Auf der Sharia Ramses näherten sie sich dem Stadtkern. Am Hauptbahnhof ging es vorbei an dem Denkmal von Ramses II. Ein gutes Stück weiter bogen sie nach rechts in die Shari 26. July ein, wo der Verkehr stärker war als in den Randgebieten am Flughafen. Das hätte man auch mit geschlossenen Augen feststellen können, denn das obligatorische Hupen war jetzt allgegenwärtig.
Sie erreichten den Nil und befuhren die Brücke, die den gleichen Namen wie die Straße trug: 26. Juli - der Tag, an dem Nasser 1956 die Verstaatlichung des Suezkanals erklärt hatte. Von hier aus konnte Fink den bereits beleuchteten Kairo Tower sehen, der mitten auf der größten Nilinsel Gezira gebaut wurde.
Sie waren beinahe am Ziel. Auf der Insel ging es noch um zwei Ecken, dann waren sie in der Shari Ismail Mohammed, in welcher sich das Hotel befand. Fink bezahlte, legte noch ein paar Pfund als Trinkgeld obendrauf und verließ das Taxi. Der Fahrer bedankte sich lächelnd mit einem „Shukran“ und fuhr sofort weiter. Auch dafür war Fink dankbar. Die meisten Fahrer, die am Flughafen auf Neuankömmlinge warteten, begleiteten die Fahrgäste bis zur Rezeption. Nicht wirklich aus Freundlichkeit, wie sie vorgaben, sondern um dort vorzugeben, sie hätten den Gast überredet, gerade in diesem Hotel abzusteigen. Dafür gab es dann eine kleine Provision. Häufig wurde das Zimmer dadurch auch teurer, denn der Hotelier wollte natürlich keinesfalls weniger verdienen und schlug die Provision einfach auf den Zimmerpreis.
Fink ging durch den schwach erleuchteten Gang zum antiquierten Aufzug. Die Rezeption befand sich im ersten Stock.
Der Polizist zog die schmiedeeiserne Gittertür zur Seite und betrat den engen Raum. Von innen schloss er die Tür, die dabei fürchterlich quietschte. Bei ihrem Einrasten erlosch das Licht. Fink kannte das und erschrak daher nicht. Als er auf den Knopf für das erste Stockwerk drückte, ging das Licht wieder an. Mit einem Ruck setzte sich der Aufzug in Bewegung.
Der Mann an der Rezeption, dessen Alter man nicht schätzen konnte, tat so, als sei er wach und hoch motiviert. „Good evening. Mr. Fink?“





























