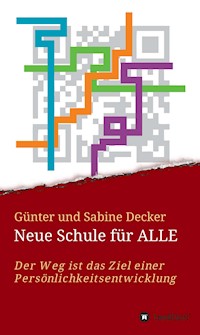
4,99 €
Mehr erfahren.
Es ist Zeit, neue Wege zu gehen und den Grundstein für eine bessere Zukunft zu legen. Nur wer sich in seiner Kindheit und Jugend besonders gut kennenlernt, weiß um seine Stärken und Schwächen, kann Verantwortung für sich und andere übernehmen und Entscheidungen treffen, die seinem Wesen entsprechen. Diese Menschen arbeiten und leben deutlich zufriedener und werden zu wertvollen Mitgliedern unserer Gesellschaft. Wir als Gesellschaft sind gefordert über die Bildung und die Zukunft unserer Kinder nachzudenken. Wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Neurophysiologie, der Pädagogik und der Entwicklungspsychologie fordern uns auf, eine neue Lernkultur zu entwickeln und umzusetzen. Diese soll helfen die kognitive, emotionale und die soziale Intelligenz individuell zu entfalten. Eine Schule, die diesen Aufgaben nachkommen will, soll Freude machen, eine solide Wissensgrundlage schaffen, auf die Individualität der Kinder eingehen und die Entwicklung der Persönlichkeit der jungen Menschen positiv begleiten. Der Geist dieser Schule soll geprägt sein durch die Liebe und Wertschätzung gegenüber den Mitmenschen und der Schöpfung. Somit wird gewährleistet, dass die Schule nicht nur Wissen und Können vermittelt, sondern auch Herz und Charakter bildet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 114
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
„In dem Augenblick, in dem man sich endgültig einer Aufgabe verschreibt, bewegt sich die Vorsehung auch.
Alle möglichen Dinge, die sonst nie geschehen wären, geschehen, um einem zu helfen. Ein ganzer Strom von Ereignissen wird in Gang gesetzt durch die Entscheidung, und er sorgt zu den eigenen Gunsten für zahlreiche unvorhergesehene Zufälle, Begegnungen und materielle Hilfen, die sich kein Mensch je so erträumt haben könnte.
Was immer du kannst, beginne es. Kühnheit trägt Genius, Macht und Magie. Beginne jetzt!“
Johann Wolfgang von Goethe
Günter Decker
Sabine Decker
Neue Schule für ALLE
Der Weg ist das Ziel einer
Persönlichkeitsentwicklung
Unsere Kontaktadresse:
Günter Decker
Ringstr. 3
81375 München
Tel.: 0173-5344118
Fax: 089-82955510
Email: [email protected]
Homepage: www.neue-zukunft-schule.de
© 2015 Günter Decker, Sabine Decker
Umschlag, Illustration:
Sabine Decker, Samantha Schütz
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-7345-2190-4
Hardcover
978-3-7345-2191-1
e-Book
978-3-7345-2192-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhalt
VORWORT
UNSER PERSÖNLICHES MOTIV FÜR UNSER BUCH
DER AUFBAU DES BUCHES
ERSTER TEIL GESCHICHTEN UND GEDANKEN, DIE DAS SCHULLEBEN SCHREIBT
LEHRER UND SCHÜLER REDEN ANEINANDER VORBEI
EIN KONKRETES BEISPIEL ZEIGT DIE GRUNDPROBLEMATIK AUF
NOTEN
WAS SAGT DIE ZEUGNISNOTE AUS?
NACHHALTIGES LERNEN?
DIE BEDEUTUNG DER NOTEN FÜR DIE SCHÜLER
EINE WIRKUNG DES SCHULSYSTEMS AUF DIE SCHÜLER
LEISTUNG- EIN ZENTRALER BEGRIFF IN UNSERER HEUTIGEN ZEIT
LEISTUNG AM BEISPIEL SPORT
„VERGLEICHEN ALS BIOLOGISCHES GRUNDPRINZIP“
LEISTUNG IN DER SCHULE
INDIVIDUELLE LEISTUNG UND LEISTUNG IM VERGLEICH ZU ANDEREN
PROBLEMATIK DER LEISTUNGSMESSUNG
KOMPETENZEN
NOTEN ALS MITTEL ZUR AUSLESE
INTEGRATION UND INKLUSION
HETEROGENITÄT ALS CHANCE
ZWEITER TEIL THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN
LERNEN AUS NEUROWISSENSCHAFTLICHER SICHT
GEDANKEN AUS DER ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE
MITTLERE UND SPÄTE KINDHEIT
Kognitive Entwicklung
Das Selbstkonzept
Motivationale Entwicklung
Emotionale Entwicklung
ENTWICKLUNG BEIM JUGENDLICHEN
DRITTER TEIL UNSERE VISION: EIN PÄDAGOGISCHES KONZEPT EINER „NEUE SCHULE FÜR ALLE“
VORÜBERLEGUNGEN
DIE DERZEITIGE SITUATION DER SCHULE AUS DER SICHT DES GYMNASIUMS
NEUE SCHULE FÜR ALLE IM ÜBERBLICK
DAS PÄDAGOGISCHE KONZEPT – „DER WEG IST DAS ZIEL“
LEITBILDER UNSERER PÄDAGOGIK
WERTEVERMITTLUNG DURCH „INNERE SEELENSCHAU“
Inklusion
Jung trifft Alt
Verantwortung übernehmen
LERNEN MIT 5 SINNEN
Duale Ausbildung
Künstlerische Ausbildung
Sport und Erlebnispädagogik
Mediale Ausbildung
„BLICK ÜBER DEN TELLERRAND“
Vernetzung mit gesellschaftlichem Umfeld
Internationalität
Gesundheitsvorsorge
ABLAUF DES SCHULBETRIEBS
DER BAYERISCHE LEHRPLAN IN MODULEN
GROBER ABLAUF DES SCHULALLTAGS
VIERTER TEIL FAQS
ANHÄNGE
AUSZÜGE AUS DER VERFASSUNG DES FREISTAATES BAYERN IN DER FASSUNG DER BEKANNTMACHUNG VOM 15. DEZEMBER 1998,
AUSZÜGE AUS DER BAYEUG
AUSZÜGE AUS DEM GRUNDGESETZ FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
KURZBIOGRAFIE DER AUTOREN
QUELLEN UND LITERATUR
Danksagung
Ein herzliches Dankeschön gilt insbesondere Herrn Univ.-Prof. Dr. Heinz Decker, der uns dazu ermunterte, unsere Gedanken in einem kleinen Büchlein darzustellen.
Anmerkung:
Der Einfachheit und der Kürze halber und um den Lesefluss nicht zu stören, verwenden wir statt der Unterscheidung zwischen weiblicher und männlicher Ausdrucksformen nur die maskuline Form.
Vorwort
Unser persönliches Motiv für unser Buch
Vor 25 Jahren wurde mein erstes Kind geboren. Sebastian sollte mein Leben grundlegend beeinflussen. Er hat das „Down-Syndrom“. In einer Zeit, als in Bayern behinderte Kinder noch von der Polizei aus ihren Dorfschulen geholt wurden, um sie dann in die damals sehr populären Förderschulen in weit entfernte Landkreisorte zu bringen, begann ich, darüber nachzudenken, wie ich demnächst meinen eigenen Sohn optimal fördern könnte. Trotz vehementen Widerstandes des hiesigen Stadtschulrates gelang es mir, mit extrem viel Einsatz und einer glücklichen Unterstützung durch das Kultusministerium, meinen Sohn in einer Montessori-Grundschule integrativ beschulen zu lassen. In den vier folgenden Jahren erlebte ich, wie Sebastian glücklich, seinen Möglichkeiten entsprechend gut in dieser Schule gefördert wurde. Er wuchs mit einer Selbstverständlichkeit mit den sogenannten „Normalen“ in dieser Schulgemeinschaft auf. Da ich ihn auch sonst nicht versteckte und ihn im täglichen Leben überall mitnahm, entwickelte er sich zu einem sehr kommunikativen und freundlichen Mitmenschen.
Durch eine glückliche Fügung bekamen wir anschließend das Angebot, Sebastian in einer weiterführenden Montessori-Schule integrativ beschulen lassen zu dürfen.
Im dritten Lebensjahr der Schule wurde ich Schulleiter dieser Schule, des damals einzigen bayerischen Montessori-Gymnasiums und gleichzeitig auch Rektor der ebenfalls dort befindlichen Montessori-Hauptschule. Unter meiner Leitung entwickelten wir die folgenden 5 Jahre neue Strukturen um inklusiv, schulartübergreifend und unabhängig der Jahrgänge die Kinder und Jugendlichen dieser Schule zu begleiten. Ohne Noten führten wir sie erfolgreich zu den Abschlüssen „Quali“, „Mittlere Reife“ und „Abitur“.
Die Wirkung der Kinder mit „Down-Syndrom“ auf die sogenannten „normalen“ Kinder war geradezu phänomenal! Schlüsselkompetenzen, soziale aber auch kognitive Kompetenzen, die heute in der Bildungspolitik formuliert werden, wurden dort von den Kindern entwickelt und gelebt. So ziehe ich heute die Bilanz, dass die Freiheitsgrade, die wir damals als Privatschule mit ca. 300 Schülern hatten, eine innere Seelenschau bei den Schülern ermöglichten, die letztlich zu einer Wertevermittlung führte, die wir in der Regelschule kaum erreichen. Eine Erklärung für diese Beobachtung mag sein, dass es sehr viele sogenannte Win-win-Situationen für alle beteiligten Personen an dieser Schule gab. Trotzdem verstehe ich die Skepsis vieler Menschen, ob so etwas wirklich umsetzbar ist. Wir sind alle natürlich geprägt von unserer eigenen Schulzeit. Doch ich kann heute sagen: Es hat funktioniert! Viele Referendare und auch Lehrer, die vor Ort ihre Fortbildungen machten, waren sehr positiv beeindruckt und verließen uns mit der hilflosen Fragestellung: Wie sollen wir so etwas, oder zumindest manche Elemente von den gesehenen Strukturen in der Regelschule umsetzen?
In den letzten Jahren war ich wieder in die Regelschule zurückgekehrt, da die Stadt München auf Grund erheblichen Lehrermangels in meiner Fächerkombination Physik und Mathematik und dem damit verbundenen sehr hohen Eigenbedarf mich nicht mehr länger für die Privatschule freistellen konnte. Dort gelang es mir, zumindest einen kleinen Baustein dieses erlebten Gesamtkonzeptes im Regelschulbetrieb erfolgreich einzuführen und umzusetzen.
Auf Grund dieser Erlebnisse wollen wir nun versuchen eine neue Schule aufzubauen, die im Wesentlichen dem im dritten Teil ausgeführten Konzept folgen wird. Gleichzeitig möchten wir Sie, liebe Leser, auffordern sich bei uns zu melden, wenn Sie unsere Vorstellungen einer neuen Schule teilen und mitgestalten oder auch als Sponsoren tätig sein wollen.
Günter Decker
Mehrere Faktoren in meiner Vergangenheit beeinflussten mich derart, mich intensiver mit Pädagogik, insbesondere auch mit Reformpädagogik, auseinanderzusetzen.
Bevor ich nach dem Referendariat in den Schuldienst startete, nahm ich 2009 an dem Projekt High Seas High School (HSHS) als Lehrerin und Betreuerin teil. 25 Schüler aus ganz Deutschland segelten hierbei 7 Monate lang um die halbe Welt. Unter der Anleitung von erfahrenen Seglern lernten sie, was es heißt, einen 36m langen Zweimaster zu segeln, die Mannschaft an Bord zu verpflegen, das Schiff in Schuss zu halten. Sie übernahmen Verantwortung und übten sich vor allem in Selbstdisziplin. Viele Tätigkeiten wurden nach einiger Zeit mit großer Selbstverständlichkeit übernommen, an die kaum ein Jugendlicher zu Hause je im Traum gedacht hätte, sie jemals zu tun. Ich denke nur daran, wie schwer es ihnen fiel regelmäßig das Schiff zu reinigen und zu schrubben, und dazu gehörte natürlich auch die Toilette zu putzen.
Auf diesem beengten Raum waren Konflikte unumgänglich. Auseinandersetzungen, Konfliktlösungen und das Finden von Kompromissen gehörte zur Tagesordnung, sowie alle anderen Pflichten auch. Die Schüler wurden zwar auch in Mathematik, Deutsch, Englisch usw. unterrichtet, aber der Fokus lag ganz klar auf der Persönlichkeitsentwicklung. Nach dem Motto „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“ (Kurt Hahn) fanden hier an Bord Persönlichkeitsprägungen und Persönlichkeitsentwicklungen statt, die Jugendliche mehr als alles andere aufs Leben vorbereiteten.
Auf unserer Reise lernten wir Menschen anderer Kulturen und andere Lebensweisen kennen, die eigenen persönlichen Leistungsgrenzen wurden ausgetestet, Herausforderungen wurden gemeistert.
Die Erfahrungen, die ich an Bord machte, prägten mich ebenfalls sehr.
In mir erwachte der Wunsch, Kindern und Jugendlichen auf ihren Weg des Erwachsenwerdens zu begleiten und sie zu unterstützen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.
Als ich 2010 nach München kam, lernte ich an meiner neuen Schule meinen zukünftigen Mann kennen, der wie kein anderer mich mit seinen Gedanken und Thesen zum Nachdenken anregte und mein Leben bereicherte.
So begann ich als Lehrerin die Schüler aus einem völlig anderen Blickwinkel zu betrachten. Ich interessierte mich zunehmend für die Entwicklungspsychologie, für das Lernen aus neurowissenschaftlicher Sicht und für reformpädagogische Erkenntnisse.
Im Alltag merkte ich allerdings schnell, dass meine Ideale weit von der täglichen Erfahrungswelt entfernt lagen.
So verging die Zeit wie im Fluge und die Erfahrungen aus meiner HSHS-Zeit verblassten zunehmend.
Die nächsten Meilensteine in meinem Leben waren schließlich die Geburten unserer beiden Töchter. Während meiner Elternzeit vertiefte ich mich in die entwicklungspsychologischen Prozesse. Was läuft eigentlich bei einem so kleinen Wesen ab? Kann ich die Entwicklung unterstützen? Wenn ja, wie?
Ich befasste mich viel mit Entwicklungspsychologie, las Bücher u.a. von Jesper Juul, Remo Largo, usw.
Am meisten allerdings faszinierten mich die Ansichten von Maria Montessori, ihre Sichtweise vom Kind, das dafür kämpft, an Unabhängigkeit zu gewinnen und Selbstständigkeit zu erlangen, das in der Phase der polarisierten Aufmerksamkeit Wissen regelrecht aufsaugt wie ein Schwamm, dem man eine vorbereitete Umgebung bieten sollte, damit es sich gemäß seiner sensiblen Phasen das aussuchen kann, was es gerade bewegt. Und vor allem spürte ich in mir große Zustimmung, in der Sichtweise, welche innere Haltung der Lehrer gegenüber dem Kind innehaben sollte. In vielen Dingen fühlte ich mich bestätigt und war davon fasziniert, dass eine Frau, die vor 100 Jahren gelebt hatte, diese Beobachtungen schon so präzise niedergeschrieben hatte. Es ist eine völlig andere Sichtweise, von der ich überzeugt bin, dass sie der Wirklichkeit recht nahekommt.
Bei meinen eigenen, kleinen Kindern konnte ich viele Erkenntnisse und Beobachtungen Montessoris bewundernd bestätigen und ich beobachte sie großenteils immer noch.
Von 2013 bis 2015 machte ich schließlich die Ausbildung in der Montessori-Pädagogik für die Sekundarstufe.
Mein Blick auf unsere Schüler und auf das bestehende Schulsystem hat sich seitdem stark gewandelt. Ich möchte von meinen Erfahrungen berichten und meine Sicht darlegen, wie Schule anders gestaltet werden kann.
Sabine Decker
Der Aufbau des Buches
Verschiedene Schulalltagsituationen, die wir als Lehrer aber auch als Schüler erlebt haben, stellten uns immer wieder vor ähnliche Fragen. Worum geht es eigentlich in dem Komplex Schule? Was wollen wir Lehrer? Was wollen unsere Schüler? Was wollen deren Eltern? Was ist also das Ziel unseres gemeinsamen Bestrebens?
Im ersten Teil beschreiben wir einige Spots aus dem Schulalltag und Begebenheiten, die uns immer wieder als Denkanstöße dienten. Dabei gehen wir in diesem Zusammenhang auf einige zentrale Kernpunkte des Schulwesens ein, die wir aus unserer persönlichen Sicht als Lehrer oder auch als ehemalige Schüler schildern. Hierbei erheben wir nicht den Anspruch auf Vollständigkeit der Beschreibung der derzeitigen schulischen Situation in unserem Lande. Vielmehr verstehen wir unsere Ausführungen als Denkanstöße teilweise erfolgreiche Strukturen noch mehr zu optimieren.
Um diese Gedanken immer wieder mit dem theoretischen Hintergrund der Lernphysiologie und Lernpsychologie zu reflektieren, haben wir im zweiten Teil dieses Büchleins einige theoretische Überlegungen aus dem Bereich der Entwicklungspsychologie und Neurobiologie ausgeführt.
Unser Hauptaugenmerk und Herzblut ist im dritten Teil dieses Büchleins zu finden, in der Vision „Neue Schule für ALLE“. Irgendwann im Laufe unserer zahlreichen Gespräche beschlossen wir unsere Gedanken niederzuschreiben und ein pädagogisches Konzept zu entwerfen. Wir hatten so viele Ideen, dass es anfangs gar nicht so leicht war, einen roten Faden zu finden. Doch wir schrieben stetig weiter, verwarfen Entwürfe, schrieben wieder neu, bis das Konzept so entstand, wie es im dritten Teil zu lesen ist. Dabei lernten wir, dass das Formulieren eines Konzeptes für ein lebendiges System, das ständig Veränderungen unterworfen ist und sich dynamisch immer stetig weiterentwickeln soll, nie fertig und vollständig sein wird. So bitten wir die unten aufgeführten Strukturen eher als eine grobe Startstruktur der Schule zu verstehen, die sich durch die steten, lebendigen Interaktionen mit besonders den Schülern dieser Schule noch in manchen Details verändern wird.
In vielen Gesprächen mit auch Außenstehenden, kamen viele Diskussionspunkte auf. Einige nach unserer Meinung wesentliche Fragen versuchten wir im vierten Teil unter den FAQs zu beantworten.
Erster Teil
Geschichten und Gedanken, die das Schulleben schreibt
Lehrer und Schüler reden aneinander vorbei
In meinem zweiten Jahr als gymnasiale Lehrkraft war ich die Klassenlehrerin einer 5. Klasse. Als Klassenleitung bekommt man einen deutlich intensiveren Kontakt zu seinen Schülern, da man während des Schuljahres mehr Zeit mit der Klasse verbringt, um auch organisatorische Dinge zu erledigen. So verbringt man unter anderem den Wandertag und eine Woche im Schullandheim zusammen.
In der 5. Jahrgangstufe war ich zudem mit sechs Wochenstunden Mathematik eingesetzt. Das ist relativ viel. In den oberen Jahrgängen hat man als Mathematiklehrer nur 3-4 Wochenstunden pro Klasse. Im Vergleich zur Grundschule ist das natürlich sehr wenig. Dort werden die Schüler in dieser Zeit hauptsächlich von einer Lehrkraft unterrichtet und betreut. Dadurch können sie einen engeren Bezug zur Lehrkraft - auch altersgemäß notwendig - aufbauen.
In dieser Jahrgangstufe ist mir am deutlichsten klargeworden, wie sehr sich die Bedürfnisse und Erwartungen der Kinder, wenn sie zu uns aufs Gymnasium kommen, von den Erwartungen vieler Lehrer unterscheiden.
Aus Sicht der Kinder betrachtet, beginnt ein großer neuer Lebensabschnitt. Weg von der Grundschule, in der alles noch recht überschaubar war. Eine Lehrerin, ein Klassenzimmer, man hatte seine Freundin oder Freund gefunden…. Im Gymnasium kommt zum Unterrichtsgong ständig ein anderer Lehrer. Auf jeden Lehrer muss man sich neu einstellen. Es dauert einige Zeit, bis man weiß, worauf er besonderen Wert legt. Auch muss man sich erst in dem riesigen Gebäude zurechtfinden. „Wo ist der Musiksaal? Wo muss ich für den Religionsunterricht hin? Den Weg zur Sporthalle habe ich vergessen!“





























