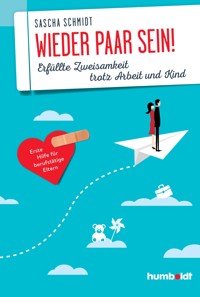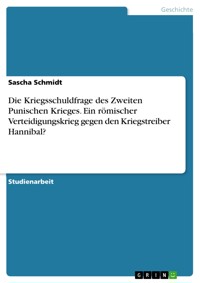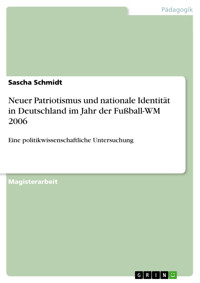
Neuer Patriotismus und nationale Identität in Deutschland im Jahr der Fußball-WM 2006 E-Book
Sascha Schmidt
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Didaktik - Politik, politische Bildung, Note: 1, Justus-Liebig-Universität Gießen (Institut für Politikwissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Als die Fußballweltmeisterschaft (WM) 2006 in Deutschland zu Ende ging, war dies auch das Ende einer 4-wöchigen Massen- und Medieneuphorie in Deutschland, die so kaum jemand erwartet hätte. Mit der Begeisterung der Deutschen für das deutsche Team ging auch ein unbeschwerter Umgang mit den Nationalstaatsfarben Schwarz-Rot-Gold einher, wie er seit 1990 nicht mehr zu beobachten war. Was war in den vier Wochen der WM geschehen? Handelte es sich nur um eine überdimensionale Party? Oder verdeutlichte sich während der WM 2006 ein bereits zuvor vollzogener ‚Wandel’ im Umgang mit der Nation, der zudem als Ausdruck der Zustimmung zum ‚neuen Patriotismus’ verstanden werden kann? Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit gilt der Frage nach den Kennzeichen und politischen Funktionen des ‚neuen Patriotismus’ und dem darin vorhandenen übergreifenden Interesse ein positives Verhältnis zur Nation und deren Geschichte zu fördern. Für die Herstellung eines positiven historischen Bezugs auf die Nation und Patriotismus wird dabei auf die Ideen und Vorstellungen des Patriotismus des 18./19. Jahrhunderts zurückgegriffen. Wird hierin vielfach doch ein aufgeklärtes und freiheitlich-demokratisches Gesellschaftsverständnis gesehen. Aufgrund dessen gilt das erste Kapitel den zentralen (historischen) Begriffen und ihren Konzepten. Die zentrale Frage hierbei ist, wie der negativ verstandene Nationalismus vom positiv gedeuteten Patriotismus historisch abzugrenzen versucht wird. In Kapitel zwei wird der Frage nachgegangen, wie es dazu kam, dass ein einst vermeintlich kritisches Verhältnis zur Nation in der BRD der unbefangenen Handhabung von 2006 wich. Die Blicke richten sich hier auf zentrale Diskurse und Debatten um Patriotismus und nationale Identität seit Entstehen der BRD (mit einem besonderen Schwerpunkt auf die Zeit ab 1982 bis 2006). Darauf erfolgt in Kapitel drei eine qualitative Analyse der Diskurse um den ‚neuen Patriotismus’ um das Jahr 2006. Einhergehend mit der Betrachtung verschiedener zentraler Aspekte des ‚neuen Patriotismus’ soll den Fragen nachgegangen werden, ob der ‚neue Patriotismus’ im Jahr der WM tatsächlich das Potential zur Förderung von Weltoffenheit, Toleranz und demokratischem Bewusstsein aufweisen konnte. Mittels der Untersuchung der Debatten um die GEW-Broschüre "Argumente gegen das Deutlandlied" wird zudem dargelegt werden, dass Kritik an der verm. Weltoffenheit des deutschen Patriotismus keinerlei Gehöhr finden konnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Page 1
Page 3
3. Der Diskurs um den ‚neuen Patriotismus’ in Deutschland66 3.1 Parteipolitische Positionen und die Bedeutungszunahme des ‚neuen Patriotismus’
3.2 Vom ‚Gemeinwohl’ des Patriotismus in einer globalisierten Welt 3.2.1 Wirtschaftspolitische Motivationsappelle an die Gemeinschaft 69 3.2.2Du bist Deutschland- Weltoffener Standortnationalismus? 72
3.2.3 Traditioneller Nationalismus und Standortnationalismus im Wechselverhältnis
3.3 Vom Selbstverständnis des ‚neuen Patriotismus’ in Deutschland 3.3.1 Die historische Abgrenzung des Patriotismus vom Nationalismus 75 3.3.2 ‚Normalisierung’ durch Historisierung - Vom neuen historischen Selbstbewusstsein deutscher Patrioten 77
3.3.3 Die ‚neue’ Liebe zum Vaterland - Abkehr von Verfassungspatriotismus und post-nationaler Identität 78
3.3.4 Aufgeklärter Patriotismus - Fern von jeglichem Nationalismus? 82
3.4 Die Fußball-WM 2006: Ausdruck eines ‚neuen weltoffenen Patriotismus’?
3.4.1 „Die Welt zu Gast bei Freunden“ 3.4.2 Fußball und Politik in Deutschland. Vom Spannungsverhältnis nationaler und transnationaler Identitäten 87
3.4.3 Die WM im Rückblick - Ein nationales Erweckungserlebnis
3.4.4 Ausgrenzender Nationalismus während der WM
3.4.5 Der ‚Hymnendiskurs’ als Ausdruck des nationalen Selbstverständnisses 93
Schlussbemerkung
Literatur3
Page 4
Einleitung
Als die Fußballweltmeisterschaft (WM) 2006 in Deutschland zu Ende ging, war dies auch das Ende einer 4-wöchigen Massen- und Medieneuphorie in Deutschland, die so kaum jemand erwartet hätte. Mit der Begeisterung der Deutschen für das deutsche Team als auch das Mega-Sportereignis ging ein unbeschwerter Umgang der Deutschen mit den Nationalstaatsfarben Schwarz-Rot-Gold einher, wie er seit der Wiedervereinigung nicht mehr zu beobachten war. Was war in den vier Wochen der WM geschehen? Handelte es sich nur um eine überdimensionale Party, deren Dynamik - mit Hilfe des ‚Volkssports’ Fußball - alle Bevölkerungsschichten mitriss? Oder verdeutlichte und verdichtete sich während der WM 2006 ein bereits zuvor vollzogener ‚Wandel’ im Umgang mit der Nation, der zudem als Ausdruck einer breiten Zustimmung zum so genannten ‚neuen Patriotismus’ verstanden werden kann?
Diskussionen darüber bestimmten noch Monate nach der WM die deutsche Medienlandschaft. Deutungs- und Anknüpfungsversuche gegenüber dem konstatierten ‚neuen Patriotismus’ bleiben vor allem durch Parteienvertreter1der so genannten Mitte sowie diverse Feuilletonpublizisten gegenwärtig. Dies verwundert insofern nicht, da die Debatten um jenen ‚neuen Patriotismus’ dem WM-Patriotismus faktisch vorausgingen und insbesondere von Politikern vornehmlich aus dem konservativen Spektrum als auch einigen populären Publizisten vorangetrieben wurden. In diesen zumeist aus einer affirmativen Position gegenüber den Entwicklungen geführten Debatten wird besonders die Frage nach der Nachhaltigkeit des ‚neuen Patriotismus’ in der Bevölkerung gestellt, die auch mehr als ein Jahr nach Beendigung der WM weiterhin nur spekulativ beantwortet werden kann. Aus diesem Grund wird die Frage nach der Nachhaltigkeit des ‚neuen Patriotismus’ nicht im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen, auch wenn in der Abschlussbetrachtung eine Einschätzung über sie ihren Platz finden soll.
Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit ist vielmehr auf die Frage nach den Kennzeichen des ‚neuen Patriotismus’, der bereits einige Jahre vor Beginn der WM diskutiert wurde, gerichtet. Vorweggenommen werden kann, dass das übergreifende Interesse der ‚neuen Patrioten’ klassischerweise hauptsächlich darin liegt, ein positives Verhältnis zur Nation und deren Geschichte zu formulieren und zu fördern. Damit verbindet sich die Vorstellung von einer nationalen Identität der Deutschen, die es zu betonen und zu bewahren gelte. Für die Herstellung dieses positiven Bezugs auf die Nation und deren Geschichte wird vor allem auf die Ideen und Vorstellungen des nationalen Patriotismus des 18. und 19. Jahrhunderts zurückgegriffen. In diesem sehen viele ‚neue Patrioten’ ein aufgeklärtes und freiheitlichdemokratisches Gesellschaftsverständnis. Dieser Rückgriff auf die Geschichte macht es notwendig - will man dem Phänomen Patriotismus auf die Spur kommen - sich mit den historischen Begriffen und ihren Konzepten auseinander zu setzen. Vor dem Hintergrund der historischen Erfahrungen mit dem Nationalismus in Deutschland -und speziell mit dessen Kulminationspunkt, dem Faschismus -, stellt sich die Frage, wie Patriotismus von diesen negativen Ausformungen unterschieden und abgegrenzt werden soll. Diese Fragen sollen ebenso im ersten Kapitel diskutiert werden wie die Definitionsproblematiken um die Begriffe Patriotismus, Nationalismus, Nation und nationale Identität. Bei der Thematisierung der Begriffe sollen zudem theoretische Grundlagen geschaffen werden, die für den weiteren Verlauf der Arbeit und den Umgang mit den Begriffen unabdingbar sind. Darüber hinaus soll der Frage nachgegangen werden, ob die positive Darstellung des Patriotismus im 18. und 19. Jahrhundert in ‚Deutschland’, wie sie
1Da in dieser Debatte um Patriotismus nahezu ausschließlich Männer zu Wort werde ich die Akteure im Allgemeinen in rein männlicher Form, also ohne jenes große ‚I’, das beide Geschlechter in der Sprache präsent machen will, bezeichnen. Hierbei geht es keineswegs um das Verschweigen der Beteiligung von Frauen am Diskurs, als vielmehr auf die absolute Männerdominanz in diesem Diskurs hinzuweisen. Die Verwendung des großen ‚I’ wird in diesen Fällen als sinnvoll erachtet, in denen Frauen tatsächlich auch beteiligt sind.
Page 5
von ‚neuen Patrioten’ vorgenommen wird, es überhaupt ermöglicht, diesen vom negativ verstandenen Nationalismus inhaltlich und zeitlich abzugrenzen. In diesem Zusammenhang stellt sich letztlich auch die Frage - insbesondere durch den Rückgriff auf die Geschichte -, was an dem jüngst diskutierten Patriotismus ‚neu’ sein soll.
Anschließend, im zweiten Kapitel der Arbeit, sollen zunächst jene diskursiven Grundlagen thematisiert werden, die für das Verständnis bezüglich der Auseinandersetzung mit dem ‚neuen Patriotismus’ als auch für verschiedene Unterdiskurse als notwendig erachtet werden. Es soll der Frage nachgegangen werden, wie es dazu kam, dass ein einst (mehr oder weniger) vorhandenes kritisches Verhältnis zur Nation in Deutschland jüngst einer unbefangenen Handhabung wich. Dass jedoch nach wie vor ein solch legerer Umgang mit Nationalstaatssymbolen (wie bspw. der Flagge) in der Öffentlichkeit nicht als Normalzustand betrachtet wird, wurde in Anbetracht der Reaktionen während der WM deutlich. Der nahezu gesamtgesellschaftliche Zuspruch zum ‚neuen Patriotismus’ und die Ausmaße der WM-Euphorie hatten die gesamte bundesrepublikanische Öffentlichkeit - von Politikern über das breite Medienspektrum bis in verschiedenste kulturelle Kreise - auffallend stark überrascht. Die Reaktionen waren jedoch spektrenübergreifend überwiegend positiv, galt bis dahin Deutschland doch weiterhin als „schwieriges Vaterland“ (Gustav Heinemann), welches von der historischen Last des deutschen Faschismus in seinem Verhältnis zur Nation belastet schien. Um zu verstehen, wie es trotz diesen Einschätzungen zum ‚neuen Patriotismus’ kommen konnte, sollen einige zentrale bundesrepublikanische Diskurse betrachtet werden. Der Schwerpunkt soll hierbei, nach einem kurzen einleitenden Blick auf die früh-bundesrepublikanische Entwicklung, auf den Renationalisierungs- und Identitätsdebatten sowie den geschichtspolitischen Diskursen infolge der Regierungsübernahme durch Helmut Kohl 1982 liegen. Anschließend sollen jene Diskurse mit den aktuellen Diskursen zum ‚neuen Patriotismus’ verknüpft werden. Dies soll vor allem anhand der Betrachtung jüngerer Identitäts- und Normalisierungsdebatten, die vornehmlich von der CDU/CSU-Union nach dem Gang in die Opposition 1998 initiiert wurden, geschehen. Denn viele dieser Kampagnen, insbesondere jene um eine ‚Leitkultur’, wurden kontinuierlich mit Forderungen nach einem ‚neuen Patriotismus’ verbunden. Einige der betrachteten Diskurse und Debatten können darüber hinaus als relevante inhaltliche (Teil-)Aspekte des ‚neuen Patriotismus’ verstanden werden als auch als Ausdruck des politischen und gesellschaftlichen Klimas. Im dritten Kapitel soll schließlich eine qualitative Auseinandersetzung, anhand zahlreicher wissenschaftlicher Beiträge und parteipolitischer Patriotismusproklamierungen, mit dem ‚neuen Patriotismus’ vollzogen werden. Einhergehend mit der Betrachtung verschiedener zentraler Aspekte des ‚neuen Patriotismus’ soll den Fragen nachgegangen werden, wie die ‚neuen Patrioten’ die Abgrenzung zum Nationalismus vollziehen und ob der ‚neue Patriotismus’, dem - von Seiten der Befürworter - das Potential zur Förderung von Weltoffenheit, Toleranz und demokratischem Bewusstsein zugesprochen wird, dieses erfüllen kann. Dabei stellt sich insbesondere die Frage, wie die Protagonisten des ‚neuen Patriotismus’ die Forderungen zur Bewahrung der nationalen Identität mit Weltoffenheit, Toleranz und demokratischem Bewusstsein verknüpfen. Zudem gilt es zu fragen, welche Rolle die ‚Last der Vergangenheit’ in den gegenwärtigen Debatten noch spielt?
Ein besonderes Augenmerk gilt den Funktionen bzw. den Potentialen, die dem Patriotismus, von dessen Befürwortern zugesprochen werden. Vornehmlich handle es sich hierbei um die Möglichkeit, den Zusammenhalt einer scheinbar fragmentierten Gemeinschaft zu sichern als auch dem Interesse am Gemeinwohl verpflichtet zu sein. Doch inwiefern kann und soll der ‚neue Patriotismus’ dies leisten?
Im Anschluss daran, also im zweiten Teil des dritten Kapitels, soll der Blick auf die Fußball-WM 2006 in Deutschland gerichtet werden. Hierbei soll dargestellt werden, dass die - im Vorfeld geförderte und geforderte und letztlich zu verzeichnende - nationale WM-Euphorie und Partystimmung eine mehrfach bedeutsame Funktion für das gegenwärtig präsentierte Bild
Page 6
Deutschlands als weltoffene und gastfreundliche Nation hatte. Es gilt einerseits den Interessen zur Förderung des Nationalbewusstseins und der Akzeptanz gegenüber einem ‚neuen Patriotismus’ nachzugehen wie andererseits der Frage, ob das während der WM medial erzeugte Bild Deutschlands tatsächlich als Spiegelbild der Gesellschaft gedeutet werden kann. Die enorme Bedeutung der Konstruktion der modernen und weltoffenen Nation soll abschließend anhand der Betrachtung des Diskurses um die Kritik am ‚Lied der Deutschen’, die von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) während der WM geäußert wurde, verdeutlicht werden.
Im Blickfeld dieser Arbeit stehen ausschließlich die Debatten, Diskurse und Positionen der Parteien sowie jene von Wissenschaftlern und Publizisten aus der so genannten gesellschaftlichen Mitte. Dies erklärt sich dadurch, dass der Diskurs um den ‚neuen Patriotismus’ von der traditionell-konservativen Parteienunion von CDU/CSU initiiert wurde und im öffentlich geführten Diskurs ausschließlich Positionen aus der so genannten demokratischen Mitte zu Wort kommen. Dass Positionen extrem rechter Parteien nicht in den öffentlichen Diskurs mit einfließen ist bereits als deutlicher Ausdruck der vorherrschenden Trennung eines Patriotismus der ‚Mitte’ vom Nationalismus der extremen Rechten zu werten. Doch weder soll in dieser Arbeit dieser vereinfachenden Trennung gefolgt werden noch die Relevanz verschiedener rechter Strömungen für diesen Diskurs und keineswegs die zunehmende Relevanz von extrem rechten Parteien, Spektren oder Einstellungen in der Bevölkerung - und damit auch für die politische Kultur - negiert werden. Sofern der Blick auf die Entwicklungen des Rechtsextremismus gerichtet ist, soll dies lediglich dazu dienen auf das Wechsel- bzw. Spannungsverhältnis von Rechtsextremismus und demokratischer Mitte zu verweisen.
Keine Beachtung soll in dieser Arbeit der inhaltlich-demokratischen Substanz der Parteien der so genannten Mitte zu Teil werden. Diese spannende Frage, u.a. im Hinblick auf die zahlreichen Grundgesetzänderungen, den damit einhergehenden Beschneidungen von Grundrechten in den vergangenen Jahren als auch die Gefahr für die Demokratie durch einen weit verbreiteten Zuspruch zu nationalistischen Einstellungsmustern, würde den Umfang dieser Arbeit schlicht sprengen. Jedoch soll zumindest die Frage angerissen werden, welche Bedeutung der Demokratie und dem Grundgesetz im gegenwärtigen Diskurs um den ‚neuen Patriotismus’ zugesprochen wird.
Da der Diskurs um den ‚neuen Patriotismus’ ein innerpolitischer bzw. innergesellschaftlicher Diskurs über das nationale Selbstverständnis ist, sollen Analysen über die bundesdeutsche Außenpolitik, trotz zunehmender geopolitischer Machtambitionen der BRD, ebenfalls in den Hintergrund der Betrachtung treten. Dies soll jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass verschiedene außenpolitische Entwicklungen ebenso wie vielfältige Globalisierungs- und Denationalisierungsprozesse (beispielsweise der zunehmende transkulturelle Austausch und die weltweit gestiegenen Migrationsströme als auch die Verlagerung von nationalstaatlichen Souveränitätsrechten auf supranationale Institutionen) eine direkte Rolle für den Diskurs spielen. Denn einerseits gehen mit diesen Entwicklungen vielfältige Warnungen gegenüber einem vermeintlichen Verlust von nationalstaatlicher Binde- und Integrationskraft einher; andererseits lassen sich in großen Teilen der Bevölkerung tatsächlich zunehmende Orientierungs- und Existenzängste registrieren. Wenn auch diese Entwicklungen in dieser Arbeit lediglich als Hintergrunderkenntnisse verbleiben, liegen doch hier vielfach die Anknüpfungspunkte für nationalistische Kampagnen.
Page 7
1. Patriotismus oder Nationalismus?
1.1 Forschungs- und Definitionsschwierigkeiten
Wenn man sich mit dem Begriff des nationalen Patriotismus2auseinandersetzen will, kommt man am Begriff des Nationalismus nicht vorbei. Dies erklärt sich schlicht dadurch, dass unter beiden Begriffen - sowohl historisch als auch gegenwärtig - „mehrdimensionale spezifische nationsbezogene Überzeugungs-, Ideologie- und Verhaltenssysteme“ verstanden werden, „die nicht nur auf die Unterstützung spezifischer politischer Systeme und Regime, sondern auch im Hinblick auf die Unterstützung der gesamten Nation konzipiert“ (Blank 2002, 28) sind. Mit dieser Gemeinsamkeit von Patriotismus und Nationalismus ist - bezüglich der Fragen nach den Definitionen und einer möglichen Trennung der beiden Begriffe - gleichzeitig das zentrale Problem angesprochen: Wenn Patriotismus und Nationalismus in einem untrennbaren Verhältnis zum Gemeinschaftskonzept der Nation bzw. zum Nationalstaat stehen, was genau unterscheidet sie dann? Ist es überhaupt möglich beide Begriffe qualitativ und/oder zeitlich voneinander zu trennen? Erschwert wird diese Frage nach der Unterscheidung durch die Erkenntnis, dass beide Begriffe seit dem 18. Jahrhundert - dem Jahrhundert der Entstehung der Idee der modernen Nation - im politischen Sprachgebrauch vielfach synonym verwendet wurden. Das damit einhergehende Problem einer sowohl historischen als auch strukturellen Trennung hat sich bis heute kaum verändert.
In der deutschsprachigen Politikwissenschaft hat sich jedoch der Begriff des Nationalismus gegenüber dem älteren Begriff des Patriotismus durchgesetzt. Dies lässt sich insbesondere historisch begründen. Während der Begriff Nationalismus verdeutlicht, dass dieser stets auf die Idee von der Nation bezogen war, galt die Loyalität des Patrioten seit dem 16. Jahrhundert - also vor der Entstehung der Idee der Nation - zunächst den damaligen Fürstentümern (vgl. KLUGE 2002, 686). Das Vaterland war dabei vornehmlich der ‚eigene’ Herrschaftsbereich. Diesbezüglich spricht man rückblickend in Deutschland auch vom Reichspatriotismus. Erst mit dem Aufkommen der Idee der Nation - im 18. Jahrhundert - konnte sich überhaupt ein nationaler Patriotismus entwickeln. Die Übergange und Loyalitäten waren, wie zu zeigen sein wird, jedoch fließend. Um jedoch das Wort Nationalismus aufgrund der negativen historischen Erfahrungen mit diesem zu vermeiden, wird gegenwärtig wieder auf den älteren Begriff des Patriotismus zurückgegriffen. Dieser wird weitgehend als positive Vaterlandsliebe begriffen. Damit soll eine Abgrenzung zum vielfach negativ verstandenen Nationalismus vollzogen werden, da dieser zu autoritär-hierarchischen Gesellschaftsvorstellungen neigt. Diese Unterscheidung ermöglicht es, dem negativ verstandenen Nationalismus eine positive, als grundsätzlich demokratisch-orientiert dargestellte Variante gegenüber zu stellen. Dies wird sowohl im Diskurs zum ‚neuen Patriotismus’ als auch im Rekurs auf den Patriotismus des 18. und 19. Jahrhunderts, der die Grundlage des gegenwärtigen Patriotismusverständnisses darstellt, deutlich. Dieser Rekurs ist zugleich auch mit der Intention verbunden, nicht nur die Liebe zur Nation, sondern auch den Bezug zur Geschichte neu zu betonen. Daher erscheint - neben der Auseinandersetzung mit den Begriffen Patriotismus und Nationalismus - auch ein Blick auf das dazugehörige Begriffsnetz, in das die Begriffe Nation, nationale Identität, Volk und Ethnie eingebunden sind, notwendig. Die Klärung dieser Begriffe ist darüber hinaus auch deswegen von Relevanz, als damit der Frage nachgegangen wird, ob das von den Befürwortern des ‚neuen Patriotismus’ anvisierte Gemeinschaftskonzept einer „weltoffenen Nation“ (Kronenberg 2006a), welche die Grundlage für einen ‚aufgeklärten Patriotismus’ darstellen soll, möglich erscheint. Hierbei soll zudem der Frage nachgegangen welche Bedeutung bzw. Funktion die Vorstellung einer
2Nachfolgend wird auf das Adjektiv national verzichtet. Gemeint ist jedoch stets der an der Nation orientierte Patriotismus - entgegen dem vor-nationalem Verständnis von Patriotismus, auf das jedoch in Kapitel 1.5.1 eingegangen wird.
Page 8
nationalen Identität, die vielfach als Ausdruck eines nationalen ‚Wesens’ verstanden wird, einnimmt.
In der historischen Auseinandersetzung mit Patriotismus und Nationalismus soll gezielt die Entwicklung der deutschen Nationalbewegung betrachtet werden. Da sich der positive Rekurs in der Diskussion zum ‚neuen Patriotismus’ lediglich auf die Entstehungsphase und die nachfolgende Entwicklung der Nationalbewegung im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation bis maximal zur Errichtung des ersten deutschen Nationalstaates 1871 richtet, wird der Blick in dieser Arbeit folglich ebenso nur auf diesen Zeitraum gerichtet sein. Darüber hinaus sollen jedoch nur die mit der Nationalstaatsgründung zusammenhängenden Besonderheiten beleuchtet werden. Auf eine detaillierte Beschreibung der Nationalstaatsentwicklung wird ebenso verzichtet wie auf eine genauere Betrachtung der Zeit nach der Entstehung des deutschen Nationalstaates, also auch der Weimarer Republik und des deutschen Faschismus3. Die hier vorgenommene Betrachtung des deutschen Nationalismus soll sich also insbesondere der Frage nach der Möglichkeit zur historischen Trennung von Patriotismus und Nationalismus widmen. Hierfür sollen zunächst verschiedene Nationalismustypologisierungen betrachtet werden, die für die beschriebene gängige Unterscheidung kennzeichnend sind bzw. einen besonderen Stellenwert einnehmen. Bezüglich dieser Auseinandersetzung ist es meines Erachtens zwingend notwendig, stets auch auf die Interessen, Ideen und Ziele der sozialen Trägerschaften im deutschen Nationalismus bzw. Patriotismus einzugehen. Denn nur anhand dieser Betrachtung, wenn dies auch aus Platzgründen nur skizzenhaft möglich ist, erscheint die Auseinandersetzung mit der Charakterisierung des Nationalismus bzw. Patriotismus, wie sie von Patriotismusbefürwortern vollzogen wird, sinnvoll.
In dieser Arbeit wird - der Nationalismusforschung folgend - dem Begriff des Nationalismus der Vorzug vor dem Patriotismusbegriff gegeben. Folgerichtig erfolgt zunächst eine Definitionsgrundlage des modernen Nationalismus. Sofern in dieser Arbeit von Patriotismus gesprochen wird, dient dies der expliziten Unterscheidung und Abgrenzung des Patriotismus vom Nationalismus, wie sie von Patriotismusbefürwortern vorgenommen wird bzw. wie dieser historisch verwendet und definiert wird. Diese Patriotismusdefinitionen werden stets in der Auseinandersetzung mit dem Nationalismus und der geschichtlichen Entwicklung geführt, weshalb auf eine gesonderte Definition des Patriotismus verzichtet werden soll. Grundsätzlich kann diesbezüglich festgehalten werden, dass sowohl für die Begriffe Nationalismus und Patriotismus wie auch für die damit in Verbindung stehenden Termini Nation, nationale Identität und Nationalstaat innerhalb der Wissenschaft sich bis heute noch keine weitläufig anerkannten Definitionen durchgesetzt haben. Dies gilt insbesondere für den Begriff des Nationalismus, der, so Peter Alter, „einer der inhaltlich vieldeutigsten ist, den es heute in unserem politischen und wissenschaftlichen Sprachgebrauch gibt“ (Alter 1985, 10). Ein Blick auf die große historische und politische Spannbreite der Verwendung der Begriffe, die in Deutschland vom ‚Patriotismus’ in den Reichsgebieten bis zur Verwendung des Begriffs im Kontext des deutschen Faschismus reicht, macht die begriffliche Vieldeutigkeit ersichtlich. Bei der Auseinandersetzung mit den Begriffen ist allerdings deutlich geworden, dass gerade viele Patriotismusdefinitionen von affirmativen Haltungen gegenüber dem
Gemeinschaftskonzept der Nation durchzogen sind. Dies versperrt jedoch, wie noch zu zeigen sein wird, einen kritischen Zugang zum Patriotismus (vgl. Herrmann 1996, 15).4Der
3In dieser Arbeit wird der Begriff des deutschen Faschismus dem des Nationalsozialismus vorgezogen. Der Begriff des Faschismus kennzeichnet m. E. wesentlich eindeutiger als die nazistische Eigenbezeichnung das von 1933-45 in Deutschland existierende System. Dennoch wird auch der Begriff des Nationalsozialismus hier aufgrund seiner Geläufigkeit im deutschen Sprachgebrauch zwangsläufig seinen Einzug finden.
4Hans Peter Herrmann hat diesen problematischen Umgang anhand verschiedener Versuche der Wissenschaft beobachten können, in den es um neue Erkenntnisgewinne über den Patriotismus in Deutschland ging (vgl. Herrmann 1996, 15)
Page 9
Verdacht der Ideologie erscheint in diesem Kontext besonders dann gerechtfertigt, wenn es in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung um die „Rekonstruktion des historischen Patriotismus-Begriffs in gegenwartsbezogener Absicht“ (Kronenberg 2006a, 22) geht. Spätestens hierbei zeigt sich, dass die Erkenntnisse der ideologiekritischen neuen Nationalismusforschungen5in dieses Vorhaben nicht miteinbezogen werden.
1.2 Grundthesen zum modernen Nationalismus
Entgegen den Vorstellungen der alten Nationalismusforschung wird die Geburt des modernen Nationalismus6- von Seiten der neuen Nationalismusforschung - im 18. Jahrhundert verortet. Die Vertreter der neuen Forschung konnten nachweisen, dass der Nationalismus ein Geschöpf der Moderne ist, für die es keinerlei historische Präzedenzfälle gab (vgl. Hobsbawm 2005, 58ff.). Erst mit der Unabhängigkeitserklärung der USA (1776), vor allem jedoch in Folge der so genannten Großen Revolution in Frankreich (1789) konnte die Idee der souveränen Nation als zentrales Merkmal des Nationalismus ihren - aus heutiger Sicht - weltweiten Siegeszug antreten. Diesen Erkenntnissen folgend sollte die Entstehung des Nationalismus stets vor dem Hintergrund der zahlreichen Modernisierungsprozesse und -krisen des 18. Jahrhunderts betrachtet werden. Dabei stellen sowohl die Ideen der Aufklärung - inklusive des damit einhergehenden Verfalls der religiösen Hegemonie sowie der Hinterfragung der Legitimation der alten Ordnung - als auch die Industrielle Revolution - als Ausdruck der „Dynamik des kapitalistischen Entwicklungsprozesses“ (Fritzsche 2000, 183) und die damit verbundene Ausbildung der bürgerlichen Gesellschaft, samt der (schleichenden) Ablösung des Feudalismus - die entscheidenden Faktoren dar (vgl. bspw. Anderson 1988, Hobsbawm 2005, Gellner 1991, Deutsch 1972).7Die Erkenntnis, dass der Nationalismus also ein Produkt der Moderne ist, verhilft eine neue Perspektive einzunehmen, die verdeutlicht, dass „es der Nationalismus [ist], der die Nationen hervorbringt und nicht umgekehrt“ (Gellner 1995, 87). Damit brachen die genannten Vertreter der neuen Nationalismusforschung mit der bis dahin weitläufig verbreiteten Vorstellung, „Nationen seien historisch notwendige, aus dem geschichtlichen Prozeß gleichsam von selbst herausgewachsene Gebilde und der Nationalismus Begleiterscheinung dieser Entwicklung“ (Hermann 1996, 8). Die Vertreter der Aufklärung Mitte des 18. Jahrhunderts im (vor-)revolutionären Frankreich, die Fortschritt, Vernunft und Rationalismus proklamierten, waren von einem egalitären Gesellschaftsverständnis, der Idee der Volkssouveränität, angetrieben. Nicht mehr nur die herrschenden Stände wurden als Nationsmitglieder definiert, sondern alle Gesellschaftsmitglieder, besonders auch der ‚Untertanenverband’, der so genannte Dritte Stand (vgl. Döhn 2000, 402).8Das moderne Nationenverständnis9begriff folgerichtig alle
5Zeitlich können die Anfänge der neuen Nationalismusforschung in den 1980ern verortet werden. Zu bahnbrechenden Erkenntnissen kamen die auch hier zitierten Arbeiten von Benedict Anderson, Ernest Gellner und Eric Hobsbawm.
6Nachfolgend wird der Begriff stets ohne das Attribut ‚modern’ verwendet. Der einmalige Gebrauch an dieser Stelle soll lediglich auf die Verwendung des Begriffs im Kontext der Moderne (und als Phänomen dieser) hinweisen.
7Eine ausführliche Analyse des Zusammenhangs von Nationalismus und Modernisierung würde über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen.
8Als Begründer des modernen Nationenbegriffs gilt Jean-Jacques Rousseau. Dieser lehnt in seiner SchriftDu contrat social ou principes du droit politique(1762) die Identifikation der Nation mit dem Monarchen und dem Adel ab und befürwortet die Identität von Volk und Nation (vgl. Öner 2002, 19). Diese Perspektive brachte nicht nur Forderungen nach Volkssouveränität auf den Weg, sondern sie initiierte auch die grundlegende Hinterfragung der bis dahin „anerkannten soziokulturellen Muster der Weltdeutung“ (Wehler 1996, 165). Insbesondere die im absolutistischen Frankreich 1789 verfasste SchriftQu’est-ce que le Tiers État?von Emmanuel Joseph Sieyès, die auf den bis dahin faktischen Ausschluss des Dritten Standes (der etwa 98% der Bevölkerung ausmachte) von gesellschaftspolitischen Entscheidungen aufmerksam machte, wird ein weit reichender Einfluss auf die Entwicklung der Französischen Revolution zugesprochen. Sieyès stellte die
Page 10
Mitglieder der Nation als politisch gleichberechtigt. Allen Mitgliedern sollten die gleichen Menschen- und Bürgerrechte sowie die gleichen Pflichten zuteil werden10. Die nationale Idee mit ihren Forderungen zur Demokratisierung des Staates zielte damit auf nicht weniger ab als auf die Ablösung der ständischen Gesellschaftsordnung. Folglich hatte diese „Verschmelzung der Theorie des Nationalismus mit der viel älteren Lehre von der Volkssouveränität […] revolutionäre Implikationen, da sie das Aufkommen einer wesentlich weltlichen Gesellschaft mit einem universell anerkannten Wertesystem gestattete“ (Neumann 1984, 135). Die postulierten Gleichheits- und Partizipationsversprechen verhalfen dem Nationalismus zu einer Einheit stiftenden Kraft sowie zu einer neuen Sinngebungs- und Rechtfertigungsinstanz zu werden, vor allem nach der Ablösung der alten Dynastien (vgl. Wehler 1996, 166). Neben den politischen Gleichheitsversprechen sind jedoch auch die sozioökonomischen, vermeintlich klassenübergreifenden Integrations- und Sicherheitsversprechen ein wesentlicher Aspekt, die vor allem im Zuge der Industriellen Revolution dazu führten, dass immer mehr Menschen für die nationale Idee gewonnen werden konnten (vgl. Deutsch 1972, 27). Für Norbert Elias entwickelte sich im Nationalismus schließlich „eines der mächtigsten, wenn nichtdasmächtigste soziale Glaubenssystem des 19. und 20. Jahrhunderts“ (Elias 1990, 194; Hervorhebung im Original). Diesem sollte es schließlich gelingen, sich weltweit als „Instrument [der] politischen Solidarisierung und Aktivierung von Menschen“ (Öner 2002, 24) durchzusetzen. Die enorme emotionale Binde- und Integrationskraft der Nation erklärt sich zudem mit der Suche der Menschen nach neuen Bindungen infolge der gesellschaftlichen Umwälzungen und der Modernisierungsprozesse (vgl. Anderson 1988, 21). Das vorrangige politische Ziel des Nationalismus war zunächst die Errichtung eines selbstbestimmten und souveränen Nationalstaates. Sofern ein Staat oder ein Reich bereits existierte, ging es vor allem um die Erlangung der vollständigen (Volks-)Souveränität und der Kontrolle über die staatlichen Institutionen durch die Nation. Es galt die Deckungsgleichheit politisch-territorialer Einheiten mit der Nation herzustellen (vgl. Deutsch 1972, 27f.). Die Vorstellungen darüber, was die Nation als soziale Großgruppe eine und begründe, artikulierte der Nationalismus stets anhand von objektivistischen politischen sowie auch ethnischkulturellen Merkmalen (vgl. Gellner 1995, 8). Diese Vorstellungen wurden durch die Vertreter der Nationalbewegung formuliert. Die soziale Trägergruppe des frühen Nationalismus des 18. Jahrhundert entstammte zunächst den Kreisen des aufsteigenden Bürgertums. Aufgrund seiner herausgehobenen Stellung und dem damit verbundenen Zugang zu Bildung und Literatur war es dem Bürgertum vorbehalten nicht nur die Ideen der Aufklärung, sondern auch die nationale Geschichts- und Mythenbildung zu verbreiten (vgl. Anderson 1988, S.27ff.). Insbesondere die Erfindung der Mythen, welche die Wurzeln der Nation in der Vergangenheit verortet, half der nationalistischen Ideologie die Identifikationslücke zu füllen, die die Ablösung der alten Gesellschaftsordnung hinterlassen hatte. Denn die Konstruktion einer gemeinsamen Geschichte diente, wie Eickelpasch und Rademacher darstellen, dazu „den einzelnen Individuen das Gefühl einer zeitlichen Einbettung in einen kollektiven Gang der Geschichte zu vermitteln, sie erklärt, warum etwas so und nicht anders ist und darum nicht verändert werden darf“ (Eickelpasch/Rademacher 2004, 69). So hat insbesondere das Verständnis von der Nation, als vorpolitische und „quasinatürliche“ (Wehler 2001, 7) Einheit das Gefühl einer schicksalhaften Verbundenheit der
Forderung diesen in die politische Organisation zu integrieren. Die Nation sollte zur obersten Legitimationsinstanz der modernen bürgerlichen Gesellschaften werden.
9Vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit bedeutete Nation, abgeleitet vom lateinischen Begriffnasci(geboren werden) soviel wie Stamm oder Abstammungsgemeinschaft. In dieser Zeit wurde der Begriff Nation sowohl als grobe Herkunftsbezeichnung verwendet, als auch für die Ständische Vertretung (wie bspw. die Generalstände in Frankreich oder die Reichsstände im Gebiet des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation) benutzt (vgl. Weidinger 2002, 11).
10In vielen Staaten bzw. Nationalstaaten ließ die Gleichberechtigung jedoch noch lange auf sich warten bzw. musste von Frauen erst erkämpft werden.
Page 11
einzelnen Nationsmitglieder untereinander hervorgerufen. Doch erst die Verbreitung der nationalen Ideen, Vorstellungen und Mythen lies den Nationalismus zu einer „von breiten Schichten getragenen politischen Bewegung [werden], welche die Bindung an die Nation zur höchsten gesellschaftlichen Bindung überhaupt erklärt[e]“ (Alter 1985, 60).11Damit wurde die Schaffung eines Nationalstaates, die Erlangung der nationalen Einheit gewissermaßen zu einer missionarischen Bestimmung. Indem diese vermeintlich natürliche Bindung zur Nation sich mit den postulierten Gleichheits- und Partizipationsversprechen verband, galt die Nation sowohl als Schicksals- wie auch als Solidargemeinschaft.
Aufgrund des postulierten Gleichheits- und Absolutheitsanspruchs der Idee der Nation wurde diese zu einem interessen- und ideologieübergreifenden Wertesystem. Aufgrund dieses Anspruchs konnten in der Folge alle sozialen, politischen, religiösen, kulturellen und ökonomischen Interessen und Differenzen sowie divergierende Solidarverbände ebenso wie abweichende Identitäten integriert, jedoch auch untergeordnet, überwölbt und homogenisiert werden (vgl. Langewiesche 1994a, 5). Indem diese Vorstellungen schließlich auf bereits existierende organisierte Herrschaftsgebilde bzw. gerade erschaffene (National-)Staaten übertragen wurden, konnte diesen damit eine weitreichende Legitimation verschafft werden. Mit dieser nach innen gerichteten nationalen Homogenisierung gingen jedoch auch stets Konflikte einher, anhand derer schließlich auch das ambivalente Verhältnis des Nationalismus und der Nation zum modernen emanzipatorisch-demokratischen Universalismus und der Aufklärung deutlich wurde (vgl. Öner 2002, 26). Denn die revolutionären Ideale forderten zwar universelle Geltung, doch ihr zentraler Handlungsraum war und blieb die einzelne Nation (vgl. Langewiesche 1994a, 6). Wie Özgür Öner darstellt, führten die Vorstellungen von der jeweils eigenen nationalen Identität bzw. sich gegenüberstehenden, verschiedenen nationalen Identitäten - auf die an anderer Stelle eingegangen wird - und die Berufung auf die nationale Interessensvertretung zu einem „halbe[n] Zurücknehmen des universalistischen Menschenbildes“ (Öner 2002, 26). Dies, wie Öner weiter darlegt, „öffnete [...] die Möglichkeit soziale Interessen einander gegenüberzustellen und zu hierarchisieren“ (ebd.). Hierin liegt das viel diskutierte Spannungsverhältnis von Partikularismus und Universalismus, welches in Nationalismus und Nation wegen der Eingrenzung der Gemeinschaft angelegt ist. Die Hierarchisierung von politischen und sozialen Interessen der Nation begründet schließlich, wie Deutsch darstellt, die Intoleranz gegenüber den Angehörigen einer anderen Nation oder Gruppe (vgl. Deutsch 1972, 50 f.). So stellt für Deutsch die „Bevorzugung der Wettbewerbsinteressen der eigenen Nation und ihrer Mitglieder vor denen aller Außenstehenden“ (Deutsch 1972, 27) ein wesentliches Element des Nationalismus dar. Mit der ethnisch-kulturellen Bestimmung der Nation ging sowohl die erwähnte innergesellschaftliche kulturelle Homogenisierung als auch eine Abgrenzung nach außen (vgl. Planert 2004, 18) einher. Die Folge dieser Selbstkonstituierung war, dass sowohl ‚Fremde’, Nicht-Nationsangehörige, als auch die Einheit gefährdende Faktoren ausgeschlossen oder assimiliert wurden. Für diesen Prozess nimmt Ethnizität, verstanden als soziales Konstrukt auf dem die Nationenbildung beruht, eine herausragende Bedeutung ein (vgl. Balibar 1990, 15; Öner 2002, 70 ff.). Es setzt „als Prinzip von Nation und Nationalstaat in Form einer politischen Ideologie […] die Norm, den Nationalstaat als kulturell homogenes Gebilde zu etablieren, was automatisch alle im Sinne der Nationalkulturen heterogenen Gruppen zu ethnischen Minderheiten macht“ (Öner 2002, 72). „Ethnizität“ ist Leggewie zufolge also „keineswegs ein vormodernes Traditionsrelikt, sondern (ebenso wie Rassismus und Antisemitismus) Produkt und Begleiterscheinung der Modernisierung“ (Leggewie 1996,
11Die Sinnstiftung durch die Nation entwickelte sich zu einer Art Religionsersatz. Die „Sakralisierung des ‚Vaterlandes’“ (Wehler, 2001, 27f.) erklärt für Wehler die Bereitschaft das eigene Leben für die Nation zu opfern. Auch Anderson sieht in der propagierten Natürlichkeit der Nationszugehörigkeit den Grund zur Opferbereitschaft für die Nation. „Auch alte Dynastien“, so Anderson, „wurden in ihrer Blütezeit als unhinterfragbar gegebene Bezugssysteme betrachtet, ganz so wie die Nation heutzutage“ (Anderson 1985, 19).
Page 12
48)12. Folglich erwiesen sich Ethnizität, moderner Antisemitismus13und moderner Rassismus14als konstitutive Elemente des Nationalismus, die in den Nationalbewegungen als auch in den Nationsbildungsprozessen stets, wenn auch in unterschiedlichen Ausmaßen, gegenwärtig waren. Dem Nationalismus ist demzufolge die Funktion der strukturellen Ausschließungspraxis ebenso zueigen wie dem Rassismus (vgl. Wiegel 1995, 43; Balibar 1990, Holz 2001, Mosse 1990).
Das nationale Selbstverständnis leitete sich zudem „von der Vorstellung des ‚auserwählten Volkes’ [ab]. Jede Nation glaubte, daß in ihr höchste Werte verkörpert seien, die sie zu schützen habe“ (Jeismann 1993, 15). Aus dem daraus folgenden Glauben an eine nationale Mission verbunden mit dem nationalen Abgrenzungsprinzip, ging schließlich auch die Aggressionsbereitschaft der Nation nach Außen hervor (vgl. Planert 2004, 16). Vor allem in der Verbindung dieses nationalen Chauvinismus mit politischen und sozioökonomischen Interessenlagen liegen letztlich die Gründe für die „Wechselbeziehung“ (Planert 2004, 16) des Nationalismus zum Krieg. Denn die kriegerischen Auseinandersetzungen, die in nahezu allen Nationsbildungsprozessen zu beobachten waren, wurden zumeist mit der Behauptung von ‚nationalen Interessen’ oder der vermeintlichen Notwendigkeit zur Verteidigung der Nation legitimiert (vgl. Planert 2004, Hobsbawm 2005, Eickelpasch/Rademacher 2004). So wurde der Universalismus regelmäßig nationalistisch überformt und instrumentalisiert. „Denn wo immer die nationale Politik mit Erfolg universalistisch aufgeladen wurde, diente dies dazu, den Vorrang der eigenen Nation offen oder auch verhüllt zu begründen“ (Langewiesche 1994a, 6). Besonders deutlich wurde dies mit dem Beginn des Konkurrenzkampfes der Nationalstaaten, im so genannten Zeitalter des Imperialismus.
1.3 Die Vorstellung von Volk und Nation. Oder: Die Konstruktion der modernen Gemeinschaft
Wissenschaftlich betrachtet unterliegen die Begriffe Volk, Nation und Ethnie ebenso kontroversen Deutungen wie die Begriffe Patriotismus und Nationalismus. Die im Folgenden vorgenommene Auseinandersetzung mit den Begriffen Nation und nationale Identität stützt sich weithin auf die Erkenntnisse der neuen Nationalismusforschung. Dieser folgend soll eine
12Weiter hält Leggewie fest, dass Ethnien weder „‚natürlicher’ als Nationen, also näher an tatsächlichen Abstammungsgemeinschaften oder biosozialen Elementarstrukturen [sind], noch sind sie ‚älter’ als Nationen in dem Sinne, daß sie historisch gewissermaßen den Rohstoff der evolutionär weiterentwickelten Nationsbildungsprozesse darstellen, als primordialer Inhalt der formalen Struktur des modernen Nationalstaates und eine sich im Evolutionsprozess transformierende Universalie“ (Leggewie 1996, 54). Dieser Perspektive folgend stellen Ethnien nicht das natürliche Rohmaterial dar, auf das die nationale Idee zurückgreift, sondern die Konstruktion von Ethnien und Nationen kann als gleichursprünglich betrachtet werden.
13Neben den Varianten des christlich geprägten und des biologischen Antisemitismus, der dem 19. Jahrhundert entstammt, verweist Klaus Holz darauf, dass mit dem Aufkommen des Nationalismus auch ein nationaler Antisemitismus einherging. In diesem wurden ‚die Juden’ als Negation des Nationalen beschrieben. ‚Die Juden’, vielfach als nationsloses ‚Wandervolk’ dargestellt, werden nicht als Mitglieder einer anderen Nation verstanden, sondern als „dritte Form“, als ein „Volk im Volke, ein Staat im Staate“ (Holz 2000, 271).
14Für Étienne Balibar geht der im 18. Jahrhundert entstandene Rassismus, aufgrund dessen dass der Nationalismus eine fiktive Ethnizität produziert, ebenso aus dem Nationalismus hervor wie der Nationalismus aus dem Rassismus (Balibar, nach Öner 2002, 96). Demzufolge können Rassismus und Nationalismus als zwei Seiten einer Medaille betrachtet werden. Die „[n]ationale Homogenisierung benutzt den ‚Rassendiskurs’ ebenso wie die ‚rassische’ Eingrenzung die geschichtlichen Mythen der Nation sich zu eigen macht, um die eine Gruppe zu definieren“ (Wiegel 1995, 85). Es gilt zudem zu betonen, dass die Verbreitung und Durchsetzung der Aufklärung - und der damit einhergehenden sich weiterentwickelnden Naturwissenschaft - als eine der wichtigsten Voraussetzungen des Rassismus angesehen werden muss. Im Zuge der Aufklärung stand die Erforschung der Naturgesetze unter der Maßgabe der Rationalität; die Klassifikation der natürlichen Elemente stand dabei im Vordergrund (vgl. Wiegel 1995, 48; Mosse 1990, 9). Diese Klassifikation jedoch ordnete nicht nur in der Natur Vorgefundenes, sondern sie erfand auch Kategorien, auf dessen Grundlage sich sowohl rassistische Ideologien als auch Nationalismus ableiten ließen (und lassen).