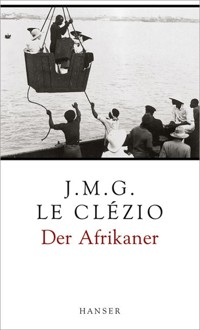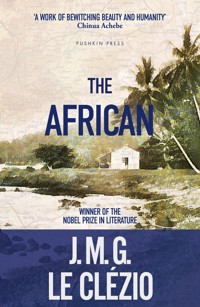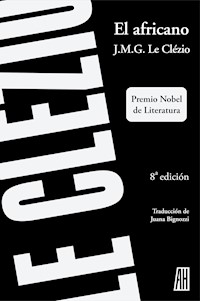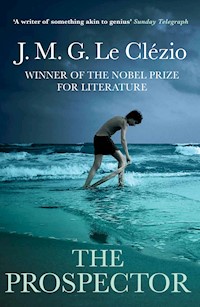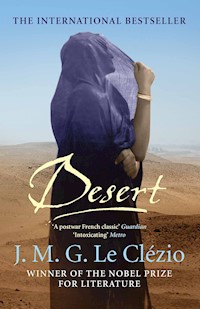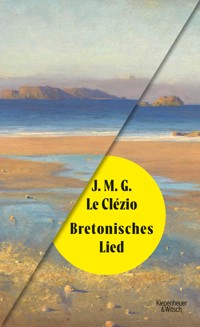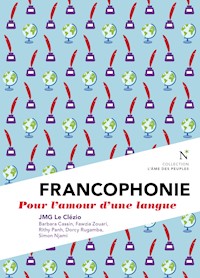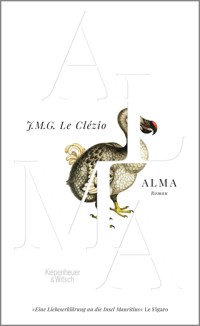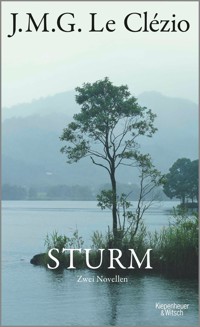19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem neuen Buch erzählt J. M. G. Le Clézio von denjenigen, die zwar den westlichen Wohlstand mit erzeugen, denen man aber keine Teilhabe daran zugesteht. Anklagend und poetisch zugleich. Acht Erzählungen, die geografisch den halben Erdball umspannen, Mauritius, Peru, das Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko, den Libanon, Frankreich, und in denen der Literaturnobelpreisträger denjenigen eine Stimme gibt, über deren Leben die Geschichte normalerweise hinweggeht, die die Welt nur erfahren und kaum gestalten können. So wie Maureez, die es trotz schwierigster Kindheit schafft, andere mit ihrer Stimme zu bezaubern. Oder eine Handvoll Jugendlicher – Grenzgänger zwischen Mexiko und den USA. Die beiden jungen Brüder Marwan und Mehdi, die nach der Zerstörung ihres Dorfes durch den Libanon irren. Oder ein tunesischer Arbeiter, der sich in seiner französischen Unterkuft nach seiner Familie sehnt. Sie alle verdienen es, gesehen zu werden, und J.M.G. Le Clézio erzählt ihre Geschichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
J. M. G. Le Clézio
Neues von den Unerwünschten
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über J. M. G. Le Clézio
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über J. M. G. Le Clézio
Jean-Marie Gustave Le Clézio, 1940 in Nizza geboren, studierte in Frankreich und England Literatur. Die Wurzeln seiner Familie liegen in der Bretagne und auf Mauritius. Er veröffentlichte über 40 Bücher – Romane, Erzählungen, Essays – und erhielt für sein Werk zahlreiche Preise. 2008 wurde er mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Le Clézio lebt hauptsächlich in Frankreich und New Mexico.
Uli Wittmann, 1948 geboren, übersetzt aus dem Englischen und Französischen, u.a. Werke von Noëlle Châtelet, Philippe Djian, Michel Houellebecq und Ben Okri.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Acht Erzählungen, die geografisch den halben Erdball umspannen, Mauritius, Peru, das Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko, den Libanon, Frankreich, und in denen der Literaturnobelpreisträger denjenigen eine Stimme gibt, über deren Leben die Geschichte normalerweise hinweggeht, die die Welt nur erfahren und kaum gestalten können. So wie Maureez, die es trotz schwierigster Kindheit schafft, andere mit ihrer Stimme zu bezaubern. Oder eine Handvoll Jugendlicher - Grenzgänger zwischen Mexiko und den USA. Die beiden jungen Brüder Marwan und Mehdi, die nach der Zerstörung ihres Dorfes durch den Libanon irren. Oder ein tunesischer Arbeiter, der sich in seiner französischen Unterkuft nach seiner Familie sehnt. Sie alle verdienen es, gesehen zu werden, und J.M.G. Le Clézio erzählt ihre Geschichten. Anklagend und poetisch zugleich.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
Titel der Originalausgabe: Avers. Des nouvelles des indésirables
Die Originalausgabe erschien 2023 bei Gallimard, Paris
© Éditions Gallimard, Paris, 2023
Aus dem Französischen von Uli Wittmann
© 2025, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Jana Meier-Roberts
Covermotiv: © Brett Allen Johnson
ISBN978-3-462-31278-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Avers
Maureez Samson
Baladirou
Erin
Bois Noirs
La Salette
Die Sterne
Leuchtender Weg
Die Pichancha
Nogales, Oktober 2002
Gespenster auf der Straße
BAB 6
B 12
TO 15
BAB 88
BAB 19
Liebe in Frankreich
Der Taniers-Fluss
Hanné
Etrebbema
Wann bin ich im Regenwald angekommen?
Yoni
Der Regenwald
Für Yoni bedeutete Manené die Ankunft …
Das Fest in Manené …
Yoni gewöhnte sich nach und nach …
Wahlen
Die Stille
Das Ende der Reise
Avers
Maureez Samson
Schon immer hatte sie dem Rauschen des Meeres an den Felsenriffen gelauscht. In der Baie Malgache nähern sich die Wellen in rascher Folge und überspülen so kurz hintereinander die schwarzen Steine, dass man nur ein ununterbrochenes sanftes Dröhnen hört, fast wie das Geräusch eines Motors. Wie der Motor der Piroge ihres Vaters, jetzt erinnert sie sich daran, obwohl sie den schon seit Jahren nicht mehr gehört hat. Auf den Bug der Piroge hatte Tomy Samson in großen roten Buchstaben den Namen seiner Tochter geschrieben, MAUREEN, aber das N am Ende war ihm verrutscht, sodass es aussah wie ein Z. Und so hatte er diesen Namen beibehalten für seine Tochter, denn er fand ihn viel schöner. Und von da an hieß Maureen für immer Maureez. Maureez, das brachte die Kinder zum Lachen. »Ki kot? To été Moris bolom? Was? Wa’ste schon ma’ auf Mauritius?« Aber das war kein Grund, sich zu schämen, im Gegenteil, sie erinnerte sich, dass sie sich schon als Kind zu ihrer vollen Höhe aufgerichtet, sie herausfordernd angestarrt und gesagt hatte: »Mo papa finn allé pa’tout, pa’tout pays Moris ça la même. Mein Papa wa übe’all, übe’all, soga’ auf Insel Mauritius.« Und dann ist er eines Tages nicht mehr vom Fischfang zurückgekehrt.
Sie hatte Tag für Tag und sogar nachts am windigen Meeresufer auf ihn gewartet, bis Lola schließlich zu ihr sagte: »Ca sifi comme ça, rentré, pas resté dihors, ki espère? Nu’ reich’ aba, kom’ rein, bleib nich’ drauße’, wo’auf wa’test du noch?« Sie weigerte sich, musste aber schließlich gehorchen und sich im Bett an die Wand quetschen, um Lola nicht schnarchen zu hören, als sei nichts passiert, alles no’mal, alles oke. Aber von da an war nichts mehr wie zuvor. Lola wurde bösartig, schlug Maureez wegen jeder Kleinigkeit. Und sie ließ sich mit einem anderen Mann ein, Zak, einem Nichtsnutz, der sich von morgens bis abends auf dem alten Sofa auf der Terrasse herumräkelte, sich betrank und aufs Meer starrte. Maureez hat ihre Mutter nicht gekannt, denn sie war kurz nach ihrer Geburt gestorben, und Tomy Samson hatte sich zwar nicht wieder verheiratet, sich aber für diese Frau entschieden, Lola Paten. Maureez hasste sie von dem Moment an, da ihr klar wurde, was hassen bedeutete, weil Lola sie anschrie, in den Arm zwickte und sie zwang, die gesamte Wäsche des Haushalts zu waschen, auch wenn sie zur Schule gehen musste. Und als Tomy Samson eines Tages nicht mehr vom Fischfang zurückkam, wurde das Leben für Maureez zu Hause unerträglich. Lola verließ oft das Haus, um in einem Hotel am Hafen zu arbeiten, und sobald sie nicht mehr da war, schenkte Zak sich ein Bier ein und sah Maureez auf seltsame Weise an, doch sie erkannte die Gefahr sehr schnell, als er sie eines Nachmittags am Arm packte und an sich zog, wobei er ekelhafte, unverständliche Worte murmelte. »Vini, nous faire un ti ballett à quat’z’yeux. Kom, wi’ mache’ kleine Ballett unte’ vie’ Auge’!« Wie konnte man nur so etwas zu einem Kind sagen? Was war das, ein Ballett? Maureez riss sich los, rannte nach draußen und versteckte sich hinter den Felsen. Als Lola abends nach Hause kam, verlor Maureez kein Wort darüber, weil sie genau wusste, dass Zak irgendeine Gemeinheit erzählen würde, etwa dass sie sich bemüht habe, ihn zu verführen, sich an ihn geschmiegt und versucht habe, ihn ins Bett zu ziehen. Sie legte sich schlafen, ohne zu Abend zu essen, rollte sich im Bett zusammen, legte den Kopf an die Wand und lauschte, wie Lola schnarchte.
Danach wurde alles noch komplizierter. Wenn Lola morgens zur Arbeit ging, verließ auch Maureez das Haus und nahm die Schultasche mit Büchern und Heften mit, als wolle sie zur Schule gehen, schlug aber einen anderen Weg ein und durchstreifte stattdessen die Gegend kreuz und quer. Zu diesem Zeitpunkt fing Maureez an zuzunehmen, vielleicht weil sie hoffte, dass Zak dadurch die Lust vergehen werde, sie anzurühren. Sie war gezwungen, die Hosenbeine ihrer Jeans abzuschneiden und den Ausschnitt ihres T-Shirts zu erweitern, aber trotz allem war es zu klein und zu kurz. Die anderen Mädchen aus ihrer Schule machten sich über sie lustig, sobald sie ihr begegneten, und riefen ihr »Fettkloß« oder »Fettsack« nach, doch obwohl sie das furchtbar wütend machte, reagierte sie nicht darauf. Und so beschloss sie kurzum, Schluss mit der Schule zu machen. Sie sagte es niemandem, sondern traf diese Entscheidung ganz allein. Sie stand morgens früh auf, wusch ihre Wäsche in der Zinkwanne, wickelte etwas Reis und brèdes in ein Tuch und legte es in ihre Schultasche, als wolle sie zur Schule gehen. Aber sobald Lola verschwunden war, machte sie sich aus dem Staub und lief durchs Buschwerk auf die Anhöhen, weit weg von der Stadt.
Maureez kannte vor allem die Steine sehr gut. Jeden Felsen in der Baie Malgache, jeden Kieselstein, jede Farbe, jede Beschaffenheit, die schwarzen, die blassweißen, die rot gestreiften, die gesprenkelten, die graublauen, die dunkelgrünen und alle Gesteinsformen, die runden, die wie Kugeln rollen, und die spitzen mit rostigen Löchern. Schon als kleines Mädchen war sie morgens mit Tomy am Strand der Bucht entlanggelaufen auf der Suche nach schönen Steinen.
Wenn sie einen Stein auflas, sah sie all die kleinen Tiere fliehen, durchsichtige Krebse, Bandasseln und auch kleine schwarze Insekten, die in die Pfützen tauchten. Sie wählte für ihren Vater einen schönen kugelrunden Stein, der glatt und schwer genug war, um als Senker für die Netze zu dienen. Maureez liebte den Geruch des Meeres, er ist intensiv und beißend, sodass man husten muss, aber es ist ein vertrauter Geruch, der eine beruhigende Wirkung hat. Die donnernde Brandung an der Barre vibrierte bis an den Strand. Manchmal ging plötzlich aus heiterem Himmel ein Platzregen nieder, ein kalter Regen, der im Gesicht und auf den Beinen prickelte, aber sie brauchte keinen Schutz zu suchen, sondern blieb bei ihrem Vater und beobachtete, wie ihm das Wasser über das Gesicht rann, durch seine tiefen Falten, oder wie es sich in seinem Haar verfing. Bei einem Regenschauer bemerkte Maureez zum ersten Mal, dass er schon weiße Haare hatte, silberne Fäden, die in seinem krausen Haarschopf glänzten. Tomy war noch nicht alt, aber er hatte schon diese silbernen Fäden, und als sie es ihm sagte, musste er lachen. Sie erinnerte sich noch gut daran, wie er gesagt hatte: »Blanc fin ’sorti mo sivi! Di Weiße sind du’ch mein Haa aus’eschlüpft!« Maureez hatte das gleiche Haar wie er, einen dichten, zerzausten Strubbelkopf, aber sie konnte machen, was sie wollte, ihr Haar ließ sich nicht bändigen. In der Schule hatte die Lehrerin zu ihr gesagt: »Das ist doch nicht schön, du musst dir Zöpfe flechten«, aber ihr Vater war dagegen und hatte ein Machtwort gesprochen: »Wir, in unserer Familie Samson, sind keine Weißen, sondern Mozambiques, wir brauchen unser Haar nicht zu verstecken, wir brauchen keine Zöpfe!«
Mozambique, das hat Maureez zwar nicht verstanden, aber das Wort hat ihr gut gefallen. Immer wenn sie an den Strand oder ins Gebirge ging, wirbelte der Wind ihr Haar durcheinander, peitschte ihr ins Gesicht, und der Regen rann ihr in die Augen. Sie war stolz auf ihren Vater und brauchte niemanden, und deswegen hasste Lola Paten sie noch mehr. Sie war eifersüchtig. Seit Maureez ganz klein war, nahm Tomy sie jeden Abend nach dem Fischfang und am Sonntagmorgen in seiner Piroge mit, der schönen weißen Piroge, auf die er mit roter Farbe den Namen seiner Tochter gepinselt hatte, und dann fuhren sie bis ans Ende der Lagune, zu den kleinen Inseln.
Später sollte sich Maureez an alle diese Fahrten erinnern, es waren gnadenvolle Momente gewesen, die sanft und zugleich heftig waren wie blendendes Licht: lange dauernde, langsame Fahrten, beim Brummen des Motors, dem Auf und Ab der Wellen, wenn sie sich den Riffen näherten, und dann auf hoher See, wenn Tomy die dreieckige Rah setzte, dem Knattern des Winds im Segel, dem leise gurgelnden Kielwasser und den Schreien der Vögel.
Die Tölpel auf der Île aux Fous waren so zahlreich, dass ihr Lärm sich anhörte wie das Rollen Tausender Eisenkugeln, die Schreie aus Abertausenden Kehlen und das Gezeter der Neugeborenen in den schwarzen Felsen und die langen Klagerufe der Albatrosse, die herkamen, um die Küken zu stehlen. Maureez glitt durchs Boot bis zum Bug und setzte sich auf die Stake, die vorn auf den Bootsrändern ruhte, der Wind ließ ihre Augen tränen, das Salzwasser durchnässte ihr Haar und ihre Kleider, die Sonne brannte auf ihren Händen und Füßen. Das Wasser war tief, fast schwarzblau, und der Himmel verblasste in der Abenddämmerung. Sie brauchte nur die Augen zu schließen, um sich vorzustellen, dass die Piroge diesmal wirklich auf große Fahrt ging und sie beide auf die andere Seite des Meeres brachte, weit weg von allem, fort von zu Hause, fort von Lolas Gejammer, ja, dass die Piroge sie auf eine wunderschöne Insel brachte, auf der sie beide für immer leben würden, eine Insel voller Düfte und Farben, auf der es nichts als Glück, Schlaf und Träume gab.
Etwa zu diesem Zeitpunkt erfand Maureez eine Freundin namens Bella, um jemanden zu haben, mit dem sie reden konnte, weil ihr Vater nicht mehr da war und niemand sich für sie interessierte. Und weil die Mädchen aus ihrer Schule sie mit Steinen bewarfen, sobald sie sie sahen, und ihr Schimpfworte nachriefen. Wenn sie ins Gebirge ging, suchte sie sich in der Nähe von La Ferme oberhalb der Baie Malgache ein Plätzchen, auf dem sie vor dem Wind und manchmal auch vor dem Regen geschützt war. Sie rollte sich in einer Felsenhöhle zusammen, legte den Kopf auf ihre Schultasche und wartete darauf, dass Bella kam. Anfangs konnte sie sie nicht richtig erkennen, sie war nur eine Gegenwart, eine Art Wärmewelle, die sie im Bauch und in den Lungen spürte, doch wenn sie die Augen schloss, tauchte auf dem roten Hintergrund ihrer Netzhaut eine leuchtende weiße Silhouette auf, die mit goldenen Punkten übersät war, eine sich bewegende Form, wie ein Spiegelbild im Wasser oder eine Wolke am Himmel. Später, als sie sich daran gewöhnt hatte, stellte sie fest, dass diese Silhouette kein Gesicht hatte, sondern nur große, weit geöffnete Augen, und tief in diesen Augen glitzerten die Goldpünktchen. Es war ein sanfter und sehr intensiver Blick, und Maureez spürte, wie ihr ein Schauer über die Haut rann, als ob mit dem Blick auch ein Atemhauch über sie hinwegglitt, von dem sich alle Härchen auf ihren Armen, Schultern und Beinen aufrichteten. Nach und nach akzeptierte sie diesen Blick, diese Silhouette und gab ihr einen Namen, Bella, weil es ein Wesen von wunderbarer Schönheit war, das nur sie sehen konnte, ein Wesen, das aus weiter Ferne kam, vom anderen Ende der Welt, um ihr zu helfen. Da begann Maureez, mit ihr zu reden, aber immer ganz leise oder fast lautlos, wie sie mit einer Freundin reden würde, um ihr etwas aus ihrem Leben zu erzählen, und um sich an ihren Vater zu erinnern, an die Piroge und an die Zeit, in der alles einfach war. Bella antwortete nie wirklich, aber Maureez hörte ihre Antworten, hörte die Worte, die sie sich erhoffte, die ihr Mut machten, Worte der Liebe, Worte, die nur für sie bestimmt waren. Sie glichen einem Lied, das man aus tiefer Kehle singt, einem Lied, das sich im Kreis dreht und wieder von vorn beginnt, wie das Murmeln des Meeres in der Ferne oder des Windes in den Dornenbüschen und in den Zweigen der Kasuarinen oder das Prickeln der Regentropfen auf ihrem Körper und ihrem Gesicht, und dann war sie wieder auf Tomys Piroge, die über das klare Wasser der Lagune glitt, bereit, die Gezeitenwelle des Kanals zu überqueren, um das dunkle offene Meer zu erreichen. Bella führte sie durch die Gärten, die sich auf dem Meeresboden befanden, durch all das, was sie früher gesehen hatte, wenn sie mit ihrem Vater an den Riffen entlanggeschwommen war, die weißen Strände, die gelben und roten Korallenwälder und Tausende von Fischen, die von einer Insel zur anderen flogen. »Warte auf mich, Bella, ich kann dir nicht folgen, du schwimmst zu schnell!« Um mit Bella zu reden, erfand Maureez sogar eine Sprache, die nicht das Geringste mit dem Französischen oder dem Kreolischen gemein hatte, eine schnelle Sprache, voller Laute mit u und a, vielen l, z und w, aber ohne k, p oder j, weil das Bella erschrecken könnte, falls sie wie ein Vogel oder eine Katze reagierte, das musste flüssig und volltönend, melodisch und besänftigend sein. Um zu sagen: »sprich jetzt nicht«, sagt sie »yawalululi«, um zu sagen: »komm zu mir«, sagt sie »hilawaluawa«, um zu sagen: »auf Wiedersehen, bis morgen«, »mawawumawa«. Manchmal, wenn sie am Strand der Baie Malgache entlangging, versteckte sie sich hinter den großen Felsen und redete mit ihrem Vater in dieser Sprache, dann hauchte sie diese Laute in den Wind, damit sie den Horizont überquerten und ihren Vater dort suchten, wo er jetzt war, auf seiner fernen Insel oder vielleicht sogar in Afrika, im Land der Mozambiques.
Aber die Realität holte Maureez Samson eines Tages ein, als sie gerade aus dem Gebirge zurückkam. Lola Paten wartete vor dem Haus auf sie und versetzte ihr als Erstes eine Ohrfeige. Sie schrie sie mit krächzender Stimme an, was eher lächerlich als erschreckend wirkte. Sie wiederholte immer wieder »Kot to été? Wo gehste hin? Wo gehste hin?« Sie nahm einen Stock, und am boshaften Aufblitzen ihrer Augen konnte man ablesen, dass sie entschlossen war, ihn zu benutzen. Maureez suchte hinter der kleinen Mauer des Hofes Schutz und reagierte nicht, sondern blickte Lola nur mit hasserfüllten Augen an, als genüge das, sie davon abzuhalten, sich ihr erneut zu nähern und sich auf sie zu stürzen. Zak stand in einer Ecke im Haus und war drauf und dran, Maureez ebenfalls anzuschreien, aber er muss wohl ihrem Blick angesehen haben, dass sie sich das nicht gefallen lassen und Lola sagen würde, was er mit ihr gemacht hatte, dass er sie an sich gedrückt, die Hände unter ihr T-Shirt geschoben und versucht hatte, sie zu küssen. Maureez spürte, wie ihr das Herz in der Brust hämmerte und sich alles vor ihren Augen drehte, weil jetzt der Moment gekommen war, in dem sich alles entscheiden würde. Sie würde nie wieder in das Haus zurückkehren können, obwohl es das Haus ihres Vaters und ihrer Mutter und nicht das von Lola Paten und Zak war, das Haus, in dem sie zur Welt gekommen, aufgewachsen war und mit ihrem Vater Tomy gelebt hatte, und nun würde sie es nie wieder sehen. Der Schwindelanfall gab ihr den Anstoß. Sie wandte sich um und schlug den Pfad ein, der in die Stadt führte, und nach und nach wurden Lolas Schreie immer leiser, bis sie verstummten. Als sie sich oben auf der Anhöhe umwandte, war das Haus nicht mehr zu sehen und auch sonst niemand. Sie hörte nur einen Hund bellen, der irgendwo auf dem Feld mit Zwiebeln und Süßkartoffeln war. Sie murmelte: »Wallalowa!«, was so viel bedeuten sollte wie: »Geh fort und komm nie wieder!«
In den darauffolgenden Tagen lebte Maureez wie ein wildes Tier im Gebirge. Sie nistete sich in einer Höhle hoch über dem Meer ein, auf einem Lager aus Tang, und sie versperrte den Zugang mit trockenen Ästen, um nicht gesehen zu werden, aber auch, um sich vor Wind und Gischt zu schützen. Anfangs hatte sie ein bisschen Angst, wegen der nächtlichen Geräusche, dem Knacken der Steine, wenn sie abkühlten, dem Hauch des Winds in den Büschen und den Schreien der Seevögel, die von den Ratten geweckt wurden. Aber dann redete sie mit Bella, und ihre Angst verschwand, sie konnte sogar die Stimme dieser Kreatur hören, die ihr in ihrer Sprache antwortete, sanft und melodisch wie eine Engelsstimme. Um ihre Angst zu überwinden, begann sie zu singen, wobei sie Bellas Stimme folgte, nur unzusammenhängende Töne, Gesänge, die sie mit Schlägen auf die Brust rhythmisch begleitete, in ihrer eigenen Sprache, mit vielen Vokalen und kehligem Gemurmel, hmmm, hmmm, hoooo, huimmm … Wenn Maureez hungrig war, schlich sie zu den Häusern in der Nähe von La Ferme. Auf den Feldern fand sie Kartoffeln und Zwiebeln und in der Nähe der Häuser Mangos und Jackfrüchte. Sie wartete, bis es dunkel wurde, um Obst und Gemüse zu stibitzen. Hunde bellten, wenn sie sich näherte, aber Maureez kannte Worte, die sie beruhigten und einschlafen ließen. Sie flüsterte ganz leise Worte mit chch und ttt, dann ließen die Hunde die Ohren sinken und setzten sich winselnd hin. Sie redete weiter auf sie ein, betrat ein Haus, und ehe sie fortging, ließ sie zum Dank immer etwas für sie zurück. Sie lief immer weiter fort, in Richtung Stadt, um Brot oder Kuchen aufzutreiben, blieb lange im Gebüsch versteckt, und wenn sie sah, dass niemand mehr in der Küche war, ging sie langsam auf das Haus zu, als kenne sie die Bewohner, schob den Vorhang aus billigem Stoff zur Seite, der vor der Tür hing, schürzte ihr T-Shirt und legte Brot und Kuchen hinein. Mehrmals wurde sie fast erwischt, als sie gerade das Haus verließ, doch sie hatte gelernt, schnell zwischen den Felsen durch das Buschwerk zu entkommen, niemand konnte sie einholen. Es war ein seltsames Leben, doch sie hatte nicht die Zeit, darüber nachzudenken, nur ab und zu wurde ihr wieder schwindelig, wie am Tag, an dem sie beschlossen hatte, in weite Ferne von Lola, Zak und dem verfluchten Haus zu fliehen. Es kam auch vor, dass sie plötzlich grundlos in Lachen ausbrach, wenn sie hinter dem schützenden Rohrgeflecht ihrer Höhle saß, ein Lachen, das sie schüttelte, bis ihr die Augen tränten, sie wusste nicht einmal, warum, aber das Lachen tat ihr gut.
Ein Mann namens Mahmoody bemerkte sie schließlich. Wie jeden Morgen überwachte er auf der Mole das Entladen der Schiffe und entdeckte plötzlich eine im Schatten des Vordachs versteckte Gestalt, die er zunächst für einen Haufen alter Wäschestücke und Netze gehalten hatte. Doch als er sich näherte, sah er ein kleines Mädchen mit dunklem Gesicht, das ihn mit großen, erschrockenen Augen ansah.
»Was machst du hier?«, fragte er leise. Mahmoody war ein alter Mann mit sanftem Gesichtsausdruck und dem Ansatz einer Glatze. Aber weil er sein ganzes Leben lang auf den Schiffen gearbeitet hatte, waren sein Körper und seine Hände abgehärtet. Da Maureez nicht antwortete, versuchte er es noch einmal, diesmal jedoch auf Kreolisch: »Ki ti fer la? Was machste da?«
Der Seewind war kalt, und Mahmoody bemerkte, dass die Kleider des Mädchens durchnässt waren und sie vor Kälte zitterte. Er sagte sich, dass sie vermutlich die Nacht auf der Mole verbracht hatte, an einen Pfosten gelehnt, halb versteckt hinter alten Planen und Tauwerk. Er konnte sich nicht daran erinnern, sie schon jemals gesehen zu haben. Er sagte:
»Wie heißt du, mein Kind?«
»Maureez«, erwiderte sie.
»Maureez und weiter?«
»Maureez Samson.«
Der Name kam ihm sofort bekannt vor.
»Samson? Bist du mit Tomy verwandt, dem Fischer, der auf See verschollen ist?«
Maureez antwortete nicht gleich.
»Du bist seine kleine Tochter, stimmt’s?«
Mahmoody hatte den Fischer nicht persönlich gekannt, in der Zeitung aber von seinem Verschwinden gelesen, er erinnerte sich, dass von seiner Familie, seiner Frau und seinen Kindern, die Rede gewesen und sogar eine Spendensammlung für sie organisiert worden war. Doch dann war er wieder in Vergessenheit geraten. Es gab so viele Fischer, die auf See verschollen waren, weil ihr Außenbordmotor eine Panne hatte und der Wind ihre Piroge ins offene Meer trieb, sodass man sie nie wieder sah.
»Tomy Samson ist mein Vater«, sagte Maureez mit leiser, etwas heiserer Stimme, und Mahmoody begriff, dass sie nicht nur fror und hungrig war, sondern noch dazu Angst hatte. Als er sich ihr näherte, kauerte sie sich in ihrem Versteck zusammen, die Hände um die Beine geschlungen, das Gesicht unter ihrem Haarschopf verborgen.
Sie schrie laut: »Wallalowa!«, als ob der alte Mann das verstehen könne. Er blickte sie an, wagte aber nicht, näher zu kommen, stand mit hängenden Armen da. Er war mager, und seine Hose flatterte ihm im Seewind um die Beine. Im Dämmerlicht des Vordachs glänzten seine Augen in dem dunklen Gesicht, aber sie begriff, dass es ein eher sanftes Leuchten war.
»Was sprichst du für eine Sprache, mein Kind?«, fragte Mahmoody. Doch sie rührte sich nicht.
»Ich bin ein Fischer wie dein Papa«, sagte Mahmoody. »Wenn du willst, kannst du bei mir wohnen, mein Haus ist da drüben, direkt am Hafen.«
Es kamen ein paar Leute hinzu, Schaulustige, Leute, die nichts Besseres zu tun hatten, als sich anzusehen, was da vor sich ging.
»Hast du keine richtige Bleibe?«, fragte Mahmoody.
Die Kleine schüttelte den Kopf. Ihre zerzauste Mähne fiel ihr in die Stirn, sie schob sie mit einer ungeduldigen Handbewegung nach hinten. Sie wollte die Silhouette des alten Mannes nicht aus den Augen verlieren und überwachte all seine Bewegungen.
Als Mahmoody sich zum Gehen wandte, stand Maureez auf und folgte ihm mit kleinen Schritten, weil sie wegen des Hungers und der Müdigkeit Mühe hatte, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Mahmoodys Haus lag direkt an der Mole, eine alte Bretterhütte mit einem Blechdach. Drinnen war es dunkel, und es roch nach Fisch, Schimmel und Rauch. Aber als Mahmoody ihr eine Schale Reis vorsetzte, aß Maureez gierig mit den Fingern, ohne den Löffel zu benutzen. So etwas Leckeres hatte sie schon seit Langem nicht mehr gegessen.
Mahmoody war ein wenig abseits im Halbdunkel stehen geblieben und hatte zugesehen, wie Maureez sich den Bauch vollschlug. Als sie fertig war, schob er eine Matratze in eine Ecke des Raumes, so weit wie möglich von der Tür entfernt.
»Das war das Bett meiner Tochter, als sie noch bei mir wohnte. Jetzt ist es dein Bett«, sagte er.
Maureez legte sich auf die Matratze und schlief gleich ein, wie jemand, der lange Zeit ein schweres Leben geführt hat. Mahmoody ging auf Zehenspitzen aus dem Haus, um seine Arbeit an der Mole zu beenden. Er sprach mit niemandem über Maureez. Falls man ihn fragen sollte, würde er sagen, dass Maureez seine Großnichte sei, die von weither angereist war, um ihn zu besuchen. Aber niemand fragte ihn. Dinge ereignen sich auf diese oder auf jene Weise, Menschen tauchen auf und verschwinden, wie der Fischer, der auf See verschollen ist, und niemand kann etwas dafür, so ist das nun mal.
Baladirou
Das Kinderheim Cœur saint de Marie ist ein hübsches weißes Gebäude, hoch oben auf einer Steilküste, umgeben von einem kleinen, vor dem Ostwind geschützten Garten, und daneben befindet sich eine moderne Kapelle mit zwei hohen Fenstern, die den Innenraum in helles Licht tauchen, Maureez traf im Frühsommer nach den Regenfällen dort ein. Mahmoody hätte sie lieber bei sich zu Hause behalten, denn er hatte sich an die Anwesenheit dieses stillen, in sich gekehrten Mädchens gewöhnt, das kaum etwas sagte, dafür aber einen Appetit hatte für drei.
Doch als Mahmoody eines Tages nach Hause kam, erwartete ihn vor seiner Tür ein Paar, das er nicht kannte: eine Frau in einem roten Kunstledermantel, begleitet von einem heimtückisch wirkenden Mann um die vierzig, der ein paar Schritte hinter ihr blieb. Die Frau redete mit lauter Stimme und forderte ihre Tochter zurück, als habe Mahmoody sie entführt und als Geisel in seiner Küche eingesperrt.
Sie fuchtelte mit den Armen in der Luft herum, sodass mehrere Passanten schließlich stehen blieben. Und dann passierte etwas Unglaubliches, mit dem Mahmoody nicht gerechnet hatte. Maureez tauchte in knöchellanger Hose und weit ausgeschnittenem T-Shirt aus der dunklen Küche auf, ging mit geballten Fäusten, zerzaustem Haar und vor Zorn blitzenden Augen auf die Frau zu und sagte nur ein einziges Mal mit leiser, heiserer Stimme: »Hau ab, Lola Paten!« Die Frau wich zurück, den Körper halb nach hinten gewandt, bereit, schnell wegzurennen. Im nächsten Augenblick zog sie den Mann hinter sich her und machte sich mit lauten Drohungen mit ihm aus dem Staub. Maureez fügte kein Wort hinzu. Sie glich einem Todesengel, wie Mahmoody sich im Nachhinein sagte, als besäße ihre Stimme die ganze Kraft der Gerechtigkeit des Himmels. Nach diesem Vorfall beschloss Mahmoody, Maureez an einen Ort zu bringen, an dem sie vor ihren Peinigern in Sicherheit war.
So gelangte Maureez Samson nach Baladirou.
Als Maureez den großen Speisesaal betrat, sah sie die Ordensschwestern. Sie standen in einer Reihe, als würden sie einen hohen Gast empfangen, diesen Eindruck zumindest hatte Mahmoody, der ein paar Schritte hinter Maureez zurückgeblieben war. Das Mädchen aber dachte das nicht, sie war viel zu eingeschüchtert, um irgendetwas zu denken. Sie stand, schlecht gekämmt, in geflickten Kleidern und mit auf beiden Seiten ihres dicken Körpers herabbaumelnden Armen da und brachte kein Wort über die Lippen. Mahmoody nannte ihren Namen, nur ein einziges Mal, dann ging er ein paar Schritte zurück und verließ den Raum.
Die Schwestern gingen auf sie zu, einige von ihnen lächelten, andere sahen Maureez neugierig an. Sie kannten ihre Geschichte. Sie hatten die schrecklichen Worte gehört, Inzest, Schläge, die Bosheit der Stiefmutter und die Trunksucht ihres Begleiters. Sie wussten, dass sie ein schwieriger Fall war. Sie hatten darauf nur geantwortet: »Sie kann zu uns kommen, wir werden uns gut um sie kümmern.« Begrüßungsworte waren überflüssig. Die älteste Ordensschwester kam näher, gab Maureez die Hand und sagte: »Ich heiße Saint-Jean-de-la-Lumière.« Dann nannte sie die Namen aller anderen: »Simone, Jean-Paul, Laurent, Pétronille.« Und fuhr fort: »Sag nicht Madame zu uns, wenn du dich an uns wendest, sondern Schwester, verstehst du?« Sie trugen lange hellblaue Kleider und einen weißen Schleier auf dem Kopf. Sie waren alle hübsch, sogar Schwester Simone mit ihrer großen Nase. Schwester Saint-Jean-de-la-Lumière nahm Maureez an die Hand, dann gingen sie alle in einen größeren Raum nebenan, in den durch hohe Fenster helles Licht fiel. Draußen sah man Palmen, die sich im Wind bewegten. Hinten im Saal stand ein altes Klavier und im Kreis davor befand sich eine Gruppe von Mädchen, die etwa im selben Alter waren wie Maureez. Sie trugen saubere Kleidung, lange Kleider oder weiße Hosen und T-Shirts und an den Füßen Flip-Flops. Manche Mädchen waren pechschwarz, andere fast weiß, und eine hatte ein rötliches Gesicht und blond gefärbtes Haar. Schwester Saint-Jean stellte ihr die Mädchen nicht vor, sondern sagte nur: »Jetzt beginnt der Musikunterricht, du musst mit uns singen.« Dann fügte sie hinzu: »Falls du den Text nicht kennst, summ einfach hmm-hmm, die Worte lernst du später.« Dann gingen die Schwestern weg, bis auf Pétronille, die Maureez zu den Mädchen führte. Diese traten ein wenig zur Seite, um Maureez Platz zu machen, und sofort darauf begann der Gesang.
Maureez nahm nicht daran teil, summte nicht hmm-hmm, wie es Schwester Saint-Jean von ihr verlangt hatte. Im Gegenteil, sie war wie erstarrt und wartete mit abwesendem Blick und vor den Bauch gepressten Armen, bis die Lieder zu Ende waren. Als die Schwester sie fragte: »Sag mal, Maureez Samson, kannst du nicht singen?« Da blickte Maureez sie herausfordernd an und begann mit ihrem absurden Singsang, dem Wallalowa und all den Geräuschen, die ihre Kehle hervorbringen konnte,