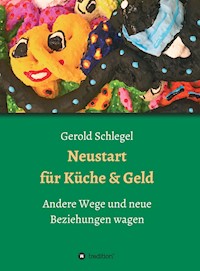
9,90 €
Mehr erfahren.
Analogien der Küche und Geld, gepaart mit biografischen Anteilen und Einsichten aus Erfahrungen, machen die Geldanlage verständlich. Komplexität ist mit Einfachheit zu bewältigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sie ist mein Begleiter auf allen meinen Wegen abseits der Mehrheit, meine Stütze, mein Energiespender und mein Mutmacher, die
Zuversicht, es zu schaffen.
Sie soll es auch für die Menschen sein, die beginnen, Küche und Geld in die eigenen Hände zu nehmen.
Gerold Schlegel
Neustart für Küche und Geld
Andere Wege und neue Beziehungen wagen
© 2020 Gerold Schlegel
Umschlag, Illustration: Gerold Schlegel, Michael Schäffner
Lektorat, Korrektorat: Michael Schäffner - schaeffner.ch
Weitere Mitwirkende: Ronald-Peter Stöferle, Vorwort – incrementum.li
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback
978-3-347-08654-8
Hardcover
978-3-347-08655-5
e-Book
978-3-347-08656-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhalt
Vorwort von Ronald-Peter Stöferle
Einführung
Worum es geht? Kurz gesagt, um ein gutes, glückliches Leben. Das Buch soll helfen, Elemente und Aspekte dafür zu finden, wie der Einzelne, also der Leser, sich selbst ein solches Leben schaffen kann. Mit Rezepten und mit den Finanzen auf neuen Wegen – dazu soll das Buch verhelfen und auch ein wenig verleiten. Die Einführung gibt Orientierung für die 4 folgenden Kapitel.
Kapitel 1 – Erfahrungen mit der Lebensmittel- und Finanzindustrie
Vieles in beiden Industrien gleicht sich, auch wenn es augenscheinlich um völlig verschiedene Dinge geht: Lebensmittel und Finanzen. Sie gleichen sich auch in den Wirkungen ihrer Produkte: sie schädigen die Kunden. Das Kapitel gewährt einen kleinen Einblick, der den Leser anregen soll, selbst auf die Suche zu gehen: die Suche nach den Analogien, aber vor allem auf die Suche nach anderen, weniger schädlichen Wegen. Das zugehörige Element: Feuer.
Kapitel 2 – Macht und Inkompetenz
Macht, Inkompetenz, Narzissmus, Statusdenken – all das ist Realität in der Finanzindustrie und natürlich auch in der Lebensmittelindustrie. Was treibt Menschen an, «dabei sein zu wollen» und welche Wirkungen hat das? Welche Glaubenssätze leiten den Einzelnen? Und wer geht jetzt schon andere Wege und zeigt damit Kompetenz? Das zugehörige Element: Wasser.
Kapitel 3 – Monokultur
Unsere bunte Welt ist deshalb bunt, weil sie Vielfalt und Leben trägt. Die Luft gehört als Element zu diesem Kapitel. Doch es ist nicht zu übersehen, dass die Vielfalt abnimmt und die Einheitlichkeit – Monokultur – mehr und mehr Platz bekommt. Darunter leiden Traditionen und Kultur. Doch die Angst, Fehler zu machen, zu verlieren oder etwas zu verpassen, bestimmt heute das Handeln der Mehrheit der Menschen. Dabei ist es doch genau das, was ein gutes, glückliches Leben verhindert.
Kapitel 4 – Tuum Est – Deine Sache, Deine Pflicht
Meine Sache – meine Pflicht. Der Einzelne kann einen anderen Weg gehen, wenn er sich dafür entscheidet. Dann muss er ihn aber auch beschreiten. Das nimmt ihm niemand ab. Das Kapitel zeigt mögliche Wege auf und benennt Menschen, die andere Wege bereits beschritten haben. Das Element, welches hierzu gehört, ist die Erde. Es bleibt am Leser, wann er einen neuen Schritt macht: Tuum Est – Deine Pflicht!
Anhang
Eine Bücherliste, Essenzen und anderes Nützliches, das helfen kann, sich von der bisherigen Monokultur zu lösen.
Vorwort
«Geroldig». Sie kennen dieses Adjektiv nicht? Dann schlagen Sie bitte kurz im Duden nach oder fragen einen befreundeten Germanisten. Oder googeln Sie den Begriff. Sie finden nichts? Das liegt wohl daran, dass ich dieses Wort erfunden habe, um meinen Freund, treuen Wegbegleiter und Kunden Gerold Schlegel zu beschreiben, denn kein herkömmliches Adjektiv wird ihm gerecht.
Gerold ist ein kreativer Freigeist, ein weitgereister «Über den Tellerrand-Schauer», ein milder Wutbürger, ein wissbegieriges Multitalent, ein Mensch, der mehr Zeit außerhalb als innerhalb der Komfortzone verbringt. Und ein gemütlicher Schweizer, der eigentlich auch Wiener sein könnte, doch dafür ist er vermutlich stets zu gut gelaunt und zu wenig zynisch. Er stellt Fragen, die sich andere nicht zu stellen getrauen und zieht Analogien, die anfangs skurril, später interessant sind und sich am Ende als genial erweisen. Er geht auf Reisen, wenn andere Urlaub machen. Er setzt auf Selbstgemachtes, während Fast Food und Systemgastronomie bedeutender werden und er verlässt die Schweiz, während die Welt in die Schweiz strömt. Er kauft Gold, während die Mehrheit Anleihen und Immobilien als Zufluchtsorte sucht und er schreibt ein Buch, während die Welt sich nur noch auf Instagram und TikTok informiert. Sprich, er ist «geroldig».
Und genauso «geroldig» ist sein Lebensweg. Alle paar Jahre, stets, wenn er sich auf seinen Lorbeeren hätte ausruhen können, stand er auf und brach in ein komplett neues Gefilde auf. Sei es sein Auslandsaufenthalt in Südafrika als leitender Koch einer Produktionsküche mit etwa 30 Mitarbeitenden, seine Rückkehr nach Europa und seinem erfolgreichen Werdegang in der Versicherungsbranche oder anschließend als Baumeister eines höchst erfolgreichen und innovativen Family Offices.
Unsere Wege kreuzten sich, als ich zu Beginn unserer Selbstständigkeit in unserem Büro in Liechtenstein saß und eine kurze, sehr unkonventionelle Mail von Gerold bekam. Beim ersten Treffen stand eine sprachliche Barriere zwischen uns, denn sein Berner Akzent ist für einen Wiener kaum verständlich. Doch wir wussten sofort, dass er anders ist und wir zueinander passen wie der Deckel zum Topf. In den folgenden Jahren wurde Gerold einer unserer wichtigsten und treuesten Kunden. Im Zuge unserer Zusammenarbeit wuchsen wir zusammen. Wir redeten und philosophierten miteinander, wir stritten und lachten, wir assen und tranken und wir lernten voneinander. Ich lernte, wie ich Strukturen richtig aufsetze, wie ich die richtigen Partner auswähle und wie ich sie langfristig binde. Gerold lernte mehr über Gold, die Spezifika von Minenaktien, das Geldsystem und die Österreichische Schule der Nationalökonomie.
Nun liegt vor Ihnen das Ergebnis einer langen Reise. Ich ermutigte Gerold bereits vor einigen Jahren – zum Start seiner neuen Reiseetappe – ein Buch zu schreiben. Als Autor zweier Bücher und zahlreicher Goldstudien weiß ich, dass es harte Arbeit ist, dass man seine Gedanken in Worte fasst, sortiert und redigiert. Insofern bin ich froh und glücklich, dass dieses feine Buch nun fertig ist und ich einen kleinen Beitrag leisten darf.
Lieber Leser, ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen dieses Buches und ermutige Sie: Gehen Sie andere, neue Wege. Zeigen Sie Mut zum Risiko, aber Respekt vor der Angst. Bleiben Sie mutig, wissbegierig, kritisch und nehmen Sie sich nicht zu ernst.
Gestalten wir unsere Welt, unser Zusammenleben und unsere Anlagelösungen ein wenig «geroldiger»!
Viel Freude, und Erkenntnisgewinn beim Konsum dieses fein komponierten Menüs wünscht Ihnen
Ronald-Peter StöferleWien, im Sommer 2020
Einführung
Wir alle wollen ein gutes und glückliches Leben führen. Doch dazu müssten wir wissen, was die Zutaten für ein gutes, glückliches Leben sind. Alles, was Sie in diesem Buch finden, geht zurück auf die Grundsätze eines guten und glücklichen Lebens. Gesundheit und Finanzen sind zwei wichtige Pfeiler. Ein gutes, glückliches Leben kann ich weder an meine Eltern, Freunde, Lebenspartner, Kirche oder Arbeitgeber delegieren. Für ein gutes, glückliches Leben trage ich selbst die Verantwortung.
Um die Neugier zu wecken und den Spass zu fördern kommen Geschichten und Erlebnisse der beiden Küchen von Essen und Geld zur Betrachtung. Das heute übliche Ignorieren dieser beiden Baustellen zu beenden, ist das Hauptanliegen. Die Leser sollen beginnen, sich selbst um ihre Geldanlage und selbst um ihr Essen zu kümmern. Diese sind zwei tragende Pfeiler eines guten und glücklichen Lebens. Denn die Parallelen der Lebensmittel- und der Finanzindustrie sind verblüffend. Sie schädigen ihre Kunden. Die einen werden krank und die anderen kommen ins Armenhaus.
Das geht anders und sicher mit mehr Vorteilen auf Seiten der Kunden. Die fitten und kerngesunden Hundertjährigen der Welt zeigen das. Sie nutzen bestechende Gemeinsamkeiten: sie verzichten auf Delegation und Berater. Sie beschränken sich im Konsum und im Komfort. Das Verhalten und die Strukturen der smarten Reichsten der Welt sind weitere «Nützlinge», die zur Sprache kommen. Der Fokus des Buches liegt auf der Essenz und das Konzentrat macht es verständlicher. Die Theorie und Sprache aus Sicht des Praktikers macht es eher fassbar.
Wer gerne im Detail wühlt oder das Haar in der Suppe sucht, kann das Buch gleich auf die Seite legen. Hier kommt die Praxis zur Sprache. Die schwer verständlichen, theoretischen Abhandlungen können andere machen. Meine Sicht ist eine andere. In der Küche und im Umgang mit Geld gibt es kein Richtig oder Falsch, sondern vielmehr Wege, die funktionieren und andere Wege, die früher oder später zu Schäden führen. Deswegen geht es in diesem Buch um eine Essenz aus meinen Erfahrungen in beiden Industrien. Anstatt mit Fachbegriffen um mich zu werfen, sind Analogien aus dem Leben im Einsatz. Selbstmachen ist selten perfekt, doch extrem dauerhaft und unschlagbar in der vermittelten Freude und dem Stolz, es geschafft zu haben. Das Buch soll Anstoss sein, dass Menschen beginnen, sich auseinanderzusetzen und über Geld und Vermögen zu sprechen. Sich auszutauschen, den Prozess der Finanzindustrie sozusagen kurzzuschliessen. Solange Vermögen und Geld ein Geheimnis bleiben, sind die Anbieter im Vorteil, zum Nachteil der Kunden. Egal ob es um das Berufs-, Bankgeheimnis oder das Geheimnis um das Familienvermögen geht – wir sollten nicht über die Grösse der Vermögen sprechen, sondern über die Strukturen und Werkzeuge, die genutzt werden, um indirektes Einkommen zu erzielen. Oder über das, was hilfreich ist, um Investitionen und Verpflichtungen zu unterscheiden. Wer die Unkosten reduzieren kann, ist sicher im Vorteil.
So, wie es niemandem in den Sinn kommen würde, im Winter mit Sommerbekleidung in die Berge zu fahren, so gibt es in der Wirtschaft genauso Jahreszeiten zu beachten, die angepasste «Kleidung» erfordern. In der Wirtschaft bilden die vier Jahreszeiten den Wirtschaftszyklus, bestehend aus Aufschwung, Boom, Abschwung, Depression. Ein Naturgesetz, das sich wiederholt und das bleibt. Mittendrin das unbeachtete menschliche Verhalten. Egal in welchem Tempo der gesellschaftliche oder der technische Fortschritt vorangeht – Naturgesetze bleiben. Unverrückbar.
Ein bisher gültiges Naturgesetz ist, dass die Naturwissenschaft ein Verständnis hat für Wahrscheinlichkeiten. Speziell in der Physik. Doch weder in der Wissenschaft der Ökonomie noch in der Sozialwissenschaft ist das Verständnis von Wahrscheinlichkeiten vorhanden, egal wie oft das Gegenteil behauptet wird. Das irrationale Verhalten von Menschen in Unsicherheiten ist Randgebiet, obwohl das bei jeder Krise wichtig wäre. In der Küche kann das Verhalten trainiert werden, denn da herrscht öfters Krise, wenn alles gleichzeitig fertig werden soll, oder etwas zulange oder zu kurz gekocht wurde. In der Corona-Krise war irrationales Verhalten gut erkennbar am Kauf von WC-Papier.
Das Unmögliche ist, vorauszusehen, welches Wetter und welche Umstände den Wirtschaftszyklus, die Börsen und die Wertpapiere beeinflussen. Trotzdem gaukelt die Finanzindustrie mit TV-Sendungen, Finanzzeitschriften, -büchern, -Magazinen, YouTube, Jahresausblicken (2020) und anderem dem Laien vor, über die Kristallkugel zu verfügen. Die schon beinahe ordinär wirkenden Werbe- und Marketingbudgets machen aus den Zauberlehrlingen der Finanzen die besten Magier. Und die Mehrheit glaubt, was viel kostet, ist Qualität.
Eine der grössten Stolperfallen des Menschen ist es, das zu tun, was die Mehrheit tut, in der Annahme und im festen Glauben, dass das richtig sei.
Die beiden Gruppen der Gesellschaft, die im Buch vorkommen werden, sind: Mittelstand und Reiche. Mit «Reiche» meine ich Familien, die ihr Familienvermögen über mehrere Generationen erhalten konnten. Hier ist explizit die gute Seite von Reichtum angesprochen. Das Verhalten der Mehrheit, das heisst, der Gesellschaft, macht dagegen offensichtlich und verständlich, dass wenig Finanzkompetenz vorhanden ist. Selbstverständlich gibt es viele Nuancen und Differenzierungen. Wir sind einzigartige Menschen. Da die Detaillierung die Komplexität fördert, wird hier Einfachheit gepflegt. Denn genauso schnell wie das Detail aufblitzt, verschwindet das Prinzip und das Verständnis des Sachverhaltes. Das ist gewollt aus Sicht der Finanz- und Wirtschaftsindustrie. Verunsicherte Kunden sind einfach zu manipulieren und zu lenken. Doch die Sicht auf Grundprinzipien erleichtert das Verständnis und stärkt die Lust, sich mit Steuern, Geldanlage, Ernährung und Bewegung auseinanderzusetzen.
Übrigens: die Unternehmenslenker mit den Millionen-Gehältern sind Prototypen der Inkompetenz, denn trotz ihrer hohen Saläre verhalten sie sich wie Finanzanalphabeten. Erkennbar ist das an ihrer eigenen Hilflosigkeit. Den Beweis finden Sie später. Finanzkompetente Menschen wissen sich selbst zu helfen. Die grosse Verantwortung als Rechtfertigung ist ein Mythos. Kein Mythos ist im Gegensatz dazu die Inkompetenz. Der Blick auf die Einkommens- und Vermögensstrukturen und das Verhalten von solchen Managern und Angehörigen des alten Reichtums offenbart die Unterschiede schonungslos, und zwar nicht in Bezug auf das verfügbare Geld, sondern in Bezug auf ihre vorhandene oder nicht vorhandene Finanzkompetenz.
Die Leser dieses Buches verfügen über mehr Finanzkompetenz. Was als Hausmannskost daherkommt, wird sich zu einem Gaumenschmaus mausern. Einzigartige Gewürze, Aromen und dazu viel Erfahrung aus der Praxis machen es möglich.
Die Rezepte, die Sie finden, lassen viel Raum zum Ausprobieren. Vielleicht sind sie auch hie und da etwas knapp. Das ist Absicht. Die Leser sollen beim Ausprobieren der Rezepte den Umgang mit der Angst vor Fehlern und vor dem Misserfolg trainieren und sie später verlieren. Je mehr ausserdem mit unbehandelten Lebensmitteln gekocht wird, umso einfacher wird’s. Theoretisches Kochen und theoretische Geldanlage haben ein Ende. Das ist eine Aufforderung, gemeinsam mit Familie, Freunden und Bekannten zu kochen. Ohne Fertigprodukte, Tiefkühlkost, Pulver und andere «Nettigkeiten».
Die eigene Intuition stärken – ihr wieder vertrauen. Aus dem Kopf und ohne Rezept kochen. Selbstvertrauen tanken und aufbauen. So trainiert das Kochen längst vergessene und vernachlässigte Fähigkeiten: Intuition, Ausprobieren, etwas wagen (Risiko)… Die so gemachten Erfahrungen sorgen im Unterbewusstsein dafür, dass sich Fähigkeiten auf andere Bereiche übertragen. Der gepflegte Absicherungsmodus wird reduziert.
Die einzelnen Kapitel beginnen jeweils mit einem Rezept mit Grundzutaten und Vorgehen. Die Grundzubereitungsarten des Kochens sind hingegen auf vier begrenzt: Feuer, Wasser, Luft, Erde. Wenn alle 12 Grundzubereitungsarten zur Anwendung kämen, ist wieder die Komplexität am Ruder.
Nach der Einführung kann das Buch kreuz und quer gelesen werden. Für ein besseres Verständnis ist das 1. Kapitel wichtig. Darin stecken Grundlagen und Hintergründe, die das Verständnis der anderen Kapitel erleichtern. Die Analogien reichen von der Küche, der Versicherung bis in die «Champions League» der Finanzen. Für den Schutz vor Übervorteilung ist das Einzige, was vor den eigenen Schwächen hilft: einfache Strukturen für das eigene Verhalten. Gegen die mächtigen Kräfte von Manipulation, Verkaufstechniken, Psychotricks etc. ist kein Kraut gewachsen. Wie bekomme ich die besten Preise und was beachte ich beim Einkauf bei der Geldanlage?
Der offiziell in Bern zugelassene Seitenwagen darf genauso wenig fehlen, wie der grenzüberschreitende Anlagebetrug, bis hin zu mehrfach versuchtem Betrug bei Finanzierungen von Firmengründungen. Auch nicht, weshalb als Sanierer ein branchenfremder Mensch nützlich ist, der gerade seinen bisherigen Job aufgegeben hatte.
Was braucht es, um allein für 130 Personen zu kochen und warum ist über 10 Jahre später bei den Gästen immer noch davon die Rede? Wo lerne ich zu improvisieren? Was ist nützlich, wenn beim 6-Gang-Menu der Saibling auf Gemüsebett im Backpapier abgefackelt wird? Wie komme ich versteckten Kosten bei Währungswechseln auf die Spur? Was sind die Lehren aus der Wahl von knapp 130 unabhängigen Vermögensverwaltern und dem praktischen Einsatz von 26? Wieso arbeite ich heute nur noch mit vieren davon zusammen? Oder wie geht das: am Dienstag grünes Licht für eine Investition von 4 Millionen Euro und am darauffolgenden Samstag wird die Firma liquidiert? Was zeichnet eine Bank im Umgang mit der Geldanlage aus? Wie gewinnt man Neukunden, die nach einem Milliarden-Firmenverkauf umworben und umgarnt werden? Welche Folgen haben die Drogen «Geld», «Macht» und «Status»? Was sind die Konsequenzen daraus?
Wer jetzt denkt, dies wird ein Buch nach dem Motto «Wie werde ich schnell reich?» oder wer die grosse Enthüllungsgeschichte erwartet, der ist auf dem Holzweg. Der Kern ist vielmehr: wie kann ich Vermögen aufbauen und im heutigen Umfeld schützen?
Meine Überzeugung ist, dass dies am besten gelingt, wenn ich die Produkte, Strategien, Strukturen und das Verhalten der reichsten Menschen nutze und die Produkte der Bank mehrheitlich im Regal belasse. Meine Erfahrungen im Umgang mit Vorgehen und Strategien der Finanzindustrie sind ein Fundus sondergleichen. Wer den Fundus kennt, traut sich nicht mehr ohne Vorsichtsmassnahmen in die Bank. Oder er lässt es lieber gleich bleiben und spielt nach eigenen Regeln, so wie das seinerzeit David mit Goliath tat. Der Sinn der eigenen Organisationen der Reichen und deren temporären Zusammenschlüssen ist es, den Missbrauch zu verhindern und die Bankkosten zu reduzieren. Deshalb ist mein Standard, überhaupt keine Bankprodukte einzusetzen. Am wichtigsten ist: je weniger Fehler und Verluste entstehen, umso grösser ist meine finanzielle Sicherheit im Alter.
Darüber, wie ich mein eigenes Vermögen bewirtschafte, werde ich einen externen Nachweis erbringen. Das ist einmalig. Meine Präferenz, die ich empfehle, ist deckungsgleich mit der Präferenz der Umsetzung. Meine Vermögensaufteilung besteht aus einer Basisanlage und einem Forschungs- und Entwicklungsteil. Der künftige Kunde kann entscheiden, ob er das Abonnement für die Basis oder beides haben will. Wer dieser Sache zum Durchbruch verhelfen will, kann das mit Geld oder Arbeit zusätzlich tun.
Ich wünsche mir, mit diesem Buch einen Beitrag leisten zu können, damit Menschen und Organisationen neue Wege und Vereinbarungen im Umgang mit der eigenen Gesundheit und den eigenen Finanzen finden. Jeder macht Fehler. Fehler sind der Nährboden, aus dem Neues entstehen und der Mensch oder die Organisation wachsen kann. Ohne Fehler keine Erkenntnisse und Einsichten. Wir alle machen Dinge, die nicht allen gefallen. Ein Naturgesetz. Jeder Tag ein Neuanfang. Dazu gehört, meinen Gegenüber so zu behandeln, wie ich behandelt werden möchte. Ich möchte Sorge tragen für meine Umwelt. Alles, was mir oder Dritten schadet, möchte ich unterlassen. Der Prozess ist auch für mich mit Rückschlägen verbunden, doch jeder Tag ist wieder eine neue Chance. Das Buch ist auf die gleiche Weise entstanden. Ein Prozess, der Veränderungen zuliess. Vieles ist über das Ausprobieren möglich geworden. Und das Buch soll dazu animieren, die Finanzen und die Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Über den Austausch untereinander wachsen neue soziale Beziehungen. Ein gutes und glückliches Leben hat drei Säulen: Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen. Das Fundament dazu sind die Werte und die persönliche Haltung.
Das gute, glückliche Leben hat nur einen Haken: «Tuum Est» - meine Sache und meine Pflicht.
Verführerisch und verheissungsvoll.Delegieren, es vermeintlich bequem haben wollen…Das Ergebnis ist oft das Problem.
Kapitel 1 – Erfahrungen mit der Lebensmittel- und Finanzindustrie
Essenz «Feuer»
Je mehr Training, umso besser die Resultate und das Gefühl für die Temperatur. Feuer kann unterschiedlich genutzt werden. Je mehr Glut, umso mehr Einsatzmöglichkeiten. Ich kann an einem Ort feuern und daneben beginnen, mit der Glut zu kochen. Auf Glut kann ich alles kochen und die Hitze bestimmen. Wer auf den Garküchen der Strasse in die Töpfe guckt, erlebt die Vielfalt der Möglichkeiten. Da werden zwischen 3 Steinen ganze Menüs zubereitet. Das «Dreibeinsystem» stellt eine wackelsichere Unterlage für die Pfanne sicher. Die Steine sind gleichzeitig Hitzespeicher. Diese Art des Kochens benötigt viel weniger Holz für die gleiche Leistung (Hitze). In Strassenküchen ein gewichtiger Kostenfaktor. Himba und Massai nutzen das System seit eh und je. Die Skandinavier haben ihr Holzbrett, das sie schräg zum Feuer im Abstand von etwa einem Meter hinstellen, um ihre Fische sanft zu garen. Das Eiweiss kann so viel weniger stocken, da die Temperatur unter 65 Grad bleibt. Auch der Speckstein, den die einen oder anderen zu Hause haben, könnte zum Kochen benutzt werden. Fleisch ohne Fett direkt in der Kohle gegrillt – ein Gaumenschmaus. Ausprobieren! Es gibt nicht vieles, was auf dem Feuer nicht produziert werden kann. Ausprobieren: 10-15 Lagen Zeitungspapier, Kräuter, Gras oder Heu darauflegen, danach eine gewürzte Lachsforelle darauf geben, alles zusammenrollen und verschnüren wie ein Packet und dieses in Wasser legen. Das vollgesogene Paket kommt direkt ins Feuer (max. 7-10 Minuten). Der billigste Dampfkochtopf.
Die Mehrheit kocht zu heiss und zu schnell. Die Feuerküche nimmt da viel Tempo und Hektik raus. So oft mit zu viel Hitze gekocht wird, so oft ist das gegrillte Fleisch zu wenig gesalzen. Wichtig ist, bei einem Feuer drauf zu achten, dass die Glut-Versorgung sichergestellt ist. Ein Ort für das Feuer und einer für die Glut. So ist schon viel mit der Hitze steuerbar. Weniger Hitze bedeutet mehr Zeit für den Garprozess. Ein empfehlenswertes sinnliches Kochbuch ist: «Feuerküche» von Chris Bay und Monika di Muro.
Feuerkochen – Temperaturen
• Räuchern, 25-90 Grad
• Smoken, 90-130 Grad
• Dämpfen, bis 100 Grad
• Kochen, 100 Grad
• Frittieren, bis zu 170 Grad
• Pfannenbraten, 140-180 Grad
• Grillen indirekt, 130-220 Grad
• Direktes Grillen, bis 260 Grad
• Steaks angrillen, 230-280 Grad
Grundausrüstung
• Gusseisenpfanne
• Wok mit zwei Griffen
• Grillzange mit Zähnen, ohne Plastik
• Schneidemesser (gross)
• Besteck (Sackmesser, Löffel, Gabel)
• Schneidebrett (Holz)
• Speckstein (für Fleisch und Gemüse u.a.)
• Feuerhandschuhe
• Feuerhaube (z.B. Deckel Weber-Grill)
• Grillrost oder direkt auf Kohle
Grundzutaten
• Steinsalz ist dem Meersalz vorzuziehen (Mikroplastik im Meersalz)
• Schwarzer Pfeffer aus der Pfeffermühle (kein Standardpfeffer gemahlen). Meine Favoriten: Kubeben, Tasmanischer, Langer Pfeffer.
• Knoblauch (gerne auch schwarz fermentierter Knoblauch)
• Chili
• Limette, Zitrone, Tomate (Fleischgerichte). Säure ist der Geschmacksturbo.
• Balsamico Hell/Dunkel
• Sauce von fermentierten Früchten
Feuerstufen/-reife, Hölzer und Brennstoffe
• Anfeuerung: Eichen-/Feigen-/Rebenholz
• Aufbauendes Feuer: Früchtehölzer (Äpfel, Birne etc.)
• Feuer-Höhepunkt: Gesammeltes Holz im Wald
• Niedergehendes Feuer: Birken-, Eschen-, Buchenholz (Cheminée-Holz)
• Rote Glut mit weissem Asche-Film: Kohle
Kochmethoden am offenen Feuer
• Glut- und Aschekochen: Ursprünglichste Form des Kochens. Artischocken, Kartoffeln, Paprika, Auberginen, Eier, Kastanien, Fladenbrot u.a. direkt in die Glut geben oder Glut auf die Seite schieben, Gemüse direkt auf die Erde, mit Glut zudecken.
• Lehmkochen in der Glut: Hobos (Nordamerikanische Wanderarbeiter) oder Roma garten das Huhn im Lehm. Leichtes Gepäck, kein Topf erforderlich. Den Lehm ca. 1-2 cm dick flach auseinanderdrücken. Das gewürzte und marinierte Huhn mit grossen Blättern umwickeln und mit Ton einpacken.
• Garen auf Stein: Einen flachen Stein als Herdplatte verwenden. Ca. 1 Stunde in die Glut legen. Dann einfetten. Fisch, Gemüse, oder Gebäck ist gut geeignet (keine nassen/feuchten Steine oder Kalk-/Feuersteine verwenden, diese zerspringen leicht).
• Garen im Blatt: Anstelle Alufolie grosse Blätter verwenden (Huflattich/Pestwurz). Gemüse, Fleisch, Früchte, Fisch oder Käse einwickeln und auf die Glut geben.
• Glutgrube: Ein Loch ca. 20-30 cm tief ausheben. Je nach Gargut die Grösse der Grube bestimmen. 1-2 Stunden feuern, damit 10-15 cm Glut entsteht.
• Indirektes Garen: in Argentinien werden Fleischstücke auf einem Eisengestell neben dem Feuer in den Boden gesteckt. In Schweden wird Fisch direkt auf ein Holzbrett neben dem Feuer platziert.
• Erdofen/-grube: Fast jedes Naturvolk hat Gerichte, die in der Erde gegart werden: Hawai/Imu, Maoris/Umu, Fidji/Lovo, Mexiko/Barbacoa, Kanake/Bougna, Peru/Pachamanca. In der Grube können ganze Ziegen oder Schafe gegart werden. Grube ausheben, Steine hineinlegen, Feuer machen. Sobald Glut vorhanden ist, das Bratgut mit Blättern oder nassen Tüchern einpacken, heisse Steine darauflegen und mit Erde zudecken. Das geht auch mit einem Topf. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ziege/Schaf benötigt sicher 3-4 Stunden. Das Erdofen-Kochen bedarf etwas Übung.
• Glutsteine/der Fellkochtopf: Grube ausheben, Fellseite mit Haaren nach aussen am Rande befestigen, Wasser, Kräuter, Kartoffeln etc. hineingeben, heisse Steine dazugeben, zum Kochen oder Simmern bringen
• Glutbrennen: So werden Kochgeschirre und Boote aus ganzen Ästen oder Stämmen gebrannt. Das Essen aus diesem Geschirr schmeckt köstlich.
• Tontopf: Wir kennen den Römertopf, ev. die marokkanische Version «Tajine». Hier ist es besonders wichtig mit konstanter tiefer Temperatur zu kochen. Eine ausgesprochen gesunde Methode – Niedergarprinzip.
• Spiesse: diese sind mit allem zu produzieren. Im Orient ist es üblich, 1 Meter lange Spiesse zu benutzen. Diese werden mit Auberginen, Tomaten, Zwiebeln, Paprika direkt ins Feuer gegeben. Anschliessend, wenn sie kohlrabenschwarz sind, geschält. Würfeln und in der Pfanne würzen.
• Grillrost: der Klassiker, den jeder kennt. Ein Gusseisenrost lohnt sich.
• Weidengeflecht: das Weidengeflecht in einer Blechdose könnte zum Räuchern ideal sein. Weidengeflecht in Bratpfanne legen, wenig Wasser dazu, eventuell mit Kräutern Zitronen-/Limettenschale leicht würzen, Gargut dazu geben, zudecken, dämpfen.
• Töpfe, Bräter, Pfannen: die Klassiker.
Wildpflanzen
Ackersenf, Bärlauch, Beifuss, Pastinake, Wilder Thymian, Schafgarbe, Wiesenknöterich
Wilde Teekräuter
Birkenblätter, Brombeer-/Himbeerblätter, Hagebutte, Kamile, Pfefferminze, Wegwarten-Blüten (Heilpflanze des Jahres 2020), Weissdornblüten
Feuerrezepte
Garen im Blatt (alternativ: in Alufolie)
Camembert Fondue: Camembert dick einpacken. Langsam erhitzen. Etwas Glut am Boden. Päckchen draufstellen und mit Glut umschliessen und bedecken. Aufschneiden, essen. Wer mag kann mit Gewürzen, Kirsch, Früchten etc. ergänzen.
Schoggi Banane: Banane schälen/halbieren und auf das Blatt oder die Alufolie legen. Dann füllen/belegen mit Schoggi und allem, was gut ist: Nüsse, Gedörrtes, Minze, Orangen, Beeren… Wenig Hitze am Rande der Glut oder auf dem Grillrost. Kann auch grob gewürfelt werden. Knaller ist die Kombination von Feueraroma: Rauch, süss, sauer, etc.
Spiesse
Ganzes Gemüse: Peperoni, Tomaten, Zwiebeln, Auberginen direkt auf dem Feuer grillen bis sie schwarz sind… schälen würfeln und in die Gusseisenpfanne/Topf und würzen.
Feuerfeste kleine Formen
Frühstückskracher: Das feuerfeste Geschirr mit Speck auskleiden, 1 oder 2 Eier dazugeben (je nach Grösse), würzen, am Rande der Glut hinstellen, zwischendurch drehen. Brotscheiben toasten/grillen und mit Butter bestreichen.
Gusseisenpfanne
Nachos Pizza: Gemüse (Tomaten, Peperoni, Rüebli, Zwiebeln, Knoblauch, Chili, Zucchetti, Kohlraben, Babylattich, Rüebli…) Je nach Saison, Lust und Vorrat. Käse. Kleinschneiden, verteilen, würzen. Alles in der Gusseisenpfanne anziehen, mit etwas Butter oder Olivenöl, würzen, grosszügig Nachos dazugeben, mit Käse bestreuen und servieren. Pfeffer aus der Mühle für den der mag.
Erfahrungen mit der Lebensmittelindustrie
Von der Ess- und Kochkultur über das Private, Beruf, Wirtschaft, Politik, Religion – praktisch jeder Bereich der Gesellschaft und des Zusammenlebens ist in der einen oder anderen Form untereinander betroffen. Das treibt oft seltsame Blüten. Vor allem aber sind ähnliche bis gleiche Strategien, Argumentationen und Muster erkennbar und in der Produktion finden sich «Fabriken», die alle nach vergleichbaren Prinzipien arbeiten. Die Werbung und das Marketing machen sich Analogien zu Nutze. Gefühle von Freiheit und Unabhängigkeit – egal ob in Bezug auf Nahrungsmittel oder in Bezug auf Finanzen – werden vermittelt. Der Komfort, die Freiheit, das Grüne, die Bequemlichkeit, die Fitness und das Gesunde herausgestrichen.
In diesem Kapitel gebe ich einen kleinen Einblick in die Nahrungsmittelindustrie und später in die Finanzindustrie. Das soll Neugier wecken und das Verständnis der Zusammenhänge und Vorgänge in der heute weitgehend ignorierten Welt der Finanzen fördern. Beispiele und Episoden aus meinem Leben kommen vor, die sicher jeder von uns auf die eine oder andere Art selbst schon erlebt hat. Als neugieriger und vermeintlich risikofreudiger Mensch habe ich viel erlebt und noch mehr ausprobiert. Hobbies wie das Seitenwagenfahren bei jedem Wetter sind ein Fundus für Erfahrungen und Training, ebenso meine Zeit als Koch im Ausland oder die vielen Reisen abseits der ausgetretenen Pfade. All das sind meine Mittel, damit die unverständliche Fachsprache für einmal still ist. Wer viel probiert, erlebt ebenso viel und ist noch öfters in Schwierigkeiten. Das alles ist ein reichhaltiges Buffet für Einsichten und ein lebenslanges Trainingslager, um dem Umgang mit Risiken und Ängsten zu erlernen.
Vereinfachen
Anstelle der 12 Grundzubereitungsarten der Küche vereinfache ich und reduziere auf die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde. Mit Wasser kann ich alle Suppen und Saucen herstellen. Beim Feuer ist Gebratenes vom Gemüse über Fleisch bis zum Fisch alles dabei. Die Luft ist beim Brotbacken und Bierbrauen ein zentrales Element. Als viertes Element kommt die Erde hinzu und damit das Fermentieren. Fermentieren ist etwas vom Wichtigsten für die Gesundheit und zur Optimierung des Geschmacks.
Je einfacher und archaischer gekocht wird, umso erfolgreicher kann jeder kochen. Da spielen sogar Mengenangaben eine untergeordnete Rolle. Das Probieren, mischen und unterschiedliches Würzen wird selbstverständlich. Je perfekter, umso komplizierter und theoretischer. Was wächst ist die Angst und Unsicherheit, es nicht zu schaffen. Willkommen in der Theorie, beim Fastfood und bei den Fertigprodukten. Ade Praxis und Gesundheit. Erwünscht sollte aber sein, sich selbst mehr zu trauen und mehr auszuprobieren. Die praktischen Erfahrungen sind viel wichtiger als theoretische Kenntnisse. Die praktischen Erfahrungen und das Ausprobieren von Gerichten fördert, Angst und Unsicherheit abzubauen. Das Zutrauen, selbst zu kochen, soll durch die eigenen Erfahrungen gestärkt werden. Das Ausprobieren erfordert es, Risiken einzugehen. Deswegen erscheinen in diesem Buch eine Reihe von archaischen Rezepten. Mit denen kann sich der Leser selbst trainieren – mit begrenztem Risiko und mit Freude beim Kochen.
Und genauso ist es mit der Finanzwelt: am Ende des Buches soll der Leser neugierig auf einfache, verständliche und risikoarme Rezepte für den eigenen Umgang mit Geld und Vermögen sein und trainieren, die Rezepte ohne Angst und mit begrenztem Risiko selbst anzuwenden.
Wer ist nicht auf der Suche nach dem guten und glücklichen Leben? Wie baue ich mir mein eigenes glückliches Leben? Was sind die Pfeiler eines guten, glücklichen Lebens? Und was kann ich vorkehren, um möglichst gesund zu bleiben? Da ist Ernährung und Bewegung blitzartig im Zentrum. Ernährung am besten gleich mit Selbstgekochtem. Mit längst vergessenen Rezepten, Zubereitungsarten, die förderlich sind für die Darmflora und für die schnelle Übermittlung von Informationen an Hirn, Beine, Hände etc. Zur Ernährung gesellt sich die Bewegung. Finanzen sind genauso zentral wie die eigene Haltung und Denkweise. Denn für ein glückliches und gutes Leben sind 4 Elemente wichtig, die ich weder delegieren noch ignorieren kann. Sie sind meine Pflicht: soziale Beziehungen, Gesundheit (Bewegung/Nahrung) Finanzen und als Fundament meine innere Haltung, Denkweise, Lebenseinstellung. Ganz gleich, wie viel ich in meinem Leben delegiere, ignoriere und verschiebe: um diese Elemente komme ich nicht herum.
Sie bleiben in meiner Verantwortung und sie bleiben meine Pflicht, mich darum zu kümmern. Das Ignorieren der Themen rund um Wirtschaft, Recht, Steuern, Vorsorge und Geldanlage führt direkt in Abhängigkeiten und letztlich zum finanziellen Schaden, sei es bei der erwarteten Pension oder den vielen Verpflichtungen, die sich einstellen. Dabei ist Unabhängigkeit einer der Schlüssel sowohl finanziell wie persönlich. Es ist genau wie bei der Ernährung: das Ignorieren einer gesunden Ernährung führt in Abhängigkeiten zu Fast Food und geringwertigen Lebensmitteln und letztlich zu schädlichen gesundheitlichen Auswirkungen.
Verpflichtungen
Der Mechanismus, sich Verpflichtungen aufzuhalsen, ist oft bereits in der Kindheit gelegt worden. In den meisten Kinderstuben ist das Einüben von Plattitüden, Verhaltensregeln und destruktiven Selbstbildern die Norm. Das Benotungssystem sowie die Methoden von Schule, Universität und Erwachsenenbildung verstärken diesen Effekt. Sie legen ein erdbebensicheres Fundament von Unfreiheit, Fremdsteuerung und Unbeweglichkeit, jedoch mit der Vorstellung von Komfort, Bequemlichkeit und vermeintlicher Sicherheit.
Doch Komfort, und Bequemlichkeit führen direkt – über kurz oder lang – in die Verunsicherung und Abhängigkeit. Das «selbst machen» und «sich trauen» nimmt ab. Denn für alles gibt es einen Experten, der die Lösung beisteuert. So wird es einfacher – wenn es dann schiefgeht – einen Schuldigen zu finden. Diese Tendenz, die Verantwortung zu delegieren, greift wie eine Seuche um sich. Eigenverantwortung ade.
Das Festhalten an Macht und Status, die hippen Marken und die Neidgesellschaft verstärken das Fundament, ähnlich dem vielen Eisen, welches zur Stabilität eines Fundamentes eingebaut wird. Ständiges Vergleichen und Eintreten in einen vermeintlich notwendigen Wettbewerb runden das ganze Gebäude von Vorstellungen, Abhängigkeiten und Verpflichtungen perfekt ab.
Peter Thiel, einer der erfolgreichsten Investoren des Silicon Valley (PayPal, Facebook, Palantir etc.), hat seine eigenen Regeln. Die wichtigste davon ist: dem Wettbewerb ausweichen. Ein unbespieltes Feld suchen. Wer in Wettbewerb geht, hat schon verloren. Egal ob Gewinnen, Verlieren oder Vergleichen: genau das gilt es zu verhindern. Als Mitglied der Bilderberg-Konferenz hat Peter Thiel für neue Projekte einen Zugang in ein exklusives Netzwerk. Den Wissensvorsprung aus diesem Netzwerk nutzt er und wählt nur die Projekte aus, die diesem Wettbewerb ausweichen. Gleichzeitig hat er so Zugang zu Informationen, die Otto Normalverbraucher erst 2 bis 3 Jahre später mitbekommt. Sein Buch «Zero to One» ist jedem Unternehmer zu empfehlen, der eigene Wege erforschen will. Mit diesem Buchprojekt und meinem Geschäftsmodell der Abonnenten mache ich genau das. Neue und andere Wege gehen, etwas wagen, was noch nie gemacht wurde und das schwer zu kopieren ist.
Gehe ich Verpflichtungen ein, werde ich rasch im Hamsterrad dieser Verpflichtungen und Zwänge willkommen geheissen. Dort, wo keiner hineinwill, aber dennoch die Mehrheit sich darinnen gefangen gibt. Dabei ist es so einfach erkennbar: immer gibt es «über mir» jemanden, der schöner, reicher, glücklicher, erfolgreicher ist. Der Vergleich funktioniert: man beginnt, sich zu messen, eben: zu vergleichen und zu übertreffen. Doch wirklich einfach wird es im Leben, wenn man damit aufhört. Übrigens: das System von Vergleichen und Messen funktioniert auch in die andere Richtung: wer will schon mit den «Untenstehenden» tauschen?
Es ist höchste Zeit, die Schlaumeiereien der Industrien «Ernährung» und «Finanzen», des Bildungssystems und der gesellschaftlichen Mechanismen aufzudecken. Die Demaskierung ermöglicht einen realistischen Blick in die Zukunft – sprichwörtlich: der Realität ins Auge schauen und sie annehmen. Das ist unbequem und liegt ausserhalb der Komfortzone. Das fährt in die Knochen. Die prägendsten, eindrücklichsten Erinnerungen und Erfahrungen meines Lebens verschafften mir die Erlebnisse, die einen zartbitteren Hauch hinterliessen. Doch irgendwie verhalfen mir genau diese Erfahrungen und Momente, persönlich zu wachsen. Das erkannte ich oft erst im Nachhinein. Doch zuerst: wie kam es dazu?
Kochen war schon im Kindsalter etwas, das ich liebte. Auf den Geschmack kam ich auf der Alp bei meinem Grossonkel. Er sömmerte als Senn auf der Alp «Ahore » oberhalb von Walenstadt seine Rinder. Die Alphütte war sehr einfach. Fliessend Wasser draussen am Brunnen und drinnen Petrollampen. Kerzen waren nur in der Küche erlaubt. Geschlafen wurde über der Küche. Der Holzherd sorgte für die Schwärze und den Geruch nach Russ und Rauch. Wenn ich nicht auf der Alp war, verbrachte ich viel Zeit im «Fäsch». Die Küche dort war noch älter und der Geruch der frischen Rösti und Eier am Samstag oder Sonntag zum Frühstück waren einmalig. Hier kochte ich meine ersten Teigwaren: Hörnli en Bloc! Ja, Hörnli kamen am Stück aus der Pfanne und mussten geschnitten werden. Das passiert halt, wenn niemand rührt und ich Erwachsene kopiere. Dennoch entwickelte sich «Älpler Hörnli mit Härdöpfel, Böllä u Öpfelmues» zu meinem Favoriten.
Ein einfaches Gericht mit nur einer Pfanne auf dem Holzherd zu schaffen, wenn das Apfelmus schon hergestellt ist. Wenig abzuwaschen und einmal Wasser holen reicht. Teigwaren, Böllä (Zwiebeln), Käse, Kartoffeln und Apfelmus. Wer es mag eventuell noch Glarner Schabziger.
1. Böllä (Ringe/Scheiben) anrösten bis sie fast schwarz sind Auf einen Teller geben und auf die Seite stellen.
2. Wasser aufkochen, kräftig salzen und Hörnli (Teigwaren) dazugeben – umrühren, nach 5 Minuten klein gewürfelte Kartoffeln dazugeben und mitkochen – al dente kochen.
3. Schichtweise in Schüssel anrichten: Hörnli/Kartoffeln, Böllä, Käse, Hörnli/Kartoffel, Böllä, Käse usw.
Archaisches Kochen erfordert im Kopf eine Veränderung. Ohne Wasseranschluss ist alles Wasser zu holen und zu tragen. Da wird jeder kreativ, um den Wasserverbrauch zu reduzieren.
Leckereien aus der Dose waren für mich seinerzeit Erbsli und Rüebli, Birnen, Ananas, Pfirsich, Ravioli, Apfelmus.
Gottseidank war später über Jahrzehnte Genuss und Experimentierfreudigkeit bei mir an erster Stelle, sozusagen eine grosse Leidenschaft: Neues ausprobieren und Unbekanntes entdecken und lieben lernen. So ist Lernen ohne Pisa-Studie im Schnellzugtempo möglich und bleibend. Praktische Erfahrungen anstelle Theorie. Und die praktische Erfahrung schlug Theorie bei weitem, denn wer sensationelles Essen entdecken will, braucht dazu grottenschlechtes Essen, um zu wissen, was die sprichwörtliche Verheissung ist. Das ist meine Überzeugung. Meine Neugier und mein Optimismus und der Glaube an das Gute hat mir viel mehr zum Erfreuen und zum Entdecken gebracht als jedes theoretische Wissen.
Die Neugier, auszuprobieren, ist der heutigen Mehrheit leider abhandengekommen, so meine Wahrnehmung. Stattdessen wird ein Absicherungsmechanismus gestählt und jedes Risiko in kleinstmögliche «Teil-Risiken» zerlegt. Am Ende überwiegt eine tiefe Angst vor Fehlern und es wird nur noch das getan, was die Mehrheit tut. Das steigende Alter führt zu noch mehr Absicherung. Die Sorge, dass es im Alter nicht reichen könnte, wächst schneller als die Menschen altern. Chancen und Möglichkeiten werden mehr und mehr ausgeblendet. Und das lässt Menschen, die zum Lernen, Entdecken und Erobern gebaut sind, sprichwörtlich verkümmern.
Das erdbebensichere Fundament, nichts zu wagen, wird in der Schule gelegt. Fehlerfrei zu sein ist ständig im Unterbewusstsein verankert und wird gefestigt. Anerkennung von Autoritäten und Eltern zu bekommen, ist die Norm. Über Lehre, Studium, Standards, Berufsverbände, Zertifikate und anderes werden später die Wege aufgezeigt, wie was zu gehen hat. Der richtige Weg ist der einzige Weg, der begehbar sein soll. (Wobei ungeklärt bleibt, was «richtig» überhaupt ist.) Die vielen Experten und Einflüsterer wie Freunde, Bekannte, Eltern, Geschwister säumen diesen Weg. Sie alle singen das Lied, in das heute viel zu viele einstimmen: «Das geht nicht. So wird das gemacht!» Wer zu lange zuhört, schwächt sein eigenes Zutrauen und stärkt die eigene Unsicherheit. Im gleichen Takt wird der Durchschnitt gefördert, denn die Fächer, in denen der Schüler stark ist, kann er vernachlässigen. Das ist zu oft die Meinung der Eltern. Gleichzeitig werden für die Fächer, in denen der Schüler Schwächen zeigt, Nachhilfestunden organisiert. Stärken werden wenig beachtet, Schwächen werden hervorgehoben und höher priorisiert.
Mein erster Lohn hängt bei mir an der Wand: ein Plakat einer Ausstellung im Kunsthaus Glarus von 1978 mit Werken von Fritz Hug. Das war mein erstes Trinkgeld im Hotel «Hof» in Bad Ragaz. Leider habe ich dem bekannten Tiermaler kein Autogramm abgeluchst. Als Chasseur (Hotelpage) geziemte es sich nicht, Forderungen an Gäste zu stellen. Und mir war schlicht nicht klar, wer Fritz Hug überhaupt war. Klar war: Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit helfen, um Trinkgelder zu erhalten. Doch nicht auf dem Radar war das, was wirklich wichtig gewesen wäre. (Unterschrift von Fritz Hug). Seine Anerkennung meiner Leistung, das Lob dieser Respektperson und die Beachtung meiner Person, haben mich blind gemacht. So geht es heute vielen Menschen, wenn sie Beachtung erhalten für das, was sie getan haben. Ablenkung ist heute ein zentrales Element in der Beratung und im Verkauf. Die wenigsten sind gewappnet gegen Beeinflussung und Manipulation. Im Kopf glauben viele, gewappnet zu sein. Das Plakat von Fritz Hug stärkt seit dieser Begebenheit meine Aufmerksamkeit bei Themen von Beeinflussung und Ablenkung. Ganz persönlich behielt das Plakat seinen Wert als Erinnerung an den Maler: es hat mich über Jahrzehnte begleitet und befand sich in jeder Wohnung immer in Sichtweite – von der Küche aus gesehen.
Im gleichen Jahr war ich als Schnupperstift auf dem Muottas Muragl im Engadin. Da lernte ich das erste Mal eine Küche kennen, in der es richtig rund ging. Bis zu 300 Personen assen am Mittag, drei Köche und drei Helfer inklusive Abwascher waren dafür verantwortlich. Hier lernte ich auf die harte Art, meinen Kopf zu gebrauchen und nicht alles für bare Münze zu nehmen. Der Auftrag Mehl zu hacken – unvergessen. Ebenso das Gelächter der Mannschaft. Meine Scham war damals riesig, der Lerneffekt ist es bis heute: auch als Lehrling kann ich unterscheiden, was richtig und was falsch ist.
Die Küche ist ein Ort, an dem ich ausprobieren kann. Ich kann Risiken eingehen und erkenne so, dass die Chancen grösser sind als die Risiken. Das wird sich übertragen auf das eigene Leben. In dem Sinne liebe ich Schwierigkeiten und Herausforderungen und der Weg meiner Kochkarriere ist gepflastert mit solchen Erfahrungen:
• Vom Lehrbetrieb mit Knorr und Hügli zum Landgasthof, in dem alles frisch selbst hergestellt wurde
• Danach direkt als Grillchef ins «Dolder Waldhaus» in Zürich
• eineinhalb-jähriger Auslandaufenthalt als Koch – ohne die Sprache zu können
• Produktionsküche leiten, wenn drei Viertel des Personals fehlen
• 23 Stunden Kocheinsatz mit zwei Köchen, einem Helfer: Buffet für 150 Personen und ein 6- Gang-Menü für weitere 70 Personen an Sylvester. Ein Mammutprogramm
• Grenzgänge des Kochens in der Armee: in veralteten Gemeindeküchen, mit offenem Feuer bis hin zu einer brennenden Bratpfanne, die beinahe die Küche abfackelte.
Eine einfache Suppe kann genauso der Inbegriff von Köstlichkeit sein, wie ein Stück Käse mit dunklem Sauerteigbrot. Der 5-Gänger genauso wie ein schlichtes Mittagsmenü. Dazu sind keine «Exklusiven Zutaten» aus der Ferne oder aus dem Meer nötig, Vielfalt und Abwechslung reichen. Je mehr ich Gerichte und Gewürze ausschliesse, umso mehr sind mir bleibende Erfahrungen verwehrt. Denn das verhasste Gericht anders zubereitet, perfekt gegart und gewürzt, kann zur Verheissung werden. Wer schon fast militant zum Ausdruck bringt: «Das habe ich nicht gerne!» oder «Das esse ich nicht!», bestraft sich selbst, denn Geschmacksnerven und Lieblingsaromen verändern sich. Dieses Jahr machte ich eine Erfahrung der ausserirdischen Art in Wien. Das Lokal «Wratschko» ist bei den Einheimischen populär für seine Wienerküche und seine unveränderte Lokalität. Touristen bleibt es oft unerschlossen. Es ist wenig bekannt, der Eingang schnell zu übersehen und befindet sich in einem Quartier mit wenig Partylokalen. Es erscheint genauso wenig in hippen Ranglisten und Stadtführern. Ich mache das «Wratschko» mit meiner Empfehlung populär und erhöhe die Gefahr, nicht mehr das Gleiche zu bekommen. Als ich das erste Mal da drin war, kam ich aus dem Staunen nicht raus. Egal ob ich die kleine Menükarte betrachtete, die Einrichtung (uralt) oder die Menschen (Vielfalt) – alles erfreute das Auge, weil es so ungewohnt war. Mein Freund bestellte «Beuschel», ich klappte die Karte zusammen und sagte: «Das nehme ich auch. Das, was du bestellst, ist gut.» Ich wusste nicht, dass in dem Gericht Niere, Lunge, Leber und Herz steckte. Das Gericht – ein Gedicht. Ich hätte es nie bestellt, wenn ich eine Ahnung davon gehabt hätte, was sich darin verbirgt. Die Verpackung «Wratschko» und «Beuschel» waren gewöhnungsbedürftig, das Resultat jedoch einmalig und sensationell gut!
Mit Mike Glauser von Jumi GmbH («Belperknolle») verbindet mich eine besondere Geschichte und die Leidenschaft für den Beruf. Lange Zeit waren wir Nachbarn in Ried bei Schlosswil (Kanton Bern). Dazumal wohnte er im Wohnwagen im Nachbargarten. Samstags ging ich nach dem Einkauf oft nach Belp, um bei seinem Onkel Käse zu kaufen und mich von Mike bedienen zu lassen. Während seines Studiums hat er dort nebenbei gearbeitet. Des Öfteren waren die Nächte kurz und dennoch versuchte jeder von uns den anderen zu übertreffen: wer war zuerst morgens um 6.00 Uhr wieder unterwegs? Der Zufall wollte es, dass wir beide keine Vielschläfer waren und uns spätestens im Kreisel in Worb sahen. Wir haben viel Spass genossen, aber zur Leidenschaft für den Beruf gehört ebenso Disziplin, um am Morgen wieder früh unterwegs zu sein.
Der Grossvater von Mike Glauser hat übrigens zu Rohmilchkäse ein logisches Verständnis: «Haltbar gemachte Milch. Je reifer und älter, umso sicherer und besserer für die Menschen. Wenn die Milch schlecht wäre, würde der Käse stinken, unförmig reifen und platzen!» Wie schön wäre es, wenn das mehr Menschen wüssten?
«Dass esse ich nicht!» – bei Fastfood und Fertiggerichten kann ich diese Aussage nachvollziehen. Bei Naturprodukten habe ich weniger Verständnis dafür. Klar, es gibt Allergien und die sind schon fast wie eine Epidemie. Was könnte der Hintergrund sein, dass immer mehr Unverträglichkeiten auftauchen? Oder was könnte der Hintergrund der Häufung von Krebs sein? Die Wissenschaft gibt Auskunft, sei es über Dopamin, Serotonin und anderes mehr. Im Kapitel über die Monokultur wird davon noch die Rede sein. Die Chemiekeulen bei Fertigprodukten oder behandelten Lebensmittel sind pures Gift. Allergien sind Anzeichen von Vergiftungen. Gleichzeitig steigt die Sucht nach Aufmerksamkeit, gefördert über Likes und Anerkennung. Doch ich kann auch als Opfer oder Kranker Aufmerksamkeit erhalten. Deshalb frage ich mich des Öfteren, ob es bei vielen Menschen mit Unverträglichkeiten um Aufmerksamkeit geht und viele dieser vermeintlichen Unverträglichkeiten gar keine sind. Doch das ist unfair, denn wer wirklich betroffen ist, leidet darunter. Könnte nicht eher die fehlende Vielfalt und der Einsatz der Chemie in den Fertiggerichten der Hintergrund sein? Das sogenannte frische Brot an der Tankstelle ist für den Menschen eine Giftkeule und hat wenig mit Brot zu tun. Trotzdem geht es weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Es ist bequem, schnell, einfach und die Mehrheit macht es so, also ist es vermeintlich gut und richtig.
Jede Auflage oder Ausschluss bei Mahlzeiten reduziert die Vielfalt und die gesunden Anteile. Dass zu positiven Erlebnissen auch negative gehören, ist ein Naturgesetz. Genauso ist es mit den persönlichen Erfahrungen. Es gibt davon nicht nur «Gute», es braucht auch die «Schlechten», denn das Naturgesetzt von Plus/Minus, also die Polarität gilt. Die Erfahrung mit «grottenschlechtem Essen» hilft, gutes Essen früher zu erkennen. Genauso die Einschätzung von Lokalitäten. Am besten lerne ich das, wenn ich es ausprobiere. Je mehr ich mich auf Listen (Ratings, «must see», Restaurantführer usw.) verlasse, umso weniger kann ich es einschätzen. Dieser Effekt lässt sich auf alles übertragen: Arbeit, Partnerschaft, Kunden, Lieferanten, Strukturen, Firmen… Um zu wissen, was funktioniert und was mir nützlich ist, benötige ich auch Erfahrungen davon, was schlecht ist. Gute und schlechte Erfahrungen bilden die Grundlage für meine künftigen Entscheidungen. Theorie und nur das tun, was sogenannt richtig ist, verhindern eigenes, unvergessliches Lernen, ein Lernen, das bleibt, ohne aufgeschrieben zu sein und das in den Bauch runterrutscht. Die Intuition wächst und damit deren Energie.
Meine Art, im Restaurant zu bestellen, bringt meine Partnerin Regina regelmässig aus dem Tritt. Vor allem, wenn ich schon bestellt habe, bevor ich am Tisch sitze. Oder wenn wir sitzen, die Karte erhalten und ich mit Lichtgeschwindigkeit weiss, was ich esse. Bestellt wird, was ins Auge sticht oder die Intuition mir zuflüstert. Da ich sowieso das Falsche bestelle, spielt es keine Rolle, was ich bestelle. Das ist meine Haltung und fester Glaube. Gleichzeitig ist es mein Trockentraining dafür, schnell zu entscheiden und Entscheide nicht aufzuschieben. Denn wenn am Nebentisch der farbenprächtige und duftende Teller serviert wird, erwacht die Unsicherheit. Der zweifelhafte Gedanke, «das Gericht ist das bessere» steigt in mir hoch. Dann gibt es ebenso Momente, die einfach sind, da das Gericht am Nachbartisch weniger verheissend riecht oder aussieht.
In dem Augenblick, in dem der Umgang in Neid und Wettbewerb kippt, beginnt der Vergleich. Wer beginnt, zu vergleichen, weckt den Mechanismus von Gewinnen und Verlieren. Das Spiel des Wettbewerbes beginnt. Das Rad dreht ab diesem Moment immer schneller, egal um was es geht: Schönheit, Reichtum, Gesundheit, Attraktivität, Haus, Ferienort etc. Und wer will schon zu den Verlierern gehören?
Woher kommt diese Einsicht? Meine ersten beruflichen Stationen (17. bis 25. Lebensjahr) wurden von der Küche dominiert. Die Hassliebe zur Lebensmittelindustrie entstand während meiner Kochlehre. Damals wurden fast alle Arten von Pulver und Fertigprodukten eingesetzt. Sie reduzierten die Arbeit und somit den zeitlichen Aufwand. Die Kochlehre, war «Trauma» und die Chance meines Lebens: ein Weckruf für den Einsatz unbehandelter Lebensmittel, für die Frische. Die Auslandserfahrung in Kapstadt zeigte mir, dass der Mensch eine Sprache schnell lernt, wenn er muss und keinen Notausstieg, keinen «Plan B» hat. Denn mit einem Wortschatz von knapp 10 Wörtern kannst du keine 20 Menschen in der Küche führen und anleiten. Das Schwierige reizte mich immer und half mir, meine Fähigkeiten zu entwickeln. Es bringt mich im positiven Sinne an und über meine Grenzen.
Der Eindruck, dass die Profi- und die Amateurküche beim Einsatz von Fertigprodukten vermeintlich Kosten spart und im Vorteil ist, ist eine Geschichte aus dem Märchenbuch. Wer sich auf «Fertiges» verlässt, verliert nicht nur gesundheitlich, sondern auf der ganzen Strecke. Das eigene Kochen dagegen stärkt und schafft Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das Einlassen auf Fertigprodukte dagegen reduziert Selbstvertrauen und baut Kompetenzen ab. Die wenigsten wissen, dass heute komplette Menükarten von Restaurants fixfertig aufbereitet gekauft werden können. In der Küche steht nur noch jemand, der die Beutel aufwärmt. (Bezeichnenderweise sind die Lieferwagen dieser Firmen neutral, also unbeschriftet.) Und genauso läuft das in der Finanzindustrie. Im Anlagegeschäft sind etwa die gemischten Anlagestrategiefonds «convenience food» - komfortabel für die Bank, zum Nachteil des Kunden. Immer wenn ich delegiere, lasse ich meine Fähigkeiten den Bach runtergehen, und im Lauf der Zeit verkümmern sie. Das sorglose Ausprobieren verschwindet. Die Angst vor dem Scheitern und vor Fehlern wächst und verfestigt sich.
Doch mit Training lässt sich die Unsicherheit eines Menschen verringern. Das im Training gewonnene Selbstvertrauen befeuert wiederum das Selbstvertrauen. Oder haben Sie schonmal ein Kleinkind erlebt, das wegen des ständigen Hinfallens aufhört, Gehversuche zu machen?
Die Wissenschaft findet immer mehr heraus, was alles krebsfördernd ist. Trotzdem geht die Gesundheit vor die Hunde. Je mehr die Industrie mit «gesund!», «fit», Schönheit usw. wirbt, umso mehr übergewichtige Menschen gibt es. Meine Überzeugung ist, dass viele Krankheiten mit der Ernährung zusammenhängen, mit den unmenschlichen Arbeitsbedingungen (Sinnlosigkeit, Leistungsdruck…), mit dem eigenen persönlichen Verhalten und mit Abhängigkeiten, die ignoriert werden.
Bereits seit dem Ende der 70er Jahre gibt es »Fertiggekochtes»: «gekochte» Eier am Stück, quasi als Meterware, Fleischpasteten, Terrinen, Wildpfeffer und natürlich viele Pulver, Dosen, Fertigsaucen, Gefrorenes, fixfertig Zubereitetes. Ja, sogar «frische» Ravioli, Lasagne, Pizzas und mehr zum Aufwärmen waren erhältlich. Heute ist das alles sehr verbreitet und dem Endverbraucher in grossen Mengen zugänglich: Kosten runter – Gewinne hoch beim Anbieter, beim Kunden dagegen Übergewicht und Krankheit.
Die Schwierigkeiten, die ich als Kunde damit bekomme und die Aufwände, die Folgen zu beheben, steigen. Keine Branche ist ausgenommen. Ich als Kunde, Patient, Investor werde zur Kasse gebeten. Alles, was im Restaurant auf einer Karte steht, kann fertig portioniert und gekocht geliefert werden. Kein Witz. Die neuen Techniken und Gerätschaften machen das möglich. Stichworte sind: Sous vide, Vakuumiergerät, Holdomat, Kombisteamer und anderes mehr. «Hausgemacht» wird vorgegaukelt, dabei sind die Speisen eingekauft und industriell hergestellt. In der «Küche» wird nur noch aufgewärmt. Einen Koch braucht es dafür nicht mehr. Die Dienstleistung «Kochen» wird «outgescourced» und das Fertigprodukt eingekauft. Es ist wie mit Dienstleistungen für IT, Buchhaltung, Kundendienst, Telefondienst, Datenerfassung etc.: sie werden in Ländern mit tiefen Lohnkosten eingekauft.
Der Holdomat ist das perfekte Gerät. Die Temperatur (20 – 120 Grad) kann fix eingestellt werden und bleibt konstant. Im herkömmlichen Ofen schwankt die Temperatur um 10 bis 15 Grad. Der Ofen heizt und kühlt sich ab und das braucht Aufmerksamkeit und die Erfahrung des Kochs. Im Gegensatz dazu der Holdomat oder Kombisteamer: das rosa gebratene Roastbeef kann mehrere Stunden mit konstanter Temperatur warmgehalten werden. Früher war bei Verschiebungen, etwa beim Hochzeitsessen mit rosa gebratenem Fleisch, höchste Alarmstufe in der Küche. Heute schmunzeln die Köche über solche Lappalien, denn sie sind mehr «Logistiker» oder «Chemiker» als dass sie Köche sind.
Trotz meiner Erfahrung und Kenntnisse von Produktion, Varianten, Techniken und anderem ist auch für mich vieles kaum mehr zu erkennen – zu «erschmecken». Die Methoden werden immer raffinierter. Heute werden ganze Menüs für Gesellschaften fertig abgepackt und – wenn gewünscht – portionenweise geliefert. Mogelpackungen auf die Spur zu kommen geht nur mit viel Erfahrung und trainierten Geschmacksnerven. Das tägliche Training mit dem Frischen ist das einzige Gegenmittel, um Fertigprodukte zu erkennen. Bestellen Sie einen einfachen gemischten Salat, eine Bratwurst mit Rösti. Danach wissen Sie viel über die Küche. Lieblos; dann sieht es auf jedem Teller gleich aus. Karotten auf dem Salat sind nicht in der Küche geschnitten, sondern fixfertig geliefert. Die Salatsauce schmeckt genau gleich wie die, die im Supermarkt zu kaufen ist. Rösti sind Fertigportion: klein und rund; es geht um die Präsentation. Jedes Restaurant sollte eine eigene Handschrift haben, aber es sieht immer öfter alles gleich aus.
Es gibt Maggi und Aromat. Und wie bei den Migros- und Coop-Kinder in der Schweiz, ist der Entscheid zwischen Maggi und Aromat eine Glaubensfrage. Die einen «würzen», das heisst sie «verschandeln» grundsätzlich alle vorgesetzten Teller, ohne das Gericht zu probieren. Andere kochen mit Vorliebe mit Maggi und Aromat. Dann gibt es Leute wie mich, die, je älter sie werden, desto mehr Abneigung entwickeln sie.
Schon in meiner Kindheit war das berühmte Maggikraut (Liebstöckel) anstelle von «Maggi» im Vorteil, denn das Geld sparten sich meine Eltern für den Hausbau. Heute weiss ich, dass im «Maggi» kein «Liebstöckel» drin ist. Was die Mehrheit als richtig erachtet ist zu oft falsch.
Also doch Mogelpackung? Givaudan, einer der grössten Aromenhersteller weltweit, hat das ehemalige Original Maggi Firmengelände 2002 von Nestlé abgekauft. Ein Schelm, wer da Böses denkt. Oder doch eine unheilige Allianz und Duo mit weltweitem «Retter»-Verhalten? Wer die Nr. 1 ist, muss sich heute keine Sorgen machen um seine Marge. Die Marktführerschaft bringt viel Einfluss in der Preisgestaltung mit sich und somit mehr Rendite. Eine geniale Konstruktion der Zwei. Hier «Nestlé» als der Vermarkter von industriell hergestellten Lebensmitteln und dort der Aromahersteller «Givaudan», der noch den letzten Kick herauskitzelt. Der Profit steigt noch höher, wenn mit weniger Rohstoffen einfacher und günstiger produziert wird. Wie sonst soll das, was auf der Verpackung draufsteht, drin sein? Oder doch nur «Aroma»?
Sowohl die in der Lebensmittelindustrie, wie in der Finanzindustrie angebotenen Lösungen schaden über kurz oder lang dem Kunden. Die wirklich guten Produkte und Lösungen sind nur wenigen bekannt. Das ist logisch, denn die Kunden kaufen das, was populär ist – mit viel Werbung populär gemacht wurde. Wer smart ist, sucht das, was nicht beworben wird. Denn der Gedanke, dass Beworbenes eine hohe Marge und mehr Gewinn für den Anbieter zum Schaden der Kunden auslöst, ist nicht von der Hand zu weisen.
Der grossen Verführung widerstehen – Ausprobieren
Egal wo ich mich aufhalte – Düfte. Neben der unsäglichen Musikdauerberieselung besteht auch dabei wenig Möglichkeit, diesen «Duftnoten» auszuweichen. Sie wecken blitzartig Erinnerungen, Bilder, Filme und lösen die unterschiedlichsten Gefühle aus – und dafür sind sie ja auch gemacht. Im Verkauf aller Arten von Produkten sind Düfte ein mächtiges Werkzeug. Der potenzielle Kunde wird via Duft «käufig» oder «milde» gestimmt. So wie Kinder ihre Eltern und Haustiere ihre Halter mit ihrem natürlichen Verhalten beeinflussen, wenn sie etwas angestellt haben. Da kann kein Mensch mehr böse sein, denn das sind Kompetenzen von Kindern und Haustieren. Bei den beiden Industrien von Lebensmittel und Finanzen, kann keine Rede mehr sein von natürlicher Beeinflussung und Manipulation, sie gehen beide weit über die Grenzen hinaus. Mit der Frage wird es klarer und verständlicher: wie fair ist die Industrie, wenn nur wenig Menschen widerstehen können?
Meine kochenden Wanderjahre führten mich von Nah bis Fern, durch Sterneküche, in Luxustempel bis hinaus zu den kleinsten Landgasthäusern. Ob Sepp Blatter klar ist, dass er mit seinem Anspruch an ein «Rindsfilet blutig gebraten» ganze Heerscharen von Köchen ausgebildet hat, mich inklusive? Er kam meistens dann, wenn der Grill im Dolder gereinigt und Freizeit angesagt war – kurz vor Schluss. Seine Anwesenheit hiess: Feierabend für den Grillchef (mich) gibt es nicht. Seine Lieblingsgarstufe «blutig» benötigt viel Zeit und Präsenz. Wenn das Innere kalt war oder die Garstufe falsch, war das Filet in Lichtgeschwindigkeit zurück in der Küche. Denn 200 Gramm kaltes Fleisch warm zu machen, ohne es zu garen, bedeutet auf gut-bernisch «langsam pressiere». Mindestens 20 bis 30 Minuten. Das Filet am heissen Grill, auf einem Teller am Rand, ohne direkten Kontakt wärmen, um ein warmes und blutiges Filet zu erhalten. Zu Beginn hatte ich Mühe, doch ich lernte dabei von Sepp Blatter, mich als Gast für meinen Anspruch einzusetzen und mich weniger zu scheuen, eine Reklamation anzubringen.
Was ist das Geheimnis, sich für die eigenen Ansprüche einzusetzen, Wünsche und Anforderungen und wenige Bedingungen festzulegen? Wer etwa «Rindsfilet blutig» bestellt, bekommt die beste und frischeste Qualität. Wer eher gegen Ende oder sehr früh zum Essen geht ebenso - Stosszeiten sind zu vermeiden. Mittagsmenü am besten nur früh und unbedingt vor 12 Uhr!
Wenn wir schon in der Sterneküche sind: die häufigsten Zutaten sind Butter, Säure und Zucker oder Honig. Diese Komponenten kitzeln den letzten Rest von Aromen in den Gaumen. Sanddorn ist die Königin unter den Säuren in der Küche von Andreas Caminada, einem der besten Schweizer Sterneköche. Diese Zutaten dürfen auch in keinem Fastfood-Gericht fehlen. Doch die Butter wird durch Fett ersetzt und der Zucker immer öfters durch Maissirup. Der Supergau beim «Maissirup» ist, dass das Sättigungsgefühl des Menschen lahmgelegt wird. Für mich ist das Betrug und gehört verboten. Für die Firmen, die Maissirup nutzen, ist es eine wirtschaftliche Notwendigkeit, um die Gewinne hochzuhalten. Maissirup wird zu 40 Prozent günstiger produziert, entsprechend schnellen kurzfristig die Gewinne nach oben. Langfristig werden die Konsumenten krank und das Gesundheitssystem der Schweiz belastet.
Im Kochclub Worb darf ich nicht mehr mit Säure kochen. Den Auslöser dafür habe ich auf einem gemeinsamen Segeltörn um die Insel Mallorca abgeliefert. Der Zitronenrisotto war nicht nur sauer, sondern entwickelte viele bittere Anteile. So hat jedes Mitglied sein Steckenpferd und seine Erfahrungen. Der eine verwechselte Zucker mit Salz, andere haben wenig Mass, wenn es um Schärfe geht. Oder es gibt Spezialisten, die nicht mehr an den Ofen ran dürfen. Wer hat schon mal ein Brot oder die Rüeblitorte ohne Salz gebacken? In dem Sinne ist Salz süsser als Zucker. Was gut ist, wird plötzlich schlecht. Die Dosierung ist das Geheimnis. Das Bittere kann wirklich nur von Menschenhand dosiert werden und die richtige Dosierung ist etwas vom Schwierigsten in der Küche. Die Lebensmittelindustrie wird Bitteres nie in ihr Sortiment aufnehmen. Sie würde sich zu schnell ungeliebt machen und Umsatz verlieren. Deshalb finden Sie in Fertigprodukten oder bei Fastfood nie Bitteres. Wichtiger wäre aber, ein Umfeld zu schaffen, in dem Fehler gemacht werden können, ohne gleich rauszufliegen. Heute dagegen dürfen Fehler nicht passieren. Wer Fehler macht, ist weg. Wer ein Umfeld hat, in dem er Fehler machen darf und kann, ist ein Glückspilz. In solchen Umfeldern können Menschen wachsen.
Die fünf Geschmäcker der Küche sind: Süss, Salz, Sauer, Bitter und Umami (Geschmack). Der getrocknete Fisch aus Japan heisst «Katsuobushi», auch bekannt als Bonitoflocken. Der Fisch gehört zur Familie der Makrelen. Der Herstellungsprozess ist seit über 300 Jahren gleich – Fermentieren. Es gibt Prozesse und Naturgesetze, die ändern sich nicht.
Wer gerne bei Migros oder Coop einkauft, lebt gefährlich. Denn rund die Hälfte der ca. 45’000 Artikel enthalten Maisbestandteile in allen Formen, die mein Sättigungsgefühl beeinflussen und somit zum Beispiel zu Übergewicht führt. Im Vanillezucker sind Maisbestandteile genauso vorhanden, wie in der Marmelade, im Senf und anderem mehr. Kunden werden sabotiert und geschädigt. Sinn: Gewinne, das heisst, die eigene Profitabilität steht im Vordergrund.
Das freihändige Kochen ohne Rezepte ist ein wiederkehrendes Training. Es fördert die Kreativität und die Neugier, etwas Neues auszuprobieren. Auch besteht die Möglichkeit, einmal weniger Erfolg zu haben. Und es stärkt das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das ist gemeint mit «Lebensschule»: ich übe, auf einem überschaubaren Feld mit Misserfolgen umzugehen – mit von vornherein begrenztem sowie kalkulierbaren Schaden. Ich kann mich deshalb auf Vorhaben einlassen, die mich an meine Grenzen bringen.
So wie es mir vor einigen Jahren mit meinem Angebot an einen guten Freund passierte: «Ich schenke dir zu deinem 50. Geburtstag meine Arbeitsleistung für das Essen – ich koche.» Eine Party ist nicht vorgesehen, meinte Sämi. Viel später fragte er, ob das Angebot noch gilt. Ja sicher! Etwa 2 Wochen vor dem Fest erhalte ich einen Anruf von Sämi. Er druckst herum. «Komm, sag schon! Wieviel Gäste hast du?» Sämi: «Gerold es ist verrückt. Alle, die eingeladen sind, kommen; keine einzige Absage.» Wieviel? «120 Erwachsene und 18 Kinder.» Da bin ich mal etwas sprachlos. Doch ich hatte gesagt, «Das mache ich», also gilt das. Und ich weiss aus Erfahrung: komplexe Probleme sind mit Einfachheit lösbar. Auch das gilt und ist ein wichtiges Naturgesetz.
Also los: Wo machst du das Fest? Wie sieht die Infrastruktur aus? Wieviel willst du pro Person ausgeben ohne Getränke? Welche Wünsche hast du? Wann treffen wir uns – gestern? Ernsthaft, wann kann ich dich sehen: Heute oder morgen? Sämi hat über 150 Länder bereist. Wie baue ich das ein? Innert Kürze war einiges zu klären: Einkauf, Transport, Service etc. Zusammen mit Werner Rothen, damals im «Schöngrün» tätig, konnte ich das dann einfädeln. Das Menu war eine Weltreise von warmen und kalten Salaten über alle Kontinente und durch die für Sämi prägenden Länder. Von der kalten Erdbeer- und Kirschensuppe über Kalbsteak am Stück (zu 80 %vorgebraten), Sauce mit Eierschwämmen, Bratkartoffeln und etwa 15 Salaten stellte ich alles in der Produktionsküche des «Schöngrün» her. Diese professionelle Infrastruktur war eine Erleichterung. Genügend Gefässe, Maschinen, Platz, Kühlung, Transport und anderes. Die Freude der Gäste war Lohn genug für die viele Arbeit. Sie schwärmen auch zehn Jahre später von diesem Fest. Möglich wurde es mit der richtigen Infrastruktur. Und Werner Rothen – Danke!
Das Essen für meine Cousine, die auf dem elterlichen Bauernhof heiratete und über 250 Gäste eingeladen hatte, war dagegen viel aufwendiger. Anstelle eines Hochzeitsgeschenkes stellte ich wieder meine Arbeitskraft zur Verfügung. Die Infrastruktur war diesmal eine einzige Herausforderung. Deshalb war klar: es gibt ein Salatbuffet, dazu drei verschiedene Fleischarten (Kalb, Lamm, Huhn), gegrillt, ergänzt durch eine Fischvariante. Dazu fünf verschiedene Saucen und Back-Potatoes. Alles während zwei Tagen im Voraus produziert. Ich konnte die Küche eines Restaurants nutzen. Dann wurde mit drei Gasgrills vor Ort ein Showkochen veranstaltet. Das Fleisch wurde nur noch für das Grillaroma heiss gemacht. Den Gästen wurden das Grillen und Kochen vorgegaukelt. Für diese Mammutaufgabe nahm ich mir eine Woche frei. Transport, Aufbau und Service übernahm ich dann zusammen mit einem Freund und Koch einer Grossküche.
Es war wie beim Skirennen in Adelboden. Im VIP-Zelt werden etwa 2'000 Menschen verpflegt. Das Essen wird in Bern hergestellt, auf Tellern angerichtet und hochgefahren nach Adelboden. Vor Ort wird es aufgewärmt und bereitgemacht für den Service: Gemüse mit Butter bepinseln, Sauce verteilen, Verzierungen platzieren - fertig. Damit so etwas gelingt, ist lediglich ein genauer logistischer Ablauf einzuhalten. Einfachheit schlägt Komplexität: Kochen in Bern – Transport – Logistik vor Ort – Abtransport Schmutzgeschirr – Abwaschen und wieder bereitstellen.
Das letzte Kocherlebnis des Erschreckens und der Freude hatte ich im Frühsommer 2019 in Wien. Da habe ich im «Muscheln & Mehr» zusammen mit dem Wirt in der Miniküche ein 6-Gang Fisch-Menü gekocht. Die Hälfte





























