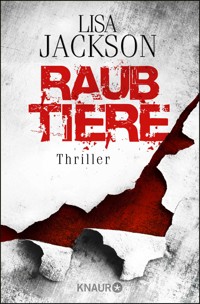Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In Lisa Jacksons nervenzerfetzendem Stand-Alone-Thriller »Never Safe – Wann wirst du sicher sein?« muss eine junge Frau über sich selbst hinauswachsen: 20 Jahre nach dem Blutbad an ihrer Familie muss sie alles dafür geben, die Morde aufzuklären – um ihre eigene Ermordung zu verhindern. Es war ein Tag, der ihr Leben in einen Albtraum verwandelte: An Heiligabend entkam die damals 7-jährige Kara einem Mörder, der ihre halbe Familie umbrachte. Jetzt, knapp zwanzig Jahre später, kommt ihr Halbbruder Jonas, der damals für die Morde verurteilt wurde, überraschend frei. Gleichzeitig erhält Kara plötzlich kryptische Nachrichten, und sie kann das Gefühl nicht abschütteln, dass sie etwas mit ihrer älteren Schwester zu tun haben. Marlie, die sie an jenem schrecklichen Heiligabend zwang, sich zu verstecken, und von der seither jede Spur fehlt. Während Kara noch versucht, die neuesten Entwicklungen zu verarbeiten, kommt es zu einem Mord in ihrem näheren Umfeld. Bald schon fürchtet Kara erneut um ihr Leben ... Der Thriller »Never Safe – Wann wirst du sicher sein?« ist unabhängig von Lisa Jacksons Reihen lesbar. »Ohne Zweifel ist Lisa Jackson eine Meisterin ihres Fachs, beherrscht ihre Suspense-Technik virtuos und konstruiert dazu eine dramatische Liebesgeschichte.« @Krimi-Couch.de über »You will pay«
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lisa Jackson
NEVER SAFE Wann wirst du sicher sein?
THRILLER
Aus dem amerikanischen Englisch von Kristina Lake-Zapp
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Es war ein Tag, der ihr Leben in einen Albtraum verwandelte: An Heiligabend vor 20 Jahren entkam die damals 7-jährige Kara einem Blutbad, bei dem beinahe ihre komplette Familie ausgelöscht wurde. Außer ihr selbst kamen nur ihre ältere Schwester Marlie und ihr Halbbruder Jonas mit dem Leben davon. Von Marlie fehlt seitdem jede Spur, Jonas wurde als Mörder verurteilt.
Kurz vor dem 20. Jahrestag des Massakers kommt Jonas auf freien Fuß. Und Kara erhält kryptische Anrufe von einer Frau, die wie Marlie klingt. Als immer mehr Menschen aus Karas näherem Umfeld zu Tode kommen, beginnt sie, auch für sich selbst das Schlimmste zu befürchten. Sie muss herausfinden, wer hinter den Morden steckt, bevor sie selbst das nächste Opfer wird …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Kapitel neunundzwanzig
Kapitel dreißig
Kapitel einunddreißig
Kapitel zweiunddreißig
Kapitel dreiunddreißig
Kapitel vierunddreißig
Kapitel fünfunddreißig
Kapitel sechsunddreißig
Epilog
Kapitel eins
Quiiietsch!
Kara riss die Augen auf.
Was war das?
Angestrengt spähte sie in die Dunkelheit.
»Kein Wort.«
Sie fing an zu schreien.
Eine Hand verschloss ihren Mund.
Fest.
»Scht!«
Marlie? Ihre Schwester beugte sich über sie und drückte ihren Kopf in die Kissen?
Kara fing an zu strampeln. Um sich zu schlagen. Sich zu wehren.
»Hör auf! Sei einfach still und hör mir zu«, flüsterte Marlie ihr ins Ohr. Ihr warmer Atem strich über Karas Haut. »Hör mir zu, hab ich gesagt!« Ihre Stimme klang dringlich. Das hier war kein Scherz, keiner von den bösen Streichen, mit denen Kara groß geworden war, denn außer Marlie hatte sie noch drei ältere Brüder. »Rabauken«, sagte ihre Mutter, »Ganoven«, sagte ihr Vater.
Doch im Augenblick setzten ihr nicht die drei zu, sondern Marlie, und die war definitiv in Panik. »Tu einfach, was ich sage«, zischte sie jetzt. »Keine Fragen, keine Widerrede. Ich meine es ernst, Kara-Bär, du musst absolut still sein.«
Warum?
Als hätte sie Karas Gedanken gelesen, fügte Marlie hinzu: »Ich kann es dir jetzt nicht erklären, vertrau mir einfach. Du bist ein kluges Mädchen, zumindest behaupten das deine Lehrer. Angeblich bist du den Kids in deinem Alter weit voraus. Also tu, was ich sage, und komm mit.«
Kara schüttelte den Kopf. Ihre Haare raschelten auf dem Kissen. Langsam gewöhnten sich ihre Augen an das dämmrige Licht. Was immer Marlie so erschreckt hatte, sie würden es in den Griff bekommen. Mama würde wissen, was zu tun war.
»Du darfst keinen Laut von dir geben, hast du verstanden?«
Marlie nahm die Hand von Karas Mund. Kara konnte sich nicht zurückhalten. »Was …«, flüsterte sie. Sofort verschloss die Hand wieder ihre Lippen. Diesmal noch fester.
»Hör mir einfach nur zu!«, stieß Marlie mit zusammengebissenen Zähnen hervor. Ihr flehentlicher Ton ließ Kara erstarren. Mama nannte ihre ältere Tochter gelegentlich eine Dramaqueen, und das war Marlie ganz bestimmt, doch diesmal war es anders. Marlie war anders. Als hätte sie Todesangst.
Kara blieb reglos liegen.
»Du musst dich verstecken.«
Verstecken?
»Sofort. Hast du mich verstanden?«
Kara nickte mit weit aufgerissenen Augen.
»Aber nicht hier.« Marlie nahm die Hand ein zweites Mal von Karas Lippen.
»Warum? Wo ist Mama?«, wisperte Kara atemlos. Sie spürte, wie sich die Angst ihrer großen Schwester auf sie übertrug.
»Verdammt! Sei still! Bitte, Kara.« Marlie schaute mit flehendem Blick auf Kara herab. »Keine Fragen. Sie könnten dich hören!«
Wer? Wer könnte sie hören?
Karas Herz hämmerte heftig. Vor lauter Angst wurde ihr abwechselnd heiß und kalt.
Marlies Gesicht sah irgendwie seltsam aus. Auf ihrer Wange war ein gezackter dunkler Strich. Die ganze Gesichtshälfte war dunkel verschmiert.
»Was hast du da?«, wisperte sie und streckte die Hand nach Marlies Wange aus.
»Nichts, Kara-Bär. Bloß einen Ratscher.«
»Komm einfach mit mir und sag kein Wort. Ich meine es ernst, Kara. Das sind böse Menschen. Sie dürfen dich nicht finden. Wenn sie dich entdecken, werden sie dir wehtun, verstehst du?« Marlies Gesicht kam noch näher. Trotz der Dunkelheit im Kinderzimmer sah Kara das Entsetzen in den blauen Augen ihrer Schwester. Und das Blut auf ihrer Wange. Marlie trug Jeans und ein Sweatshirt, ihre blonden Haare hatte sie zu einem Zopf geflochten.
Kara schüttelte heftig den Kopf.
»Okay, zum letzten Mal.« Marlies Stimme hatte einen warnenden Ton angenommen.
Kara nickte langsam. Als ihre große Schwester diesmal die Hand von ihren Lippen nahm, blieb sie stumm. Angestrengt schluckte sie gegen den Kloß an, der sich in ihrem Hals gebildet hatte.
»Ich habe dich lieb, Kara-Bär … Ich werde wiederkommen und dich holen, das verspreche ich dir.« Marlie schaute aus dem Fenster. Das Mondlicht spiegelte sich auf der dicken Schneedecke. Entschlossen nahm sie Karas Hand. »Komm jetzt!« Sie wollte ihre Schwester von der Matratze ziehen, aber Kara brauchte keine weitere Aufforderung. Sie schlug die Bettdecke zurück, stand auf, dann schlich sie zusammen mit Marlie an deren Bett vorbei. Im Licht des Mondes, dessen silbriger Schein durchs Fenster ins Zimmer fiel, sah Kara mehrere Stapel ordentlich zusammengefalteter Kleidungsstücke auf der zerknitterten Bettdecke. Daneben lagen Marlies Schuhe. Wie Kara war sie barfuß.
Damit man ihre Schritte nicht hört.
Karas Blut gefror zu Eis. Hier stimmte etwas nicht. Und zwar ganz und gar nicht. Sie trat auf ein Spielzeug, vermutlich einen Barbie-Schuh. Es tat weh, und sie biss sich auf die Zunge, um nicht laut aufzuschreien. Marlie öffnete vorsichtig die Tür zum Flur.
Von unten wehte der Geruch des erlöschenden Kaminfeuers zu ihnen herauf, versetzt mit den leisen Klängen eines Weihnachtslieds.
»Stille Nacht …«
Marlie spähte in die Dunkelheit.
»Heilige Nacht …«
Sie holte tief Luft, drückte Karas Hand und flüsterte: »Los!« Dann zog sie ihre jüngere Schwester in den dunklen Flur, vorbei an den geschlossenen Kinderzimmertüren der Brüder bis zur Treppe ins Erdgeschoss. Gleich hinter dem oberen Treppenabsatz befand sich die Tür zu Mamas und Daddys Schlafzimmer.
»Alles schläft …«
Kara atmete erleichtert auf. Marlie brachte sie zu Mama – obwohl … Nein. Ihre Erleichterung verpuffte. Sie blieb vor der Tür neben der zu Mama und Daddy stehen, vor der Tür, die immer abgeschlossen war. Dahinter befand sich eine weitere Treppe. Sie führte in den zweiten Stock – ein Labyrinth aus ungenutzten Räumlichkeiten.
Was sollte das?
Nein!
»Einsam wacht …«
Kara sperrte sich. Sie würde nicht dorthinauf gehen. Nein, nein, nein!
Sie wollte gerade protestieren, als Marlie ihr einen Blick zuwarf, der Stahl hätte schneiden können.
Bong!
Kara fuhr zusammen, ihr Herz hämmerte, doch es war nur die alte Standuhr neben der Eingangstür im Erdgeschoss, die mit melodischem Klang die Stunde schlug.
»Herrgott«, wisperte Marlie und drehte den Knauf. Die Tür schwang auf. Marlie schob Kara hindurch und die steilen Holzstufen hinauf, während sie die Tür hinter sich schloss.
Bong!
»Nein, Marlie«, flüsterte Kara, die den Eindruck hatte, dass die Temperatur mit jeder Stufe um ein Grad abkühlte.
»Uns bleibt keine Wahl!«, sagte Marlie mit erstickter Stimme, als sie den zweiten Stock erreichten.
Anstatt das Licht einzuschalten, zog sie eine kleine Taschenlampe aus der Hosentasche und stellte sie an. Der dünne Strahl huschte zuckend über mit großen Laken abgedeckte Möbel und Kisten, ausrangierte Lampen, gestapelte Bücher und Koffer mit aussortierten Kleidungsstücken. Ihre Familie benutzte den zweiten Stock, der laut Mama einst als Dienstbotenquartier gedient hatte, als Lagerraum. »Ihr dürft nicht nach oben gehen«, hatte Mama ihre Patchworkfamilie gewarnt und sich eine Zigarette angezündet. »Es ist dort nicht sicher. Sollte ich einen von euch da oben erwischen, gibt es Hausarrest, darauf könnt ihr euch verlassen. Habt ihr mich verstanden?«
Natürlich hatte ihre Drohung nicht gefruchtet.
Natürlich waren sie alle hinaufgeschlichen und hatten die Räumlichkeiten erkundet. Die Brüder waren andauernd dort oben, und auch Kara hatte sich oft genug in den zahlreichen kleinen, miteinander verbundenen Zimmern umgesehen. Sie kannte sich dort recht gut aus, doch heute Nacht, in der Dunkelheit, kamen ihr die kalten Räume bedrohlich und böse vor. Die verschlossenen Türen erinnerten sie an Wächter, die den schmalen Korridor fest im Blick hatten.
Bong!
»Wo ist Mama?«, fragte sie wieder und kämpfte gegen die aufsteigende Panik an.
Marlie warf ihr einen strengen Blick zu und schüttelte den Kopf. Dann legte sie einen Finger auf die Lippen und zog sie hinter sich her.
Am Ende des Korridors befand sich eine weitere Treppe, die noch enger war als die, die zu den Dienstbotenquartieren führte. Von dort gelangte man direkt zwei Stockwerke tiefer in die Küche. Für eine Sekunde dachte Kara, sie würden wieder nach unten gehen, auch wenn das unsinnig war, aber kurz vor der Treppe blieb Marlie vor einem Wandschrank stehen, in dem, so hatte sie früher behauptet, die Dienstboten einst die Bettwäsche, Handtücher und was die Herrschaften sonst noch an feinem Leinenzeug benötigten, aufbewahrten. Der Wäscheschrank war aber gar kein Schrank, sondern eine stets abgeschlossene Tür, hinter der steile Stufen zum Dachboden führten. Dort oben war Kara bislang nur ein Mal gewesen, denn bis auf ein paar Kisten und Kartons sowie ein altes Möbelstück von ihrer Großmutter, eine Art Truhe, gab es da nichts Spannendes. Daddy hatte Kara mit hinaufgenommen und ihr die Eule gezeigt, die unter den Dachsparren nistete. Sie hatte ihn gefragt, warum die Truhe dort stand und nicht in den ehemaligen Dienstbotenzimmern, und Daddy hatte ihr zugezwinkert und erklärt, er wisse doch, dass sie dort heimlich spielten. Er hänge sehr an der Truhe, und er wolle nicht, dass sie einen Kratzer bekam.
Jetzt war Daddy nicht bei ihr.
Kara wurde es noch mulmiger zumute. »Da können wir nicht hoch …«, setzte sie an, doch Marlie zog bereits einen Schlüssel aus ihrer Jeanstasche und schob ihn ins Schloss. Die Tür zur Dachbodenstiege schwang knarzend auf.
»Komm«, flüsterte Marlie.
Kara schüttelte den Kopf. »Ich will nicht«, flüsterte sie zurück. Marlie würde sie doch sicher nicht mit Gewalt auf den Dachboden zwingen!
»Das ist mir egal.« Marlie schubste sie durch die schmale Tür und sperrte hinter ihnen ab.
»Was soll das, verdammt noch mal?«
»Hör auf zu fluchen, Kara-Bär.«
»Aber …«
»Ich rette dich. Uns.« Es klickte laut, als Marlie den alten Lichtschalter nach oben drückte, aber alles blieb dunkel.
»Verdammt«, murmelte sie. Die Stiege hinter der verschlossenen Tür war nicht zu erkennen.
»Hör auf zu fluchen«, äffte Kara ihre große Schwester nach. »Wovor willst du uns eigentlich retten?«
»Schscht, sei leise. Das willst du gar nicht wissen.«
»Doch! Doch, sag’s mir!«
»Hör zu, es ist … kompliziert.« Marlie zögerte.
»Und gruselig.«
»Ja, echt gruselig. Beängstigend.« Marlie schaltete ihre Taschenlampe wieder ein und richtete den Lichtstrahl auf die enge Stiege. Die Stufen waren steil und kaum breit genug für Karas Füße.
Auf dem Dachboden war es eiskalt und stockdunkel.
»Ich will da nicht hin.«
»Du musst.«
Karas Haut fing an zu kribbeln, doch sie weigerte sich nicht länger. Spürte, dass jeglicher Widerstand zwecklos war. Marlies Stimme klang anders als sonst, und sie brachte die sonst so rebellische Kara dazu, sich zu fügen. Furchtsam folgte sie dem zittrigen Lichtstrahl der Taschenlampe, der über die alten Dachsparren glitt. Kara war sich sicher, dass sie jeden Moment eine Fledermaus oder die Eule aufscheuchen würden, doch alles blieb ruhig.
Sie stand auf der obersten Stufe, Marlie auf den staubigen Bodendielen, sodass sie nun auf Augenhöhe waren. Marlies Gesicht war von unten beleuchtet, das kleine Grübchen in ihrem Kinn warf einen Schatten und verzerrte ihr Gesicht zu einer unheimlichen Fratze. Als Kara noch jünger gewesen war, hatte ihr Bruder Jonas diesen Effekt häufig verwendet, um seine schaurigen Geistergeschichten möglichst eindrucksvoll zu untermalen.
Aber heute Nacht ging es um etwas anderes, nicht darum, der kleinen Schwester Angst einzujagen, so viel stand fest.
»Du bleibst hier und wartest, bis ich zurückkomme.«
»Nein!«
»Es wird nicht lange dauern, versprochen.«
Kara schüttelte den Kopf. »Ich will zu Mama.«
»Ich weiß, aber ich habe dir doch gesagt, dass das nicht möglich ist.«
»Warum nicht? Du darfst mich hier nicht allein lassen!«
»Nur ganz kurz, ehrlich.«
»Nein!«
»Kara …«
»Warum versteckst du mich hier? Wovor willst du mich beschützen?« Kara fing an zu schluchzen. Ihre Geschwister hängten ständig ein »Versprochen!«, »Ehrlich!« an ihre Sätze, doch sie sagten nur selten die Wahrheit. »Wer sind die bösen Menschen, von denen du gesprochen hast, Marlie?«
»Ich … ich weiß es nicht.«
»Was machen sie denn Böses?«
»Ich … keine Ahnung … ich bin mir nicht sicher … aber sie sind wirklich sehr böse. Etwas ganz Schlimmes passiert hier, Kara-Bär.«
»Was denn? Wo?«
»Ich weiß es nicht.«
»Aber es passiert, hier, in unserem Haus?«
»Ich … ja … bitte, mach einfach, was ich dir sage.«
Kara spürte, dass ihre Schwester ihr die Wahrheit vorenthielt. »Wo sind Mama und Daddy?«
Marlie zögerte. »Nicht da.«
»Lügnerin.« Aber warum log ihre große Schwester?
»Kara …«
»Wo sind Jonas, Sam und Donner?«, fragte Kara panisch. Ihre älteren Halbbrüder. Am Abend waren sie alle noch da gewesen. Sie hatten zusammen gegessen, ein wunderschönes, festliches Heiligabend-Essen. Anschließend hatten Donner und Sam Musik gehört und Videospiele gespielt und sogar etwas Alkohol getrunken. Jonas, der Einzelgänger, hatte sich in sein Zimmer zurückgezogen und Ninja-Techniken trainiert. Sam zog ihn ständig damit auf und nannte ihn Joe-Judo. Jonas hasste diesen Spitznamen.
»Alle sind fort«, flüsterte Marlie.
»Fort?« An Heiligabend? Das war doch sehr merkwürdig. »Wovor hast du Angst, Marlie?«
Marlie leckte sich nervös die Lippen, dann wisperte sie kaum hörbar: »Wie ich schon sagte: Böse Menschen sind hier.«
»Wer? Woher weißt du das?« Das war doch völlig absurd. »Du machst mir Angst. Ich will zu Mama.«
»Ich habe dir gesagt, dass sie nicht hier ist!« Marlies Stimme wurde schärfer. So wie Mamas Stimme, wenn sie sauer war oder wütend auf Karas Brüder. »Schluss mit der Fragerei, du bleibst hier und wartest, bis ich dich hole.«
»Nein! Bitte lass mich nicht allein!« Kara klammerte sich voller Furcht an ihre große Schwester. Warum sollte sie hier allein in der Dunkelheit auf dem unheimlichen Dachboden sitzen, wo es nach feuchtem Staub und Schimmel roch? Sie war doch erst sieben, fast acht, und sie hatte schreckliche Angst vor Spinnen und Ratten und anderen ekeligen Tieren.
Marlie schüttelte Kara ab.
»Au!«
»Leise, Kara-Bär.«
»Aber ich werde erfrieren!«
»Bestimmt nicht. Tu um Himmels willen mal das, was man dir sagt, Kara.« Damit drehte Marlie sich um und stieg die steile Stiege hinab. Der Schein ihrer Taschenlampe durchschnitt zittrig die Dunkelheit, dann öffnete Marlie die Tür, schlüpfte hinaus und ließ Kara allein zurück.
Vorsichtig tastete Kara sich nach unten, die Arme ausgestreckt, die Hände an die Wand neben der Stiege gepresst, eine Stufe nach der anderen, bis sie vor der schmalen Tür stand.
Ihre Hände suchten nach dem Knauf.
Endlich!
Kara schloss die Finger darum und drehte. Der Knauf bewegte sich nicht, die Tür ließ sich nicht aufdrücken.
Die Tür ist abgeschlossen! Marlie hat mich eingesperrt!
Wut und Furcht tobten in ihr. Sie drückte das Ohr ans Türblatt, doch sie hörte nichts, nicht einmal Marlies davonhuschende Schritte. Wahrscheinlich war ihre große Schwester längst weg.
Nein, nein, nein!
»Marlie!« Kara rüttelte am Knauf, dann hämmerte sie gegen das Holz. Als ihr Zorn nachließ, lehnte sie sich mit dem Rücken gegen das Türblatt und rutschte daran hinab, bis sie in der Hocke saß. Unwirsch wischte sie die Tränen ab, die in ihren Augen brannten.
Sie wollte hier raus, raus aus diesem Furcht einflößenden Gefängnis, aber Marlies Worte hallten in ihr nach wie der Schlag einer Totenglocke: Es ist kompliziert … und echt beängstigend.
Das war kein schlechter Scherz. Marlie meinte es ernst, todernst. Jemand … etwas Böses war hier.
Schaudernd biss sie auf ihre Unterlippe, rappelte sich hoch und setzte sich auf die zweitunterste Stufe. Die Tür war eine finstere Barriere zwischen ihr und dem Rest der Welt. Sollte sie wirklich hier sitzen bleiben und warten?
Was, wenn das Böse die Treppe zum zweiten Stock hinaufkam, auf die schmale Tür zum Dachboden stieß und sie hier entdeckte?
Was, wenn das Böse Marlie etwas antat? Wenn es sie umbrachte? Bei dem Gedanken setzte Karas Herz vor Schreck einen Schlag aus.
Sie sehnte sich nach ihrer Mutter und ihrem Vater. Die beiden würden wissen, was zu tun war. Aber laut Marlie waren sie nicht zu Hause, und was das betraf, hatte sie bestimmt nicht gelogen.
Oder doch?
Sie durfte jetzt nicht unüberlegt handeln, durfte keine Aufmerksamkeit erwecken. Nein, sie musste klug sein. Ihre Lehrer hielten sie für klug, das hatten sie gesagt. Sie musste einen Weg finden, zu fliehen und sich in Sicherheit zu bringen.
Entschlossen stieg sie die steilen Stufen wieder hinauf und tastete sich vorsichtig zu dem runden Fenster im Giebel vor. Das Glas war schmutzig, ließ aber etwas Mondlicht herein. Kara sah die staubigen Kartons und Kisten, in die schon lange niemand mehr hineingeschaut hatte. Die meisten davon waren beschriftet. Bücher, las Kara. Kleidung. Büro. Auf anderen standen Namen: Sam jr. Jonas. Donner. Marlie. Sie hatte keinen Karton – die Jüngste unter ihren Geschwistern, das einzige gemeinsame Kind von Mama und Daddy.
Plötzlich raschelte es in einer der Ecken. Kara wirbelte herum und verengte die Augen, um besser sehen zu können, doch sie konnte nichts erkennen. Sie lauschte angestrengt. Winzige Krallen, die über den Holzboden huschten. Ein Marder? Eine Maus … oder etwa eine Ratte?
Schaudernd wandte sie sich ab und hob willkürlich den Deckel von einem der Kartons. Gerade als sie anfangen wollte, den Inhalt zu inspizieren, hörte sie von unten einen grauenhaften Schrei, der ihr das Blut in den Adern erstarren ließ.
»Aaahhh!«
Kara fuhr zusammen. Fast hätte sie sich in die Hose gemacht vor Schreck. Sie atmete tief ein und wieder aus und wartete darauf, dass sich ihr Herzschlag ein wenig beruhigte.
Der Schrei hallte in ihren Ohren nach.
Was hatte das zu bedeuten? Und vor allem: Wer hatte geschrien?
Marlie?
Mama?
Oder jemand anderes?
Von unten hörte sie gedämpftes Poltern.
War jemand gestürzt und hatte etwas Schweres mit sich gerissen? Vielleicht eine Stehlampe oder einen Sessel?
Mit trockenem Mund blinzelte Kara gegen die Tränen an.
»Mama«, kam es mit einem Schluchzen über ihre Lippen.
Sei nicht so ein Baby!
Mit tränenverschleiertem Blick konzentrierte sie sich wieder auf den Karton. Büro, stand auf dem Deckel. Nicht besonders interessant. Aktendeckel, aus denen vergilbte Unterlagen ragten, ein alter Tacker, Umschläge, ein Klebeband-Roller und eine Schere. Sie nahm aus dem Karton einen Stoß Papiere, der von einer Büroklammer zusammengehalten wurde, zupfte die Büroklammer ab, dann griff sie nach der Schere und schlich lautlos die steilen Stufen hinunter zur Tür.
Einmal hatte sie Jonas dabei beobachtet, wie er die verschlossene Badezimmertür mithilfe einer Büroklammer öffnete, und nun versuchte sie, es genauso zu machen wie er. Sie bog den dünnen Metalldraht so gerade wie möglich, dann schob sie ihn ins Schloss, gleich unter dem Knauf. Es hatte bei den verschlossenen Zimmertüren von Sam jr. und Donner geklappt, warum sollte es nicht auch jetzt funktionieren? Vorsichtig rüttelte sie an dem feinen Draht, bewegte ihn hin und her und lauschte dabei auf Geräusche auf der anderen Seite der Dachbodentür. Alles war still.
»Komm schon, komm schon«,murmelte sie kaum hörbar, zog den Draht noch einmal heraus und richtete ihn erneut aus. Auf einmal spürte sie, wie sich die Verriegelung löste. Mit einem leisen Klicken gab das Schloss nach. Kara kämpfte gegen ihre Furcht an, dann holte sie tief Luft, drehte den Knauf und stieß die Tür auf, die Schere in der erhobenen Hand.
Kapitel zwei
Der Flur war leer.
Und stockfinster. Das einzige Licht, das unheimliche Schatten an die Wände zeichnete, kam vom Treppenaufgang am gegenüberliegenden Ende.
Kara leckte sich nervös die Lippen, wie sie es Hunderte Male getan hatte, wenn sie durch dieses alte Haus geschlichen war. Sie huschte zur Treppe und eilte auf Zehenspitzen die Stufen hinunter, wobei sie kaum zu atmen wagte, um ja kein Geräusch zu machen.
Im ersten Stock blieb sie stehen und lauschte, doch außer dem Weihnachtslied von vorhin war nichts zu vernehmen.
»Stille Nacht …«
Lautlos hastete sie über den Läufer und öffnete die Tür zu dem Zimmer, das sie sich mit Marlie teilte.
»Heilige Nacht …«
Das Zimmer war leer. Die Kleiderstapel lagen noch immer auf Marlies Bett, daneben die Stiefel und der aufgeklappte Koffer. Karas eigenes Bett war so, wie sie es verlassen hatte, die Bettdecke zurückgeschlagen, das Laken zerknittert.
Kara schlich zu dem kleinen Schreibtisch, an dem sie ihre Schulaufgaben verrichtete, und nahm die rosa Taschenlampe aus der oberen Schublade. Sie ließ den Strahl durchs Zimmer und in die Ecken gleiten. Keine Marlie.
Kara biss sich auf die Lippe.
Kämpfte gegen die Panik an, die sich erneut in ihr breitmachte.
Durch die einen Spaltbreit geöffnete Tür hörte sie die Musik von unten.
»Hirten längst kundgemacht …«
Wieso spielt ständig dasselbe Lied?
Als hätte jemand die Repeat-Taste auf dem CD-Player gedrückt.
Sie spähte durch den schmalen Spalt und vergewisserte sich, dass der Flur leer war, bevor sie hinaus und in Jonas’ Zimmer schlüpfte. Er hatte den kleinsten Raum, der noch unordentlicher war als sonst. Das Bett war zerwühlt, der Schreibtisch überladen mit allerlei Kram, auf dem Fußboden türmten sich schmutzige Kleidungsstücke und Spiele. Kara schaltete die Taschenlampe an und zuckte zurück. O Gott! Sie schaute in zwei braune Augen, die sie blicklos anstarrten. Es gelang ihr gerade noch, den Schrei hinunterzuschlucken, der in ihrer Kehle aufstieg. Eine Sekunde später realisierte sie, dass das Augenpaar zu dem Hirschkopf gehörte, der für gewöhnlich an der Wand hing und der nun auf dem Fußboden lag. Das Geweih ragte bizarr in die Höhe.
Die Taschenlampe glitt ihr aus der Hand.
Mist!
Ihr Herz hämmerte so heftig gegen ihren Brustkorb, dass sie fürchtete, es würde explodieren.
Reiß dich zusammen, schimpfte sie innerlich. Das ist doch bloß ein Hirsch, noch dazu einer, der schon lange tot ist! Überall im Haus hingen Jagdtrophäen an den Wänden, und ja, sie hatten ihr immer schon Angst eingejagt, aber das war kein Grund, sich in die Hose zu machen. Kara hob die Taschenlampe auf und ließ den dünnen Lichtstrahl über den Rest des Chaos gleiten. Ein Stück von dem Hirschkopf entfernt stand eine halb leere Flasche Gatorade, daneben auf dem Boden der ausgestopfte Adler, der sonst an der Wand hing – genau wie der Hirschkopf. Überall lagen Federn verstreut. Wieso war der Vogel von dem Haken an der Wand gefallen? Kara trat einen Schritt näher und zuckte erneut zurück. Dem Adler fehlte der Kopf – ein sauberer Schnitt, als hätte man ihn vorsätzlich enthauptet. Hektisch sah sie sich um und entdeckte den Kopf ein Stück weiter weg auf dem Teppich, den scharfen Schnabel in den Teppich gebohrt.
Mit zitternden Händen richtete sie die Taschenlampe auf die Wand über Jonas’ Kommode, wo ein Schwert hing, ein Relikt aus einem Krieg, der schon seit langer Zeit vorüber war. Es war streng verboten, die Waffe zu berühren, geschweige denn von der Wand zu nehmen. Das durfte keiner von ihnen, auch nicht Jonas, niemals.
Nie.
Das Schwert war fort.
Kara war nicht überrascht.
Erst heute Nachmittag hatte sie durch die halb geöffnete Tür beobachtet, wie Jonas sich dem Verbot widersetzte und mit dem Schwert herumfuchtelte, als wäre er ein Krieger in einem Fantasy-Film. Ein Ninja oder so was.
Idiot, hatte sie gedacht.
Jetzt hatte sie schreckliche Angst.
Sie drehte sich um und verließ Jonas’ Zimmer, die Finger fest um den Griff der Schere geschlossen.
Den nächsten Raum teilten sich ihre beiden anderen Brüder. Donner war Marlies richtiger Bruder, beide waren von Mama. Mama hatte sie zur Welt gebracht, bevor sie Daddy geheiratet hatte. Sam jr. und Jonas waren ebenfalls richtige Brüder, aber sie waren von Daddy. Sie hatten eine andere »echte« Mom. Kara war froh, dass sie das Kind von Mama und Daddy war, doch im Augenblick interessierte sie das nur wenig.
Wo waren die anderen?
Auch im Zimmer von Donner und Sam jr. herrschte ein wüstes Durcheinander – das Bettzeug lag auf dem Fußboden, dazwischen sah sie zerknüllte Kleidungsstücke, Schuhe, Stiefel, leere Getränkedosen und Einwickelpapier von Schokoriegeln. Sams Rucksack stand am Fußende vom Bett, sein neues Nokia-Handy lag auf dem Nachttisch. Er war der Ordentlichere von beiden und verließ das Zimmer für gewöhnlich nie ohne sein Mobiltelefon.
Mit zusammengeschnürter Kehle sah sie sich weiter um. Donners Hälfte war völlig zugemüllt, ein leerer Pizzakarton lag auf seinem Bett, eine Schachtel Zigaretten lugte unter seinem Kopfkissen hervor.
Die Nerven bis zum Zerreißen gespannt, schlich sie wieder in den Flur.
»Durch der Engel Halleluja …«
Vorsichtig näherte sich Kara wieder der Treppe hinter der Tür neben Mamas und Daddys Schlafzimmer, die zu den Dienstbotenquartieren führte. Sie huschte hinauf und rannte noch einmal durch den langen Flur, vorbei an den ehemaligen Dienstbotenzimmern bis zu der schmalen Treppe, über die man direkt hinunter in die Küche gelangte. Dort war alles dunkel. Zum Glück schien immer noch der Mond auf den Schnee vor den Fenstern, sodass sie ihre Taschenlampe nicht anschalten musste. Geräuschlos umrundete sie die frei stehende Kücheninsel, dann tappte sie durch einen Durchgang ins Esszimmer, wo ein großer Tisch stand, der von der Anrichtekammer bis kurz vor die Glastüren zur Terrasse reichte. Hinter dem tief verschneiten Garten glitzerte der See im Mondschein, umstanden von weiß überzuckerten Tannen und Fichten.
Der Tisch im Esszimmer war festlich gedeckt, die Kristallgläser funkelten rot im Schein der glühenden Kohlen im Kamin des angrenzenden Wohnzimmers, in dem Daddy am Nachmittag ein munteres Feuer entfacht hatte. Sie hatte zugesehen, wie er Holz aufschichtete, das er aus der hinter einer Tapetentür verborgenen Kammer gleich neben dem Kamin holte. Bevor er es anzündete, hatte er alte Zeitungen darunter gestopft, damit die Scheite besser Feuer fingen. In den beiden Räumen roch es nach Rauch und nach etwas anderem … Sie schnupperte. Ein seltsam metallischer Geruch stieg ihr in die Nase. Lautlos ging sie hinüber ins Wohnzimmer. Vor dem bodentiefen Fenster stand der Weihnachtsbaum. Schief. In einem merkwürdigen Winkel. Umgestürzt. Die hellen Lichter blinkten, mehrere Zweige waren abgebrochen.
Ganz anders als am Nachmittag.
Karas Nacken kribbelte.
Und dann fiel ihr Blick auf die Wände.
Auf die dunklen Flecken und Rinnsale in Richtung Fußboden.
Rot.
Dickflüssig.
Blut!
Auf den Holzdielen sah sie dunkelrote, fast schwarze Pfützen.
Diesmal konnte sie den Schrei nicht hinunterschlucken. Ihr Magen drehte sich um. Dort, auf Mamas Perserteppich, lag ihr Bruder Donner, mit aufgeschlitzter Kehle, die Haut weiß wie Milch, das blonde Haar rot gesträhnt, die Augen starr zur Decke gerichtet. Kara machte einen Schritt zurück und trat mit der Ferse auf etwas Weiches. Sie wirbelte herum und entdeckte Sam jr., der zusammengerollt auf dem Boden lag, die Haare voll Blut, der Mund offen, die Augen leblos und leer.
»Neiiin!«, schrie sie wieder und brach in lautes, abgehacktes Schluchzen aus.
Die Schere glitt ihr aus der Hand, dann die Taschenlampe, deren Strahl nun auf Jonas fiel, der zum Teil vom Weihnachtsbaum verdeckt wurde. Sein Gesicht und das Hemd waren blutüberströmt. Auch er hatte die Augen geöffnet.
Hyperventilierend starrte sie ihn an und fing erneut an zu schreien, als sie sah, dass er blinzelte.
War er etwa noch am Leben?
»K-K-K-a… Kara …«, stammelte er. Seine Stimme war nicht mehr als ein ersticktes Flüstern.
Sie blickte in sein blutverschmiertes Gesicht.
»Hol … hol … Hilfe …« Er versuchte, sich aufzurichten, doch dann ließ er sich zurückfallen. »Lauf …« Es klang, als würde er gurgeln. Sie sah, wie er die Augen verdrehte, und rannte los, doch sie rutschte auf dem Blut aus, das überall zu sein schien: an den Wänden, auf dem Fußboden, sogar an der Decke.
»Marlie!«, rief sie. Wo zum Teufel war sie? »Marlie!« Den Namen ihrer großen Schwester brüllend, stolperte Kara aus dem Wohnzimmer und lief hoch zum Schlafzimmer der Eltern.
Von Schluchzern geschüttelt, stieß sie die Tür auf und verharrte entsetzt auf der Schwelle. »Nein!«, kam es keuchend über ihre Lippen, dann brach sie zusammen. »Nein, nein, nein!« Ihre Eltern lagen im Bett, Mama in ihrem Seidenpyjama, ihr Daddy in Boxershorts. Beide waren voller Blut, genau wie das Bettzeug, das Bettgestell und die Wand. Mamas blonde Haare waren zerzaust, ihre Augen glasig und starr, in ihrer Kehle klaffte ein tiefer Schnitt. Daddys Gesicht war seltsam bläulich, aus seinem offenen Mund floss Blut. Sein nackter Oberkörper war übersät mit hässlichen, tiefen Schnitten, auch sein Hals war aufgeschlitzt, buchstäblich von einem Ohr zum anderen.
Benommen trat Kara zurück.
Tot.
Sie waren alle tot.
Außer Jonas.
Sie wollte gerade zurück ins Wohnzimmer zu ihrem Halbbruder rennen, als ihr einfiel, was er gesagt hatte.
Hol Hilfe!
Das Telefon.
Sie musste die Neun-eins-eins anrufen.
Im Schlafzimmer war ein Apparat, aber sie würde den Anblick ihrer Eltern nicht noch einmal ertragen. Nein, sie musste das Telefon in der Küche benutzen oder Sams neues Handy, das auf seinem Nachttisch lag. Sie musste die Polizei anrufen. Einen Rettungswagen holen. Eilig hastete sie wieder hinunter und durchs Wohnzimmer, sah Jonas reglos hinter dem Weihnachtsbaum liegen. Hoffentlich war es nicht schon zu spät!
Sie hielt inne.
Im selben Moment hörte sie, wie sich die Haustür öffnete.
Marlie?
Nein!
Nicht ihre Schwester, sondern ein Mann erschien auf der Schwelle zum Wohnzimmer.
Ein großer Mann. Mit einer schwarzen Skimaske.
Der Mörder!
Großer Gott!
Kara stieß einen erstickten Schrei aus und sprintete los. Sie rutschte in einer Blutlache aus, doch zum Glück fing sie sich wieder und stolperte weiter.
»Heilige Scheiße! Was zur Hölle …?«, fluchte der Mann.
Er hatte sie gesehen!
Kara lief.
Lief um ihr Leben.
So schnell sie ihre Füße trugen, durchquerte sie das Esszimmer, wobei sie einen Stuhl umstieß, um ihm den Weg zu versperren, dann riss sie die Terrassentür auf und stürmte hinaus in den verschneiten Garten.
»He!«, rief der Mann hinter ihr. »He, du! Bleib stehen!«
Das könnte dir so passen!
»Stopp! Kleines Mädchen, bleib stehen!«, befahl er noch einmal, doch sein lauter Kommandoton trieb sie lediglich dazu an, noch schneller zu laufen. Schnell wie der Wind sauste sie durch die Schneewehen.
»He, Kleine …«
Vor Entsetzen schrie sie laut auf, doch sie blieb nicht stehen.
Ohne nachzudenken, duckte sie sich unter den niedrigen Ästen eines Tannengehölzes hindurch und schlug den Weg zum See ein. Hier war der Schnee festgetrampelt und fühlte sich eisig an unter ihren nackten Füßen. Schneebedeckte Zweige peitschten ihr ins Gesicht, Brombeerranken verhakten sich in ihrem Schlafanzug. Sie hörte, wie der Stoff eines Ärmels zerriss, spürte die Dornen, die ihre Haut ratschten, doch sie hielt nicht an, wagte es nicht, sich umzudrehen. Ihre Lunge brannte, ihr Atem bildete kleine, helle Wölkchen in der Dunkelheit, aber sie wurde nicht langsamer. Mit gesenktem Kopf schoss sie zwischen den Bäumen hindurch.
Was war passiert?
Wer hatte Mama und Daddy umgebracht?
Warum? Sie spürte die Tränen, die auf ihren Wangen zu Eis gefroren, als sie beim Rennen ihre Eltern vor sich sah, blutüberströmt, voller grässlicher Schnittwunden. Sam und Donner mit ihren rot verklebten Haaren und den blicklosen Augen, und Jonas, der sich aufrichtete und ihr sagte, sie solle abhauen. Lauf! Hol Hilfe! Auf einmal bemerkte sie Marlie hinter einem der verschneiten Bäume, weiß wie ein Gespenst, das Gesicht blutüberströmt. Sie beugte sich vor und trieb sie zur Eile an: »Lauf, Kara-Bär, lauf!«
Kara nahm an, dass ihre große Schwester nicht wirklich da war, dass sie sich das alles nur einbildete, doch sie zwang sich, noch schneller zu rennen.
Ihre Ohren rauschten vor Anstrengung, dennoch konnte sie Schritte hören. Leichte Schritte, die lauter wurden und dann plötzlich schwerer und schwerer. Er kam näher.
Schneller, Kara, schneller!
Keuchend stürmte sie vorwärts, bis endlich das schwarze Wasser des Sees im Mondlicht sichtbar wurde. Ein Teil der Oberfläche war eisbedeckt. Am gegenüberliegenden Ufer sah sie die hellen Fenster einiger Häuser, die ihr in diesem Moment vorkamen wie Leuchtfeuer.
Wenn sie es doch nur bis dorthin schaffen könnte!
Sie musste es schaffen!
Würde es schaffen!
Schneller, Kara, lauf schneller!
Sie stieß mit dem Zeh gegen eine rausragende Wurzel, schrie laut auf und stolperte nach vorn. Schmerz schoss durch ihren Fuß und zwang sie, das Tempo zu drosseln und ein paar Schritte zu hinken. Am liebsten hätte sie aufgegeben, sich in den Schnee geworfen und geweint.
Nein! Du musst weiterlaufen. Hilfe holen. Jonas ist noch am Leben!
Mit zusammengebissenen Zähnen kämpfte sie sich vorwärts.
Der Killer kam näher.
Sie hörte seinen abgehackten Atem, spürte, wie seine schweren Schritte den Boden beben ließen. Dann stolperte auch er und rief ihr keuchend hinterher: »Um Himmels willen, Mädchen, bleib stehen! Ich tue … ich tue dir nichts!«
Sie glaubte ihm keine Sekunde.
Lauf!
Sie erreichte das Ufer und hielt rutschend an.
»Stopp!«, brüllte der Mann. »Herrgott noch mal, bleib stehen!«
An dieser Stelle war der See zugefroren. Kara betrat das Eis, das aussah wie Glas, und schlitterte auf die Lichter zu, immer weiter weg vom Ufer.
»He!«, rief er noch einmal mit rauer Stimme.
Sie ignorierte ihn, lief weiter, rutschte aus, rappelte sich wieder hoch. Sie hätte den Pfad am Ufer nehmen sollen, aber nun war es zu spät.
Der Mörder hatte die Eisfläche ebenfalls betreten.
Nein!
So schnell sie konnte, humpelte sie weiter, auf die Rettung verheißenden Lichter zu. Dort war bestimmt jemand, der ihr helfen würde, sie musste nur das gegenüberliegende Ufer erreichen.
»Geh nicht weiter! Verdammt!«
Vor lauter Angst verlor sie das Gleichgewicht.
Er schien näher zu kommen.
Sie musste aufstehen, schneller sein als er!
Aus dem Augenwinkel sah sie, dass er nur noch ein paar Schritte von ihr entfernt war.
Sie richtete sich auf und wollte gerade weiterlaufen, als sie ein lautes Knacken vernahm.
Zu ihrem Entsetzen sah sie, wie das Eis unter ihren Füßen einen Riss bekam, eine einzelne gezackte Linie, von der sich weitere feine Linien ausbreiteten, die binnen Sekunden an ein riesiges Spinnennetz erinnerten.
Der Killer erstarrte. »Scheiße.«
Das Netz gab nach.
Knirsch. Knack.
»O Gott!«, stieß er hervor. »Bleib stehen, Mädchen!«
Kara erstarrte vor Angst. Sie konnte nicht besonders gut schwimmen.
Ein weiteres lautes Knacken. Diesmal hörte es sich fast an wie ein Ächzen.
Das Eis unter Karas Füßen brach.
Sie stieß einen schrillen Schrei aus und wurde im nächsten Moment von den eisigen Fluten verschluckt.
Wie ein Stein sank sie in die schwarze Tiefe des Sees.
Sie ruderte wild mit den Armen, versuchte, sich an die Oberfläche zu kämpfen, konnte kaum das Loch im Eis über sich erkennen. Zum Glück schien der Mond hell. Über ihr trieben Eisschollen. Sie schluckte Wasser.
Sie musste irgendwie an die Oberfläche gelangen, musste husten, Luft holen!
Plötzlich brach das Eis erneut. Sie sah, wie der Mann ins Wasser stürzte, so dicht neben ihr, dass er sie beinahe berührt hätte. Die Wellen, die er verursachte, trieben die Schollen auseinander, was ihr die Möglichkeit gab, den Kopf aus dem Wasser zu recken. Verzweifelt schnappte sie nach Luft.
Kurz darauf tauchte auch er wieder auf und streckte die Hand nach ihr aus.
Sie entzog sich seinem Griff und versuchte zu schwimmen, weg von ihm, doch stattdessen sank sie erneut in die undurchdringliche Schwärze des Sees. Ihre Lungen brannten.
Auf einmal hörte sie Marlies Stimme in ihrem Kopf.
Schwimm, Kara-Bär, schwimm!
Sie kämpfte sich an die Oberfläche und hustete, was dazu führte, dass sie noch mehr Wasser schluckte.
Kämpf, Kara, du darfst nicht aufgeben!
Marlies Stimme war schwach und drang wie aus weiter Ferne zu ihr.
Karas Lungen drohten zu bersten. Sie hörte auf zu strampeln, ließ sich treiben und spürte kaum, wie starke Arme sie umschlangen. Ihr Blick verschwamm, dann sah sie nichts mehr, hörte nur noch die leisen Klänge des Weihnachtslieds, die in ihrem Kopf nachhallten.
»Schlaf in himmlischer Ruh …«
Kapitel drei
Sie wissen, was man so sagt.« Dr. Zhou saß in einem Polstersessel in ihrer Praxis im zweiten Stock eines historischen Hauses im Nordwesten von Portland und zog leicht die dünnen Augenbrauen in die Höhe.
»Nein, aber es ist sicherlich von Belang«, erwiderte Kara, dann fügte sie hinzu: »Haben Sie sich jemals gefragt, wer ›man‹ eigentlich ist?«
»Oh, das weiß ich. Die Weisen der Jahrhunderte.« Dr. Zhous dunkle Augen blitzten im Nachmittagslicht, das durch das Fenster hereinfiel. Sie war eine kleine Frau. Zierlich. Blauschwarzes Haar, intelligente Augen und ein durchtrainierter Körper vom Marathonlaufen.
Karas Blick schweifte zum Fenster. Die Dezembersonne stach durch die tief hängenden grauen Wolken und fing sich in den glitzernden Eiszapfen an den Dachrinnen. Sie sahen aus wie Dolche aus Kristall. Auf der Fahrt hierher hatte sie im Radio gehört, dass es an Heiligabend wieder schneien sollte. Kara schauderte bei der Vorstellung. Sie träumte nicht von weißen Weihnachten, und wenn doch, dann war es ein Albtraum. »Also, welche weisen Worte hat man heute für mich parat? Klären Sie mich auf.«
»Dass die Schuld eine eifersüchtige Geliebte ist.«
»Ach, verschonen Sie mich.« Kara wollte so etwas nicht hören.
»Die Schuld lässt keinen Raum für andere Emotionen, vertreibt sie, indem sie erbittert ihren Platz verteidigt.«
»Die Schuld ist also eine Frau? Selbstverständlich.« Kara lachte trocken. »Dann sind Sie jetzt nicht nur meine Psychologin, sondern haben auch noch einen Abschluss in Philosophie vorzuweisen?« Es gelang ihr nicht, die Schärfe aus ihrer Stimme herauszuhalten.
»Nur zur Erinnerung.«
Als würde Kara jemals über die Schuldgefühle hinwegkommen, die seit mehr als zwei Jahrzehnten ihr ständiger Begleiter waren. »Überlebenden-Syndrom« nannte man das.
Zwanzig Jahre Therapie, in denen sie erwachsen geworden war, zwanzig Jahre, in denen sie sich mit dem Trauma auseinandersetzen musste, das sie für immer gezeichnet hatte, und sie war nach wie vor weit davon entfernt, sich auch nur ansatzweise gut zu fühlen. Sie wusste, dass sie keine Heilung finden würde, aber man hatte ihr versichert, dass es ein Leben für sie gab, ein »normales« Leben. Das hatte die Kinderpsychologin behauptet, genau wie die Jugendpsychologin und jetzt Dr. Zhou, die dritte Psychologin, die sie als Erwachsene aufsuchte.
Kara glaubte nicht, dass sich für sie jemals so etwas wie Normalität einstellen würde.
»Sie sagten, Sie würden keine Geister mehr sehen«, stellte Dr. Zhou fest. »Ist das richtig?«
»Ich hätte Ihnen nie davon erzählen dürfen«, erwiderte Kara. »Das war bloß ein alberner Traum!«
»Ein wiederkehrender alberner Traum.«
»Ja, aber seit einiger Zeit nicht mehr«, log Kara. »Schon seit zwei oder drei Monaten nicht mehr.«
In Dr. Zhous Blick lag Skepsis. Sie lehnte sich in ihrem Sessel zurück und klopfte mit einem Bleistift gegen ihre Lippen. Als würde sie ihrer Patientin nicht glauben. »Was ist mit Ihrem Gefühl, beobachtet zu werden? Verfolgt?«
Kara zuckte die Achseln. »Auch das ist besser geworden.«
»Tatsächlich?« Noch mehr Skepsis. Dr. Zhou ließ den Bleistift in eine Tasse auf dem kleinen Beistelltisch fallen.
»Ja!«, beharrte Kara.
Mit gerunzelter Stirn sagte Dr. Zhou: »Hören Sie, Kara, ich weiß, dass Ihnen diese Jahreszeit besonders zu schaffen macht. Die Feiertage werden hart für Sie, aber Sie haben die Nummer von Dr. Prescott, und Sie können mich im Notfall auf dem Handy erreichen.«
»Ist mein Leben nicht ein einziger Notfall?«, fragte Kara, nur halb im Scherz. Sie würde keine andere Psychologin anrufen, würde keine Sitzung mit einer anderen Person in einem anderen Büro absolvieren. Würde nicht neu beginnen oder Dr. Zhous Kollegin auf den neuesten Stand bringen. Nein, sie fühlte sich wohl hier, in dem Raum mit den eisgrünen Wänden, den weichen Polstersesseln und den Blumenaquarellen. Mit dieser Seelenklempnerin. Endlich.
»Das gehört dazu.« Dr. Zhou stand auf und streckte Kara die Hand entgegen, doch als Kara sie nehmen wollte, umarmte sie sie stattdessen. Die Psychologin war einige Zentimeter kleiner als Kara, aber das hielt sie nicht davon ab, Kara ermutigend den Rücken zu tätscheln. Dann rückte sie von Kara ab, blickte ihr in die Augen und sagte: »Wir sehen uns am siebten Januar.«
Kara nickte. »Es sei denn, ich bin bis dahin voll und ganz wiederhergestellt.«
»Sicher.« Die Psychologin gab sich keine Mühe, ihren Sarkasmus zu verbergen. Sie wussten beide, dass nicht nur die Weihnachtsfeiertage für Kara die schwärzeste Zeit des Jahres waren, sondern dass in diesem Jahr noch etwas anderes hinzukam: Jonas, der Bruder, der überlebt hatte, würde aus dem Gefängnis entlassen werden. In zwei Tagen.
Was für eine Freude.
»Frohe Weihnachten«, sagte Dr. Zhou.
»Ihnen auch frohe Weihnachten.« Karas Stimme versagte. Sie fürchtete, zusammenzubrechen, also nahm sie Schal und Mantel, um die Praxis zu verlassen, bevor ihr die Tränen über die Wangen liefen. Während sie durch den mit Teppich ausgelegten Flur hastete, vorbei an mehreren anderen Praxen, schob sie die Arme in die Ärmel ihres langen Mantels und band sich den Schal um.
Sie stieß die Glastür des dreigeschossigen Gebäudes auf und eilte über den Parkplatz zu ihrem Jeep, der neben einem vereisten Schlagloch stand, dann drückte sie auf die Fernbedienung, um die Türen zu entriegeln.
Der Parkplatz war geräumt und gesalzen, doch ein Blick in den Himmel zeigte ihr, dass es vermutlich früher schneien würde als im Wetterbericht angekündigt. Bevor sie einstieg, schaute sie prüfend ins Wageninnere.
Niemand versteckte sich im Fußraum oder hinter den Sitzen.
Sie öffnete die Tür, glitt auf den Fahrersitz und ließ den Motor an. Aus Gewohnheit verriegelte sie die Türen, dann schaute sie in den Rück- und die Seitenspiegel. Niemand zu sehen. Kein durchgeknallter Killer, der darauf aus war, sie zu schnappen, nur ihr eigenes besorgtes Gesicht starrte ihr entgegen. In ihren haselnussbraunen Augen standen Tränen. »Schluss jetzt!«, schalt sie sich, stellte ihr iPhone laut und lehnte es in den Getränkehalter, bevor sie den Rückwärtsgang einlegte und aufs Gas trat. Der Jeep schoss nach hinten.
Ihr Handy klingelte. Kara warf einen Blick aufs Display.
Tante Faizas Name blinkte auf.
»Nein«, murmelte sie, »bitte nicht jetzt. Am besten nie.« Sie würde sich nicht mit der Frau auseinandersetzen, die sich so eifrig bereit erklärt hatte, sie großzuziehen, nur um ihr Erbe anzuzapfen – ein Erbe, das sie antreten konnte, wenn sie in zwei Wochen achtundzwanzig wurde. Nein, sie hatte wahrhaftig keine Lust, sich Faizas neugierige Fragen oder zermürbende Vorwürfe anzuhören. Diese Zeit war vorbei. Die Tatsache, dass Tante Fai immer noch in Karas Elternhaus wohnte, eine Villa in den West Hills mit Blick auf Portland, hätte sie ärgern müssen, denn diese Villa gehörte zu ihrem Erbe. Doch es war ihr egal. Das riesige Haus mit den vielen Zimmern und der atemberaubenden Aussicht war für sie nichts als eine schmerzhafte Erinnerung an das, was sie verloren hatte. Tante Faiza war zu ihrem Vormund ernannt worden, und sie und ihr Freund, ein Musiker, hatten das Haus übernommen, um für Kara da zu sein, doch sie hatten sich nicht sonderlich für sie interessiert, geschweige denn sich um sie gekümmert. Kara hatte den Großteil ihrer Kindheit bei Merritt Margrove, dem Anwalt der Familie, und seiner zweiten Frau Helen verbracht. Ihr Haus am östlichen Ufer des Flusses, ein Bungalow in den schmalen Straßen von Sellwood, hatte sich mehr wie ein Zuhause angefühlt als die Villa auf dem bewaldeten Hügel.
Sie rollte vom Parkplatz und reihte sich in den Verkehr ein, wobei sie einen Pick-up schnitt. Der Fahrer drohte ihr mit der Faust und hupte wütend, aber sie achtete nicht auf ihn und fuhr einfach weiter. Wieder klingelte das Handy. Tante Faiza gab nicht auf.
»Großartig.« In letzter Minute bog sie ab und setzte rückwärts in eine enge Parklücke vor dem Schnapsladen. »Das ist keine gute Idee«, murmelte sie, trotzdem stellte sie den Motor ab, stieg aus und schloss den Jeep ab. Anschließend steckte sie die Schlüssel in ihre Handtasche und ging hinein.
Hier befand sie sich auf vertrautem Terrain, wusste, was sie haben wollte.
Eine Flasche Merlot und dazu zwei kleine Flaschen Wodka von der Größe, wie man sie in Flugzeugen bekam.
Schließlich stand Weihnachten vor der Tür. Und ihr Bruder würde aus dem Knast kommen. Das musste gefeiert werden, und Kara konnte ein bisschen fröhliche Weihnachtsstimmung gut gebrauchen. Sehr viel fröhliche Weihnachtsstimmung wäre noch besser.
Die Frau an der Kasse war um die fünfzig. Sie roch nach Zigaretten und Pfefferminz-Pastillen. Auf ihren orangestichigen Haaren thronte eine lustige Weihnachtself-Kappe mit einem Glöckchen, das klingelte, wenn sie den Kopf bewegte.
Fröhliche Weihnachten.
Kara bezahlte in bar und ignorierte den neugierigen Blick der Kassiererin, als sie ihr das Wechselgeld aushändigte und die Flaschen einpackte.
Verdammt. Sie schien zu überlegen, wo sie sie einordnen sollte.
Kara liebte ihre Anonymität.
Die ihr bald um die Ohren fliegen würde, so viel stand fest.
Wie um ihre Gedanken zu bekräftigen, blieb ihr Blick an einem Zeitungsständer in der Nähe der Kasse hängen. EISKALTER KILLER KURZ VOR DER HAFTENTLASSUNG lautete die Schlagzeile. Darunter stand: COLD-LAKE-MÖRDER JONAS MCINTYRE SOLL AUF FREIEN FUSS GESETZT WERDEN.
Karas Magen brannte. In ihrer Kehle stieg Galle auf.
Als die nächste Kundin, eine Frau über sechzig in einem langen roten Mantel und passender Baskenmütze, ihre Weinflaschen auf den Verkaufstresen stellte, nahm Kara eine Zeitung heraus, sagte: »Die kommt noch dazu«, und reichte der Kassiererin einen Fünfer.
»Augenblick mal«, ließ sich die ältere Frau stirnrunzelnd vernehmen, »jetzt bin ich dran.«
»Mag sein«, gab Kara zurück, »aber ich war zuerst da. Frohe Weihnachten.« Während die Frau empört nach Luft schnappte, wandte sich Kara der Kassiererin zu. »Stecken Sie das Wechselgeld da rein«, bat sie und deutete auf die Spendendose für das örtliche Tierheim. Dann klemmte sie sich die Zeitung unter den Arm und verließ den Laden, um kein weiteres Aufsehen zu erregen. Sie musste ihre Anonymität wahren.
Draußen wurde es langsam dunkel, die Straßenlaternen schienen bereits und ließen die Schneeflocken glitzern, die lautlos vom Himmel fielen.
Kara warf einen Blick ins Wageninnere, dann öffnete sie die Tür, legte die Zeitung auf den Beifahrersitz und stellte die Tasche mit den Flaschen daneben, bevor sie einstieg und aus der Parklücke setzte. Im Rückspiegel sah sie die Frau mit der roten Baskenmütze aus dem Laden eilen, einen finsteren Ausdruck im Gesicht.
In der Innenstadt herrschte stockender Verkehr. Stop and go, eine lange Schlange von Bremslichtern und Scheinwerfern, obwohl es erst späterer Nachmittag war. Um diese Jahreszeit wurde es schnell dunkel. Die Schlagzeilen des Register auf dem Beifahrersitz waren der blanke Hohn und schienen sie zu verspotten, genau wie das Foto von der Berghütte, in der die Familie McIntyre früher ihre Urlaube verbracht hatte. Wenn man das dreigeschossige Haus, das vor über hundert Jahren von einem berühmten Architekten entworfen worden war, denn als »Hütte« bezeichnen konnte. Ihre Eltern hatten es getan. Überladen und prachtvoll, nach den Vorstellungen von Karas Ururgroßvater erbaut, stand die »McIntyre-Hütte« – eigentlich ein riesiges herrschaftliches Haus inklusive Dienstbotenquartieren – noch immer am Mount Hood in den Bergen von Oregon, wo sie langsam, aber sicher verfiel. Kurz nach den grauenhaften Ereignissen an Heiligabend vor zwanzig Jahren hatte Tante Faiza ein ZU-VERKAUFEN-Schild aufstellen lassen, aber niemand hatte das Haus haben wollen, in dem eine ganze Familie auf brutalste Art und Weise abgeschlachtet worden war. Mittlerweile hatten sich bereits ein halbes Dutzend Immobilienmakler die Zähne an den spärlich gesäten Interessenten ausgebissen, die die McIntyre-Hütte, wenn überhaupt, dann zu einem Spottpreis erwerben wollten. Womit ihre geldgierige Tante natürlich nicht einverstanden war.
Die Tragödie war national bekannt. Die Medien hatten ihr gleich mehrere Namen aufgedrückt: Cold-Lake-Massaker und McIntyre-Massaker waren die geläufigsten, und sie machten Kara gleichermaßen Angst.
Als sie vor einer roten Ampel abbremste, klingelte ihr iPhone schon wieder. Auf dem Display erschien eine Nummer aus der Region, kein Name. »Vergiss es.«
Seit die Medien Wind von Jonas’ bevorstehender Entlassung bekommen hatten, wurde sie von Reportern belagert, mit denen sie ganz bestimmt nicht reden würde. Sogar dieser nervtötende Wesley Tate hatte sich bei ihr gemeldet. Nein, nicht sogar, ausgerechnet dieser nervtötende Wesley Tate hatte sie am Telefon bedrängt, ihm ein Interview zu geben. Der Kerl war schlau. Charmant. Gut aussehend. Und er war zu nah dran an der Geschichte.
Sein Vater, ein Cop außer Dienst, hatte Kara vor dem Ertrinken bewahrt. Er war dabei ums Leben gekommen. Wieder verspürte sie weit mehr als ein Quäntchen Schuld. Wahrscheinlich war sie es seinem Sohn schuldig, ihm ihre Version der Ereignisse zu erzählen.
Nein. Das war keine gute Idee. Ganz gleich, wie dicht Tate an der Sache dran war, wie sehr er emotional involviert sein mochte – er war ein Reporter. Ein männlicher Reporter.
Und im Augenblick befand sich Kara im Männerhasser-Modus. Wegen Brad Jones, den sie vor zwei Wochen in die Wüste geschickt hatte.
Wie die wenigen Freunde, die sie vor ihm gehabt hatte, hatte auch er sich mehr für Karas ominöses Schicksal interessiert als für sie als Frau. Und natürlich war da noch ihr Erbe – der Treuhandfonds, alle möglichen Aktien, Wertpapiere, Festgelder und die Immobilien –, zumindest das, was davon übrig war, der Teil, den Tante Fai nicht verschleudert hatte.
»Was für eine Überraschung«, murmelte sie und stellte das Radio an, um nicht länger über Brad nachdenken zu müssen. Weihnachtsmusik schallte durchs Wageninnere. Ausgerechnet »Stille Nacht«.
»… Holder Knabe im lockigen Haar …«
»Nö, das ganz bestimmt nicht.« Wo war »Rockin’ Around the Christmas Tree«, wenn man es mal brauchte? Sie schaltete das Radio aus und fuhr ohne Musik weiter. Nach etwa einer Stunde passierte sie das WILLKOMMEN-IN-WHIMSTICK-Schild, welches verkündete, dass in diesem Ort knapp über zwölftausend Einwohner lebten.
Kara umfuhr das Zentrum und rollte durch Nebenstraßen und Alleen, bis sie schließlich in die ruhige Straße einbog, in der sie wohnte. Ihre Nachbarn kannte sie kaum, und das war gut so. Drei Häuser weiter, direkt am Fuß eines kleinen Hügels, bog sie in ihre Einfahrt ein. Zum Glück drängten sich weder Nachrichten-Vans noch Reporter auf der schneebedeckten Straße. Abwarten. Vermutlich dauerte es nicht mehr lange, bis genau das der Fall war. In ebender Sekunde, in der Jonas McIntyre auf freien Fuß gesetzt würde, würden die aufdringlichen Medienschnösel in ihre Privatsphäre drängen.
Sie drückte auf die Fernbedienung für die Garage. Das Tor fing an, nach oben zu rollen. Noch bevor es ganz offen war, gab sie Gas und fuhr hinein. Ein weiterer Druck mit dem Finger, und das Tor rollte wieder nach unten. In weniger als einer Minute war sie im Haus, schaltete die Lichter an, drehte die Heizung auf und begrüßte Rhapsody, ihren Rettungshund, eine Mischung aus Terrier und Labrador-Retriever. Möglicherweise steckte noch ein Schuss Pitbull mit drin, aber das war eine reine Vermutung. Kara würde es nie erfahren, es sei denn, sie ließe bei dem Hund einen DNA-Test vornehmen, doch das Geld dafür wollte sie sich sparen. Wen interessierte es schon, welche Rassen in Rhapsody steckten? Für Kara zählte ausschließlich, dass diese zottelige Fünfundzwanzig-Kilo-Hündin mit den weisen goldenen Augen voller Liebe zu ihr aufblickte und ihr so viel Zuneigung schenkte, wie es seit ihrer frühen Kindheit niemand mehr getan hatte.
»Ja, du bist ein braves Mädchen«, lobte Kara und kraulte den Mischling hinter den Ohren. Rhapsody jaulte begeistert und umkreiste sie aufgeregt, so schnell, dass sie aussah wie ein karamellfarbener Wirbelwind. »Schon gut, schon gut, ich hab’s ja verstanden«, sagte Kara lächelnd, »du bekommst deine Belohnung, und ich bekomme meine.« Sie nahm eine Flasche Rotwein aus der Tasche, dann befahl sie dem Hund, sich zu setzen.
Rhapsody gehorchte, die Augen fest auf Kara geheftet, die einen Hundekeks mit Schinkengeschmack aus der Leckerli-Dose nahm und dem Hund zuwarf. Die Mischlingshündin fing ihn in der Luft auf, dann trottete sie damit ins Wohnzimmer zu ihrem Hundebett, während Kara die Flasche entkorkte und sich ein Glas Wein einschenkte. Sie nahm einen Schluck Merlot und spürte, wie sie sich ein wenig entspannte. Als Rhapsody den Keks verspeist hatte, öffnete sie die Hintertür und sah zu, wie der quirlige Mischling über die Terrasse in den Garten stürmte und dabei einen Vogel aufschreckte, der dick aufgeplustert auf dem Zweig einer Ziertanne gesessen hatte. Der Hund war ihr bester Freund, um nicht zu sagen, ihr einziger. Was ihre Schuld war. Es war ihr all die Jahre über nicht gelungen, den Menschen, die sie kennenlernte, zu vertrauen. Zu viele wollten ihrer Meinung nach bloß ihre Bekanntschaft machen, weil sie a) neugierig waren auf ihre Vergangenheit, b) etwas von ihr wollten, oder c) beides. Freunde waren den Ärger einfach nicht wert. Hunde, besonders Rhapsody mit ihrer bedingungslosen Zuneigung, waren so viel besser als Menschen, von ihren Beziehungspartnern ganz zu schweigen. Die konnte man alle vergessen.
Es schneite jetzt stärker: kleine, pudrige Flocken, die den bisherigen zehn Zentimetern eine weitere fluffige Schicht hinzufügten. Rhapsody galoppierte von einem Ende des Gartens zum anderen, baute die aufgestaute Energie ab und hinterließ einen weiteren Trampelpfad in der weißen Decke. Der verschneite Rasen war lang und schmal und bot dem Hund genügend Platz, um sich auszutoben, doch er war umgeben von einem Zaun mit einem abschließbaren Tor und einer dichten, undurchdringlichen Hecke aus Thujen, Rhododendren und Lorbeer. Genügend Privatsphäre, um Kara von ihren Nachbarn abzuschotten. Was perfekt war. Jetzt waren Büsche und Sträucher voller Schnee und erinnerten Kara an die Fichten und Tannen rund um das Haus am Mount Hood und an jene grauenvolle Nacht, in der sie durch den Wald gerannt war, an die Nacht, die ihr Leben für immer verändert hatte …
»Schluss damit!«, sagte sie so laut, dass Rhapsody, die an der Hausecke im Schnee schnüffelte, abrupt aufblickte und die Ohren anlegte, bereit, einen potenziellen Eindringling zu verjagen. »Tut mir leid«, beruhigte Kara die Hündin. »Komm, lass uns reingehen. Es ist eiskalt hier draußen.«
Sie nahm einen weiteren großen Schluck Merlot und spürte, wie ihr langsam von innen heraus warm wurde. Rhapsody raste weiter durch den Schnee und wirbelte weiße Wolken auf. Wie herrlich, so sorglos zu sein, dachte Kara sehnsüchtig und blickte hinauf in den Himmel, weil sie das entfernte Brummen eines Flugzeugs hörte. Irgendwo über der dichten Wolkendecke schwebte ein Flieger voller Menschen, die irgendwohin flogen, einem unbekannten Ziel entgegen. Schneeflocken verfingen sich in ihren Wimpern, und Kara blinzelte. Die Flocken rieselten auf ihre Wangen.
Was hätte sie darum gegeben, einfach wegfliegen zu können.
Zu vergessen.
Sie hatte es bereits versucht, hatte vor einigen Jahren eine Europareise unternommen. Es hatte nichts genutzt. All die Exkursionen und Ausstellungen, die Schlösser, Kunstgalerien und Menschenmassen konnten sie nicht davon abhalten, in Gedanken immer wieder zum Cold Lake zurückzukehren. Eiffelturm, Louvre, Notre-Dame in Paris, Big Ben und Buckingham-Palast in London, die Schlösser am Rhein, eine Villa am Comer See, ein Zimmer über einer Bar in Belfast – mittlerweile war alles verschwommen, nur der Schmerz war geblieben, genau wie das Gefühl der Schuld. Sie dachte daran, wie oft sie umgezogen war: nach Portland mit Tante Faiza, ans Junior College in Kalifornien, ein kurzes Intermezzo in Denver, dann der Abschluss an der Louisiana State University in Baton Rouge, und trotzdem hatte sie die Erinnerungen nicht abschütteln können. Neue Freunde, neue Orte, Neuanfänge. Vergeblich.
Hatte sie wirklich geglaubt, sie könne vor der Vergangenheit davonlaufen?
Wie töricht.
Und wie ironisch, dass der einzige Job, den sie je hatte an Land ziehen können – eine Stelle als Aushilfslehrerin an einer Grundschule –, ausgerechnet hier, in Oregon war, weniger als eine Stunde von den Ufern des Cold Lake und dem Ferienhaus des Horrors entfernt. Ihr Leben hatte sich geschlossen wie ein Kreis, die perfekte Gelegenheit, »die Vergangenheit zu bewältigen«, sich »ihren Dämonen zu stellen«, wie man es ihr seit Jahren riet, doch was hatte ihr das gebracht? In ihr herrschte immer noch Chaos, und das würde vermutlich für den Rest ihres Lebens so bleiben.
Und was war mit dem Haus, in dem sie aufgewachsen war? Der Villa in Portland, die sie in weniger als zwei Wochen erben würde und die seit der Tragödie von Tante Faiza okkupiert wurde? Sie hatte vor dem Familiengericht behauptet, Kara brauche »Stabilität«, »ein vertrautes häusliches Umfeld«, »einen Ort, an dem sie verankert« wäre. Doch die Villa hoch oben in den West Hills war für sie alles andere als ein Zuhause, eher ein Ort, den sie mied. Nicht umsonst war sie bei dem ehemaligen Familienanwalt und Freund ihres Vaters und dessen zweiter Frau eingezogen. Sie wollte nicht dort wohnen, wo die Geister der Vergangenheit ansässig waren. Merritt Margrove hatte es irgendwie so drehen können, dass er sich das Sorgerecht mit Tante Faiza teilte – ob offiziell oder inoffiziell, hatte Kara nie ganz verstanden, und sie hatte auch nicht nachgefragt. Obwohl das blutige Massaker rund sechzig Meilen entfernt von der Villa mit dem atemberaubenden Blick über die Stadt stattgefunden hatte, konnte sich Kara dort nicht mehr heimisch fühlen. Nicht nach dem, was in der McIntyre-Hütte passiert war. Alles, was sie an die glücklichen Zeiten mit ihrer Familie erinnerte, bevor diese am Heiligabend vor zwanzig Jahren von einem Irren mit Skimaske ausgelöscht worden war, war so schmerzhaft, dass es ihr die Luft zum Atmen raubte.
»Ups«, sagte sie laut, als sie feststellte, dass sie ihr Weinglas bereits geleert hatte. Zeit für ein weiteres. Sie musste aufhören, in Selbstmitleid zu baden. Und wer behauptete, dass ihre frühe Kindheit tatsächlich nur glücklich gewesen war? Ihre Erinnerungen waren vernebelt, voller Löcher, ihre nostalgischen Gefühle beruhten auf Bruchstücken, vielleicht sogar Träumen, miteinander verwoben, aber immer noch löchrig. Im Augenblick wollte sie nicht an damals denken. »Jetzt komm, Rhap!«, rief sie die Hündin.
Sie ging ins Haus, und Rhapsody trottete hinter ihr her, dann blieb sie stehen und schüttelte sich Schnee und Wasser aus dem Fell. »Nur zu«, sagte Kara grinsend, »saubere Fußböden werden ohnehin überbewertet.« Sie schloss die Hintertür, legte Mantel und Schal ab und hängte beides an einen Garderobenhaken, dann zog sie ihre Stiefel aus und kickte sie neben den Schirmständer. »Abendessen?«, fragte sie und füllte den Hundenapf, bevor sie sich Wein nachschenkte.
Als Rhapsody gefressen hatte und ihr Glas leer war, ging sie nach oben ins Schlafzimmer und warf einen Blick auf die Uhr. Kurz nach sechs. »Das passt schon«, versicherte sie sich selbst, zog Jeans und Pulli aus und schlüpfte in ihren ausgebeulten Lieblingspyjama.
Ihr Blick fiel auf ihr Spiegelbild. Sie sah blass aus und erschöpft, der Flanellschlafanzug war mindestens eine Nummer zu groß, ihre Zähne vom Rotwein verfärbt.
»Jämmerlich«, sagte sie zu ihrem Konterfei. Die meisten Siebenundzwanzigjährigen würden sich um diese Uhrzeit für den Abend fertig machen, nur sie igelte sich ein. Eine Zeit lang hatte sie sich der Partyszene angeschlossen, in Clubs gefeiert, sich mit anderen jungen Leuten getroffen, doch nach dem College hatte sie das Interesse daran verloren. Was vermutlich einer der Gründe dafür war, dass ihre Beziehung mit Brad nicht funktioniert hatte. Einer von vielen.
Sie kehrte ins Erdgeschoss zurück, füllte ihr Glas ein weiteres Mal und ging hinüber ins Wohnzimmer. Vor dem Bücherregal neben dem Kamin blieb sie stehen und betrachtete das einzige Foto, das sie von ihnen beiden hatte. Sie standen in Florida vor einer Gruppe von Palmen und stießen mit Champagner an, während hinter ihnen die Sonne unterging. Das Glas des Bilderrahmens hatte einen Sprung, ein Zeugnis ihrer letzten Auseinandersetzung, aber Kara hielt es für angebracht, das Foto mitsamt gesprungenem Glas stehen zu lassen, selbst wenn es sie an das brechende Eis des Cold Lake vor all den Jahren erinnerte.
Denk nicht daran. Sie blendete die Erinnerung an die Ereignisse von damals aus.
Und die Erinnerung an Brad.
Auch er war Geschichte, wie man so schön sagte. Seufzend stellte sie den Gaskamin an, ließ sich aufs Sofa fallen und klopfte neben sich, damit Rhapsody ihr Gesellschaft leistete. Der Hund sprang hoch und machte es sich gemütlich. Wie ferngesteuert schaltete sie den Fernseher an, ein großer Flachbildschirm auf der anderen Seite des Kamins. Aus Gewohnheit zappte sie durch die Kanäle, warf einen Blick auf die Shopping-Sendungen, Kochshows, Heimwerker-Programme, blieb kurz bei Alligator-Jäger und Bares für Rares hängen, bis sie einen Nachrichtensender fand, auf dem wegen der bevorstehenden Entlassung von Jonas McIntyre über das Cold-Lake-Massaker berichtet wurde. »Grauenhaft«, murmelte sie und lauschte konzentriert, als ein Reporter die altbekannten Fakten aufzählte. Bilder von ihrer Familie und dem Ferienhaus in den Bergen flackerten über den Bildschirm. »Einfach grauenhaft.«
Die Fakten ließen sich kurz zusammenfassen. Vier Menschen waren ermordet worden: Samuel McIntyre und seine Ehefrau Zelda McIntyre, geborene Donner, geschiedene Robinson, sowie zwei von ihren Kindern, Samuel McIntyre jr. und Donner Robinson. Ebenfalls tot in der Nähe des Tatorts aufgefunden wurde Detective Edmund Tate, ein Polizist, der in einem der Nachbarhäuser Urlaub gemacht und Kara McIntyre, der jüngsten und einzigen gemeinsamen Tochter von Samuel und Zelda, das Leben gerettet hatte.
Nach wie vor vermisst wurde Marlie Robinson, Tochter von Zelda McIntyre und Zeldas erstem Ehemann Walter Robinson. Seit jener Nacht war Marlie wie vom Erdboden verschluckt.
Samuels zweiter Sohn Jonas, der die Attacke wie durch ein Wunder schwer verletzt überlebt hatte, war wegen des abscheulichen Verbrechens angeklagt und verurteilt worden. Nun hatte man das Urteil aufgrund neuer Informationen aufgehoben. Jonas sollte aus der Haft entlassen werden, nachdem er fast zwei Jahrzehnte, mehr als die Hälfte seines Lebens, hinter Gittern verbracht hatte. Jonas, teilte der Reporter den Zuschauern mit, hatte stets geschworen, dass er unschuldig war.
Nun rollte die Polizei den mittlerweile eiskalten Fall wieder auf.