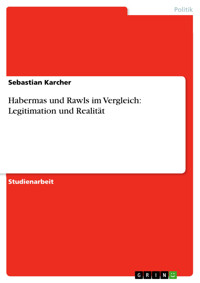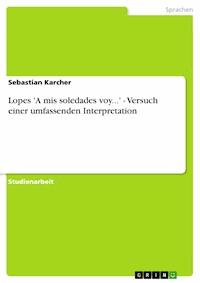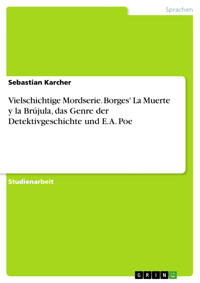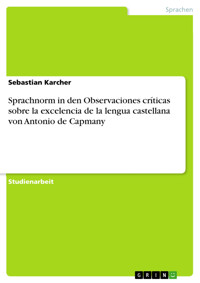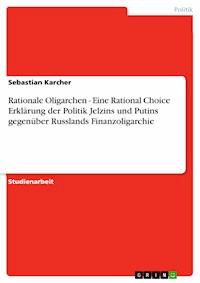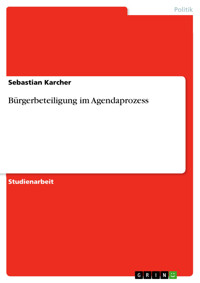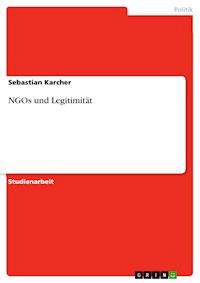
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Politik - Allgemeines und Theorien zur Internationalen Politik, Note: 1,0, Eberhard-Karls-Universität Tübingen (Institut für Politikwissenschaft), Veranstaltung: Ordnungsprobleme in der Weltpolitik, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit hat zwei große Teile, die den zwei entscheidenden Fragen der Untersuchung entsprechen. Das erste Kapitel behandelt die Frage „Legitimität wofür?“, das zweite Kapitel die Frage „Legitimität wodurch?“. Die im ersten Kapitel gestellte Frage nach den Handlungen, die einer Legitimierung bedürfen wird im journalistischen Bereich oft unterschlagen. Die meisten politikwissenschaftlichen Abhandlungen beschäftigen sich mit der Legitimität politischer Systeme (Lipset), oder Handlungen. Da es keiner Legitimierung für öffentliche Meinungsäußerungen und Proteste Bedarf, ist eine genaue Abgrenzung gerade für die Frage der Legitimität von NGOs von großer Wichtigkeit. Zunächst werden die Aussagen der drei behandelten Theorien vorgestellt. Den Forderungen der verschiedenen NGOs selbst sowie ihren Legitimierungsversuchen wird im Rahmen der Fallstudien besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Das zweite Kapitel geht in ähnlicher Weise vor. In einem ersten Schritt werden die Legitimitätskonzepte skizziert und dann auf die vier untersuchten Fälle übertragen. Auf diese Weise sollen die Konzepte möglichst analytisch verglichen werden. Eine empirische Überprüfung anhand aufzustellender Hypothesen ist jedoch aufgrund der Komplexität des Begriffes nicht möglich: Jede der vorgestellten Theorien verbindet sich auch mit einer unterschiedlichen Definition von Legitimität (aus diesem Grund findet sich auch keine Arbeitsdefinition in dieser Einleitung). Es fehlt so an einer einheitlichen Messlatte. Stattdessen wird versucht, die Erklärungsmöglichkeiten der Theorien im Bezug auf die Legitimierungsstrategien der INGOs und die Gründe für die Anerkennung von Legitimität durch andere Akteure zu vergleichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2006
Ähnliche
Page 1
Eberhard-Karls Universität Tübingen Seminar für Politikwissenschaft HS Weltordnungspolitik, SoSe 2002
Page 2
Einleitung
Nichtregierungsorganisationen (NGOs)1haben Hochkonjunktur. Kaum eine Konferenz, bei der sie nicht anwesend sind, kaum ein Problem, sei es global oder lokal, zu dem nicht ihre Meinung eingeholt wird. Die Aktionsformen von NGOs sind dabei sehr vielfältig. Sie reichen vom klassischen Lobbying bei Parteien, Organisationen und Konferenzen bis zu großangelegten Kampagnen, von Protestbriefen hin zu zivilem Ungehorsam. Inzwischen sind immer öfter Stimmen zu hören, die vor einem zu großen Einfluss der Organisationen warnen. In jüngster Vergangenheit wirkten vor allem zwei Ereignisse als Auslöser für solche Kritik: Die erfolgreiche Kampagne von Greenpeace gegen die Versenkung der ÖlplattformBrent Spar(1995) durch den Öl-Multi Shell sowie die (z.T. gewalttätigen) Proteste von Globalisierungskritikern auf Tagungen von WTO, IWF und Weltbank, EU oder G7/G8. Tenor der meisten dieser Artikel war die Behauptung, NGOs besäßen keine demokratische Legitimität. Otto Graf Lambs-dorff bezeichnet ihren Einfluss als „eine Form des Imperialismus in kleinen Schritten“ (Lambsdorff 2000). Im Rahmen der Brent Spar Affäre finden sich zahlreiche Artikel mit diesem Tenor in FAZ (z.B. 23.6.1995, 19.10.1995) und Zeit (z.B. 28.7.1995, 22.9.1995). In der politikwissenschaftlichen Debatte hat sich Legitimität als schwieriger Begriff erwiesen. In Deutschland gab es zu Beginn der 70ger Jahre eine rege Diskussion, die geprägt war von den großen Denkschulen normativ-ontologisch, kritisch-dialektisch und empirisch-analytisch. Auslöser dieser Debatte war Jürgen Habermas Text überLegitimationsprobleme im Spätkapitalismusgewesen. Mit der strengen Abgrenzung der Denkschulen gegeneinander ist auch die Diskussion um Legitimität weitgehend von der Agenda verschwunden. Nur zögerlich finden sich daher auch Beiträge zur Legitimität von NGOs in Politikwissenschaftlichen Publikationen, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Diese Arbeit soll der stattfindenden essayistisch-journalistischen Debatte eine theoretisch fundierte politikwissenschaftliche Analyse gegenüber- bzw. zur Seite stellen. Zwei Versuchen die Legitimität von NGOs zu diskutieren wird eine auf Jürgen Habermas’ Diskursethik gründende neue Betrachtungsweise gegenübergestellt. Christian von Haldenwang (1999) führt zur Bestimmung von Legitimationsnotwendigkeit den Begriff der „Regulierungsleistungen“ ein, der kollektiv bindende Entscheidungen als Legitimationsgegenstand ersetzen soll. Darauf baut er ein neues Legitimitätskonzept auf, das den gewandelten Anforderungen der Politik entsprechen soll. Boli (1999) lehnt sich in seinen Betrachtungen stark an Max Weber an, erweitert aber dessen Kategorien
1Unter NGOs sollen „nichtstaatliche, nicht gewinnorientierte Gruppen, die eine bestimmte, im öffentlichen Interesse liegende Zielsetzung verfolgen“ verstanden werden. (Schmidt/Take 1997: FN 2). Im folgenden wird oft von NGOs und INGOs, internationalen NGOs die Rede sein. Wo immer eine Aussage sowohl auf nationale als auch auf internationale Organisationen zutrifft, wird der erste Begriff verwendet, wo der internationale Charakter einer NGO von Bedeutung ist der zweite.