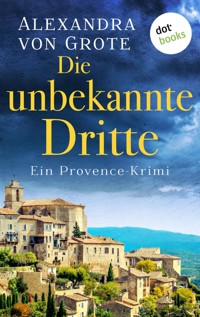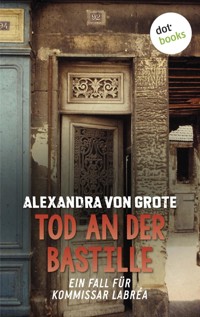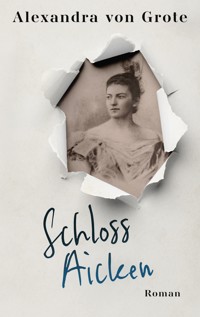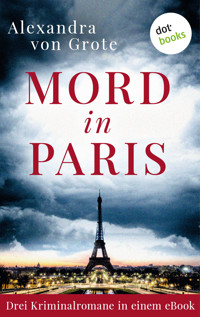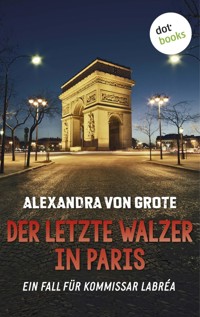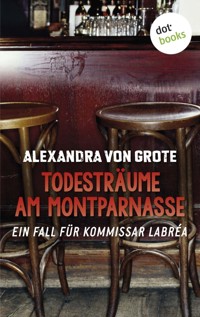Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Vergangenheit holt jeden ein … Wenn dunkle Erinnerungen erwachen: Der fesselnde Südfrankreich-Krimi »Nichts ist für die Ewigkeit« von Alexandra von Grote als eBook bei dotbooks. Wer die Vergangenheit kennen will, muss alles riskieren … Als in einer Höhle zwei verwitterte Skelette gefunden werden, scheint es nichts mehr zu geben, was sie identifizieren könnte – bis auf einen besonderen Siegelring. Sophie, die als jüngstes Mitglied der alteingesessenen Familie Perdillon gerade zum nahen Stammsitz zurückgekehrt ist, glaubt daher, dass einer der Toten ihr Vorfahre sein muss. Schnell zeigt sich aber, dass nie jemand vermisst wurde. Wie sind die Toten also in den Besitz des Schmuckstücks gekommen? Sophies Neugier ist geweckt. Doch je mehr Fragen sie stellt, umso deutlicher wird, dass es in ihrer Familie seit langem ein tödliches Geheimnis gibt – und je näher sie der Wahrheit kommt, desto mehr gerät auch sie in Gefahr … Jetzt als eBook kaufen und genießen: der packende Kriminalroman »Nichts ist für die Ewigkeit« von Bestsellerautorin Alexandra von Grote zeigt die Schattenseiten der Ardèche, einem der schönsten Gebiete im Süden Frankreichs – ein Lesevergnügen für die Fans von Pierre Martin und Sophie Bonnet. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Wer die Vergangenheit kennen will, muss alles riskieren … Als in einer Höhle zwei verwitterte Skelette gefunden werden, scheint es nichts mehr zu geben, was sie identifizieren könnte – bis auf einen besonderen Siegelring. Sophie, die als jüngstes Mitglied der alteingesessenen Familie Perdillon gerade zum nahen Stammsitz zurückgekehrt ist, glaubt daher, dass einer der Toten ihr Vorfahre sein muss. Schnell zeigt sich aber, dass nie jemand vermisst wurde. Wie sind die Toten also in den Besitz des Schmuckstücks gekommen? Sophies Neugier ist geweckt. Doch je mehr Fragen sie stellt, umso deutlicher wird, dass es in ihrer Familie seit langem ein tödliches Geheimnis gibt – und je näher sie der Wahrheit kommt, desto mehr gerät auch sie in Gefahr …
Über die Autorin:
Alexandra von Grote ging in Paris zur Schule und machte dort das französische Abitur. Sie studierte in München und Wien Theaterwissenschaften und promovierte zum Dr. phil.
Nach einer Tätigkeit als Fernsehspiel-Redakteurin im ZDF war sie Kulturreferentin in Berlin.
Seit vielen Jahren ist sie als Filmregisseurin tätig. Sie schrieb zahlreiche Drehbücher, Gedichte, Erzählungen und Romane. Ihre Romanreihe mit dem Pariser Kommissar LaBréa wurde von der ARD/Degeto und teamWorx Filmproduktion verfilmt.
Alexandra von Grote lebt in Berlin und Südfrankreich.
Mehr Informationen über Alexandra von Grote finden Sie auf ihrer Website: www.alexandra-vongrote.de/
Bei dotbooks erschienen bereits die Romane »Die Geschwindigkeit der Stille« und »Die Nacht von Lavara« sowie die Provence-Krimi-Reihe um Florence Labelle:
»Die unbekannte Dritte«
»Die Kälte des Herzens«
»Das Fest der Taube«
»Die Stille im 6. Stock«
Zudem veröffentlichte Alexandra von Grote bei dotbooks die Krimi-Reihe um Kommissar LaBréa:
»Mord in der Rue St. Lazare«
»Tod an der Bastille«
»Todesträume am Montparnasse«
»Der letzte Walzer in Paris«
»Der tote Junge aus der Seine«
»Der lange Schatten«
Die ersten drei Fälle von Kommissar LaBréa liegen auch als Sammelband unter dem Titel »Mord in Paris« vor.
***
eBook-Neuausgabe September 2014, November 2021
Copyright © der Originalausgabe 2006 Knaur Taschenbuch. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co. KG, München
Copyright © der Neuausgabe 2014, 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Stefano Termanini
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96655-870-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Nichts ist für die Ewigkeit« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Alexandra von Grote
Nichts ist für die Ewigkeit
Kriminalroman
dotbooks.
In Memoriam
Pierre Vincent Possiet de Roussier
Mein hugenottischer Urahn
Geboren 1677 im Vivarais
»Herr, bewahre uns vor dem, was ein Mensch aushalten kann.«
Altes russisches Gebet
Prolog
Gaspard faltete die Hände. Sie waren groß und voller Schwielen, die Nägel schmutzig und eingerissen.
»Herr, wir danken dir für diese Speise, an der du uns teilhaben lässt und die du gesegnet hast. Amen.«
»Amen.« Augustine hob ihr Haupt und legte die Hand auf den Kopf ihres Sohnes Baptiste. »Amen«, murmelte sie erneut und strich mit ihren Fingern über sein dunkles, lockiges Haar. Der Junge lächelte seine Mutter an. Die Pupillen seiner Augen glänzten wie schwarze Oliven.
Gaspard nahm den Schöpflöffel und gab die dampfende Suppe in die Teller. Das Licht der Kerze flackerte, und der Schatten seiner hünenhaften Gestalt tanzte auf der grob verputzten Wand. Von draußen ertönte ein Windstoß wie das Fauchen eines wilden Tieres, gleich darauf folgte der erste Donnerschlag. Durch die Ritzen der roh gezimmerten Tür waren zuckende Blitze zu sehen. Der Hund und die Katze, die einträchtig in der Nähe der Feuerstelle lagen, schreckten hoch. Gleich darauf prasselte der Regen auf das Dach der Hütte, als ob ein Sack feiner Kieselsteine auf die spiegelglatte Fläche eines zugefrorenen winterlichen Sees ausgeschüttet würde. Ein Luftzug fuhr durch den Kamin in die Glut des Feuers. Funken stoben durch den Raum und verglühten wie Sternschnuppen in einer Augustnacht.
Schweigend löffelten die Eheleute ihre Suppe. Gaspard betrachtete seine rechte Hand, um deren Daumen ein sauberer Verband gewickelt war. Am Morgen hatte er sich beim Hantieren mit der Fräse einen gehörigen Splitter hineingetrieben. Augustine hatte den Span herausgezogen, die Wunde ausgewaschen und eine Kräuterkompresse darauf gelegt.
Der kleine Baptiste hielt ein Stück Brot in den Händen, knetete es, riss ein Stück davon ab und steckte es in den Mund. Das Heulen des Windes wurde stärker. Das Gewitter stand genau über dem Tal. Die Donnerschläge hallten von den Steilwänden der Berge wider, ein nicht enden wollendes Echo. Gaspard legte den Löffel an den Tellerrand. Erneut faltete er die Hände. Seine Lippen bewegten sich im stummen Gebet, während Augustine langsam weiteraß und dem Pochen ihres Herzens lauschte.
Plötzlich erklang von draußen der Hufschlag von Pferden. Durch den peitschenden Regen und die immer häufiger aufeinander folgenden Donnerschläge waren gellende Männerstimmen zu hören. Befehle wurden geschrien, Waffen klirrten.
Augustine drehte ihren Kopf zur Tür, und Gaspard beendete sein stummes Gebet. In das Krachen der Donnerschläge mischte sich das Schreien einer Frau, das Aufheulen eines Kindes. Wiederum erklangen Befehle und erneut das Getrappel von Pferden.
Dann trat Stille ein. Eine unheimliche, trügerische Stille.
Gaspard stemmte seine großen Hände auf die Tischplatte, als wolle er sich erheben. Doch er blieb sitzen, und ein tiefer Seufzer entströmte seiner Brust.
»Heute wurden wir verschont«, sagte er mit seiner tiefen, rauen Stimme. »Der Herr hat uns beschützt. Doch wer weiß, wie es morgen sein wird? Dann schlagen die Dragoner des Königs uns die Tür ein, rauben das Wenige, was wir besitzen, und brennen die Hütte nieder. Und niemand wird uns helfen.«
Er schob seinen Teller beiseite und strich sich die Haare aus der Stirn. Schon seit geraumer Zeit reifte ein Plan in seinem Herzen. Durch die Ereignisse der letzten Wochen und Monate bekam er stetig Nahrung. Vor zwei Monden hatten die Schergen des Königs Pastor Grégoire Villiers vor den Augen der Gemeinde zu Tode geschleift. Aus den Bergen der Cévennen hörte man, dass die Aufständischen, die die Soldaten zu fassen bekamen, aufs Rad geflochten und zur Schau gestellt wurden. In den letzten vier Wochen waren die Dragoner in sechs Nachbardörfer eingefallen, die weiter im Norden lagen. Ihr heutiger Überfall hier im Dorf würde nur der Anfang dessen sein, was sie an Untaten im Namen des Königs in den Cévennen, im Vivarais und anderswo begingen.
»Wir gehen fort von hier, Frau«, sagte Gaspard zu Augustine. Sie ließ ihren Löffel sinken und nickte. Schon lange ahnte sie die Gedanken ihres Mannes, auch wenn er sich ihr nicht offenbart hatte.
»Gleich in der Morgendämmerung brechen wir auf«, fuhr Gaspard fort. »Ich habe gehört, dass der König von Preußen gute Handwerker sucht. Ich bin Zimmermann, wir könnten unser Glück dort versuchen. Hier haben wir keine Zukunft mehr.«
Augustine senkte die Augen. Vor wenigen Wochen hatte sie ihr neunzehntes Lebensjahr vollendet. Sie war in diesem Dorf geboren, genau wie Gaspard. Als Kind hatte sie zuerst die Ziegen gehütet und dann den Vater sowie die sieben jüngeren Geschwister versorgt, als die Mutter im neunten Kindbett dahingerafft wurde. Und nun sollte sie die Heimat verlassen? In die Fremde gehen, die wie eine unbekannte Landschaft mit all ihren möglichen Gefahren vor ihnen lag?
Gaspard nahm Pfeife und Tabaksbeutel. Sorgfältig stopfte er die Pfeife und achtete darauf, dass kein Krümelchen Tabak verloren ging.
»Sie werden uns unseren Glauben nehmen, unser Leben. Unseren Sohn werden sie in ein Kloster stecken, damit er in ihrem Glauben erzogen wird. Der Herr hat anderes mit uns vor. Und der Stimme des Herrn werden wir gehorchen.«
Gaspard stand auf, warf einen Scheit Holz ins Feuer und nahm einen Reisigzweig, um die Pfeife anzuzünden. Als sie brannte, legte er den Arm um die Schulter seiner Frau.
»Wir sind nicht die Ersten, die ihre Heimat verlassen müssen, Frau. Und wir werden auch nicht die Letzten sein.«
Wenig später packten sie ihre Habe zusammen, während der kleine Baptiste friedlich auf der großen Lagerstatt schlief, die die Familie sich teilte. Hund und Katze waren erwacht und verfolgten unruhig das Geschehen, als ahnten sie, dass sie zurückbleiben mussten.
Als die ersten Hähne krähten, brach Gaspard mit seiner Familie auf. Im Morgengrauen verließen sie das Dorf in der Gewissheit, dass es wohl ein Abschied für immer sein würde.
Es wurde eine lange, entbehrungsreiche und beschwerliche Wanderung, bis Gaspard mit Augustine und Baptiste die rettende Grenze zur Schweiz erreichte. Von dort aus ging es dann unter Gefahren und in mühseligen Tagesmärschen weiter, bis sie nach Preußen gelangten, in ein Städtchen namens Greifswald.
Man schrieb das Jahr 1702.
Teil I
Kapitel 1
Sein Gesicht brannte. »So«, zischte Amandine. »Wenn ich jetzt noch ein Widerwort höre, nehme ich den Ledergürtel deines Vaters.«
Die fünf Finger ihrer Hand hatten ein Muster auf seiner Wange hinterlassen. Olivier warf seiner Mutter einen schnellen Blick aus den Augenwinkeln zu und wollte sich wegstehlen.
»Wo willst du hin?«, Amandines Stimme klang plötzlich schrill und hoch, wie immer, wenn sie fahrig und nervös war und ihrem Zorn freien Lauf ließ. »Du bleibst hier! Ich hab dir schon heute Morgen gesagt, dass du den Schuppen aufräumen sollst. Dein Vater ist ja anscheinend nicht dazu in der Lage.« Sie schnaubte verächtlich.
Olivier öffnete die Küchentür und lief über den schmalen Flur. Wenig später sprang er die zwei Stufen hinunter, die von der Haustür über den Plattenweg zum Tor führten, das das Grundstück von der Straße trennte.
»Tito!«, rief Olivier und spähte zur Hundehütte, die neben dem Schuppen stand. Doch Tito war nirgendwo zu sehen.
Auch als er die sich überschlagende Stimme seiner Mutter vernahm, die hinter ihm herschrie, rannte Olivier weiter. Die Befehle und Verwünschungen, die sie ausstieß, vermischten sich mit dem Geschrei der Zikaden in dem Pinienwäldchen, das hinter dem Haus seiner Eltern begann.
Olivier drehte sich nicht um, als er nach wenigen Schritten die Straße erreichte. Doch er wusste, dass seine Mutter inzwischen mit erhobener Faust in der Haustür stand. Ihr Mund war, wie stets in solchen Situationen, zu einem schmalen Schlitz zusammengepresst. Wie die Münder der Strichmännchen, die Olivier früher in der Vorschule mit unbeholfener Hand gezeichnet hatte.
Er würde nicht zurückkommen. Er würde für immer fortgehen. Zuerst würde er sich verstecken und in Ruhe überlegen, wohin seine Flucht von zu Hause führen könnte. Niemand würde ihn vermissen und nach ihm suchen. Seine Eltern würden froh sein, wenn sie ihn endlich los waren.
Vor der Kurve drehte Olivier sich dann doch noch einmal um. Seine Mutter war nicht mehr zu sehen.
Das Haus seiner Eltern, ein unverputzter Flachbau mit roh gezimmerten und ungestrichenen Fensterläden, duckte sich vor den harten, rissigen Erdhügeln, die an der hinteren Seite des Grundstücks aufgeworfen worden waren, wo ursprünglich ein Garten angelegt werden sollte. Doch dazu war es nie gekommen.
Jetzt ertönte ein Bellen aus dem Pinienwäldchen. Olivier blieb stehen.
»Tito«, flüsterte er. »Da bist du ja endlich!«
Der Hund sprang freudig an ihm hoch und leckte ihm das Gesicht. Sein zotteliges Fell, das wie ein Vorhang über seine Augen fiel, hatte die Farbe von abgestandenem Milchkaffee. Olivier streichelte das Tier, klopfte ihm den Hals und murmelte ein paar Worte, die der Hund sofort verstand. Er lief einige Schritte voraus und blickte sich um, ob ihm der Junge auch folgte.
Na also, dachte Olivier. Dann bin ich wenigstens nicht allein, wenn ich das alles hier hinter mir lasse. Flüchtig erinnerte er sich an den Tag, als sein Vater mit ihm ins Tierheim gefahren war und Olivier sich einen Hund aussuchen durfte. Seine Wahl war auf Tito gefallen, auch wenn er nicht im Entferntesten einem Wachhund ähnelte. Denn seine Mutter hatte sich mit der Anschaffung eines Hundes nur einverstanden erklärt, wenn es ein typischer Wachhund wäre. Dieses eine Mal hatte sich Oliviers Vater gegen seine Frau durchgesetzt, und Tito durfte bleiben.
Es war Mittag. Die kurzen Schatten der Zypressen auf der gegenüberliegenden Straßenseite züngelten über den Asphalt. Schlangen raschelten im Straßengraben, aufgescheucht durch Oliviers Schritte und das Bellen des Hundes.
Zwei Löschflugzeuge flogen über das Tal. In den Fernsehnachrichten war gestern berichtet worden, dass sich die Waldbrände nördlich von Rochemanteau ausgeweitet hatten. Inzwischen bedrohte das Feuer bereits die kommunalen Wälder von Gésier, ein Wander- und Naturschutzgebiet. Schon den ganzen Vormittag waren die Flugzeuge zu einem dafür vorgesehenen Abschnitt der Rhône geflogen, um Wasser zu tanken und es bei ihrer Rückkehr über den Wäldern abzuwerfen. Ihr Motorenlärm schwoll an und nahm ab wie das Brummen einer riesigen Hornisse.
Auf dem Dorfplatz unter einer Platane am Brunnen saß der alte Elias Chavel auf einer Bank und war eingenickt. Aus seinem zahnlosen Mund rann weißer Speichel.
Laetitia, die junge Wirtin des Café Central, wischte die Tische auf dem Bürgersteig ab. Noch hatten sich keine Gäste eingefunden. Die meisten Leute kamen erst am Spätnachmittag oder abends ins Lokal, größtenteils Einheimische.
Im Haupthaus der Domaine Perdillon, dem ehemaligen Weingut und schönsten und größten Anwesen im Dorf, war unter der Pergola der Terrasse der Mittagstisch gedeckt. Im Vorbeigehen warf Olivier einen Blick durch die Gitterstäbe des hohen Eisentors. Madame de Perdillon, eine dunkelhaarige und elegant wirkende Frau, deren Vater aus Spanien stammte und ein Vermögen mit seinem Baugeschäft in Valence gemacht hatte, brachte ein Tablett mit Schüsseln und Platten. In dem Moment betraten auch Monsieur de Perdillon, Rechtsanwalt in Privas, sowie die 13-jährige Tochter Nelly die Terrasse. Nelly war mit Olivier in dieselbe Klasse der Grundschule gegangen. Jetzt besuchte sie das Gymnasium in der Stadt und hatte kaum noch Kontakt zu den ehemaligen Schulkameraden im Dorf.
Olivier beschleunigte seine Schritte. Er wollte möglichst nicht gesehen werden und nicht grüßen müssen. Wollte nicht das herablassende Lächeln von Madame de Perdillon wie eine mildtätige Gabe entgegennehmen. Er spürte einen Stich in seiner Brust, ein Gefühl von ungestillter Sehnsucht und brennendem Neid. Auch wenn Nelly klein und dick war und die Jungs im Dorf sich über sie lustig machten und Zoten rissen, hätte Olivier gern mit ihr getauscht. Was würde er darum geben, nicht der Sohn von Jean-Pierre LeDret zu sein, dem arbeitslosen Gelegenheitshandwerker, und einer Mutter, die tagaus, tagein in einer Kittelschürze herumlief und allen Familienmitgliedern das Leben zur Hölle machte! Und die jeden Mittwoch im Haus der reichen Familie de Perdillon putzen ging und damit die monatliche Sozialhilfe aufbesserte.
Schon lag das imposante Herrenhaus hinter ihm, und Olivier pfiff nach Tito, der durch ein Loch im Zaun in den verwilderten Garten des heruntergekommenen Chavel-Gehöfts auf der anderen Straßenseite geschlüpft war.
Am Ausgang des Dorfes bog Olivier mit dem Hund in einen Feldweg ein, der nach zwei Kilometern quer durch Wein-, Sonnenblumen- und Melonenfelder in die Schlucht führte, zur Feengrotte. Hier wollte er die erste Nacht verbringen. Niemand aus dem Dorf ging je dorthin. Die Alten erzählten, dass es dort schon immer gespukt habe. Doch Olivier hatte keine Angst vor Gespenstern.
Morgen würde er dann weiterziehen. Wohin, wusste er noch nicht. Doch er war sicher, bis zum nächsten Tag einen Plan zu haben, wie sich ein dreizehnjähriger Junge allein durchschlagen konnte.
***
Aus dem Schlafzimmer hinter der Küche erklang das Schreien des Kindes. Amandine LeDret, geborene Monico, legte das Spültuch beiseite und wischte sich die Hände an der Kittelschürze ab. Sie strich sich eine Strähne ihrer stumpfen Haare zurück, deren belangloser Blondton sich nur wenig von der teigigen Farbe ihres Gesichtes unterschied. Sie ging ins Nebenzimmer, nahm die kleine Cloë aus dem Bettchen und wiegte sie sanft hin und her. Sofort hörte das Kind auf zu schreien und lachte seine Mutter mit seinem breiten Gesicht an. Amandine presste die Kleine an ihre Brust, stieß einige beruhigende Laute aus und ging im Zimmer auf und ab. Nachdem sie Cloë ins Bett zurückgelegt hatte, klingelte das Telefon. Amandine eilte in den Flur, wo der Apparat stand, und nahm den Hörer ab. Eine junge Frau fragte mit süßlicher Stimme, welches Kühlschrankmodell die Familie besäße, und ob sie nicht … Es war erneut einer dieser Werbeanrufe. Amandine ließ sie gar nicht erst ausreden.
»Danke, wir brauchen nichts«, sagte sie schroff und legte den Hörer auf
Als sie in der Küche den Rest des Mittagsgeschirrs abspülte, fiel ihr Blick hinaus auf die verkrusteten Erdhügel, wo ursprünglich einmal ein Garten hatte angelegt werden sollen. Um diese Jahreszeit waren sie übersät mit Unkraut, Disteln und wilden Gräsern. Schmetterlinge flatterten umher, Bienen und Hummeln suchten dort vergeblich nach Nahrung.
Hinter den Erdhügeln standen die Autowracks. Amandines Mann Jean-Pierre hatte sie im Lauf der Jahre aufs Grundstück geschafft. Unfallwagen, ausrangierte und defekte Modelle. Stück für Stück hatte Jean-Pierre begonnen, sie auszuschlachten. Bei fast allen fehlten die Reifen, die er für einen geringen Betrag verscherbeln konnte. Das kleinste Modell war ein sandfarbener R4 aus dem Jahr 1972, das größte ein uralter Citroen-Wellblech-Lieferwagen, dessen bleifarbener Lack im Wechsel der Jahreszeiten stumpf geworden war.
Die Karosserien rosteten auf dem Grundstück vor sich hin. Bis in alle Ewigkeit würden die Wracks immer mehr in die Erde hineinwachsen. Bizarre Skulpturen, die alle überdauern würden, die dieses halbfertige und im Eigenbau zusammengeschusterte Haus je bewohnten.
Amandine schenkte sich einen Kaffee ein, den sie am späten Vormittag aufgebrüht und in eine Thermoskanne abgefüllt hatte, und ließ sich auf einen der Küchenstühle fallen. Die Hitze schnürte ihr den Atem ab, feine Schweißbäche rannen über ihren Rücken. Draußen flimmerte das Mittagslicht und ließ die Konturen der Zypressen auf der anderen Straßenseite verschwimmen.
Wo mochte Olivier, dieser verdammte Bengel, wieder hingerannt sein? Im letzten Winter war er einmal für drei Tage verschwunden. Als er zurückkam, hatte er zuerst von ihr, dann von seinem Vater eine Tracht Prügel mit dem Ledergürtel bezogen. Viel genützt zu haben schien es nicht. Der Junge war aufsässig, eigenbrötlerisch, faul und ein schlechter Schüler. Wenn sie Oliviers hochaufgeschossene Gestalt mit den dünnen Beinen in den viel zu weiten Bermudashorts und seine struppigen schwarzen Haare sah, seine Schritte hörte, seine heisere Stimme, die kurz vor dem Stimmbruch stand, empfand Amandine bestenfalls ein Gefühl der Gleichgültigkeit. Sie mochte ihren Sohn nicht. Von Anfang an hatte sie ihn abgelehnt, schon in den ersten Wochen der Schwangerschaft. Olivier war kein Kind der Liebe gewesen, sondern das Produkt eines schnellen, unschönen Augenblicks. Amandine hatte zu viel Sangria getrunken in jener Nacht, als Jean-Pierre sie von der Fête Votive nach Hause gebracht und im Schutz der Dunkelheit in den Straßengraben gezogen hatte, wo es dann passiert war. Am Ende des dritten Schwangerschaftsmonats heirateten sie. Amandine wollte das Kind nicht, und sie wollte auch Jean-Pierre nicht, dessen Hasenscharte sie abstieß. Nach einer ersten Operation in Jean-Pierres Kindheit fehlte für weitere Verschönerungen seines Gesichtes später das Geld. Geblieben war ein Ausdruck von Verschlagenheit, der allerdings – das musste Amandine einräumen – Jean-Pierres Charakter nicht gerecht wurde.
Als dann der Zeitpunkt für eine Abtreibung verpasst war, beugte sich Amandine dem Machtwort ihrer Mutter, die in einer eilig geschlossenen Ehe die einzige Chance für ihre Tochter sah.
Im Februar war sie 34 Jahre alt geworden. Ihr gefühltes Alter war weit höher. Die Zeit, bevor Jean-Pierre und der ungeliebte Sohn in ihr Leben traten, schien weit zurückzuliegen. Manchmal tropften Bruchstücke von Erinnerungen durch Amandines Gedankenwelt. Bilder von früher tauchten auf, mit düsteren Szenen wie aus einem Schauermärchen: die Mutter, die Amandine und ihren jüngeren Bruder oft mit Essensentzug und stundenlangem Stehen in der Küchenecke strafte; der Vater, der jeden Abend betrunken aus dem Café Central nach Hause kam und sich mit der Schrotflinte erschoss, als Amandine zehn Jahre alt war. Sie hatte ihn damals gefunden. Es war der letzte Schultag vor den Sommerferien. Die Hitze brütete über dem Land, und eine seltsame Schwere lag in der Luft, die auf Amandines kleine Schultern drückte. In einer Art Vorahnung, dass etwas Ungewöhnliches geschehen war, verlangsamte sie ihre Schritte auf dem Nachhauseweg. Als sie dann die Küchentür öffnete, lag der Vater neben dem rechteckigen Bauerntisch, von der Wucht des Schusses zu Boden gestreckt. Bis an die Wand über der Spüle war die Gehirnmasse gespritzt. Der Zeigefinger der rechten Hand, seltsam verzerrt, steckte noch in der Vorrichtung, die er sich gebastelt hatte, um den Abzug des Gewehrs betätigen zu können, als er sich in die Schläfe schoss.
Amandines Mutter hatte an diesem Tag in Privas Einkäufe getätigt. Sie war kurz darauf zurückgekehrt und alarmierte sofort Opa Mimo, ihren Schwiegervater. Als der Doktor und die Polizei ins Haus kamen, schnappte Amandine einige Wortfetzen der Erwachsenen auf. Ihr Vater hatte eine Art Abschiedsbrief hinterlassen, hieß es. Einen Zettel, der, halb unter eine leere Kaffeetasse geschoben, auf dem Küchentisch gefunden wurde. Darin hatte er wohl seine Motive für die Tat erklären wollen.
Bis heute jedoch wusste Amandine nicht, warum ihr Vater auf diese Weise aus dem Leben geschieden war. Opa Mimo, der Vater des durch eigene Hand Getöteten und Amandines Großvater, hatte den Zettel nicht einmal seiner Schwiegertochter gezeigt. Notgedrungen musste er die Gendarmen vom Inhalt des Abschiedsbriefes in Kenntnis setzen, damit jede Art von Fremdverschulden am Tod seines Sohnes ausgeschlossen werden konnte. Die Gendarmen hatten, laut späterer Aussage von Amandines Mutter, nach der Lektüre der Abschiedszeilen nur den Kopf geschüttelt und keinen weiteren Kommentar abgegeben. Danach war der Zettel auf unerklärliche Weise verschwunden und nie wieder aufgetaucht.
Wenig später zog Opa Mimo dann zu Amandine, ihrem kleinen Bruder und ihrer Mutter. Bis dahin lebte er allein auf seinem kleinen Hof am anderen Ende des Dorfes. Seine Frau war zwei Jahre zuvor nach langer Krankheit gestorben, und so nahm er den Tod seines Sohnes zum Anlass, seine Lebenssituation zu verändern. Er verkaufte sein kleines unscheinbares Gehöft aus Natursteinen an eine belgische Professoren-Familie. Diese baute das Wohnhaus und die beiden Scheunen in den darauf folgenden Jahren zu einem stattlichen Zweitwohnsitz aus und verbrachte seitdem jedes Jahr die Sommer-, Oster- und Weihnachtsferien in Rochemanteau.
Auf der Straße waren Schritte zu hören. Amandine stand auf und blickte durchs Küchenfenster. Zwei Wanderer gingen über den Asphalt, ein junger Mann und eine junge Frau. Der Mann hielt eine aufgeschlagene Landkarte in der Hand. Trotz der großen, voll gepackten Rucksäcke und trotz der unerträglichen Hitze sahen die beiden keineswegs erschöpft und verschwitzt aus. Als sie Amandine am offenen Küchenfenster stehen sahen, winkten sie ihr zu und grüßten freundlich. Amandine reagierte mit einem angedeuteten Lächeln, das sie sofort zurücknahm, und starrte ihnen nach.
Die beiden sahen aus, als wären sie glücklich. Ja, das Lächeln auf den Gesichtern, der dargebotene Gruß, der feste, nach vorn drängende Schritt in der gleißenden Sonne – das alles zeugte von Freiheit und Abenteuer, von Liebe und Glück, vom unbändigen Brausen des Lebens, das an Amandine vorbeigezogen war wie ein fernes Gewitter, dessen Kühle und Erfrischung man vergeblich herbeigesehnt hat.
Die Schritte der Wanderer hatten sich längst entfernt, als Amandine immer noch am geöffneten Fenster stand und plötzlich spürte, dass ihre Augen feucht geworden waren.
Mit dem Handrücken wischte sie die Tränen fort, ging zum Küchentisch und trank den letzten Rest des inzwischen erkalteten Kaffees. Erneut dachte sie an ihren Sohn, der vor zehn Minuten einfach weggerannt war, ohne auf ihr Rufen zu reagieren. Bei dem Gedanken, wie sie ihn strafen würde, wurde ihr mit einem Mal wieder leichter ums Herz.
Aus dem Wohnzimmer ertönte die nuschelige Stimme von Opa Mimo, der eigentlich Gaston hieß. Was er sagte, konnte Amandine nicht verstehen. Abgesehen davon interessierte es sie auch nicht.
Jeden Tag wacht der Alte früher aus seinem Mittagsschlaf auf, dachte sie und warf einen Blick auf die Küchenuhr. Er würde sie wieder beschäftigen und herumkommandieren, wie jeden Nachmittag. Als Erstes verlangte er nach seinem Kaffee, gleich darauf verspürte er Appetit auf Kekse. Er beklagte sich über die Hitze (im Winter über die Kälte und den Mistral) und forderte jede Stunde einen Eisbeutel, den er auf seine Schläfen legte, damit die Adern abschwellen konnten. Wie ein roter Faden durchzog Opa Mimos Anwesenheit Amandines Kinder-, Jugend- und Erwachsenenjahre. Er gehörte zu ihrem Leben wie der ungeliebte Sohn, das hasenschartige Gesicht ihres Ehemannes, das stickige, unfertige Haus, die Autowracks hinter den Erdhügeln und das nicht vorhandene Glück, auf das zu warten Amandine längst aufgegeben hatte.
Kapitel 2
Die Zeit fraß sich durch den Tag, bedächtig, wie eine schwache Flamme sich durch feuchtes Zeitungspapier kämpft.
Am Stand der Sonne konnte Olivier erkennen, wie viel Uhr es war. Aufgrund der Länge der Schatten, die die Steineichen auf die Oberkante der Schlucht warfen, vermutete er, dass es bereits kurz nach fünf sein musste.
Den ganzen Nachmittag über hatte er auf dem Felsplateau vor dem Eingang der Feengrotte gesessen und sich seinen Gedanken hingegeben, die ziellos kamen und gingen. Zwanzig Meter unter ihm, hinter dichtem Gestrüpp und Geröllhängen, lag das Flussbett. Jetzt im Sommer war es ausgetrocknet. An den Felswänden, die den Fluss zur Nordseite hin abgrenzten, konnte man die Spuren der verschiedenen Wasserstände ablesen. Im Herbst, Winter und Frühjahr strömte das Wasser im Fluss wie ein reißender Strom. Dann wurden Teile des Felsenpfades, der zur Feengrotte führte, oft sogar unterspült.
Tito lag mit ausgestreckten Pfoten neben ihm auf dem Felsen. Seine Zunge hing hechelnd aus dem Maul, sicher hatte er Durst. Oliviers Hand ruhte auf Titos Hals, dessen Fell sich warm und vertraut anfühlte.
Mit einem Mal verspürte Olivier ein nagendes Hungergefühl in seinem Magen. Er kramte sein Taschenmesser aus der Hosentasche und schnitt die Melone auf, die er sich auf dem Weg hierher von einem der Felder besorgt hatte. Das Fleisch, orangengelb wie die Farbe der Sonne in alten Kinderbilderbüchern, schmeckte süß und saftig. Die Schalen schleuderte Olivier in weitem Bogen in Richtung des ausgedörrten Flussbettes. Sie verfingen sich in den Zweigen des Unterholzes.
In etwa vierhundert Metern Entfernung, in westlicher Richtung, glitzerte das Spätnachmittagslicht auf den Dachziegeln der ehemaligen Mühle, als hielte jemand einen Spiegel in die Sonne.
Die Mühle lag am Fluss, und wer zur Feengrotte wollte, musste dort vorbei. Im letzten September, während der großen Unwetter, war der Fluss in wenigen Stunden bedrohlich angestiegen, und die Fluten hatten die Mühle völlig unter Wasser gesetzt. In der lehmigen Brühe, die tagelang in den Räumen stand, schwammen die losgelösten Kacheln der Fußböden sowie sämtliche Möbelstücke. Nach starken Gewittern und Regenfällen stand die Mühle in den letzten Jahren regelmäßig unter Wasser. Doch das hatte die Familie Tessier, die das Haus schon seit Generationen bewohnte und im letzten Jahr bei der Septemberflut die ganze Nacht bis zu ihrer Rettung durch die Feuerwehr auf der Dachterrasse ausharren musste, nicht vertreiben können.
Plötzlich sprang Tito auf, um einer Eidechse nachzujagen, die über das Geröllfeld unterhalb der Grotte huschte.
»Tito, bleib hier!«, rief Olivier. Der Hund hörte nicht auf ihn. Er raste den Abhang hinunter, nur wenige Meter trennten ihn von der Stelle, wo die Eidechse in eine, Felsspalte geschlüpft war. Jetzt kam Tito ins Rutschen. Olivier beugte sich nach vorn, konnte den Hund jedoch nicht mehr sehen. Ein Teil des Abhangs war in sich zusammengesunken und hatte einer quadratmetergroßen Öffnung Platz gemacht. Aus der Tiefe dieses schwarzen Lochs, zweifellos eine versteckte Höhle unterhalb der Feengrotte, erklang ein jämmerliches Jaulen.
»Oh, mein Gott!«, sagte Olivier und rief erneut nach seinem Hund.
»Tito! Verdammt noch mal, was machst du denn für Sachen? Warte, ich hol dich da raus.«
Vom Felsplateau aus spähte er nach unten. Unmöglich, über den weggesackten Teil des Abhangs in die Höhle zu gelangen. Er musste versuchen, vom Haupteingang her vorzudringen. Olivier zog ein Feuerzeug aus der Tasche, das er stets bei sich trug, da er hin und wieder heimlich eine Zigarette rauchte. Ob die Flamme ausreichen würde, ihm in der Finsternis den Weg zu weisen, wusste er nicht.
Er warf Tito noch einige beruhigende Worte zu, erhob sich vom Felsvorsprung und betrat die Höhle. Dunkelheit und Kälte umfingen ihn. Es roch nach Erde und Kalkgestein. Im spärlichen Licht der Feuerzeugflamme wirkten die verwitterten Tropfsteingebilde an der rechten Seite größer, als sie waren. Lautes Flattern und schrille Laute ließen Olivier zusammenzucken. Eine Schar Fledermäuse, die sich an der rauen Kalkdecke festgekrallt hatte, war erwacht. Die Tiere durchquerten mit ohrenbetäubendem Kreischen die Höhle, einige strömten hinaus.
Nach etwa zehn Metern verengte sich der Durchgang. Ein großer Felsbrocken versperrte den Weg. Unmöglich für Olivier, ihn beiseite zu wälzen. An der Seite, hinter verwitterten Gesteinsbrocken, gab es jedoch einen Spalt. Dahinter befand sich offenbar eine zweite Kammer. Mit viel Mühe zwängte Olivier seinen schmalen Körper hindurch. Unmittelbar dahinter gähnte ein dunkles Loch. Er konnte nicht erkennen, wie weit es hier in die Tiefe ging. Vorsichtig spähte er nach unten und entdeckte eine alte Holzleiter.
»Tito?!«, rief Olivier und lauschte. Das Echo seiner Stimme hallte aus der Tiefe wider. Jetzt hörte er den Hund, doch das Jaulen war in ein bedrohliches Knurren übergegangen. Es klang dumpf und wie von weit her. Irgendwo unterhalb dieses dunklen Lochs musste Tito liegen. Hoffentlich war er nicht verletzt. Olivier steckte das Feuerzeug ein, tastete nach der Leiter und stieg vorsichtig hinunter. Er rechnete damit, dass die Sprossen morsch waren und brechen konnten. Doch er kam wohlbehalten unten an.
Von hier aus musste es einen Zugang zu dem Teil der Höhle geben, in den Tito gestürzt war. Olivier knipste das Feuerzeug an. Die Flamme flackerte und erlosch mehrere Male, ehe er sie mit der hohlen Hand schützte.
Mit tastenden Schritten ging Olivier in die Dunkelheit. Er erkannte weitere Tropfsteinformationen und sah tellergroße Spinnennetze an den Wänden.
Plötzlich berührten seine Füße einen anderen Untergrund als den felsigen Kalkboden. Als Olivier sich bückte, entdeckte er eine hölzerne Falltür, groß genug, dass ein erwachsener Mensch bequem hindurchkriechen konnte. Olivier entfernte den darauf liegenden Staub und kleinere Gesteinsbrocken. Dann stieß er mit der Hand an einen eisernen Riegel, mit dem die Klappe verschlossen war. Er zog ihn zurück, es ging leichter, als er dachte. Er stemmte die Falltür nach oben und sah, dass in das Gewölbe darunter Tageslicht hineinfiel. Der Hund hatte aufgehört zu knurren, Olivier konnte hören, wie er hechelte.
»Gleich hol ich dich raus, Tito«, sagte der Junge und spähte durch die Falltür. Erneut führte eine morsche Holzleiter in die Tiefe.
Hastig stieg Olivier hinunter. Tito schien gesund und munter zu sein. Doch er begrüßte sein Herrchen nicht, sondern lief bellend in den hinteren Teil der Höhle, die völlig im Dunkeln lag. Nach einem kurzen Zögern folgte der Junge ihm und knipste erneut das Feuerzeug an.
Dann blieb er wie angewurzelt stehen und schlug die Hand vor den Mund. Mit schnellem Griff packte er Tito, nahm ihn auf den Arm und ging zu der Öffnung, die auf den Abhang führte. Er sah, dass er von hier aus nicht hinauskonnte.
Ohne sich noch einmal umzudrehen, hastete er zur Leiter, dann durch die beiden Kammern der Grotte ins Freie und rannte über den kleinen Felsenpfad zur Mühle.
***
Nach einer längeren Rast in der einzigen Kneipe des Dorfes Rochemanteau, dem Café Central, hatten die beiden jungen Rucksacktouristen ihre Wanderung fortgesetzt und erreichten gegen achtzehn Uhr die Mühle. Der Mann nahm seine Wasserflasche, die außen am Rucksack hing, trank einen tiefen Schluck und reichte die Flasche seiner Begleiterin. Diese strich sich die Haare aus der Stirn und atmete tief durch.
»Wenn wir dem Felspfad folgen, müssten wir auf direktem Weg in die Höhle gelangen.« Der junge Mann warf einen Blick auf seine Karte und wies mit der Hand nach vorn. »Weiter nördlich liegt dann das Hochplateau.«
»Falls der Fluss dort genauso ausgetrocknet ist wie hier, gibt es da kein Wasser«, antwortete seine Freundin und runzelte die Stirn. »Nicht gerade ein idealer Platz zum Zelten.«
»Dann gehen wir eben zurück. Nach der Karte ist es nicht weiter als eine Stunde Fußweg. Wenn wir direkt durchs Flussbett gehen, wahrscheinlich noch kürzer.«
Er drehte sich um zum Eingang der Mühle, deren Fensterläden geöffnet waren. »Hier wohnen doch Leute! Fragen wir einfach mal nach.« Energisch klopfte er an die Haustür und wartete. Nachdem sich niemand blicken ließ und er erneut geklopft hatte, zuckte er resigniert mit den Schultern. »Anscheinend niemand zu Hause.«
In dem Moment sahen sie, wie ein halbwüchsiger Junge mit flatternden Bermudashorts, gefolgt von einem aufgeregt bellenden Hund, den Weg entlanggelaufen kam. Als er die Wanderer erreichte, blieb der Junge stehen und japste nach Luft.
»Dort hinten, in der Feengrotte!« Atemlos hielt er inne. Dann fuhr er fort:
»Totenköpfe. Da sind zwei Totenköpfe in der Höhle!«
Wenig später hatten die beiden Wanderer das Wesentliche in Erfahrung gebracht. Nachdem sie bei der Schilderung des Jungen zuerst ungläubig gelächelt hatten, waren sie nun unsicher geworden, ob seine Schilderung nicht doch der Wahrheit entsprach.
»Vielleicht sollten wir die Polizei alarmieren«, meinte die junge Frau.
»Zeig uns doch mal, wo du die Totenköpfe gefunden hast«, sagte der junge Mann und lächelte Olivier aufmunternd zu. Doch der schüttelte den Kopf und streichelte rasch seinen Hund. Um nichts in der Welt würde er noch einmal in die Feengrotte zurückgehen.
»Das ist keine gute Idee, da jetzt allein nachzusehen, Serge.« Die junge Frau zog ihr Handy aus einer der Seitentaschen ihres Rucksackes. »Wie ich schon sagte: Am besten rufen wir die Polizei.«
Entschlossen wählte sie die Notrufnummer.
***
Yvonne Tessier döste in ihrem Rollstuhl vor sich hin. Doch auch in ihrem Halbschlaf registrierte sie, dass sie sich noch immer in der Mühle befand und dass der Nachmittag sich dem Ende zuneigte. Jeden Moment musste ihre Tochter Geraldine zurückkommen. Wieso war sie nicht schon längst hier? Von irgendwoher erklang eine Lautsprecherstimme. Im Radio brachten sie Nachrichten und kündigten für die Nacht schwere Gewitter an. Dann ist es ja gut, dass die Fensterläden geschlossen sind, dachte Yvonne. Dann sollte Geraldine, wenn sie gleich nach Hause kam, sie gar nicht erst öffnen …
Jäh fuhr die alte Frau aus ihrem Nickerchen auf. War da nicht ein Klopfen an der Haustür? Das musste Geraldine sein! Sie war nach Rochemanteau auf die Post gefahren, um Geld abzuheben. Yvonne fragte sich erstaunt, warum ihre Tochter nicht ihren Haustürschlüssel benutzte?
Erneut ein heftiges Klopfen.
Yvonne beugte sich vor, griff mit ihren dürren, gichtgeplagten Fingern an die Räder ihres Rollstuhls und rollte vorsichtig zum Fenster. Sie spähte hinaus und erblickte zwei junge Leute mit Rucksäcken. Der Mann hielt eine Landkarte in der Hand.
Was wollten die? Um diese Tageszeit kamen Wanderer und Touristen nur selten hier vorbei. Yvonne warf einen Blick auf die große Uhr, die in der Mitte der Wohnzimmerwand hing, direkt über der Anrichte. Doch François, ihr Schwiegersohn, hatte die Uhr immer noch nicht wieder in Gang gebracht. Bei dem großen Unwetter im letzten September war sie abends auf fünf Minuten vor zehn stehen geblieben, dem Zeitpunkt, als das Wasser in Minutenschnelle einen Pegel von einem Meter fünfzig im ganzen Haus erreichte. Die Uhr war zwar nicht überspült worden, doch bedingt durch die Feuchtigkeit (oder höhere Gewalt, ein Zeichen Gottes vielleicht?) hatte sie einfach ihren Geist aufgegeben.
Yvonne schüttelte den Kopf. Sie schätzte, dass es ungefähr achtzehn Uhr sein mochte.
Erneut blickte sie nach draußen. Links vom Haus ging es zur Schlucht und zum Fluss, dessen Wasser in den Sommermonaten zuerst zu einem schmutzig braunen Rinnsal zusammenschrumpfte, um danach gänzlich zu versiegen. Dann verendeten auch die letzten Fische, die es bis dahin geschafft hatten. Plötzlich sah Yvonne von dort aus eine Gestalt auf die Mühle zulaufen. Als diese näher kam, erkannte sie den Sohn von Amandine LeDret. Er rannte auf das Haus zu, wobei er von einem Hund überholt wurde. Dann blieb er keuchend stehen und rief den beiden jungen Leuten ein paar Worte zu, gestikulierte aufgeregt mit den Armen und deutete Richtung Schlucht.
Yvonne lehnte sich im Rollstuhl zurück und fuhr einige Meter in die Tiefe des Raumes. Sie strich sich mit der Hand, auf der die Adern blau, wie feine Kordeln, hervortraten, durch den spärlichen Flaum ihrer schlohweißen Haare.
Für einen Moment schloss sie die Augen, die durch den Schleier des Alters eine undefinierbare Farbe angenommen hatten. Eine Erinnerung drängte sich in ihre Gedanken, so zwingend, als wäre es gestern gewesen. Sie sah ihren Mann Philippe, wie er den Weg von der Schlucht zur Mühle gelaufen kam. Am Fluss und in den Wäldern hinter dem Hochplateau lag sein Jagdrevier. Es gab Hasen, Dachse und Wildschweine. Damals, als sie beide noch jung waren, kannte man keine Überschwemmungen im September. Allenfalls stieg das Wasser im Fluss Ende Oktober, Anfang November geringfügig und für kurze Zeit über die Ufer und drang einige Zentimeter über die Schwelle der Haustür. Das war normal, daran war man in der Mühle gewöhnt.
Yvonne lächelte, als ihre Gedanken zurückschweiften. Philippe mit dem wettergegerbten Gesicht, den vollen, glatten, dunkelbraunen Haaren unter der Ballonmütze. Er läuft den Pfad entlang, der von der Schlucht zur Mühle führt. Er trägt ein rotes Halstuch und hält seinen dicken Eichenstock in der Hand. Nein, nicht seinen Eichenstock, sondern seine Flinte, und sie hängt über seiner Schulter. Oder war es doch der Eichenstock? Sein großes Jagdmesser hat er auch umgegürtet. Er ist nicht allein, als er in der Mühle ankommt, an diesem heißen Sommerabend. Er hat einen Hund bei sich. Philippe trägt ihn auf seinen Armen. Der Hund ist tot.
Verwirrt öffnete Yvonne ihre Augen. Dunkel erinnerte sie sich, dass sein Fell blutgetränkt und Philippes Kleidung besudelt war. Von einem Schuss? Plötzlich war Yvonne sich ganz sicher. Ja, von einem versehentlich abgefeuerten Schuss! So hatte es Philippe ihr damals erklärt. Doch das Tier hatte eher so ausgesehen, als wäre es mit dem Messer abgeschlachtet worden …
Erneut steuerte Yvonne ihren Rollstuhl näher ans Fenster und sah nach draußen. Der LeDret-Junge streichelte seine zottelige Promenadenmischung. Die junge Frau hatte ihr Mobiltelefon in der Hand und wählte eine Nummer. An die Tür klopfte niemand mehr.
Yvonne strich sich über den faltigen Hals. Heutzutage wusste man nie, welche Absichten die Menschen haben mochten. Die Mühle lag weit außerhalb des Dorfes. Niemand in der Familie Tessier öffnete Fremden je die Tür. Das war ein eisernes Gesetz in der Mühle, und deshalb hatte es bis jetzt auch nie eine böse Überraschung gegeben.
Yvonne zog die Schultern hoch und schlang ihre mageren Arme darum, beinahe so, als wäre ihr kalt.
Ja, sie fröstelte ein wenig. Es war feucht in den Räumen, und der Geruch von durchnässtem Mauerwerk und modrigem Holz hatte sich im Haus eingenistet. Er ähnelte dem Geruch des Alters und dem des Todes.
Damals, als Philippe mit diesem toten Hund nach Hause kam, war der Krieg gerade vorbei. Das Land hatte sich befreit, die Deutschen waren abgezogen. Mit den Kollaborateuren, die es, wie allerorten, auch hier gegeben hatte, machte man kurzen Prozess. Die Männer, die in Arbeitslager nach Deutschland verschleppt worden waren, kamen zurück. In Rochemanteau spürte jeder die Aufbruchstimmung, den Beginn einer neuen Zeit. Es roch nach Sommer und abgeernteten Feldern, nach unbeschwerter Liebe, nach der Süße und Unendlichkeit des Lebens, das noch vor ihnen lag.
Kapitel 3
Sophie de Perdillon hatte sich im Bad frisch gemacht und ging in Slip und Büstenhalter zurück in ihr Zimmer. Der Raum war hellgelb getüncht und sparsam eingerichtet. Schon als Kind hatte sie dieses Zimmer bewohnt. Es galt als eines der schönsten im Haus, mit einem halbrunden Erker, Stuckverzierungen und einem kunstvoll gearbeiteten Marmorkamin. Seit jeher wurde der Raum als das Turmzimmer bezeichnet. In den letzten Jahren hatte Sophie es nur in den Sommersemesterferien benutzt, die sie regelmäßig in Rochemanteau verbrachte. Ihre Besuche hier beschränkten sich auf wenige Wochen. Maria, Gérard de Perdillons zweite Frau und Sophies Stiefmutter, hatte sie von Anfang an nicht gemocht und dies auch deutlich zum Ausdruck gebracht. War sie eifersüchtig auf Sophie, zu der Gérard ein ebenso inniges väterliches Verhältnis zu haben schien wie zu Nelly, seiner Tochter aus dieser zweiten Ehe? Beneidete sie Sophie um ihre Jugend, um ihre Karriere als angehende Juristin, die möglicherweise einmal die Kanzlei ihres Vaters übernehmen würde?
Im letzten Sommer war Sophie unfreiwilligerweise Zeugin eines Gesprächs zwischen ihrem Vater und Maria geworden. Sie hatte gerade ihren Koffer ausgepackt und wollte sich eine Erfrischung aus der Küche holen. Auf dem Weg ins Erdgeschoss kam sie am Schlafzimmer des Ehepaares vorbei, dessen Tür einen Spalt weit offen stand.
»Wie lange will deine Tochter denn diesmal bleiben?«, hatte Maria ihren Mann gefragt. Es hatte gereizt und ungewohnt scharf geklungen.
»Keine Ahnung«, hatte Sophies Vater erstaunt gesagt. »Warum fragst du? Passt es dir nicht, dass sie hier ist?«
»Doch, doch«, hatte Maria eilig erwidert. »Wieso sollte es mir nicht passen? Ich würde mich nur gern darauf einstellen.«
»Was gibt es denn da einzustellen? Sophie ist ein erwachsener Mensch, sie fällt niemandem zur Last.«
»Ich habe nicht gesagt, dass sie mir zur Last fällt.«
»Ich weiß nicht, wie lange sie bleibt, Maria. Sie ist meine Tochter, und das hier ist auch ihr Elternhaus. Akzeptiere das doch bitte endlich!« Danach hatte Sophie gehört, wie die Tür zum Bad, das ans Schlafzimmer grenzte, heftig ins Schloss gefallen war.
Mit einer gewissen Genugtuung hatte Sophie auf diese Weise in Erfahrung gebracht, dass ihr Vater zu ihr hielt und Marias ständigen Sticheleien entgegentrat. Ihre Stiefmutter würde es nicht schaffen, sie gänzlich von hier zu vertreiben!
Nach der Scheidung hatte Sophies Mutter damals das Département verlassen und war mit der zwölfjährigen Tochter nach Paris gezogen. Sie suchte sich einen Job in der Modeindustrie und wurde Directrice in einem Haute-Couture-Laden am Faubourg St. Honoré. Zu ihrem Mann, der sie von einem Tag zum anderen wegen Maria hatte fallen lassen, brach sie den Kontakt ab. Allerdings sorgte sie dafür, dass Sophie ihren Vater regelmäßig besuchen konnte und Verbindung zu ihm hielt. Sophie wusste, dass ihr Vater sie liebte und stolz auf sie war. Als angehende Juristin schlug sie auf beruflicher Ebene dieselbe Richtung ein wie er. In finanzieller Hinsicht zeigte sich Gérard seiner Tochter gegenüber stets großzügig. Geld war in der Familie Perdillon ohnehin nie ein Thema gewesen. Der Grundbesitz, diverse Firmenbeteiligungen und Aktienfonds beliefen sich auf einige Millionen Euro. Dies alles würde eines Tages zu gleichen Teilen auf Sophie und Nelly übergehen. Sophie kannte das Testament ihres Vaters, er hatte vor einigen Jahren ausführlich mit ihr die darin getroffenen Regelungen besprochen.
Wenn Gérard hin und wieder nach Paris kam, verbrachten sie schöne Abende in gemütlichen Restaurants, gingen ins Theater oder ins Konzert und führten juristische Fachgespräche. Alles in allem war ihr Verhältnis unkompliziert und harmonisch. Nur eines hatte Sophie schon als Teenager nicht verstehen können: Wieso hatte sich ihr Vater damals von ihrer Mutter getrennt? Gisèle war eine attraktive und kluge Frau, ein Jahr jünger als Gérard. Mit Maria, die als Gerichtsdolmetscherin in Grenoble arbeitete, konnte sie es in jeder Hinsicht aufnehmen. Bis auf die Tatsache, dass sie zwanzig Jahre älter war. Als Sophie ihren Vater einmal nach den Gründen der Trennung fragte, hatte er nur den Kopf geschüttelt und gemeint: »Das verstehst du nicht, Sophie. Wie soll ich es dir erklären? Das ist eben so. Dass Maria jünger ist als deine Mutter, spielt dabei keine entscheidende Rolle.«
Doch das hatte Sophie ihm nicht abgenommen.
Später, als sie selbst erste Erfahrungen in der Liebe machte, als sie Beziehungen einging und wieder löste, und um die Schwäche wusste, die körperliches Begehren auslösen kann, urteilte sie milder über ihren Vater. Gefühle für einen Menschen tauchen auf und verschwinden wieder, wie Stationen an einer Bahnstrecke. Man hält an, verweilt, reist weiter – und bald schon entschwindet die alte Station den Blicken. So ähnlich musste es damals ihrem Vater ergangen sein, als er sich anlässlich eines Prozesses gegen eine spanische Autoschieberbande in die junge Gerichtsdolmetscherin Maria Val-Perez verliebte.
Sophie zog eine blaugestreifte Bluse aus ihrer Reisetasche und eine Jeans. Nachdem sie sich angekleidet hatte, öffnete sie die Tür des wuchtigen Nussbaumkleiderschranks und betrachtete ihre Gestalt in dem ovalen Spiegel, der auf deren Innenseite angebracht war. Zufrieden lächelte sie sich zu, zupfte noch einmal ihre dichten, relativ kurz geschnittenen Haare zurecht und schloss den Kleiderschrank. Sie ging zum Fenster, das weit offen stand und die Sicht auf den Dorfplatz freigab. In der Ferne, bei der Mühle am Fluss, erhob sich die lang gezogene, schroff abfallende Bergkette, hinter der das Hochplateau lag.
Auf dem Dorfplatz spielten einige alte Männer Boule, und ein paar halbwüchsige Jungs ließen die Motoren ihrer Mopeds aufheulen. Auf dem Bürgersteig, vor dem Café Central, saßen nur wenige Gäste. Aus der Musikbox im Lokal erklang eine Schnulze von Céline Dion.
Die Dämmerung war bereits hereingebrochen. In den Platanen rund um den Platz klagten die Zikaden, und von fern, aus einem der Gärten im Dorf, drang das Plärren eines Säuglings herüber.
Als sie das Zimmer verließ, um nach unten zu gehen, hörte Sophie hinter sich schnelle Schritte. Es war ihre Stiefschwester Nelly, die offenbar auf sie gewartet hatte. Nelly strahlte sie an, und Sophie legte den Arm um ihre Schulter.
»Was meinst du, ob Papa schon da ist?«, fragte sie.
»Glaube ich nicht.« Nelly hakte sich bei Sophie ein. »Heute Mittag hat er gesagt, dass es spät werden könnte.«
»Ach ja, er steckt ja mitten in dem Boucher-Prozess!« Das Verfahren um die Serviererin Francine Boucher, die ihren kleinen Sohn ertränkt haben sollte, war in die zweite Runde gegangen. Gérard de Perdillon verteidigte die junge Mutter, und die erstinstanzliche Verhandlung hatte bereits vor zwei Jahren im ganzen Land für Schlagzeilen gesorgt.
»Genau«, antwortete Nelly. »Der Staatsanwalt wird wahrscheinlich versuchen, den Prozess platzen zu lassen, meint Papa.« Es klang ein wenig altklug.
Sie gingen die Treppe hinunter in die Halle. Von dort aus führte eine Tür ins Esszimmer, dahinter befand sich die Küche. Im Esszimmer lagen vier Gedecke auf dem Tisch, und ein üppiger Strauß kurz geschnittener gelber Rosen verströmte einen intensiven Duft. Die Tür zur Terrasse war geschlossen, damit das Licht im Raum keine Insekten anzog.
Maria erwartete die beiden bereits. Sie war eine attraktive, aparte Frau Mitte dreißig. Heute hatte sie ihr Haar zu einem strengen Knoten nach hinten gesteckt, was ihr das exotische Aussehen einer Flamencotänzerin gab.
Ihre Tochter Nelly hatte zwar das schöne, dunkle Haar ihrer Mutter geerbt, nicht aber deren schmale, schlanke Figur. Nelly steckte mitten in der Pubertät und fühlte sich oft recht unbehaglich, vor allem, was ihr Gewicht anging.
»Da seid ihr ja!« Maria lächelte Sophie an, doch ihre Augen blieben kühl und distanziert. »Sophie, nimm doch bitte schon Platz. Nelly, du kannst mir helfen, die Sachen hereinzutragen.« Maria hatte in Anbetracht von Sophies später Ankunft und wegen der hochsommerlichen Temperaturen etwas Leichtes vorbereitet. Es gab Melonenspalten mit Bergschinken, danach eine kalte Gazpachosuppe und einen gemischten Salat mit gebratener Hühnerbrust. Dazu hatte Maria eine Flasche roten Landwein geöffnet. Früher wurde ein solcher Wein auf der Domaine selbst hergestellt. Doch seit vielen Jahren waren die Keller stillgelegt und die Weinfelder verpachtet. Seitdem bekamen die Perdillons jedes Jahr von den Pächtern ihr festes Kontingent an Wein.
Das Gespräch bei Tisch wurde hauptsächlich von Nelly und Sophie geführt. Maria begnügte sich damit, ab und zu ein paar höfliche Fragen zu stellen. Nelly wollte, wie üblich, alles über Sophies Studentenleben in Paris wissen. Insbesondere interessierte sie jedoch Sophies Privatleben.
»Und? Bist du immer noch mit Paul zusammen?«, Nellys Augen funkelten neugierig.
»Ach was!«, Sophie lachte. »Das war doch gar nichts Ernstes.«
»Echt?« Nellys Stimme klang enttäuscht. »Dabei fand ich ihn total süß! Kommt er dich dieses Jahr also nicht hier besuchen?«
»Nein.«
»Schade!«
»Wir haben uns getrennt.«
»Wieso denn?«
»Es wurde mit der Zeit langweilig mit ihm.«
»Langweilig? Ich fand ihn echt super!«
Sophie wechselte das Thema und wandte sich an Maria.
»Habt ihr denn schon neue Urlaubspläne?«
Maria tupfte sich vorsichtig mit der Serviette den Mund ab. »Leider kann ja dein Vater im September nicht wegfahren, weil der Boucher-Prozess sich vermutlich hinziehen wird. Wir wollten nach China.«
»Ich weiß«, antwortete Sophie. »Papa hat es mir neulich am Telefon erzählt.« Ihr Vater und seine zweite Frau planten nie Urlaub im üblichen Sinne. Im Sommer blieben sie in Rochemanteau, und jedes Jahr im Herbst begaben sie sich auf eine große Bildungs- und Kunstreise. »Fliegt ihr dann später nach China, oder erst im nächsten Jahr?«
»Wenn ich das wüsste! Bisher steht alles noch in den Sternen.« Maria trank einen Schluck Wein. »In jedem Fall fahren Nelly und ich Mitte Juli für einige Wochen zu meiner Cousine nach Barcelona.«
»Nach Barcelona?« Nelly blickte ihre Mutter erstaunt an. »Davon weiß ich ja gar nichts.«
Maria lächelte fein.
»Das sollte ja auch eine Überraschung sein, Chérie.«
»Und Sophie?« Rasch drehte Nelly den Kopf zu ihrer Stiefschwester. »Ich meine, wir wollten doch Ende Juli ein paar Tage ans Meer, oder nicht?«
»Ja, natürlich«, sagte Sophie schnell. »Das machen wir dann eben vor eurer Reise.« Sophie warf Maria einen kurzen, viel sagenden Blick zu. Sie hatte den Wink ihrer Stiefmutter verstanden, sich möglichst nicht allzu lange in Rochemanteau aufzuhalten. Doch den Gefallen würde sie Maria nicht tun. Erst Ende August wollte sie wieder zurück nach Paris.
Maria zündete sich eine Zigarette an und sah auf die Uhr. Es war bereits kurz nach elf.
»Ich verstehe nicht, warum Gérard immer noch nicht da ist.« Sie schüttelte den Kopf und sagte zu Sophie: »Dein Vater arbeitet zu viel! Rede du doch einmal mit ihm. Vielleicht hört er ja eher auf dich als auf mich.« Deutlich vernahm Sophie den spitzen Unterton, der in Marias Worten mitschwang.
Dann legte Maria Nelly die Hand auf den Arm.
»Ich glaube, es wird jetzt Zeit für dich, mein Schatz.«
Etwas unwillig erhob sich Nelly von ihrem Stuhl.
»Du wolltest doch noch kurz mit raufkommen«, sagte sie zu Sophie.
»Ich komme in zehn Minuten«, erwiderte diese. »Mach dich erst in Ruhe fertig.«
***
Jean-Pierre LeDret dachte nicht daran, um diese Uhrzeit schon nach Hause zu gehen. Nach dem Abendessen, das aus einem faden Auberginenauflauf und einem fetttriefenden Stück Fleisch bestanden hatte, war er ins Café Central geflüchtet. Dies schien die einzige Möglichkeit zu sein, dem mürrischen Gesicht seiner Frau Amandine und ihren wütenden Tiraden über Olivier, der offenbar wieder einmal spurlos verschwunden war, zu entgehen. Das Meisterschafts-Endspiel der Fußball-Liga konnte er sich ohnehin nicht vor dem eigenen Fernseher ansehen. Den hatte Opa Mimo ab einundzwanzig Uhr für seine wöchentliche Quizsendung »Wer wird Millionär?« in Beschlag genommen. Er behauptete, Quizsendungen seien gut für die geistige Fitness, und er war stolz darauf, mit fünfundachtzig Jahren noch ein fantastisches Gedächtnis zu haben. Das mit dem Gedächtnistraining war natürlich nur eine Ausrede. Opa Mimo setzte sich stets durch, was das Fernsehprogramm anging. Schon lange hatte sich Jean-Pierre vorgenommen, ihm einen eigenen kleinen Apparat in sein Zimmer zu stellen. Doch bis jetzt fehlte dazu das nötige Kleingeld. Opa Mimo, der über eine monatliche Rente von achthundert Euro verfügte und kaum Ausgaben hatte, war zu geizig, um selbst einen zu kaufen.
Jean-Pierre bestellte noch ein weiteres Bier, das zehnte an diesem Abend. François Vilard, der Klempner, hatte ihm während des Spiels, das sie sich im Café angesehen hatten, zwei Wodka spendiert. François war blendender Laune gewesen, denn sein Lieblingsverein Lyon lag bis zur Halbzeit bereits deutlich in Führung.
Jean-Pierre streckte seine Beine aus und dehnte seine massigen Schultern. Diese Plastikstühle waren einfach unbequem. Früher stellte der Wirt gemütliche Korbsessel auf den Bürgersteig. Doch seine Tochter Laetitia, die die Kneipe vor kurzem übernommen hatte, fand die Plastikstühle praktischer. Die Zeiten änderten sich eben. Alles im Leben änderte sich.